
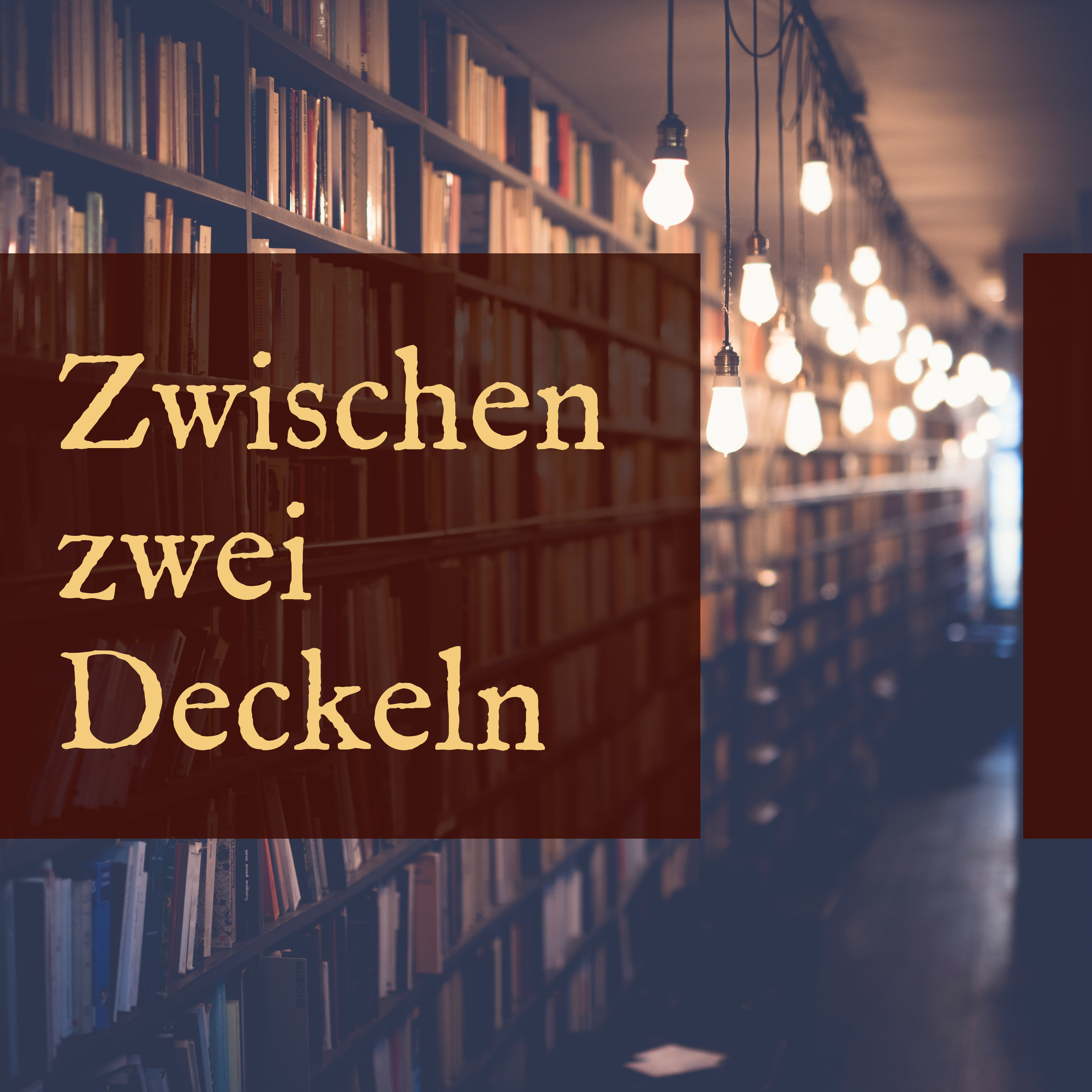
Zwischen Zwei Deckeln
Zwischen zwei Deckeln
Sachbücher zu Wissenschaft, Gesellschaft und dem guten Leben
Episodes
Mentioned books

9 snips
Jan 8, 2026 • 0sec
103 – „Zerstörungslust“ von Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey
Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey analysieren die Sehnsucht nach Zerstörung als treibende Kraft hinter dem Rechtsdrift. Sie beleuchten, wie der demokratische Faschismus demokratische Strukturen untergräbt und die soziale Mobilität schwindet. Themen wie illiberale Demokratien und staatliche Defizite werden ebenso diskutiert, wie das Gefühl der politischen Kränkung und der Verlust von Zukunftsperspektiven. Interessante Einblicke in das Zusammenspiel von Destruktivität und Ideologie runden das Gespräch ab.

Dec 18, 2025 • 1h 9min
102 – „I Want a Better Catastrophe“ von Andrew Boyd
Der Klimwandel war schon das eine oder andere Mal Thema in unserem Podcast. In seinem Buch „I Want a Better Catastrophe“ nimmt Andrew Boyd jedoch eine besondere Perspektive ein, die Manche als schonungslos ehrlich und Andere als pessimistisch beschreiben würden:
Boyd stellt sich in seinem Buch der unvermeidlichen Realität, die die Klimakatastrophe in den nächsten Jahrzehnten bedeuten wird: Große Teile der Erde werden unbewohnbar werden, die Zivilisation, die wir heute kennen, wird sich nicht länger halten können und wir werden unermessliches Leid erleben. Wie, fragt sich Boyd, lässt sich da noch ein Sinn im Leben finden?
Dazu interviewt er unterschiedliche Menschen, die sich zu genau dieser Frage Gedanken gemacht haben, und reflektiert diese Gespräche für sich. Denn die Fragen sind ernst und wir als Gesellschaft tun alles, diese Realität zu verdrängen, wo wir lernen müssten, unser eigenes Ende zu betrauern.
Shownotes
Webseite zum Buch
Interviewpartner im Buch:
Guy McPherson — “If we’re the last of our species, let’s act like the best of our species.”
Tim DeChristopher — “It’s too late — which means there’s more to fight for than ever.”
Meg Wheatley — “Give in without giving up.” Can I get my Buddhism with a side of strategy, please?
Gopal Dayaneni— “We’re going to suffer, so let’s distribute that suffering equitably.”
Jamey Hecht— “Witness the whole human story through tragic eyes.”
adrienne maree brown— “How do we fall as if we were holding a child on our chest?”
Robin Wall Kimmerer— “How can I be a good ancestor?”
ZZD053: „Zukunft als Katastrophe“ von Eva Horn
ZZD057: „Energierevolution Jetzt“ von Cornelia Quaschning und Volker Quaschning
ZZD058: „Merchants of Doubt“ von Naomi Oreskes & Erik M. Conway
ZZD064: „The Web of Meaning“ von Jeremy Lent
ZZD077: „Das nomadische Jahrhundert“ von Gaia Vince
ZZD079: „Der Allesfresser“ von Nancy Fraser
ZZD081: „Die Unterwerfung“ von Philip Blom (81)
ZZD083: „Im Grunde Gut“ von Rutger Bregman
ZZD093: „Klimaschmutzlobby“ von Susanne Götze und Annika Joeres
Buch: „Erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden“ von Christian Holler, Joachim Gaukel, Harald Lesch, Florian Lesch
Buch: „Verkaufte Zukunft“ von Jens Beckert
Buch: „Die Nachhaltigkeitstransformation in Deutschland“ von Jörg Radtke
Buch: „Zwischen friedlicher Sabotage und Kollaps“ von Tadzio Müller
Artikel: „Cross-system interactions for positive tipping cascades“ von Sibel Eker, Timothy M. Lenton, Tom Powell, Jürgen Scheffran, Steven R. Smith, Deepthi Swamy und Caroline Zimm
Artikel: „Chinas Elektrostaat revolutioniert den Klimaschutz“ von Adam Tooze (Surplus, €)
Artikel: „Klimawandel und Gesellschaft. Vom Katastrophen- zum Gestaltungsdiskurs im Horizont der postkarbonen Gesellschaft“ von Fritz Reusswig
Artikel: „Öko-Startups und der grüne Geist des Kapitalismus – zur unternehmerischen Bearbeitung von ökologischen Herausforderungen“ von Eltje Gajewskiund Gregor Kungl
Artikel: „The Future of Health on a Damaged Planet“ von Nils Gilman, Paul Kotrba, Alex Marashian, Georg Seifert, Jörg Tybbusek und Tom Wallmann
Artikel: „Um handlungsfähig zu werden, müssen wir die Hoffnung aufgeben“ von Nils Müller
Online: Freies Institut für Philosophie der Sozialforschung
Quellen und so
Intro und Outro der Episode stammen aus dem Stück Maxixe von Agustin Barrios Mangore, eingespielt von Edson Lopes (CC-BY).
Das Umblättern zwischen den Teilen des Podcasts kommt hingegen von hoerspielbox.de.
Zwischen zwei Deckeln findest du auch im sozialen Medium deiner Wahl: Mastodon und Bluesky.
Der Beitrag 102 – „I Want a Better Catastrophe“ von Andrew Boyd erschien zuerst auf Zwischen zwei Deckeln.

8 snips
Nov 27, 2025 • 0sec
101 – „How to Read a Book“ von Mortimer J. Adler und Charles van Doren
Die Diskussion beginnt mit der Herausforderung, anspruchsvolle Bücher zu lesen. Es wird erklärt, dass Lesen eine aktive Tätigkeit ist, die richtiges Fragenstellen erfordert. Anhand von Adlers vier Lesestufen – elementares, inspektionales, analytisches und syntopisches Lesen – wird eine klare Strategie vermittelt. Tipps zu Notizen und Markieren verdeutlichen, wie man analytisch vorgehen kann. Auch die Bedeutung von Primärlektüre und legitimer Kritik wird hervorgehoben, ebenso wie spezielle Tipps für Fachliteratur. Die Zuhörer erfahren, wie sie ihre Lesekompetenz effektiver gestalten können.

4 snips
Nov 6, 2025 • 2h 11min
100 – KI-Diskussion von Amanda, Christoph, Holger und Nils
In dieser spannenden Diskussion werden die gesellschaftlichen Implikationen der Künstlichen Intelligenz thematisiert. Die Teilnehmenden beleuchten die Grenzen technologischer Lösungen und die kritische Notwendigkeit von KI-Literacy. Ein Fokus liegt auch auf den langfristigen Auswirkungen auf Wissensarbeit und den Verlust von Kompetenzen. Zudem wird die Rolle von Algorithmen im Organisationsverhalten erörtert. Abschließend wird die Verantwortung beim Einsatz von KI hinterfragt und die potenzielle Abhängigkeit von KI-Antworten thematisiert.

Oct 16, 2025 • 1h 25min
099 – „Sisyphos im Maschinenraum“ von Martina Heßler
Martina Heßler beleuchtet die faszinierende Doppelnatur von Mensch und Maschine. Während der Mensch als fehlerhaft wahrgenommen wird, offenbart sich die vermeintlich perfekte Maschine als ständige Herausforderung. Die Hosts diskutieren, wie menschliche Unvollkommenheiten und komplexe Systeme zu Fehlern führen. Zudem wird die Rolle der KI als neuer Maschinentyp angesprochen, der nicht deterministisch ist und besondere Risiken birgt. Kritisch wird das Vertrauen in Technologien reflektiert, die oft neue Probleme schaffen, die sie lösen sollen.

Sep 25, 2025 • 1h 5min
098 – „Empire of AI“ von Karen Hao
Nachdem wir in der letzten Episode eher metaphysisch-philosophisch unterwegs waren, geht es heute zur harten Realität der Künstlichen Intelligenz:
In „Empire of AI“ verfolgt Karen Hao den Aufstieg von openAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT. Die Autorin zeichnet ein umfassendes Bild von der Gründung bis zum Jahr 2025, porträtiert die involvierten Personen und zeigt den eindrücklichen Wandel von openAI von einem Non-Profit zu einem For-Profit-Unternehmen. Nebenbei streift sie bedenkenswerte Aspekte des aktuell vorherrschenden Entwicklungsprozesses von Künstlicher Intelligenz: Die Machtkonzentration, die Ideologie und schließlich die Ausbeutung natürlicher und menschlicher Ressourcen.
Shownotes
Buch: „Was das Valley denken nennt“ von Adrian Daub
Buch: „Blood over Bright Haven“ von M. L. Wang
Buch: „Automaton“ von Berit Glanz
ZZD 042: „Europa: Infrastrukturen der Externalisierung“ von Arch+ 239
ZZD 060: „Chokepoint Capitalism“ von Rebecca Giblin und Cory Doctorow
Blogpost: „Um handlungsfähig zu werden, müssen wir die Hoffnung aufgeben“ von Nils Müller
Blogpost: „The LLMentalist Effect: how chat-based Large Language Models replicate the mechanisms of a psychic’s con“ von Baldur Bjarnason
Artikel: „TechScape: How cheap, outsourced labour in Africa is shaping AI English“ von Alex Hern
Artikel: „AI and the threat of “human extinction”: What are the tech-bros worried about? It’s not you and me“ von Émile P. Torres
Podcast: „Die neuen Zwanziger – Salon“ vom August 2025
Newsletter: „Ed Zitron’s Where’s Your Ed At“
Transkript (automatisch erstellt)
Nils: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 98 von Zwischenzweideckeln, eurem Sachbuch-Podcast. Wir gehen jetzt mit großen Schritten auf die große hunderte Episode zu und fangen jetzt heute den dritten oder machen heute den dritten Teil unseres KI-Schwerpunkts. Und ich habe heute Amanda dabei. Hallo Amanda.
Amanda: Hallo.
Nils: Genau, du hast uns ein thematisch passendes Buch mitgebracht, zu dem wir dann auch gleich kommen. Aber erst mal die Frage, was treibt dich sonst gerade um?
Amanda: Ich habe vor zwei, drei Wochen ein paar Prüfungen abgeschlossen, meine Facharztprüfung unter anderem und sonst noch was Akademisches abgeschlossen. Und dann verfalle ich immer so in eine Phase, wo ich was lesen muss, was ich sonst nie lesen würde. Und dann habe ich mir so ein Buch geschnappt, was auch, ich muss zugeben, ein Dorn im Auge ist für meinen Partner. Das heißt Bauen und Verdichten und es geht um Asphaltstraßenbau. Und das habe ich letzte Woche gelesen. Ich fand das wirklich sehr interessant.
Nils: Das ist eine interessante Auswahl für ein Buch zur Erholung und Ablenkung.
Amanda: Ja, ich weiß jetzt Dinge, wie man, ich weiß jetzt, wie man eine Straße baut. So und was für Arten von Asphalt es gibt und was da die Vor- und Nachteile von sind. Und also ja, es war echt erholend.
Nils: Lag das bei euch im Wohnzimmer am Couchtisch rum?
Amanda: Ja, ich habe mir das mal gekauft und ich muss jetzt auch ein bisschen rechtfertigen, dass wir das noch immer haben, dass das bei uns im Regal steht. Und deswegen habe ich das jetzt einfach gelesen.
Nils: Okay, ja. Man lernt nie aus, ne?
Amanda: Genau. Bei dir?
Nils: Ja, ich habe tatsächlich, mich treibt so ein bisschen seit dem Urlaub so ein bisschen ein dunkler Blick auf die Welt eher um. So dieser Punkt, Klimakatastrophe und Co. Was ist, wenn wir das jetzt einfach verseppt haben? Was machen wir denn dann jetzt damit? Also ein bisschen dieser Gedanke, nicht zu sagen, was ist jetzt, wie können wir das noch verhindern? Sondern es wird jetzt auf irgendeine Art und Weise kommen. Was machen wir damit? Und habe da auch einen längeren Artikel auf meinem Blog zugeschrieben im Urlaub. Schaut da gerne mal vorbei, nilsmüller.info. Und habe jetzt, ohne das geplant zu haben, tatsächlich auch passenden Roman gelesen. Also wer das Ganze eher in Roman-Thema verpackt haben will, da gibt es von M.L. Wong einen Fantasy-Roman, Blood over Bright Haven. Der das auch so ein bisschen, so dieses Verdrängen, also hinter dem ganzen Kollaps-Gedanken steckt, so die Idee von der Verdrängung. Dass die Gesellschaft dieses Thema einfach verdrängt, davon nichts mehr hören will. Weil sie irgendwie damit nicht umgehen kann. Und das haben wir ja bei Corona auch irgendwie, ist so mein Gefühl. Da reden wir ja auch nicht mehr drüber. Wundern uns über die mysteriösen Krankheiten. Und bei Klima machen wir das Ganze halt auch so. Und das ist in dem Roman halt echt super aufgearbeitet. Macht Spaß zu lesen, ist aber der Stimmung vielleicht nicht unbedingt zuträglich.
Amanda: Okay, ja. Ja, das ist das Thema generell ja wohl nicht, leider.
Nils: Ja, ja. Gut, aber jetzt widmen wir uns wieder KI, auch so ein ganz entspanntes Thema, was alle Leute ganz nett finden und überhaupt keine Emotionen hervorruft. Du hast uns mitgebracht von Karen Howe, heißt sie meine ich genau, das Buch Empire of AI. Ist ein frisches Buch von Anfang des Jahres, gibt es auch noch nicht in der deutschen Übersetzung. Der Untertitel sagt wahrscheinlich schon viel über den Inhalt Dreams and Nightmares in Sam Altmans Open AI. Die Autorin ist eine Journalistin, gerade im Bereich KI, kommt mein Eindruck nach, aber auch eher aus der kritischen Schiene, vermute ich mal. Aber ich will dir nicht zu viel vorweggreifen, möchtest du mit dem TLDL anfangen? Klar.
Amanda: In Empire of AI verfolgt Karen Howe den Aufstieg von Open AI, dem Unternehmen hinter ChatGPT. Die Autorin zeichnet ein umfassendes Bild seit der Gründung bis zum Jahr 2025, porträtiert die involvierten Personen und zeigt den eindrücklichen Wandel von Open AI, von einem Non-Profit zu einem Full-Profit-Unternehmen. Nebenbei streift sie bemerkenswerte Aspekte des aktuell vorherrschenden Entwicklungsprozesses von künstlicher Intelligenz. Die Machtkonzentration, die Ideologie und auch die Ausbeutung natürlicher und menschlicher Ressourcen.
Nils: Ja, danke dir. Okay, dann ist, glaube ich, das Thema gesetzt. Nimm uns doch mal mit in die Entstehung und die Geschichte von Open AI.
Amanda: Das mache ich gerne. Das Buch ist ziemlich lang. Das ist 480 Seiten lang, wobei man auch sagen muss, die letzten 100 Seiten sind oder 50, 60 sind Index und Notizen, Endnotes. Die Autorin hat also wirklich extrem, extrem viele Quellen herbeigezogen. Also das ist fast schon ein historisches, wie sagt man, ein geschichtsschreiberisches Buch. Sie hat sehr viele Interviews geführt, sie hat sehr viele Quellen, sie hat sehr viele Reisen gemacht. Also in dem Sinne wirklich eine sehr umfassende Recherche zu diesem Thema. Das ist einerseits natürlich sehr interessant. Ich glaube, das hat auch einen gewissen Benefit längerfristig, wenn man dann zurückschaut irgendwann mal auf dieses Unternehmen. Ist aber ein bisschen anstrengend zu lesen, fand ich. Ich kann es nicht genau festmachen, an was das lag. Ich fand, das Thema ist interessant. Ich fand auch, die Sprache war eigentlich flüssig und trotzdem hat es extrem lange gedauert, bis ich durch das Buch durch war. Ich werde auch das Buch jetzt nicht so ganz von Kapitel zu Kapitel vorstellen. Sie macht so ein bisschen auch einen Spannungsbogen rein. Den werde ich weglassen. Aber ja, ich pickte einfach so ein bisschen die Themen raus, die ich dann auch besonders interessant fand. Beginnen tut sie mit einem Event, der stattgefunden hat, als Sam Altman vor zwei Jahren gefeuert wurde als CEO. Das ist so ihr Aufhänger. Sam Altman, das steht auch schon im Untertitel, ist, wie gesagt, der Gründer von OpenAI. Und das Unternehmen ist jetzt fast zehn Jahre alt und wurde zusammen von ihm mit Greg Brockman und Ilya Satzkever gegründet. So, das sind, ich habe jetzt die Namen mal gesagt. Ich werde da auch nicht mehr groß drauf eingehen, aber auch für euch, falls ihr euch das Buch, also falls ihr das lesen möchtet, es kommen extrem viele Namen vor von all diesen Tech-Guys und auch sonst Personen. Also man braucht da fast schon so einen Spickzettel nebenher, um sich da wieder bewusst zu werden, wie jetzt da genau was ist, mit welcher Intention und welchem, ich sage mal, Net-Worth im Hintergrund.
Nils: Und ich vermute, weil es sind tatsächlich fast alles Guys, ne?
Amanda: Also, ja, zum Großteil schon. Es gibt aber schon auch ein paar Frauen, die da rausstehen. Aber ja, also die Gründer auf jeden Fall, das sind Typen, die das, ich sage mal klassisch das Silicon Valley, ja, aus dieser Brutstätte auch so ein bisschen kommen. Und was, ich glaube, was mir nicht bewusst war, bevor ich das Buch gelesen habe, ist, dass Open AI wirklich als Non-Profit-Unternehmen gegründet wurde. Ganz initial war das, das war auch so ein bisschen klassisch, ne? Da gab es irgendwie, Sam Altman hat zum Dinner geladen irgendwo und dann sind da mal all diese Menschen zusammengekommen und haben sich da gefunden und haben über künstliche Intelligenz diskutiert. Und dann entstand da so dieses Start-up und initial auch mit Elon Musk. Also, der war da sehr, sehr involviert zu Beginn. Auch, weil Elon Musk wohl davor schon oft diese Angst geäußert hatte, ne, dass künstliche oder das AGI kommt, also Artificial General Intelligence, allgemeine künstliche Intelligenz. Vielleicht, das wäre so eine Art von künstlicher Intelligenz, die noch einen Schritt umfassender, ein umfassenderes Skillset hat, als das wir bisher kennen. Also, es ist wie so, kann eventuell selbstlernend sein, kann sich selber vermehren, je nachdem. Also, es gibt keine allgemeine Definition dafür, aber es ist auf jeden Fall eine Art von künstlicher Intelligenz, die nochmal eine Skala höher oder ich sag mal die höchste Skala betrifft, die es aber aktuell noch nicht gibt, ne? So, und das ist so ein bisschen, da komme ich auch später noch zu, das ist nur ein bisschen auch eine ideologische Frage, na, wie steht man zu dieser AGI? Und auf jeden Fall hat Musk wohl da auch sich schon Gedanken drüber zugemacht davor und fand dann die Idee sehr gut, dass man ein Unternehmen gründet mit dem Ziel eigentlich, das zu entwickeln, aber so, dass es halt der Menschheit nützt. Also, dass man das sicher entwickelt und dass man da auch viel Forschung dazu macht und so weiter. Das ist auch der Grund, warum Open AI, Open AI heißt, ne? Also, das Open steht nicht unbedingt dafür, dass man den Quellcode offenlegen soll, da sind sie dann ziemlich schnell von weggekommen, sondern das ist halt Open für alle, im Sinne von alle soll davon profitieren. Ja, das ist so der Beginn. Was, ich sag mal, ein ziemlich wichtiger Punkt ist, dass Musk dabei war, der hat das mitgesponsert und zwar mit einem Betrag von einer Milliarde Dollar. Och, Taschengeld. Und das fand ich auch so, ich hab das gelesen, ich war so, was? Also, das Unternehmen, Neugründung und dann kommt so eine Zahl ins Spiel, das ist wirklich Wahnsinn, ne?
Nils: Irre, ja.
Amanda: Und sie schreibt dann das auch so ein bisschen lakonisch, ne? Wie sie da besprochen haben, wie viel Funding sie zuerst brauchen und dann hätte wohl Musk gesagt, ja, wenn wir da nur mit 100 Millionen reingehen, dann werden wir da nicht ernst genommen und so. Komm, wir machen gleich eine Milliarde und ihr schaut mal, was ihr da kriegt an Funding und den Rest, den geb ich euch, so. Holy. Ja, genau, holy. Und ich finde, das zeigt schon so ein bisschen das ganze Setup, ne? Also, wenn man mit sowas reingeht, also, es gibt ja keine andere Branche in der Ökonomie, die sowas zustande bringt, ne? Also, mit einem Versprechen, das noch nicht existiert, gleich zu Beginn, ohne irgendetwas je geliefert zu haben, so viel Geld zu verdienen zu haben. Das ist wirklich krass. Ja, so hat das begonnen und eigentlich, wie gesagt, ich sag mal, sehr eine noble Einstellung zu der ganzen Sache und so haben sie dann auch die Talente ein bisschen akquiriert. Also, sie haben mit diesem Versprechen von Research, von Openness und so weiter, haben sie, ja, die Top Minds aus dem Silicon Valley ein bisschen angeheuert, haben denen dann natürlich auch sehr, sehr viel gezahlt. Weil die sind auch, die waren auch gefragt bei Google und bei Microsoft und so weiter und also denen auch so viel gezahlt, was natürlich überhaupt nicht üblich wäre für eine Non-Profit-Organisation. Aber so war, das war so, dass der erste Schritt auch so ein bisschen die Talente zu, ins Boot zu holen, ne? Ja. Das hat dann soweit so gut geklappt. Irgendwann kam es dann zur Frage, ob Altman und Musk, die hatten zuerst dann noch in anderen Unternehmen immer viel zu tun und wer dann CEO werden sollte von OpenAI. Und irgendwie gab es dann auch so schon so ein bisschen einen Zwist zwischen denen oder Musk wollte das, Altman wollte das und schließlich wurde es Altman und Musk ist dann da ausgeschieden und hat dann auch sein Geld gleich mitgenommen. Also, diese Milliarde war dann doch nicht mehr da.
Nils: Aber die brauchten sie dann auch offensichtlich nicht direkt.
Amanda: Die brauchen sie schon und die haben sie dann am Ende von Microsoft gekriegt. Ah, okay. Ja. Also, die sind dann da.
Nils: So sind die da reingekommen.
Amanda: Genau. Das ist auch eine ziemlich, das ist über lange Zeit eine ziemlich enge Verbandelung zwischen Microsoft und OpenAI. Also, Microsoft hatte wie das, das Recht auch auf die Nutzung der Technologie. Hat auch nicht nur Geld, sondern auch das ganze Computing Power zur Verfügung gestellt, die ganzen Server.
Nils: Und ich glaube auch zum reduzierten Preis oder sowas, ne? Da mal nicht irgendwas gelesen zu haben.
Amanda: Kann sein. Ich habe mir das nicht mehr so genau gemerkt. Also, auf jeden Fall waren die da ziemlich zusammen, haben die da zusammengespannt. Und zu Beginn war das natürlich super für OpenAI. Und irgendwann kam es auch fast so ein bisschen zu einem Kipppunkt, ne? Wo OpenAI plötzlich so groß war, dass es nicht mehr unbedingt von Microsoft abhängig war. Aber Microsoft war von OpenAI abhängig. Es hat dann so wieder ein bisschen eine andere Dynamik entfacht. Aber grundsätzlich war dann da das Geld und schon auch so ein bisschen der erste Moment von, ne? Ich verkaufe ein bisschen meine Seele als Non-Profit-Unternehmen und dann verkaufe ich mich halt einem Tech-Giganten. Ist auch so ein bisschen wohl der Spruch von AI-Forschenden. Entweder du verkaufst dich für Big Tech oder du gehst halt irgendwie in den Industrie-Militär-Komplex. Der kann dann staatlich sein, aber, naja, der Nutzen oder was dann damit erstellt wird, ist jetzt auch nicht unbedingt ethisch vielleicht gewünscht, ne?
Nils: Oder moralisch. So.
Amanda: Das war so schon der erste Punkt, ne? Also, jetzt Geld haben sie, sie haben die Compute-Power. Und dann ging’s auch dann ziemlich schnell daran, das mal zu nutzen. Und dann haben sie da ein bisschen rumgewurstelt, sag ich mal.
Nils: Okay, ja.
Amanda: Mit allem Möglichen. Da wurde ein bisschen mit Videogames und da ein bisschen künstliche Intelligenz probiert und eine Roboterhand. Und dann, ich glaub, war das DeepMind oder so. Irgendwann hat dann das AlphaGo geschlagen. Keine Ahnung. Also, das war nicht OpenAI, aber das war wie so der, ich sag mal, das Feld, ne? Jeder macht so ein bisschen was, aber niemand weiß eigentlich, wo man hin will. Niemand weiß, was AGI überhaupt ist. Ich glaube, bis heute. Aber da, das ist so wie das große Ziel. Und der Knack oder, ich sag mal, der Schlüsselmoment war dann, als OpenAI eigentlich auf dieses Sprachmodell sich zentriert hat. 2017, ich glaube, das wurde von Google, hat das veröffentlicht, kamen diese Transformer-Architektur, kamen da auf. Vielleicht für die Nicht-Techies unter unseren Hörenden. GPT, also das, was man auch aus Chat-GPT kennt, das steht für Generative Pre-Trained Transformer. Also Generative, Generativ heißt, es erstellt Inhalte, also das, in diesem Falle Text. Pre-Trained heißt, es wurde eben trainiert auf in der Regel sehr, sehr, sehr großen Datenmengen, kann dann wie auch im Nachhinein noch spezifisch für gewisse Tasks angepasst werden. Und das Transformer, das ist eben so eine Art von spezifischer Netzwerkstruktur oder Architektur für neuronale Netze, die einen Zusatznutzen gebracht hat, weil früher konnten diese Netze Dinge nur sequentiell bearbeiten. Und das Transformer-Modell kann das jetzt parallel. Und das hat dann insgesamt sehr viel Impact gehabt, weil man plötzlich mit längeren Kontexten umgehen konnte. Also wenn man zum Beispiel Daten genommen hat, Textdaten, die schneidet man in der Regel in kleine Stücke, dann hat man so Tokens. Und wenn die dann sequentiell verarbeitet werden, dann sind das nur ganz kleine Ausschnitte, die man sozusagen verarbeiten kann. Und mit den Transformer-Modellen konnte man plötzlich einen viel größeren Kontext erfassen. Und dann hat man natürlich auch viel mehr, ich sag mal, Bedeutung, die man da mitnimmt.
Nils: Die bieten auch, glaube ich, so eine Aufmerksamkeitslogik. Also die klassischen Modelle können ja immer nur quasi ein Wort nach das andere hängen. Und die können wirklich so Prioritäten im Grunde von Bedeutung und sowas dann auch verstehen. Und wissen halt, dass irgendwie ein nicht ganz so wichtig ist wie das Wort Apfelsaft, keine Ahnung.
Amanda: Genau. Das ist so ein bisschen das, ich sag mal, die technologische Neuerung. Und auf die hat man sich dann so ein bisschen gestürzt und dann eben seine ganze Idee eigentlich auf diese Sprachmodelle konzentriert. Und ich finde das interessant, weil das ist ja nicht unbedingt logisch. Also klar, es gibt Sprachphilosophie. Das ist auch ein Teil der Philosophie, wo man sagen kann, die Sprache ist, unsere Welt besteht aus Sprache oder ist Sprache. Das ist von dem her nicht ganz abwegig. Und trotzdem, dass man jetzt sagt, okay, diese allgemeine künstliche Intelligenz wird durch ein Sprachmodell entstehen, ist eine Art von Ideologie, die man aufgebaut hat und die man jetzt einfach verfolgt.
Nils: Ist natürlich bei dem KI-Thema so ein bisschen vorangelegt mit dem Turing-Test.
Amanda: Ja, stimmt.
Nils: Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wann ist ein Computer intelligent? Da gibt es ja diesen klassischen Turing-Test sozusagen, der ist dann intelligent, wenn jemand, der blind sozusagen mit dem Computer kommuniziert, nicht erkennt, dass er mit einem Computer kommuniziert. Beziehungsweise halt einen automatisierten, einen menschlichen Interaktionspartner nicht zufällig voneinander unterscheiden kann. Das legt ja auch schon diesen Sprachfokus so ein bisschen in der ganzen Branche irgendwie nahe.
Amanda: Absolut, das ist recht, ja. Das stimmt. Ich finde das trotzdem interessant, weil meines Erachtens, das beschreibt sie nur in einem Satz in dem Buch. Und ich finde das eigentlich eine zentrale Erkenntnis insgesamt, weil diese allgemeine künstliche Intelligenz bringt ja dieses Versprechen. Oder sie sagen, das wird die Menschheit verbessern oder das wird uns eben, das wird die Klimakrise lösen. Das wird den Hunger bekämpfen und so weiter. Und warum ein Sprachmodell das leisten können soll, ist mir ein Rätsel. Also das kann ja niemand begründen.
Nils: Ganz klar.
Amanda: Und deswegen finde ich das schon interessant, dass man dann sich so stark auf so etwas einschießt. Weil es gibt ganz viele andere Arten von künstlicher Intelligenz, die das vielleicht eher kann. Nicht allgemein, nicht alle Probleme, ein einziges Modell, aber sehr wohl irgendwie ein statistisches Modell, irgendeine Zeitreihenanalyse. Irgend so was, wo man halt ein Problem lösen könnte.
Nils: Ja, aber ich glaube, das ist genau der Gedanke in diesem AGI, weil Sprache, alles was wir Menschen irgendwie machen, machen wir irgendwie über Sprache. Und dann ist es natürlich auch naheliegend zu sagen, okay, dass auch so eine AGI über Sprache laufen muss, weil wie du gerade sagtest, wenn die halt besonders gut statistische Modelle rechnen kann, dann kann sie halt offensichtlich nicht eine Lösung für den Klimawandel schreiben. Oder eine Pressemitteilung für die Einführung eines neuen Solarparks, keine Ahnung. Also ich finde schon logisch, warum man da auf Sprache kommt. Aber wenn man genauer darüber nachdenkt, hast du natürlich völlig recht. So, hä? Warum?
Amanda: Genau. Ja. Wie auch immer. Das ist jetzt das, ich sage mal, das Credo, also dass diese Sprachmodelle das Nonplusultra sind auf diesem Gebiet. Und das bringt, abgesehen davon, dass der Nutzen ein bisschen fragwürdig ist, so, also nicht der konkrete Nutzen, den wir alle davon ziehen, sondern der Nutzen als AGI, meine ich jetzt, bringt das halt einfach extrem viele Nebenkosten mit sich. Ja. Die nicht nur die Computing Power sind, sondern alles andere. Wir kommen da noch später zu. Was auch inhärent ist von diesen Sprachmodellen, ist die Tatsache, dass sie extrem viele Daten brauchen. Auch das, andere Modelle brauchen das nicht unbedingt. Die werden nicht tendenziell besser, je mehr man da reinpackt. Bei diesen Large Language Models ist das auf jeden Fall so, zum gewissen Teil. Also bei Open AI war es so, dass die bis GPT-2 sehr gute, kroatierte Daten hatten. Also das ist auch unter AI Research ist das ganz klar. Oder ich arbeite ja auch in der Datenwelt, also das ist Shit-in, Shit-out, das ist ein ganz bekannten Spruch. Man, den Output einer Applikation, eines Modells steuerst du eigentlich damit, was du da reinpackst. Und bei GPT-2 waren das eben noch sehr, sehr gute Texte, gute, klar, strukturierte, kuratierte Datensätze. Und schon mit GPT-3 ist man davon weggekommen. Da hat man plötzlich alles, was man im Internet gefunden hat, da mitgenommen. Und das hat die Qualität massiv verschlechtert.
Nils: Verschlechtert? Dieses verschlechtert. Warum hat man es denn dann gemacht?
Amanda: Weil das eine Art auch von Ideologie war. Also da kommen wir jetzt zum, wenn ich sage verschlechtert, dann ist das natürlich auch ein Blick, den ich jetzt gewählt habe. Oder aus so einem bestimmten Blick, wenn man sagt verschlechtert. Insgesamt kann man schon sagen, sind die Modelle natürlich besser geworden. Also was die können schon, was der Output anbelangt oder was die Performance in gewisser, in einer Safety-Hinsicht anbietet, sind die schlechter geworden. Ich muss mich entschuldigen, dass ich da immer so viele englische Wörter brauche. Ich habe einfach das Buch auf Englisch gelesen und das, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das ist nicht, genau. Also das ist so ein bisschen der Punkt mit dieser Daten, mit dem Datenscaling. Und warum ich das so sage, ist auch, dass es einfach wirklich wie eine Ideologie behandelt wurde. Es ist dieses zehnmal mehr. Und Sam Altman hat sich das offenbar irgendwie ins Hinten tätowiert, dass immer alles zehnmal mehr. Zehnmal mehr Geld, zehnmal mehr Compute-Power von einem zum nächsten, alles immer zehnmal mehr. Das hat er von irgendeinem anderen Startup-Guru, glaube ich. Und das hat wohl so funktioniert. Es war, ich glaube, auch sehr eindrücklich für die Forschenden zu sehen, dass das tatsächlich funktioniert hat. Je mehr Daten du da reingepackt hast, desto besser ist das Modell geworden. Das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich. Problem war aber eben die Datenqualität. Und ich springe jetzt da hier vielleicht ab. Was das Problem damit war, war unter anderem, dass so viel Müll jetzt da drin war, dass auch plötzlich gefährliche Dinge da mit dabei waren und auch hinten rausgekommen sind. Also plötzlich kamen da ein Skandal von OpenAI, war das in einer gewissen Applikation, ich weiß nicht, ob es eine Applikation war. Sie haben das irgendwo ausgerollt, wo man das nutzen konnte. Und da wurde dann plötzlich sehr, sehr viel Synthetic Child Abuse Material produziert.
Nils: Okay, ja.
Amanda: So. Da hat wie niemand mit gerechnet, wohl in diesem Ausmaß. Das kam dann, ich glaube, auch für die Menschen in der Firma ein bisschen als Schock. Ja. Und da hat man gemerkt, na, da muss man was gegen machen. Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Ansätze, wie man sowas stoppen kann. Man kann da wie, ich sage mal, einfach hinten einen Deckel drauf machen und einem Modell, bevor es was ausspuckt, sagen, ne, schau mal bitte, was da genau, was du da genau gesagt hast. Passt das oder solltest du das vielleicht eher nicht rausgeben? Was aber viel oder in einem ganz anderen Ausmaß passiert, ist Content Moderation auch von den Inhalten, die da reingehen. Oder dann halt, dass man im Nachhinein schaut, was kann das Modell, also wenn man das so promptet, was kommt da raus und dann Menschen müssen das wie kategorisieren und sagen, hey, das ist nicht adäquat und so weiter.
Nils: Das ist jetzt aber auf dem Output-Level, nicht auf dem Input.
Amanda: Genau, es gibt beides. Also ich sage mal, dieses Input-Moderation, das kennen wir ganz klassisch, wenn wir irgendwo auf einer Webseite sind und wir müssen angeben auf einem Bild, klicke alle an, die eine Ampel haben. Wir kennen das, das machen wir, das ist die Kategorisierung von Bildern für autonomes Fahren, damit das da erkennt wird. Das kannst du natürlich auch machen für Text oder du machst das gleiche halt auf dem Output. Also du hast wie schon, du lässt das Modell schon Text generieren und schaust dann, was kommt dabei raus. Und das Problem davon ist, dass diese Content-Moderation oder dieses, falsch, diese Data-Annotation, also die Annotierung von Daten, seien es jetzt Text oder Bilddaten, das machen Menschen. Und das machen nicht Menschen, die im Silicon Valley sitzen, sondern das machen Menschen, die im globalen Süden sitzen. Und das ist ein großer Punkt, den Karen Howe in ihrem Buch herausarbeitet, ist, wie Menschen da ausgebeutet werden. Und sie beschreibt da verschiedene Personen, einerseits in Venezuela, in Kolumbien, aber auch in Kenia, in Nigeria, die diese Arbeit machen. Und das funktioniert in der Regel so, dass, das sind natürlich dann wieder andere Firmen, man externalisiert das. Und diese Firmen haben dann meistens einfach einen Web-Auftritt und man kann sich da einloggen und dann kriegt man halt, wie so diese Tasks zugeschickt. Und dann arbeitet man die ab. Und dann hat man so einen Zähler oben, der sagt, pro Task, wie viel man hat oder wie viel man abgearbeitet hat. Und meistens kriegt man dann ein paar Cent für einen Task. Und das Problem ist natürlich, dass das A, sehr anonym ist. Also die Personen arbeiten nicht irgendwie, die sind nicht angestellt, die haben keinen richtigen Arbeitsvertrag, die haben keine Vertretung und so weiter. Und verdienen das Minimum, wenn überhaupt. Also es ist einfach halt, was die gerade zahlen möchten. Und wenn man in Not ist, dann nimmt man halt jede Arbeit, die man machen kann. Und so beschreibt sie auch, wie dann diese Firmen initial zum Beispiel in Venezuela waren, weil Venezuela war politisch sehr instabil zu dieser Zeit. Sehr, sehr, sehr hohe Inflation. Das heißt, alle haben sich natürlich auf irgendeine Fremdwährung gestürzt, wenn sie die kriegen konnten. Gleichzeitig sehr gute Internetabdeckung und eine nicht, eine gut ausgebildete Bevölkerung. Also das war wie so eine Goldgrube für Menschen, die diese Arbeit gemacht haben. Und so haben halt viele da dann für diese großen Firmen Daten annotiert, was grundsätzlich, und das fand ich noch interessant, dass bei vielen dieser Personen, die haben dann auch nicht gesagt, dass sie die Arbeit per se schlimm fanden, sondern tatsächlich, wie die organisiert ist. Also eben diese Anonymität. Und für gewisse waren dann auch so, also die haben dann zum Beispiel, sind nicht mehr rausgegangen, weil diese Tasks nicht mehr ständig reingekommen sind.
Nils: Oh.
Amanda: Also man hat dann die Website offen und dann kommt plötzlich so, ah, du hast hier einen Task und wenn du dir den nicht schnappst, dann kommt halt eine andere Person und nimmt den.
Nils: Ah, okay.
Amanda: Das heißt, eine Frau schildert dann, dass sie nur noch 30 Minuten pro Tag rausgegangen ist, auch in der Nacht, Computer immer offen gelassen, dass wenn in der Nacht ein Task kommt, dass man den abarbeitet. Und so sieht man schon, also die prekäre Art des Arbeitens ist wirklich schlimm, ne? Und das gleiche, irgendwie war dann in Venezuela, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, was der Grund war, aber aus irgendeinem Grund hat dann diese Firma gesagt, ja, jetzt passt es uns hier nicht mehr, packt dann, schaltet einfach die ganze Website für alle Menschen in Venezuela ab und geht nach Kenia und macht das gleiche dort. Also es ist wirklich, und das, hier spielt auch so ein bisschen wieder das rein, warum sie das Empire of AI nennt, ne? Also diese, diese, dieser kolonialistische Gedanke, na, ich gehe wohin, ich extrahiere da die, die Ressourcen, die ich kriege und wenn ich davon genug habe, dann lasse ich alles stehen und liegen und gehe zum Nächsten, wo ich was abbauen kann, ne? Ja, also es ist sehr eindrücklich, wie sie, wie sie das beschreibt. Das ist so ein bisschen das mit dem, mit dem Problem der Datenqualität, ne? Also das ist jetzt, ich sag mal, die, die, die harmlose Form ist eben, dass man einfach Daten, ja, beschreiben muss, was da rausgekommen ist und dann gab es natürlich eben, ich sag mal, je schlimmer der Content war, desto schlimmer auch die, die Bedingungen für die Menschen, die das moderieren mussten oder die das annotieren mussten. Also es gab dann irgendwann halt, konntest du entweder Gewalt oder halt sexualisierte Darstellungen und das ging dann also wirklich bis zu unvorstellbarer Grausamkeit, musste man sich das im Minutentakt da reinziehen. Das ist, ja, man kennt das auch ein bisschen von Facebook und von anderen Social Media Content Moderations und das machen ja oft Menschen auch in Südostasien oder, oder wo auch immer. Ja, ja, das ist so ein bisschen der Punkt von, von dieser menschlichen Arbeitskraft, die durch diese Modelle oder durch die Entwicklung solcher Modelle ausgebeutet wird und OpenAI hat dann noch weiter oder dieses Scaling, das, das geht immer, immer weiter. Und für GPT-4 hatten sie dann plötzlich eigentlich keine Daten mehr. Also das, da wurde schon alles gescrapt und, und reingezogen, was da vorhanden war. Das heißt, sie mussten jetzt irgendwie kreativ werden und, äh, haben sich dann, äh, YouTube, äh, vorgenommen.
Nils: Okay.
Amanda: Und haben dann Millionen von YouTube-Videos transkribiert und das als Input genommen.
Nils: Oh, ja, okay.
Amanda: Das ist eine juristische Grauzone und was ich noch interessant fand, ist, dass auch zum Beispiel Google selber, die haben ja auch ihre Modelle trainiert und, und Forschung dazu gemacht, durften das nicht. Also die mussten da ganz viele interne Schranken überwinden, damit sie jetzt da auf YouTube-Daten zugreifen konnten. Und OpenAI halt auch so in diesem, , Sinne von, wie geht das, äh, move fast and break things?
Nils: Ja, genau.
Amanda: So ein bisschen das, ne? Die, das, ja, haben das halt dann einfach so gemacht. Genau. Und so kam das halt dazu, dass OpenAI sich von Jahr zu Jahr von diesem Non-Profit-Gedanken immer mehr zu einem For-Profit, , gemausert hat. Ich denke mal nicht unbedingt nur aus Profit-Gier, tatsächlich auch, weil einfach dieses Scaling so viele Ressourcen benötigt, dass man halt da Geld für braucht, ne? Das kriegst du sonst nicht, da musst du irgendwo das Geld wieder reinholen oder du musst zumindest dann den Investoren und Investorinnen irgendwas zu bieten haben. Deswegen, denke ich mal, ist das so ein bisschen ein Sachzwang, der sie dazu gezwungen hat. Und trotzdem, ne, die ganze Dynamik ist dann auch ein bisschen ausgeartet. So war das. Interessant fand ich auch, wie sie geschildert hat, als sie Chat-GPT ausgerollt haben. So, man muss dazu sagen, GPT, das ist das Modell dahinter, ne? Das kann man durch eine API, das heißt durch eine Schnittstelle ansteuern oder konnte man früher, kann man immer noch. Und da muss man so ein bisschen, ganz wenig Technik für können, ne? Oder man muss eine Applikation haben, die das kann. Und mit Chat-GPT, das kennen die meisten von uns, das ist halt ein Chat-Interface, wo man was reingebt und kriegt, kriegt dann eine Antwort. Und als sie das ausgerollt haben, wurden die komplett, komplett überrannt.
Nils: Ja.
Amanda: Die hatten da nicht mit gerechnet. Alle ihre Server down, ne? Also die haben da wirklich, also die waren komplett im Seich, im Aufschwitzel-Deatsseit. Also die haben echt, die wussten nicht mehr wohin mit ihrer Kapazität. Und das Interessante daran ist, dass man, sie behaupten ja, dass sie nach, dass sie AGI bauen wollen. Und dann oft kommen die dann auch mit irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten, dass sie so und so wahrscheinlich, dass wir das in diesem und diesem Jahr bauen werden. Und dann sowas Banales wie Chat-GPT, konnten sie nicht vorhersehen, was das für ein Erfolg sein würde für die Menschen. Ist so ein bisschen, okay, also die, ich sag mal, die Prognosefähigkeit dieser Firma stellt das so ein bisschen in Frage. Und ja, mit Chat-GPT kam dann eben auch, ich sag mal schon so, der allgemeine Bekanntheitsgrad und ab dann sind auch die Kosten explodiert. Also irgendwie Schätzungen sagen, dass sie pro Tag nur für die Compute-Kosten sind das 700.000 Dollar pro Tag, die das kostet seit Chat-GPT.
Nils: Da kenne ich, glaube ich, sogar größere Zahlen schon mittlerweile, aber ja.
Amanda: Okay, ja, ja, kann sein.
Nils: Aber wahrscheinlich stand vor einem Jahr, wenn das Buch geschrieben wurde und das wird ja nicht weniger.
Amanda: Ja, ja. Ich glaube, die Zahl bezog sich auch auf einfach dann, nachdem Chat-GPT gelauncht wurde. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt auch schon ein bisschen herzett. Ja, ist nicht weniger geworden. Nee, bestimmt nicht. Das ist so ein bisschen die Geschichte mit diesem immer Scaling und immer mehr. Open AI hat auch, wie gesagt, ein paar Skandale dann gehabt. Einerseits eben diese, naja, diese ganze Geschichte mit irgendwelchen Child-Sex-Abuse-Material. Dann gab es eine Geschichte, wo die Mitarbeitenden, die die Firma verlassen haben, die mussten wohl ein Non-Disparagement-Agreement unterschreiben. Das ist ein, wie sagen wir das, nicht Verunglimpfungs-
Nils: Okay.
Amanda: Genau, also, dass du nicht schlecht über die Firma sprechen darfst, wenn du sie verlässt.
Nils: Okay.
Amanda: Weil wenn du es tust, dann hast du kein, darfst du deine Aktien oder deine Equity in der Firma, darfst du die nicht mehr verkaufen oder die wird dir dann weggenommen. Ist wohl sehr ein No-Go eigentlich in dieser ganzen Start-Up-Welt und wurde entsprechend dann auch als Riesenskandal angesehen, dass man das überhaupt so macht. Und zu Recht auch, weil wenn sich eine Firma auf eine wohlwollende Technologie einschießt, die sie entwickeln möchte, dann muss sie natürlich auch kritisierbar bleiben und sein. Sei es von Mitarbeitenden oder sonst wem. Deswegen ist das natürlich ein absolutes, das geht nicht. Und andere Skandale waren dann eben mit Altman, der dann gefeuert wurde. Also da haben, der Grund war wohl, dass der sehr manipulativ war. Der hat sehr oft die Dinge verdreht, die Personen ihm gesagt haben, Dinge verschwiegen und so weiter, sodass dieses Board, also Open Air hat wie ein unabhängiges Board, das eigentlich auch diese Mission überwachen soll. Und man hat sich da zu Beginn auch immer mitgerühmt, dass man eben auch den CEO feuern kann, wenn das nötig ist, wenn der jetzt plötzlich diese Mission gefährdet. Und dieses Board hat dann eben entschlossen, dass man auf einen feuern muss und plötzlich, also das war dann auch irgendwie ein riesen Tumult. Und nach ein paar Tagen sind dann gewisse Board-Member plötzlich wieder umgekippt und wollten ihn dann doch wieder zurück. Und nach einer Woche war er dann wieder da. Ja, hat dann das Ganze nicht unbedingt stabiler gemacht, hat dann auch gewisse Personen, ich sag mal, aus der Firma rausgetrieben, die sehr maßgeblich dafür verantwortlich waren. Unter anderem ist die ganze Safety-Abteilung, diese Sicherheitsabteilung immer, immer weiter geschrumpft. Also Open Air hat immer schneller Dinge veröffentlicht, diese Vorsichtsmaßnahmen oder Kontrollmechanismen, die man in der Regel hat, bevor man irgendetwas, ich sag mal, auf die Allgemeinheit loslässt, die wurden immer weiter abgebaut und immer weiter vernachlässigt. Und ein weiterer Skandal, der dann vor letztes Jahr, war das, entstanden ist, dass es als Open Air ein Sprachassistent oder eine Assistentin rausgebracht hat und diese Stimme eigentlich von Scarlett Johansson gerne gehabt hätte wohl. Sam Altman war wohl sehr Fan von diesem Film Her, wo Scarlett Johansson eben so eine künstliche Intelligenz vertont. Sie hat dann das aber abgelehnt und dann haben sie am Schluss irgendeine andere Stimme genommen, die aber sehr, sehr ähnlich klingt und das war dann auch so ein bisschen Skandal, der auch sagt…
Nils: Ich finde dieses, also Her ist ja wirklich ein verstörender Film. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, ich habe ihn damals im Kino gesehen. Das ist ein extrem guter, aber verstörender Film und es gibt immer so diese Geschichte, die Science Fiction schreibt Geschichten darüber, wie der Torment Nexus die Welt zerstören wird und der Silicon Valley sagt, Oh ja, lasst uns eine Torment Nexus bauen. Die missverstehen die Warnung als Anleitung. Absolut.
Amanda: Genau so ist es, so ist es mit Her und so ist es wohl auch, also Altman muss wohl auch ein Wahnsinns-Fan von diesem Manhattan Project gewesen sein, Fan im Sinne von auch der Film Oppenheimer, der ist auch jetzt noch nicht so alt. Die haben dann auch immer zusammen geschaut und auch da, also sie sehen wie so die Gefahr, aber das wollen das um jeden Preis bauen und vergessen dann, dass auch diese Oppenheimer, der die zweite Hälfte seines Lebens eigentlich damit gehadert hat, dass er das überhaupt ermöglicht hat. Das wird dann wie ausgeblendet.
Nils: Aber es ist ja in dem Film, kommt es ja eigentlich sogar rüber, also das thematisiert das Jose da, es geht um nichts anderes in diesem Film. Ich weiß nicht, wie man den gucken kann und irgendwie mit einer Verherrlichung da rauskommt.
Amanda: Ich weiß nicht, auf jeden Fall haben sie das geschafft.
Nils: Man könnte jetzt, könnte jetzt kätzerisch sagen, spricht nicht für ihre Intelligenz.
Amanda: Naja, also ich, es ist schon, ja, wenn man, ich sag mal dieses, das Buch wird zum Teil auch sehr persönlich, im Sinne von, es porträtiert auch diese Personen sehr intim. Okay. Zu Sam Altman auch, ich finde es ein bisschen schwierig, das zu, ihnen zu fassen, so wie sie beschreibt, er sei wohl ein sehr guter Zuhörer auch, er konnte sehr, sehr viele Menschen auf seine Seite ziehen. Das kann man natürlich als manipulativ betrachten, das kann man aber auch, ich sag mal, also das kann einfach auch eine gute Charaktereigenschaft sein, dass man es schafft. Deswegen, es ist ein bisschen schwierig. Es kommt dann auch eine Geschichte mit seiner Schwester da mit rein, die ist wohl ein bisschen, ich sag mal, auf die schiefe Bahn geraten in ihrem Leben, musste dann auch Sexarbeit machen. Und das ist halt so ein bisschen schräg, weil Sam Altman natürlich extrem viel Geld gehabt hätte, um sie zu unterstützen. Also sie musste das machen, weil sie einfach prekär in einer prekären Lebenssituation war. Und es wird aber auch, und das finde ich, macht die Journalistin gut, die Autorin, sie macht das sehr differenziert. Sie sagt jetzt nicht, man hätte und so und so, sondern sie sagt, das ist halt wie nicht ganz klar. Also diese Schwester hat wohl eine sehr schwierige Geschichte. Sie klagt Sam Altman danach an und sagt, dass er sie sexuell belästigt hätte, als sie ein kleines Kind gewesen ist. Also es kommen danach wie solche Dinge da vor. Und es ist einfach schwierig zu durchblicken. Also ich will mir da jetzt nicht anmaßen, da irgendwas zu sagen zu können. Das sind schwierige Situationen und die Familie scheint das argumentiert so, dass sie eben der Schwester immer wollte, dass sie auf eigenen Beinen stehen kann. Also nicht die einfach Geld so geben. Und gleichzeitig, ja, klingt das natürlich trotzdem seltsam, wenn dann, ja, ich weiß nicht genau, wie das ist. Ich finde es auch ein bisschen, ja, ich habe das jetzt gelesen, aber ich würde mich da immer so ein bisschen abgrenzen von dieser persönlichen Sicht auf diese Menschen.
Nils: Vor allem auf die nicht so richtig Beteiligten.
Amanda: Ja, genau. Ja, das ist so ein bisschen zur Geschichte von Open AI. Jetzt die Ideologie dahinter ist, haben wir ja schon gesagt, das ist dieses ein bisschen der, fast schon der moralische Imperativ. Diese AGI zu entwickeln, mit dem Gedanken, dass diese AGI der Menschheit auch hilft. Und was sich da, ich glaube, das hast du auch im ersten Podcast der Serie erwähnt, ist es mit Boomers and Doomers.
Nils: Ja.
Amanda: Bin ich mir sicher.
Nils: Ja, ja.
Amanda: Genau, also es gibt dann wie so, ich sage mal, die Personen, die das möchten, dass das entsteht, teilen sich dann so in die zwei Lager. Ja, die Boomers sehen diese allgemeine künstliche Intelligenz als ein bisschen das Heilsversprechen an, der eben Wohlstand für alle und löst alle Probleme. Und die Doomers sind halt so ein bisschen, sehen das Risiko. Ja. Auch, dass diese KI potenziell die Menschheit auslöschen kann.
Nils: Aber wollen tun sie so trotzdem. Also das ist immer das Spannende dabei.
Amanda: Ja, ja, ja. Genau. Also diese Boomers und Doomers, die konzentrieren sich dann auch immer in diesen, ich sage mal, in diesen Firmen und Unternehmen, die AI entwickeln. Also das, sie wollen das beide, aber die einen sehen halt das ein bisschen pessimistischer oder sagen, man muss das auch irgendwie kontrollieren. Und eine Form, die dann sehr prominent wurde, ist, dass man in dieser Ideologie von Effective Altruism, ich weiß nicht, ob du, ja, das ist auch so ein Silicon Valley, wurde da ein bisschen geboren. Eine Art von, eine Bewegung, sage ich mal, die eigentlich altruistisch sein soll, aber, oder ist, im Sinne von, dass man versucht, das größtmögliche Wohl für alle zu erreichen. Es klingt eigentlich sehr utilitaristisch, meiner Meinung nach. Was, ich denke, der Unterschied ist, dass es sich eben auch auf Dinge bezieht, die halt im Moment noch nicht konkret sind. Also sie argumentieren dann mit diesem Expected Value, das ist so ein Konzept, das besagt, wie wahrscheinlich ist etwas, die Eintretungswahrscheinlichkeit eines Events und sozusagen der Effekt, den der Event hat, also ist das positiv oder negativ.
Nils: Ja, Erwartungswert.
Amanda: Und wenn man das, Erwartungswert, genau, wenn man das multipliziert und je höher, desto, ich sage mal, desto dringender ist das. Und eines dieser Probleme, die dann von diesem Effective Altruism erkannt wurde, ist eben diese Rogue AI, also diese bösartige künstliche Intelligenz, die dann die Menschheit zerstört. Und die muss man dann eben möglichst verhindern. Und da wurden Millionen, also Millionen von Dollars dann gespendet, um eben diese AI zu verhindern. Es ist so ein bisschen, ich finde das ein sehr zweischneidiges Schwert. Ich finde, wenn man dieses, grundsätzlich dieses Effective Altruism finde ich nicht so schlecht. Auch die Idee, dass man Geld so spendet, dass es auch einen großen Nutzen am Schluss bringt und nicht einfach, wo man gerade Lust hat, sage ich mal. Oder was einem sympathisch ist, das verstehe ich irgendwo noch.
Nils: Ja, das klingt erstmal sehr rational, vernünftig.
Amanda: Und gleichzeitig ist es, wenn man das sich dann weiterdenkt, also ein Imperativ ist dann ja, möglichst viel Geld zu verdienen, weil man ja auch möglichst viel Geld spenden kann. Das klingt halt einfach so ein bisschen eine Absolution für das ganze Silicon Valley Mindset. Also ja, ich mache mal alles kaputt und fülle mir die Taschen und dann kann ich es ja immer noch im Nachhinein für einen guten Zweck ausgeben.
Nils: Ja, da steckt ja auch noch dieser Gedanke hinter, du hast das gerade schon angedeutet, ich wollte es noch mal ein kleines bisschen deutlicher machen, dass es sozusagen nicht um uns jetzt primär geht, sondern um die Billionen von Menschen, die es in Zukunft irgendwann geben wird, wenn wir das komplette Universum besiedelt haben. Genau. So, und für die müssen wir dann das Gute wollen, wenn ich diesen Erwartungswert berechne, das ist vielleicht nicht wahrscheinlich, dass das passiert, aber es sind so unendlich viele Leute, dass das dann unser jetziges Wohl irgendwie übersteigt. Und ob da jetzt irgendwie 10.000, 100.000 Menschen im globalen Süden Hungers sterben oder ausgebeutet werden dafür, das spielt dann eigentlich keine Rolle.
Amanda: Genau. Ja, es ist schon absurd, wenn man sich so durchdenkt. Ja, diese, ich sag mal, diese Angstmacherei, die hat sich dann auch sehr ins Politische gezogen, also diese ganzen Tech-Menschen haben wohl sehr viel Einfluss auch auf Policymaking. Jetzt nicht nur, also sie beschreibt das ein bisschen in den USA, wie das da zustande gekommen ist, aber es ist wohl dann auch schon auf die EU übergeschwappt. Ein Narrativ ist immer so die Angst vor China, wir müssen das schaffen, bevor China das macht. Aber auch so gewisse Argumente wurden dann übernommen, die gar nicht unbedingt Sinn machen. Also beispielsweise werden, wird dann so die Art von gefährlicher AI wurde dann quantifiziert mit 10 hoch 26 Flops. Ein Flop ist ein Floating Point Operation, das ist einfach eine Maßeinheit, wie man die Rechenleistung quantifizieren kann. Und 10 hoch 26, das ist eine riesige Zahl, die aber komplett arbiträr ist. Ja. Ein bisschen, nicht komplett natürlich, aber irgendwie schon so. Die EU hat dann das ein bisschen restriktiver gemacht, hat dann 10 hoch 25 Flops genommen. Und das ist wie so, das wirkt so ein bisschen verzweifelt, weil ich sage mal, Personen, die sich damit auskennen, sagen danach, ja, das hat überhaupt keinen Zusammenhang mit dem Risiko. Die Rechenleistung per se ist nicht, das korreliert nicht per se mit dem Risiko. Das heißt, einfach eine Zahl zu nehmen, weil man so verzweifelt irgendeine, ich sage mal, eine Regulation aufbauen muss, das wirkt so ein bisschen, ja, es ist einfach nicht professionell.
Nils: Ja.
Amanda: Das ist irgendwie, zeigt auch ein bisschen den Einfluss, den diese Tech-Leute haben, weil die Zahl stammt ursprünglich von ihnen. Das wurde einfach eins zu eins übernommen.
Nils: Klar, weil das sind ja die Experten, die haben ja Ahnung.
Amanda: Genau, genau. Ja, und da wird natürlich auch sehr viel Lobbying gemacht und ich habe jetzt erst kürzlich, habe ich ein Video gesehen, wie diese Leute da bei Trump am Tisch sitzen und irgendwie da ihm einfach so sich anbiedern. Und er sitzt da und wartet, bis da jeder dieser Typen da gesagt hat, wie toll, dass er ist und wie glücklich, dass er ist jetzt da unter seiner Präsidentschaft weiter.
Nils: Da gab es doch auch diese Szene, wo irgendwie Trump gefragt hat oder ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall sagte Zuckerberg, wie viel Geld sie jetzt in Zukunft irgendwie investieren wollen. Ich weiß nicht, ob das KI war. Und er sagte dann irgendwie 600 Milliarden Dollar oder was das war, also auch eine unendlich absurde Summe. Und dann war das Mikrofon noch an, als er dann irgendwie ins Gespräch mit Trump ging und dann sagte Zuckerberg zu Trump halt, ja, ich wusste nicht, welche Zahl du hören wolltest, so ungefähr.
Amanda: Oh mein Gott. Ja. Also es ist auch, man muss auch sagen, wenn man diese Zahlen liest, ich kann die auch nicht in ein Verhältnis setzen. Ich verstehe auch gar nicht mehr das Ausmaß von diesen Skalen. Ich finde das sehr schwierig.
Nils: Ja.
Amanda: Jetzt das letzte, der letzte Punkt, den ich noch machen möchte, ist ein Thema, das sie schneidet, ist der Ressourcenverbrauch von natürlichen Ressourcen. Also sie beschreibt, wie diese großen Server Farmen von diesen Hyperscalers, also das sind, ich sag mal, das sind wirklich Fußballfelder voll Gebäuden, die einfach vollgepackt sind mit Rechenpower. Und Servern, ja. Und Servern, genau. Und das braucht natürlich extrem viele Ressourcen, das überhaupt zu bauen. Also so Chips, die brauchen Silizium, die brauchen aber auch viel Kupfer zum Beispiel. Kupfer wird in Chile abgebaut, die brauchen viel Lithium, Lithium wird auch in Chile abgebaut. Deswegen porträtiert sie da auch in Chile einerseits ein paar Menschen, die damit zu tun haben. Diese Server Farmen brauchen aber auch Land und Energie und vor allen Dingen auch Wasser. Und deswegen sind diese Firmen auch immer auf der Suche nach Orten, wo sie das finden, zu möglichst günstigen Preisen und möglichst ohne eine Bevölkerung, die da aufmuckt. Und so porträtiert sie das, wie das in Chile und in Uruguay wohl der Fall war, wie die da hingekommen sind und das bauen wollten und sich dann auch die Menschen gewehrt haben. Und beispielsweise ist es auch so, dass der Energieverbrauch, der wird nie quantifiziert richtig. Und das wird dann so als Geschäftsgeheimnis gehandhabt. Das gleiche übrigens mit dem Wasserverbrauch. Und beim Energieverbrauch, das ist so ein generelles Problem. Und das sagt auch Timnit Gebru, das ist eine Forschende, eine Forscherin, die, ich glaube sie war bei Google.
Nils: Ich meine auch, ja.
Amanda: Und hat dort auch die Forschungsabteilung geleitet. Und früher war das wohl so, dass man sehr offen auch Forschung gemacht hat und publizieren konnte und durfte, ohne da, dass man, wie sagt man, geschweigt, verschweigt, zum Schweigen gebracht wurde.
Nils: Ja, genau. Verschliegenheit war das andere Wort wahrscheinlich, was du besucht hast.
Amanda: Ja, ja, nee, ohne dass sie da plötzlich nicht mehr das machen durften, weil aus irgendeinem Grund. Und sie sagt auch, es sei sehr, sehr schwierig, da zu Zahlen zu kommen, weil egal, wie man anschreibt, die geben das nicht preis. Sagt natürlich schon ein bisschen was darüber aus, dass sie wahrscheinlich was zu verheimlichen haben. Und das macht das Ganze aber sehr schwierig, weil man es eben nicht so gut quantifizieren kann. Und beim Wasser ist es wohl ähnlich. Und ich weiß nicht, ich glaube in Uruguay war es so, dass man, dass dann die Bevölkerung sich wirklich so dagegen gewehrt hat und sie auch dann der Regierung gesagt hat, sie müssen das offenlegen. Das kann nicht sein, dass das unter Verschwiegenheit gehalten wird, bevor das gebaut wird. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie tausend, dass das Zentrum, also dieses Serverzentrum tausendmal mehr Wasser gebraucht hätte, als das ganze, die ganze Stadt oder das ganze Dorf, wo es gebraucht wird, pro Jahr. Also stell dir das mal vor, wenn du, und diese, diese Server, die brauchen Trinkwasser. Ja, ja. Das ist, das war den, das war den Menschen nicht bewusst davor, ne. Also das, das, die, wegen der, wegen dem Reinhardtsgrad, das darf dann auch nicht verstopfen und so weiter. Das muss gute Qualität von Wasser sein. Und in einem Ausmaß, das, wie sollst du das denn zur Verfügung stellen, ne. Und sie beschreibt dann das auch, dass das eben auch in Ländern war, die dann sehr von Trockenheit betroffen waren und so weiter. Und das ist natürlich, also das ist komplett gegen, gegen den Willen der Bevölkerung ist, dass da sowas gebaut wird. Und auch dort, ich finde, die, die Menschen oder die Aussagen sind dann erstaunlich, , rekonziliant eigentlich, ne. Also die sagen irgendwie, ja, das Problem ist gar nicht unbedingt das, aber wir kriegen halt gar nichts zurück. Also sie bauen das, sie verbrauchen die Ressourcen, sie schaffen keine Arbeitsplätze, ne. Solche großen Zentren schaffen sehr, sehr wenige Arbeitsplätze. Auch die, die ausgeschrieben wurden, waren dann zum Beispiel auf Englisch ausgeschrieben, also nur Personen, die Englisch konnten. Ja. Ja, steht aber in einem Land, das Spanisch spricht. , und das sei halt wie, ja, sei das große Problem, ne. Und dann kommen sie mit irgendwelchen Kompensationen, Google hat dann irgendwo einen Park gebaut, äh, an einer Stelle, wo niemand je hinkommt.
Nils: Ja, super.
Amanda: , und also die, Karen Howe ist dann den auch anschauen gegangen, da hat gesagt, da standen zwei vertrocknete Bäume und es ist wie so.
Nils: Ein Park.
Amanda: Genau, die Leute wollen keinen Park, ne. Die wollen halt was anderes, wenn man, wenn man.
Nils: Wasser trinken, wäre besser.
Amanda: Korrekt. Ja, , und auch da natürlich, also warum das zustande kommt, ist natürlich, dass die, die Regierungen sind ein Stück weit auch gezwungen, solche Deals anzunehmen, weil es extrem viel Geld bringt.
Nils: Mhm.
Amanda: , und dann haben wir auch wieder die, ich sag mal, die gängige Praxis, , dass man halt den globalen Süden in dieser Hinsicht ausnutzt, , weil man, weil man kann.
Nils: Ja.
Amanda: Ja, das ist so ein bisschen, sind so die, die Hauptpunkte, , zum Schluss, ich find’s schon spannend, oder? Ich, , beim Lesen war mir das nicht ganz so bewusst, warum sie das Empire of AI nennt, aber wenn man sich so ein bisschen Hauptcharakteristika von einem Imperium rauspickt, dann passt das schon ganz gut, ne.
Nils: Ja. Ja.
Amanda: Also, diese Expansion, , auch die Machtkonzentration, also man will ja ein Monopol eigentlich bauen.
Nils: Ja.
Amanda: , sagt auch dann irgendwo, ist ein, ich glaub, ein Zitat von Peter Thiel, das ist auch so ein, ein Tech-Guy.
Nils: Ja.
Amanda: Der sagt, ne, diese ständige Innovation, wenn du was machst und ein anderes Unternehmen macht Innovation in dem gleichen Bereich, das hilft zwar der Bevölkerung oder der Gesellschaft, das hilft dir aber nicht als Unternehmen.
Nils: Ja.
Amanda: , ja, macht Sinn, ne, aber ist halt die Frage, was man, was man gerne hätte. Ja, und auch die ganze, diese Ideologie dahinter und auch diese kulturelle Hegemonie, ne, diese Sprachmodelle, da ist ein, ein einstelliger Prozentsatz vom Input ist nicht englisch. Ja. , und so weiter. Also, das, es passt gar nicht so schlecht, dieser Titel Empire of, of AI.
Nils: Okay.
Amanda: Ja. Was denkst du dazu?
Nils: Bist du, bist du durch sozusagen? Ich bin durch. Du bist durch, auf allen Ebenen. Ja, danke für die, äh, dafür, dass du uns das, äh, das Buch vorgestellt hast. , noch eine weitere spannende Perspektive, glaube ich, auf, äh, auf das Thema KI, jetzt auch so im Rahmen unserer Reihe, ne, letzte Episode, äh, von Holgers Buch, äh, Live 3.0, oder was Holger vorgestellt hat. Das war ja eher so ein bisschen philosophisch, äh, sehr Meta. Und ich glaube, jetzt gucken wir einmal, haben wir einmal so reingeguckt in die, in die dreckige Realität sozusagen. Das finde ich immer einen schönen, schönen Kontrast. Danke dir dafür. , ich hab jetzt thematisch gar nicht so viel zu ergänzen. Ich kann halt noch so ein paar, paar Lesetipps, äh, dazu geben. Ich bin ja in dem Thema schon, schon so ein bisschen drin. , als Episoden jetzt aus, also abgesehen jetzt von den anderen beiden KI-Episoden oder auch von dem, äh, was ist das? The Eyes of Our Master von, , Pasquinelli. Ich glaube, es war Episode 88. Da habe ich jetzt vor allen Dingen zwei nochmal rausgepickt, die, glaube ich, nochmal ganz guten Kontrast geben, oder Kontext geben. Dieses Thema, , Imperialismus, äh, Ausbeutung des globalen Südens. Da haben wir ja die Episode, ich weiß jetzt nicht, welches es ist, ich glaube, es ist 42, , zu Afrika-Infrastrukturen der Externalisierung, äh, wo ich dieses, das Sonderheft sozusagen von dem Architekturmagazin vorgestellt hab. , da muss ich dran denken, wo das einfach auch nochmal historisch eingeordnet wird, genau dieses, diese Entwicklung quasi, , die wir als, als globaler Nord, da ist es jetzt primär Europa, aber das lässt sich ja ausweiten, , eben gerade mit, mit Afrika jetzt im Speziellen. Aber warum sollte sich das nicht auch auf, äh, auf Mittel- und Südamerika übertragen lassen, vom, vom Argument her haben. Und die zweite Episode, habe ich gerade nun mal auch nicht im Kopf, ist von Corridor Road Chokepoint Capitalism. Da musste ich jetzt ganz am Ende dran denken, wo du sagst, ja, es ist halt dann im Endeffekt auch ein Wettbewerb zwischen den Unternehmen. Das ist ein marktlicher Wettbewerb. Es geht nicht darum, irgendwie die Gesellschaft besser zu machen, , sondern es geht darum, das Unternehmen abzusichern. Und da haben gerade in, in der Tech-Branche gibt’s halt diese, diese Strategie des, des Chokepoints quasi, also zu sagen, , ich hab einfach, mein, mein Monopol ist so groß und so gefestigt, dass mir einfach keiner was kann. Und dann ist mir auch sämtliche Regulierung egal, dann finde ich Regulierung sogar gut, weil ich hab die Ressourcen, die zu bedienen und die abzu, und das zu bezahlen. Irgendwelche Startups, die was Neues versuchen in meiner Branche, aber nicht. Und die muss ich mir also schon mal keine Gedanken mehr machen. Also das fand ich auch nochmal einen ganz, ganz spannenden Punkt. Also hier so zwei, äh, Seit, Seitwege sozusagen, die ich hier auf jeden Fall noch, noch reingeben möchte. , dann haben wir einige Sachen zum Thema, du hast es angesprochen, dieser Ideologie, da gibt’s ja dieses kürze Tescreal, das hab ich wahrscheinlich in meiner Episode, , zu, äh, wie hieß das Buch, äh, der Icon auch schon erwähnt. , da geht’s genau um diese, eine Effective Altruism-Ideologie, die irgendwie so einen ganz perfiden, rationalistischen Blick auf die Welt hat, wo man auch so das Gefühl hat, die sehen eigentlich so den biologischen Menschen, der wir jetzt sind, nur so als Zwischenstation auf dem Weg zu irgendwelchen Cyborgs. Oder zu irgendwelchen künstlichen Intelligenzen, die dann die Weiten des Raumes, äh, entdecken. Also das ist auch irgendwie so eine ganz, ganz seltsame Perspektive. Äh, ich hab noch einen Artikel, den hab ich, glaub ich, bei Icon auch schon vorgestellt. Da ist ein Guardian, der ganz schön genau diese Moderation zeigt. Aber nochmal einen ganz spezifischen Aspekt von dieser Moderation, den du sagtest, weil sich nämlich, ne, dadurch, dass, ich glaub, Nigeria war’s, ist ein ganz zentrales Land eben bei einem dieser KI-Modelle für die, für die Generierung von, äh, für die Moderation von Inhalten. Und auch vor allen Dingen für die Bewertung von Output. Na, die halt sagen, okay, das war eine gute Antwort, das war eine schlechte Antwort. , und dass sich das wohl darin zeigt, dass in den Chat-GPT, äh, aus, ich weiß nicht, ob es Chat-GPT ist, irgendeines dieser Modelle, äh, in den Outputs halt so nigerianische Sprachmanierismen finden. , weil die halt, ne, da gewertet werden. Und was jetzt aber dazu führt, dass Texte, die diese Sprachmanierismen haben, von irgendwelchen KI-Erkennern, als KI-generiert erkannt werden. Was jetzt natürlich wieder dazu führt, dass Texte, die in dem echten nigerianisch geprägten Englisch verfasst werden, häufiger als KI-generiert erkannt werden. , das ist auch wieder, ne, da haben wir auch wieder eine rassistische Dimension drin, also struktureller Rassismus, nicht persönlicher Rassismus. , dann habe ich natürlich noch den Elementalist-Effekt, das ist auch ein sehr schöner Artikel, darüber, warum wir, wenn wir sinnvollen Text lesen, glauben, dass da jemand Intelligentes hintersteht, der diesen Text geschrieben hat. Also, wir lesen Intention in Sprache rein, wir versuchen zu verstehen, was wollte der da sagen, , und das ist halt ein Effekt, den sich, äh, gerade diese Sprachgenerierung zunutze macht, da hatten wir es am Anfang ja auch von. , genau, was habe ich noch? Ein Roman habe ich letztens gelesen, tatsächlich auch zufälligerweise, , wo es genau um diese Organisation der Arbeit ging, von der du sprachst, um diese Moderationsarbeit, das ist Automaton von Berit Glanz. Das ist ein deutscher Roman, , die eben genau das Leben einer alleinerziehenden Mutter, glaube ich, ist es, zeigt, die genau ein solches Leben lebt, , genau diese Aufgaben macht, genau diese, äh, das ist der Amazon Mechanical Turk, ne, das ist die, die rassistische Bezeichnung, äh, dieser Arbeitsweise. , aber Automaton ist im Grunde die, die Neutralisierung, also die, die nicht rassistische Bezeichnung, , das gleiche Gedanke. Und dann, als letztes, äh, ihr merkt, ich lese viel zu dem Thema, , der Newsletter von Ed Citron, äh, der schreibt unglaublich lange Artikel, also, der schreibt irgendwie jede Woche einen Artikel, der bei manchen anderen irgendwie schon fast ein Buch wäre. , und der rekonstruiert hat vor allen Dingen die wirtschaftliche Seite, gerade hinter OpenAI und was investieren die eigentlich gerade und wie realistisch sind Umsatzerwartungen und was passiert eigentlich, wenn die irgendwie keine Kapitalrunden mehr einsammeln und da kam eben auch diese OpenAI-Zahl her. Ich glaub, die sind mittlerweile bei zwei oder drei Milliarden Dollar Kosten für Compute pro Monat und haben halt aber nur irgendwie, ich glaub, eine Milliarde Dollar pro Monat Umsatz. , und da sind alle anderen Kosten, wie Trainingskosten von neuen Modellen und so weiter, sind auch gar nicht eingerechnet. , und haben jetzt irgendwie, was ist das, bei Oracle haben sie jetzt für 350 Milliarden Dollar Compute-Kapazität bestellt für die nächsten fünf Jahre. , oder 250 Milliarden, ich weiß es nicht genau, irgendwie so eine, so eine, so eine Fantasiezahl, , und keiner weiß eigentlich, wie die jemals diesen Umsatz reinfahren soll, weil die nämlich, das fand ich bei dem Ed Citron Beitrag so spannend, die sind noch immer Non-Profit, rechtlich. Ja. Und die kriegen irgendwie so eine große, äh, große Finanzierungscharge nur, wenn sie bis Ende des Jahres kein Non-Profit mehr sind. Aber das sagen alle, das geht eigentlich nicht, weil die haben doch gar nicht erst dafür angefangen, das zu versuchen.
Amanda: Ja.
Nils: , also das, das ist auch einfach super spannend, wenn euch das Thema tiefer interessiert und ihr bereit seid, lange Artikel zu lesen, , schaut euch, äh, schaut euch, äh, Ad Citron’s Newsletter an, der ist da auch sehr, sehr lesenswert. So, jetzt hab ich mal wieder meine üblichen Empfehlungen rausgehauen. Hast du noch welche, Amanda?
Amanda: Äh, sehr gut. Ich hab eine Podcast-Empfehlung, weil die 29er, vielleicht kennt ihr den Podcast, im Salon das gleiche Buch besprochen haben, letzten Monat. Ja, ich hab, ich war da schon dabei, das zu lesen, , da kann man sich das auch noch ein bisschen von einer anderen Perspektive anhören, mit sehr viel mehr Meinung zu, , aber, ja, es ist ziemlich lang, äh, der Salon jeweils, äh, aber, ja, wenn man möchte, kann man, kann man das nochmal von einer anderen Seite, äh, sich anhören. Ich hab noch ein anderes Buch, und zwar, das, auf Deutsch heißt das, was das Valley Denken nennt, von Adrian Daub, da geht es auch ein bisschen so um, um, um dieses Mindset oder um dieses Geschäftsmodell, ne, von dieser Disruption und eben Breakthings und so weiter, äh, der das da ein bisschen beschreibt.
Nils: Das hast du auch selber gelesen schon?
Amanda: , ich hab’s gelesen, ja.
Nils: Okay, aber mir ist das immer noch so, das müsste ich eigentlich mal lesen.
Amanda: Es ist nicht so, es ist, äh, dünn.
Nils: Ja, ja, es ist, ich hab nur so viele Bücher, die ich eigentlich mal lesen wollen würde, äh, selbst wenn die noch so dünn sind.
Amanda: Das stimmt, , er hat noch ein anderes, das weiß ich gerade nicht mehr, äh, das liegt bei mir noch auf, auf der Lese, auf der Leseliste. Ja, auf jeden Fall, , da hat man auch so ein bisschen einen Einblick zu, wie das funktioniert. Ja.
Nils: Gut, äh, genau, zu dem Thema Tescreal kann ich euch auch noch, äh, irgendwie einen Artikel verlinken, den hab ich aber, glaub ich, bei AI-Con auch schon verlegt, insofern, , genau. Gut, hast du noch Punkte, die du mitgeben möchtest, uns mitgeben möchtest zu diesem spannenden Buch?
Amanda: Nein, ich bin gespannt auf die nächste Episode.
Nils: Gut, dann, , ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, hier bei Episode 98. Das, das wird spannend, das wird spannend. Wenn ihr Episode 99 und natürlich dann auch die 100 und damit das große Finale unseres KI-Themen-Schwerpunktes nicht verpassen wollt, dann abonniert zwischen zwei Deckeln doch am besten auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. , als Indie-Podcast freuen wir uns natürlich besonders über Podcasts ein, über Abonnements, einfach über den RSS-Feed. Wir brauchen keine großen Plattformen für dieses Medium, , aber ihr findet uns halt auch auf den Plattformen, weil sonst hört uns keiner. , das, äh, also Spotify. Spotify und so weiter, da könnt ihr uns abonnieren. Ihr könnt natürlich unsere Webseite aufsuchen, zwischenzweideckeln.de, da findet ihr alle relevanten Links. Und wenn ihr uns Kommentare hinterlassen wollt, könnt ihr das auf der Plattform eurer Wahl tun. Ich hab tatsächlich, , letzte Woche erst geschnallt, dass auf Spotify mittlerweile ernsthaft, äh, Podcast-Episoden kommentiert werden. , also könnt ihr uns da Kommentare hinterlassen. Auch da freuen wir uns über die Webseite natürlich auch ganz besonders. , und ihr könnt uns in den sozialen Medien ansprechen. Wir sind auf Blue Sky, sind wir, glaube ich, im Deckeln. Und auf Mastodon sind wir erreichbar unter atzzzd.podcasts.social. Ansonsten bleibt mir bis zu unserer nächsten Episode nur euch zu wünschen viel Spaß beim Lesen.
Amanda: Tschüss zusammen.
Quelle und so
Intro und Outro der Episode stammen aus dem Stück Maxixe von Agustin Barrios Mangore, eingespielt von Edson Lopes (CC-BY).
Das Umblättern zwischen den Teilen des Podcasts kommt hingegen von hoerspielbox.de.
Zwischen zwei Deckeln findest du auch im sozialen Medium deiner Wahl: Mastodon und Bluesky.
Der Beitrag 098 – „Empire of AI“ von Karen Hao erschien zuerst auf Zwischen zwei Deckeln.

Sep 4, 2025 • 1h 15min
097 – Life 3.0 von Max Tegmark
In Leben 3.0 betrachtet Max Tegmark die künstliche Intelligenz mit einem weiten Blick. Er sortiert sie als eine neue Form des Lebens ein, und spekuliert über mögliche Entwicklungen der Menschheit und Künstlichen Intelligenz in der Nahen und fernen Zukunft. Insbesondere betrachtet er auch Fragen, die sich aus dem Blick auf die Zukunft für heutige Entscheidungen zur Künstlichen Intelligenz ergeben.
Shownotes
Buch: „Leben 3.0“ von Max Tegmark (Verlagswebseite, deutsche Version)
Youtube: Cory Doctorow zu Enshitification
Serie: „Sherlock“ (BBC, Wikipedia), zum Thema, wie intelligente Wesen aus dem Gefängnis ausbrechen.
Buch: „Complexities“ von John Law und Annemarie Mol (Verlagswebseite)
Artikel: „Chatbot wird zum Unternehmer – und scheitert grandios“ (TagesAnzeiger, Paywall)
Buch: „Wenn die Sterne verlöschen“ von Isaac Asimov (Open Library)
Buch: „Das Drachenei“ von Robert L. Forward (Verlagswebseite)
Buch: „Computerdenken“ von Roger Penrose (Springer Nature Link)
Buch: „Hyperobjects“ von Timothy Morton (societyandspace.org)
Buch: „The Precipice“ von Toby Ord (80000hours.org)
ZZD015: „Roboterethik“ von Janina Loh
ZZD017: „Hello World“ von Hannah Fry
ZZD022: „Natural-Born Cyborgs“ von Andy Clark
ZZD037: „Im Wald vor lauter Bäumen“ von Dirk Brockmann
ZZD043: „Der erweiterte Phänotyp“ von Richard Dawkins
ZZD049: „The Collapse Of Chaos“ von Ian Stewart und Jack Cohen
ZZD064: „The Web of Meaning“ von Jeremy Lent
ZZD073: „Die unfassbare Vielfalt des Seins“ von James Bridle
ZZD088: „Das Auge des Meisters“ von Matteo Pasquinelli
ZZD096: „The AI-Con“ von Emily M. Bender und Alex Hanna
Quellen und so
Das Bild im Episodencover ist von Evgeny Ozerov.
Intro und Outro der Episode stammen aus dem Stück Maxixe von Agustin Barrios Mangore, eingespielt von Edson Lopes (CC-BY).
Das Umblättern zwischen den Teilen des Podcasts kommt hingegen von hoerspielbox.de.
Zwischen zwei Deckeln findest du auch im sozialen Medium deiner Wahl: Mastodon und Bluesky.
Der Beitrag 097 – Life 3.0 von Max Tegmark erschien zuerst auf Zwischen zwei Deckeln.

9 snips
Aug 14, 2025 • 1h 16min
096 - „The AI-Con“ von Emily M. Bender und Alex Hanna
Die Diskussion über die Schattenseiten der Künstlichen Intelligenz steht im Mittelpunkt. Automatisierung könnte zu schlechteren Arbeitsbedingungen und einer Ungleichheit in Sozialsystemen führen. Der Einfluss von KI auf Kreativität und Buchproduktion wird thematisiert, ebenso wie die ethischen Debatten dazu. Außerdem wird die Verbindung zwischen Arbeitsbedingungen und Demokratie erforscht. Abschließend werden die finanziellen Herausforderungen von KI-Modellen und deren Skalierbarkeit diskutiert, sowie verleihen unterschiedliche Perspektiven der Debatte zusätzliche Tiefe.

Jul 24, 2025 • 1h 7min
095 – „Vertrauensfragen“ von Ute Frevert
Ute Frevert rekonstruiert in „Vertrauensfragen – eine Obsession der Moderne“ die Veränderungen des Vertrauensbegriffs über die letzten Jahrhunderte. Sie verfolgt diese Entwicklung von den Anfängen, als man nur Gott vertrauen sollte, über die Romantik, die Vertrauen zur Grundlage der Liebesehe machte, bis hin zur heutigen Verwendung des Begriffs in Politik und Wirtschaft. Dabei zeigt sie, wie Vertrauen von einer privaten, intimen Gefühlshaltung zu einem universellen Werbewort geworden ist. Dabei plädiert die Autorin dafür, zwischen systemischer „Zuversicht“, die moderne Institutionen durch Verlässlichkeit und Transparenz schaffen, und echtem „Vertrauen“ zu unterscheiden, das nur in persönlichen, intimen Beziehungen seine Berechtigung hat.
Shownotes
Buch: „Vertrauensfragen“ von Ute Frevert (Verlagswebseite)
Buch: „Ehrenmänner“ von Ute Frevert (Deutsche Digitale Bibliothek)
Zu Eriksons Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung (kevinhall.at)
„Vom Pädagogik-Paradies zum Skandalinternat: die Odenwaldschule“ (wdr.de)
„Genossenschaftsbank“ (deutsche Wikipedia)
FAQ der Stiftung Warentest
ZZD063: „Epistemische Ungerechtigkeit“ von Miranda Fricker
ZZD069: „Wie Gefühle entstehen” von Lisa Feldman Barrett
ZZD080: „Verfassungsschutz” von Ronen Steinke
ZZD083: „Im Grunde gut“ von Rutger Bregman
ZZD086: „Regeln“ von Lorraine Daston
ZZD089: „Arbeit. Macht. Missbrauch.” von Lena Marbacher
ZZD092: „Gekränkte Freiheit“ von Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey
Buch: „Die Kinderwüste“ von Stefan Schulz (Verlagswebseite)
Buch: „Über Kriege und wie man sie beendet” von Jörn Leonhard (Verlagswebseite)
Buch: „Vertrauen“ von Niklas Luhmann (Verlagswebseite)
Buch: „Das Vertraute unvertraut machen“ von Zygmunt Bauman (Verlagswebseite)
Artikel: „The Department of Good Living“ von John Last im NOEMA Magazin
Buch: „Why trust science?“ von Naomi Oreskes (Verlagswebseite)
Buch: „Liars and Outliers: Enabling the Trust that Society Needs to Thrive“ von Bruce Schneier (Verlagswebseite)
Buch: „Treue“ von Hernan Diaz (Verlagswebseite)
Quellen
Intro und Outro der Episode stammen aus dem Stück Maxixe von Agustin Barrios Mangore, eingespielt von Edson Lopes (CC-BY).
Das Umblättern zwischen den Teilen des Podcasts kommt hingegen von hoerspielbox.de.
Zwischen zwei Deckeln findest du auch im sozialen Medium deiner Wahl: Mastodon und Bluesky.
Transkript
Music:[0:00] Music
Amanda:[0:16] Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen zwei Deckeln, dem Sachbuch-Podcast, in dem wir euch alle drei Wochen, ihr werdet es kaum glauben, ein Sachbuch vorstellen. Ich bin Amanda und ich habe heute Christoph mit dabei.
Christoph:[0:30] Hallo zusammen.
Amanda:[0:32] Hallo. Was steht bei dir gerade an, Christoph?
Christoph:[0:35] Ich habe es im Vorgespräch gerade schon gesagt, vor allen Dingen ganz viel Ehrenamtsvorbereitung, weil ich, also wenn der Podcast erscheint, ist unsere Ferienfreizeit schon vorbei, aber grundsätzlich fahre ich jetzt auf Ferienfreizeit und dafür ist immer viel vorzubereiten, viel zu tun. Ja, das mache ich gerade. Was machst du?
Amanda:[0:57] Ja, ich finde das immer sehr faszinierend, weil bei uns gibt es, also das gibt es wahrscheinlich schon, aber ich kenne das wie eigentlich nicht in der Schweiz, dass man das so macht, Ferienfreizeit. Deswegen finde ich das sehr, sehr cool, dass du das machst und dass es das gibt in dieser Form bei euch. Bei uns, ja, Ferien stehen jetzt dann auch bald an. Ich bin aber im Moment eher ein bisschen mit Nicht-Ferien beschäftigt. Ich muss eine Arbeit schreiben. Da geht es um Roboter und Intimität. Ich versuche da herauszufinden, wie Intimität, die sich ja in der Sozialwissenschaft, ist das ein Phänomen, das sehr unterschiedlich konzeptualisiert wird, wie sich das übertragen lässt auf die Robotik. Weil dort hat man ja eher so ein bisschen ein sehr, ich sag mal, kognitivistisches Credo eher und ja, ob sich das vereinen lässt. Deswegen lese ich ziemlich viele Papers darüber und ja, beschäftige mich ein bisschen mit dem Thema.
Christoph:[1:58] Es klingt auf jeden Fall total spannend. Ich habe ja für so Robotik auf jeden Fall so ein kleines Nebenfable, auch wenn ich es jetzt länger nicht bespielt habe. Das klingt richtig gut.
Amanda:[2:08] Ja, ist auch. Nur ich finde immer, wenn man dann so ein bisschen den Zwang zu hat, gewisse Dinge zu lesen, dann nimmt der Spaß daran proportional ab. Aber ja, das gehört dazu. Ja, heute stellst du uns was anderes vor und zwar das Buch Vertrauensfragen von Ute Frewert. Ute Frewert ist eine deutsche Historikerin. Sie ist im Moment Präsidentin der Max-Weber-Stiftung, hat aber früher an der Uni Bielefeld und in Yale gelehrt und war auch am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin Direktorin.
Christoph:[2:50] Genau. Ich habe vergessen, in die Schaunouts reinzuschreiben, dass das Buch bei C.H. Beck erschienen ist und von 2013, glaube ich, ist. Also ein bisschen älter, aber das ist ja bei so historischen Büchern vielleicht nicht ganz so schlimm.
Amanda:[3:03] Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Vertrauen ist auch so ein Begriff wie Intimität. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Auffassungen zu, würde ich mal sagen. Deswegen bin ich gespannt, was du uns erzählen willst. Machst du gleich das TLDL?
Christoph:[3:19] Ja, gerne. Die moderne Institutionen durch Verlässlichkeit und Transparenz schaffen und echten Vertrauen zu unterschreiben, das nur in persönlichen, intimen Beziehungen seine Berechtigung hat.
Christoph:[4:02] Ja, genau, das ist so der Aufriss. Ich muss für unsere Hörerinnen einmal ganz kurz sagen, ich habe es Amanda im Vorgespräch schon gesagt, ich habe hier leider relativ laute Bauarbeiten gerade bei mir zu Hause und genau, dagegen kann ich nichts tun und ich hoffe, es kommt auf der Aufnahme nicht so durch und vielleicht erwischen wir auch eine relativ ruhige Minute. Genau, ich gebe in der Postproduktion alles, das rauszufiltern, aber seht es mir im Zweifel nach, bitte.
Christoph:[4:30] Ja, also sie startet in das Buch mit der zentralen Ausgangsfrage oder Problemstellung, dass sie sagt, naja, Vertrauen mir ist so ein Satz, der unseren Alltag durchzieht, ohne dass so richtig erklärt wird, was damit eigentlich gemeint ist. Und sie stellt sich die Frage, warum eigentlich ausgerechnet an Vertrauen appelliert wird und nicht an zum Beispiel Glauben oder Zuversicht, Sympathie oder auch an den Eigennutz, sondern dass Vertrauen so im Zentrum steht. Und sie sagt, dass Vertrauen in unsere Alltagskommunikation also offensichtlich so natürlich ist, dass es nicht eigens erklärt oder begründet werden muss. Und sie geht dem Ganzen anders nach. Da vielleicht schon ein ganz kleiner Einschub, wie bin ich auf Ute Frewart gekommen? Ich habe mal das Buch Ehrenmänner von ihr gelesen. Im Studium war das bei uns Thema. Da beschäftigt sie sich mit dem Duell als Sozialform und wie sich das entwickelt hat und warum es dann irgendwann ausgestorben ist. Und weil so der Ehrbegriff entstanden ist. Und wir haben ja in Deutschland stark den Begriff der Würde auch. Und ich glaube, sie ist einfach so eine Gefühlshistorikerin und geht eben Gefühlen oder Begriffen so auf den Grund. Und das hat sie jetzt bei Vertrauen eben auch gemacht. Aber so bin ich auf sie gekommen und fand das irgendwie ganz, ganz spannend.
Amanda:[5:48] Das klingt interessant. Das Wort Ehrenmann, das ist, was bei uns ein bisschen lustig klingt, weil im Moment ist das so Slang bei kleinen, nicht bei kleinen Kindern, aber so ist es in Deutschland auch, dass man so sagt, bisschen Ehrenmann.
Christoph:[6:04] Also wir betonen es anders, aber ja, wir sagen das auch. Oder nicht wir, aber ja. Bestimmt die Jugendlichen, die ich ab dem Wochenende sehe, die ganz sicher. Das, was sie voranstellt auch im ersten Kapitel ist, dass Vertrauen erstmal nicht universal ist. Also genauso wie Liebe ist auch Vertrauen von soziokulturellen Rahmungen abhängig und was wir heute unter Vertrauen verstehen, unterscheidet sich dann doch irgendwie erheblich von früheren Epochen.
Christoph:[6:31] Was Sie ganz spannend findet und das finde ich auch spannend, deswegen habe ich es mitgenommen, ist, dass der Begriff in allen europäischen Sprachen existiert und im Englischen sogar doppelt als Trust and Confidence und dann eben mit unterschiedlichen Konnotationen. Also da meint es ja verschiedenes.
Christoph:[6:47] Und was auch noch ganz, ganz interessant ist als Vergleich, der Conman ist im Englischen jemand, der Vertrauen erschleicht, während die Vertrauensperson oder der Vertrauensmann in Deutschland deutlich oder im Deutschen sehr positiv besetzt ist. Also den Begriff gibt es überall, aber die unterschiedlichen Wertungen sind eben ein bisschen verschiedentlich und sie greift dann noch die Anwendungsbereiche des Vertrauens auf, das ist einmal Politik, also wir haben sowas wie die Vertrauensfrage im Parlament als Instrument politischer Kontrolle oder Legitimation und dann natürlich aber auch als Werbethema, darauf kommt es im letzten Kapitel stark zu sprechen, in der Wirtschaft ist es mittlerweile ubiquitär, also Konsumentscheidungen werden an Vertrauensappelle geknüpft.
Christoph:[7:29] Persönliche Beziehung, gerade zwischen Liebenden oder auch zwischen FreundInnen, ist es ein wichtiges Komplex und die übergreifende Frage, die sie sich stellt, ist, was Vertrauen zwischen den Liebenden mit dem politischen oder wirtschaftlichen Vertrauen eigentlich verbindet oder ob es da Verbindung gibt. Vertrauen kann als riskante Vorleistung, der Begriff kommt von Niklas Luhmann, den kennt ihr ja mittlerweile auch, sie war in der Uni Bielefeld, also ich glaube, sie hatte auch gewisse Verbindungen zu, leider macht sie den theoretischen Bezug in ihrem Buch nicht so stark, wie ich es mir gewünscht hätte, aber Luhmann sagt, Vertrauen ist eine Investition und eine riskante Vorleistung, die Früchte tragen soll, also es ist etwas, was ich einer anderen Person entgegenbringe, in der Hoffnung, dass sich das auszeigt gewissermaßen.
Christoph:[8:17] Und das ist ein kleiner Einschub von mir, Vertrauen geht da als moderner Mechanismus zur Komplexitätsreduktion. Wenn ich Vertrauen in die Welt gebe oder zu anderen Personen, dann muss ich mir nicht so viel Gedanken machen. Also ohne Vertrauen lohnt es sich nicht, morgens aus dem Bett zu steigen, beziehungsweise sie macht dann den Unterschied zwischen Vertrauen und Zuversicht aus, aber wenn wir gar kein Vertrauen oder keine Zuversicht in die Welt haben, dann müssten wir eigentlich gar nicht aufstehen und nur so kommen wir durch die Welt. Ja, natürlich hat es aber auch eine Gefühlsdimension und das ist insofern spannend, sie macht den Vergleich zum Lach-Yoga auf, wo sie sagt, naja, wir wissen mittlerweile, Aktionen können Gefühle hervorrufen und nicht nur Gefühle bringen Aktionen hervor. Also wir können lachen, wie beim Lach-Yoga und dann empfinden wir Freude, dadurch, dass wir lachen und nicht andersrum. Und das ist beim Vertrauen ein bisschen anders, weil es immer mindestens zwei Parteien braucht. Also ich kann mir selbst vertrauen, ja, aber auch da begegne ich mir ja spiegelbildlich. Es geht immer um das Verhältnis zu etwas anderem und selbst im Zweifel zu mir als etwas anderem.
Christoph:[9:27] Grundsätzlich kann man aber natürlich sagen, dass Selbstbeschreibungen Vertrauen immer als positive und wohlige Erfahrung beschreiben und genau, sie hat dann noch ein ganzes Kapitel zur Pädagogik, aber grundsätzlich kann man mal sagen, dass Vertrauen auch als etwas skizziert wird, was gelernt werden muss. Also es ist nichts, was uns einfach gegeben ist, sondern es ist ein, ja, also wir wissen oder wir haben es mittlerweile zumindest geframed, als dass Menschen, die nicht vertrauen können, auf jeden Fall in ihrer Persönlichkeitsentwicklung eine Beeinträchtigung haben. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, das so zum Start erstmal und dann geht sie dazu über, vom 18. Jahrhundert aus Lexikon-Einträge zu vergleichen. Sie sagt, Lexikon-Einträge sind hervorragend, damit man skizzieren kann, was sich eigentlich in einer gewissen Epoche unter einem Begriff vorgestellt wurde. Und da startet sie eben 1746 und dort wird in einem Lexikon geschrieben, dass es Vertrauen nur unter wahren Christen gebe und zwar in ihrem Verhältnis zu Gott.
Christoph:[10:33] Anderen Menschen zu vertrauen scheint da noch relativ naiv, also nur Gott kann man komplett vertrauen und nur das ist wirklich belastbar, das mit den Menschen ist eher schwierig. Ein bisschen Ausnahmen gibt es, wenn man seinem Arzt, seiner Ärztin vertraut, das ist so ein bisschen anders. Finde ich dann ganz spannend mit diesem ganzen Kontext Halbgott, der Arzt als Halbgott. Ich weiß nicht, ob man da eine Verbindung ziehen kann, macht sie jetzt in dem Buch nicht. Aber es sind so Sachen wie, fällt das Vertrauen weg, so haben die Medikamente schon die halbe Kraft verloren. Aber das sind halt die wirklichen Ausnahmen.
Christoph:[11:06] Man solle nicht auf andere Menschen vertrauen. Das wird so ein bisschen mit religiösen Erneuerungsbewegungen anders. Die hatten ein bisschen lockeres Verhältnis zum zwischenmenschlichen Vertrauen und zwischen den Brüdern und Schwestern in brüderlichen Gemeinschaften, sowas wie Orden und so, gibt es dann die zärtliche, vertrauliche, übereheliche Liebe, die dann irgendwann einkehrt. Also da entwickelt sich das so langsam. Und dann im 19. Jahrhundert gibt es dann so eine wirkliche Abkehr von dieser religiösen Dominanz, sondern da kommt dann diese relationale Perspektive stärker raus, die ich gerade eben schon angesprochen habe. Also die Beziehung zwischen einem Kaufmann und einem Kunden wird hervorgehoben. Ein Kaufmann hat Vertrauen, wenn man ihm sein Geld und Geldeswert in gewisser Hoffnung, dass es sicher bei ihm sein werde, übergibt. In Klammern, er hat Kredit. Also da kommt so das erste Mal was Wirtschaftliches auf. Und trotzdem bleibt es aber nicht so ein rationales Kalkül, sondern es gilt weiterhin als etwas zum Wohlfühlen.
Christoph:[12:05] Und es wird auch ein bisschen aufgemacht, dass wenn jemand niemandem vertraue, dann bleibe diese Person einsam, kalt und lieblos. Und das gilt in dieser Zeit, also im 19. Jahrhundert, als das größtmögliche Unglück, weil der Freundschaftskult damals sehr groß war. Also Freundschaften waren super wichtig und Freundschaft ohne Vertrauen war dann nicht mehr denkbar. Und der vertraute Freund zum Beispiel war eine Tautologie. Also jemand, dem man vertraut ist, mit dem ist man automatisch befreundet. Und wenn man einen Freund, eine Freundin hat, dann vertraut man dieser Person auch. Sie macht nochmal den ganzen Punkt der nationalsozialistischen Instrumentalisierung auf.
Christoph:[12:45] Also wie gesagt, diese Vertrauensbeziehung zu Gott verliert an Dominanz und es entstehen schon davor und auch im 19. Jahrhundert entsteht sowas wie der Vertrauensarzt, der Vertrauensmann, das Vertrauensamt, der Vertrauensbeweis, die Vertrauensstellung, alles so Begriffe, die dann neu geschöpft werden. ähm, Und sie sagt, in der Zeit wird Vertrauen zum Lieblingswunsch der Moderne, weil es so viel Wohlgefühl für den Beschenkten als auch den, der es schenkt, bringt. So, das ist die Skizzierung da. Und dann, genau, ich habe gerade schon gesagt, nationalsozialistische Instrumentalisierung, da wird Vertrauen zu einer der wichtigsten Aufgaben der Erziehung. Natürlich ist damit aber nicht nur das Vertrauen untereinander gemeint, sondern natürlich vor allen Dingen das Vertrauen in den Führer, in Adolf Hitler. Das ist total wichtig, dass man in diesem Kontext irgendwie eine Führergefolgschaft an den Tag legt. Und in den Betrieben, ich bin ja nun auch Gewerkschafter.
Christoph:[13:50] Gab es schon länger das System des Vertrauensmanns, also einer Person, die man wählt von den Beschäftigten, die dann in den Konflikt treten kann oder in die Beratung mit der Geschäftsführung. Und das soll aufgehoben werden. Also es gibt dann Vertrauensräte, der Begriff bleibt, aber die sollen den Gegensatz von Kapital und Arbeit aufheben durch ein Band des persönlichen Vertrauens. Also das ganze Gegeneinander in einer marxistischen Lesart, in der modernen Arbeitsweise wird da aufgehoben quasi. Und ja, da wird der Begriff also ein Stück weit ausgehöhlt.
Christoph:[14:27] Und dann in der Nachkriegszeit, also ab den 1950er Jahren, gibt es nochmal eine grundlegend erneuerte Diktion und Vertrauen findet seinen Ort dann eher in der Familie, in der Ehe und in der Freundschaft und im Verhältnis von Arzt und Patient, das ist jetzt aus dem großen Brockhaus, also das Arzt-Patient-Innen-Verhältnis, das bleibt.
Christoph:[14:49] Und ja, genau, so langsam kehrt es dann auch als Vertrauen in Funktionssysteme ein, also im Berufsleben, Wirtschaftslesen.
Christoph:[14:58] Das Thema Vertrauenskrise in der Politik kommt so langsam auf, da geht das dann so ein bisschen los, dass es auch auf andere Funktionssysteme, das ist jetzt meine Lesart, übertragen wird. Und ab den 1970er Jahren gibt es dann noch so das ganze Thema Psychologisierung und Urvertrauen. Also Eriksson ist da glaube ich so der Pädagoge oder Psychologe, den man nennen muss. Das ganze Thema, das ursprüngliche Vertrauen im Verhältnis des Kindes zur Mutter ist so das, was aufkommt und das Urvertrauen als Grundlage für soziale Kompetenz und emotionale Sicherheit. Also im Prinzip zur Personenwerdung wird Vertrauen da ganz massiv angeführt. Und ohne Vertrauen seien Menschen nicht in der Lage, positiv zu denken und ein gutes Leben zu führen. Also das, was ich gerade eben schon mal angerissen habe. Ja, was auffällt, wir haben eine durchgängig positive Bewertung des Begriffs, auch wenn er sich so ein bisschen verschiebt über die Zeit, aber das bleibt.
Christoph:[15:56] Und wir haben drei Hauptbewegungen im Prinzip. Wir haben diese Säkularisierung, weil das Gottvertrauen sich ein Stück weit abschwächt und das Vertrauen in Menschen deutlich an Bedeutung gewinnt. Wir haben eine Expansion von den persönlichen Beziehungen auf entferntere, weniger intime Verhältnisse und die Psychologisierung. Also Vertrauen wird zur Grundlage der psychischen Gesundheit. Das sind so die drei Sachen, die man vielleicht rausnehmen kann. Alles anhand von Lexikon-Einträgen gearbeitet. Das muss man vielleicht ergänzend dazu sagen, weil ja, ich weiß nicht genau, wie prägend das für die ganz breite Bevölkerung im 18. und 19. Jahrhundert war.
Amanda:[16:37] Ich bin gespannt, ob sie jetzt so auch eine, also im Moment hast du einfach Begriffe oder den Begriff Vertrauen und die Verwendung des Begriffs genannt in unterschiedlichsten Kontexten und macht sie jetzt auch so eine eigene Definition, also sucht sie sich sozusagen den semantischen Gehalt daraus, den sie dann auch untersuchen möchte oder geht es wirklich darum, einfach Vertrauen als Begriff und der Wandel des Begriffes darzustellen im Buch?
Christoph:[17:02] Nee, es geht schon primär darum, die Entwicklung nachzuzeichnen. Also so einen eigenen Begriff, so benutzt man Vertrauen jetzt richtig oder so, das macht sie nicht so sehr. Sie hat am Ende auf jeden Fall die Kritik, die Unterscheidung, Zuversicht und Vertrauen drin und das Thema Funktionssysteme und persönliche Beziehungen. So, worum geht es denn eigentlich bei dem Begriff und was verwechselt man da? Das schon, aber sonst eher nicht. Sie geht dann weiter auf den Wandel des Vertrauens in Liebesbeziehungen und der Ehe ein. Sie zitiert ja ganz viel Wagners Lohengrimm, das kann ich nicht besonders gut wiedergeben, weil ich zum einen mit Opern, zum zweiten mit Wagner und so einfach nichts zu tun habe. Also für mich ist es, genau, zu mir spricht es nicht so richtig, deswegen gehe ich da nicht so richtig drauf ein. Aber genau, für die Interessierten da draußen, die Beziehung zwischen den beiden ist ein offensichtlich modernes Verständnis ehelicher Liebe und diese Liebe verträgt keine Geheimnisse und basiert auf Offenheit, Transparenz und wechselseitigem Vertrauen. Das vielleicht dazu wenn ihr die opa kennt dann sagt euch das sicher mehr als es jetzt mir sagt ich weiß nicht ob das ob das ein themenfeld für dich ist.
Amanda:[18:22] Ähm, nee, also nee, aus dem Schlegreif wüsste ich jetzt auch nicht. Aber ich weiß, dass es sehr, ich sag mal, wenn es um Vertrauen und Hochzeit geht, dann ist es auf jeden Fall die Musik, die man sehr oft dazu hört.
Christoph:[18:38] Naja, aber die Romantiker auf jeden Fall so um Friedrich Schlegel ging bei der Ehe dann so langsam von zwei selbstständigen Menschen aus, die sich einander ohne Wenn und Aber anvertrauten. Und ich würde sagen, das ganze Thema, man hat keine Geheimnisse voreinander, in einer Liebesbeziehung ist was, was sich gehalten hat. Ich würde sagen, das ist immer noch ein Ideal, was wir vorfinden.
Christoph:[18:57] Ich kenne, glaube ich, keine Beziehung zumindest, die besonders ohne, also die irgendwie, in denen das ganz normal ist, dass es keine, dass es Geheimnisse voreinander gibt. Also ich habe das Gefühl, das persistiert so. Weiß nicht, ob du da mitgehen würdest. Doch, doch. Ja, dass eine Ehe auf Liebe gründet, das war natürlich so bis zur modernen Ehe, keine Ahnung, irgendwann ab dem vielleicht in Teilen spätes 18. Jahrhundert, dann 19. Jahrhundert so langsam, das war überhaupt nicht vorgesehen. Also so eine Ehe wurde geschlossen, um Arbeit zu teilen, Vermögen zu mehren, Besitz zu vererben oder religiöse Fortschriften zu befolgen. Also Liebe, das vielleicht dazu, das hat… Also habe ich in meinem Studium gelernt, da habe ich einmal so ein umfangreiches Seminar zur Liebe belegt, war im Prinzip lange was, was den Reichen und Schönen vorbehalten wurde. Also wenn man Nebenbeziehungen führen konnte, die konnten dann liebevoll sein, aber so für die allgemeine Bevölkerung war das nicht unbedingt was. Das ist ein ziemlicher Luxus des Adels im Prinzip, Liebesbeziehungen führen zu können.
Christoph:[20:09] Gleichzeitig gab es natürlich Pflichten füreinander, also wechselseitigen Respekt und Fürsorge, das war schon gewünscht und vorgesehen, aber leidenschaftliches Begehren und Hingabe halt nicht. Aber dieses ganze Thema Pflichterfüllung zueinander ist auf jeden Fall was gewesen. Und dann im neuen romantischen Liebescode nahm Vertrauen dann eben einen zentralen Stellenwert ein und sich vertrauen, verloben, vermehlen, waren alle auch so relativ äquivalent zueinander, wie heißt das, synonym benutzt. Also sich vertrauen war das gleiche wie sich verloben, sich vermehlen, spannenderweise.
Amanda:[20:47] Ich finde das interessant, weil vorhin hast du gesagt, anfangs oder früher war das eher dann die Pflicht und da gibt es ja auch ein Vertrauen zu. Also man kann ja auch sozusagen darauf vertrauen, dass jemand seine Pflicht erfüllt. Und dann projiziere ich das Vertrauen zwar nicht auf die Person, aber auf das Regelwerk, in dem die Person handelt.
Christoph:[21:06] Das finde ich einen guten Punkt, stimmt. Ja, sehe ich auch so. Und das wäre dann vielleicht auch der Übertrag da rein, dass wir heute darauf vertrauen. Und da würde sie sagen, naja, ob das so richtig ist, dass unsere Straßenbahn zur Arbeit morgen wieder fährt. Und das ist vielleicht, ja, also ein Vertrauen in Regelwerke gibt es sicherlich, gab es sicherlich damals auch. Sie würde, glaube ich, sagen, dass sich das in der modernen Gesellschaft ausgeweitet hat, dass man früher weniger Vertrauen da reinsetzen konnte, dass die Welt morgen noch genauso funktioniert wie heute. Läuft ein bisschen konträr zu den Krisensemantiken, die wir so haben. Aber ich würde zumindest sagen, der Alltag, den wir so in den westlichen Gesellschaften bestreiten, auf den können wir relativ gut vertrauen, dass der so, dass der ganz gut läuft.
Christoph:[21:54] Wo war ich auch bei der Romantik? Klingt wie eine ganz anstrengende Phase, finde ich übrigens. So alles, was damals geschrieben wurde, als das losging und so, es klingt alles, ist ja auch immer alles sofort mit so, alles endet immer mit Suizid und nur Drama und fürchterlich. Also ich finde, es klingt wahnsinnig anstrengend. Die Frage, die sich natürlich bei der Romantik stellt, wenn man sich am Ende der Liebe, wenn sie dann verflogen ist, nicht direkt suizidieren möchte, dann ist ja ein bisschen die Frage, wie man sich, wie sich Gefühle auf Dauer stellen lassen. Wir können ja nicht uns alle umbringen, nur weil irgendwie die rosa-rote Brille abgesetzt ist. Also die Frage danach, was passiert, wenn die erste Leidenschaft weg ist. Und da ist dann Vertrauen irgendwie so ein maßgeblicher Faktor, den man einbauen soll. Und wenn man feststellt, dass das funktioniert, hat das doch einen Eigenwert und das ist toll, das kommt dann so raus und ja, das ist das, was kommt. Später kommt dann noch die Treue dazu, also ein bisschen, ich habe über Ehre und Würde gesprochen in dem anderen Buch. Treue und vertrauen liegen ja auch irgendwie nah beieinander und tauchen dann im 19 jahrhundert oft als synonyme auf mein ja dann jetzt heute aber auf jeden fall schon noch mal was anderes und das, Es geht da dann langsam los, aber dann ist es eben noch synonym verwendet.
Christoph:[23:21] Ich überlege gerade, wie ich gut weitermache. Ja, 20. und 21. Jahrhundert, da ist, glaube ich, nochmal zu sagen, die kameradschaftliche Treue zueinander, die wird nochmal hervorgehoben. Die gibt es natürlich parallel. Das ist dieser ganze Militärskult, den wir ja gerade hier im Wilhelminischen Deutschland auch stark hatten. Da ist das nochmal irgendwie wichtig und zentral. Und der liegt halt, der wird semantisch ähnlich benutzt. Sie meint aber natürlich, ist das irgendwie unterschiedlich. Wenn man zusammen mit jemandem in einem Schützengraben ist, dann bleibt ja nicht so richtig was anderes, als dieser Person zu vertrauen. Das ist was anderes als das Vertrauen, das wir in Freundschaften oder in der Liebe aufbauen. Weil das viel freiwilliger gewählt ist und deinem Soldaten, Kamerad, dir bleibt nichts, als dem zu trauen. Und genau, ihr seid beide treuer, geben dem Vaterland schön und gut, aber ihr seid da in einer Zwangssituation. Ja. Also die israelische Soziologin, die ganz viel zu Gefühlen arbeitet und ganz viel zu Liebe arbeitet.
Christoph:[24:35] Auf die kommt sie nochmal zu sprechen und sie meint, wir erleben jetzt das Gefühl in die Logik ökonomischer Beziehungen und Transaktionen eingepasst wird. Das Buch ist von 2013, das kann man jetzt sicherlich mit mit den Entstehungen von allen Dating-Apps und so nochmal, kann man sicherlich nochmal schärfer skizzieren oder könnte man. Und trotzdem besteht aber irgendwie der romantische Traum weiter fort. Also obwohl das alles so rational wirkt, bekennen sich Menschen weiterhin zum Traum der Romantik, dass das auch der ihre ist. Zumindest sagt sie das. Ich kann das jetzt empirisch nicht direkt prüfen, aber ich würde das zumindest als Semantik, würde ich da, glaube ich, mitgehen erst mal, so gefühlt.
Christoph:[25:19] Ja, also wir haben Liebe und Vertrauen, die irgendwie nah beieinander sind. Und sie sagt, vielleicht kann man heute sagen, dass sie ein bisschen kürzer getaktet werden, also so das ganze Thema serielle Monogamie vielleicht auch, das hat sie jetzt nicht mit drin. Ich weiß auch nicht, ob es 2013 als Begriff schon so etabliert war, aber wir haben Liebe und Vertrauen, aber vielleicht in einem schnelleren Wechsel zwischen den Personen und einer Anlegung auf Wiederholung und sie meint, damit verliert dieser Liebes- und Vertrauensbegriff ein bisschen das, was ihn eigentlich ursprünglich mal ausgezeichnet hat. Also Exklusivität einerseits zu einer Person und auch die Totalität. Es geht nur um diese eine andere Person. Ja, weiß ich nicht, steht mir jetzt nicht so nah diese Perspektive, aber ich wollte sie euch zumindest mitgeben. Genau, dann kommt sie im nächsten Kapitel zu Freundschaften als gewählte Vertrauensbeziehung. Und ursprünglich war es mal so, dass sich Männer Männer an Vertrauen und Frauen suchen, die Gesellschaft vertrauter Freundinnen. Also Freundschaften zwischen Mann und Frau waren ziemlich unverstellbar im 18. Jahrhundert. Also die Freundschaft zwischen einem Mann und einer Frau stand immer unter Verdacht. Das konnte man sich nicht so richtig vorstellen. Was ging, war, wenn beide Parteien verheiratet waren? Also es war schwierig, aber möglich her, so vielleicht.
Christoph:[26:48] Sie zitiert dann Kants Definition einer moralischen Freundschaft, denn dort geht es darum, dass das völlige Vertrauen zweier Personen in wechselseitiger Öffnung ihrer geheimen Urteile und Empfindung zueinander besteht. Also es ist schon viel Pathos dabei auf jeden Fall. Aber ich habe schon gesagt, Freundschaft hatte in der Zeit Hochkonjunktur im 18. Jahrhundert und am Anfang des 19. Jahrhunderts.
Christoph:[27:15] Und was natürlich, was wir heute auch noch kennen, jetzt vielleicht mehr unter dem Begriff der Wahlverwandtschaft, ist so ein bisschen, das ist ja völlig logisch, aber Freundschaften waren halt anders als familiäre Beziehungen handverlesen. Ist ja klar. Und deswegen konnte man da besonderes Vertrauen reinsetzen. Und die Frage danach, wem man was anvertraut, hat auch die Hierarchie in den Freundschaftsbeziehungen stark mitbestimmt. Also wer die engsten Geheimnisse, tiefsten Geheimnisse kannte, der war quasi ganz oben. Das bedeutet natürlich aber auch, dass FreundInnen sehr viel Macht bekommen haben, weil man natürlich dann Geheimnisse hat, die man verraten kann. Ich weiß nicht, was die Leute damals alles getrieben haben, dass man so unfassbar viel Geheimnisse hatte, aber das scheint wichtig gewesen zu sein. Man kann natürlich der vertrauenden Person schaden und macht sich damit verletzlich. Sie geht da auch noch mal auf das ganze Thema Kameradschaft ein. Also gerade jüngere Menschen sehnten sich nach Wärme und Aufgehobensein im Kreis gleichgesinnter Freunde. Und dann gab es auch diese bündischen Bewegungen und den Kameraden, da hat man fest vertraut. Deswegen nennt man sie ja dann auch Bundesbrüder, wie in der Familie.
Christoph:[28:29] Aber es ist ein bisschen die Frage, ja, vertraut man dem Konzept des Bundes quasi, in dem man da ist, Studentischer Bund oder was auch immer, oder vertraut man eigentlich den konkreten Personen? Und da kann man natürlich schon differenzieren. Und ja, genau. Und Helmut Plessner hat auf jeden Fall damals gewarnt vor zu großer Nähe und Vertrautheit in diesen Strukturen, weil man da so einen, also er hat da einen Radikalismus der Gemeinschaft sowohl auf kommunistischer als auch faschistischer Seite erkannt und damit dann ja auch recht behalten, muss man sagen. Da wächst dann nicht nur Gutes drauf, so historisch. Auf den Punkt gebracht, dass was ich gerade eben meinte, ist, wenn man in so einem NS-Schulungslager zum Beispiel ist, dann ist das natürlich Kameradschaft, die man da erlebt. Und das ist eben gerade nicht das Ergebnis einer freien, selbstbestimmten Entscheidung. Also man ist Mitglied einer Gemeinschaft, aber ist da natürlich irgendwie zwangssozialisiert. Man kann ja nicht so richtig gut daraus machen.
Christoph:[29:35] Ja, und die Verhältnisse erfordern halt, dass man diesen anderen Menschen vertraut. Über die Pädagogik haben wir schon ein bisschen gesprochen. Die wird dann nochmal zum Thema. Und ab dem 18. Jahrhundert wird, sagt sie, avanciert Vertrauen zu einer sozialmoralischen Allzweckwaffe. Das fand ich irgendwie ganz schön. Und es setzt sich die Vorstellung durch, dass Vertrauen eben nicht vom Himmelfeld, sondern gelernt, erprobt und erzogen werden muss. Das, was ich gerade eben schon mal meinte. Und entsprechend waren auch die LehrerInnen als VertrauensbildnerInnen gefordert. Und sie geht dann nochmal explizit, das würde ich jetzt aber ein bisschen ausklammern, auf die Probleme in den Reformschulen, sowas wie der Skandal um die Odenwaldschule, ich weiß nicht, ob der bei euch in der Schweiz so angekommen ist, darauf geht sie nochmal ein, also vor allen Dingen Vertrauensmissbrauch durch LehrerInnen und die Kirchen hat sie jetzt nicht mit drin, da würde ich das aber auch so sehen. Da gab es ja auch in beiden großen deutschen Konfessionen auf jeden Fall Missbrauchsskandale. Und sie spricht da über Gerold Becker von der Ohnenwaldschule nochmal explizit. Also sie hat das Thema Missbrauch von Vertrauen in Machtbeziehungen auf jeden Fall in dieser pädagogischen Komponente mit drin. Ja.
Christoph:[30:56] Die Erfahrungen aus der NS-Zeit und mit dieser Überspitzung des Vertrauens führen zumindest kurzfristig zu einer Abkehr von dem Vertrauensbegriff und man hatte in den 1960er Jahren so ein bisschen die Hoffnung auf eine demokratische Schule in einer demokratischen Gesellschaft, bei der man eben Vertrauen als Leitbegriff so ein bisschen verabschiedet hat. Das währt aber nur kurz, weil dann gesagt wird, naja, ihr habt Vertrauen irgendwie rausgeworfen und jetzt vertraut ihr in nüchterne Daten und nicht mehr in höhere Ideale. Und das kehrt dann doch rechtzügig wieder zurück in die Bildungsagenda und das Ziel der humanen und sozialen Erziehung, auch so humboldtsches Bildungsideal und so, das haben wir ja zumindest hier im deutschsprachigen Raum stark und von daher findet keine richtige Verdrängung davon statt. Ja, das ist so das, was sie zum Themenkomplex Freundschaft, Pädagogik, andere zwischenmenschliche Beziehungen als Ehe zu sagen hat.
Amanda:[31:58] Darf ich kurz nachhaken? Natürlich. Wenn du sagst, die Lehrpersonen waren dafür zuständig, das Vertrauen zu bilden oder Menschen dafür auszubilden. Was ist denn da genau mit gemeint? Also Vertrauen in wen?
Christoph:[32:18] Also, ich glaube erstmal die Kompetenz, vertrauen zu können in andere Menschen, das ist so das eine ganz Zentrale. Dann das Vertrauen da rein, dass einem vorgesetzte Personen, wie zum Beispiel eben BildnerInnen, vertrauenswert sind, kann man das so sagen? Also ich glaube, es geht darum, die Grundkompetenz, diese Idee von, ein Mensch ist nur dann eine gelungene Persönlichkeit, wenn er oder sie vertrauen kann, dass man das entwickelt, dass man das herstellt. Und dazu zählt eben in dem ersten Schritt, dass man dem Lehrer, der Lehrerin stark vertraut und darauf vertraut, dass der Weg, den diese Person für einen einschlägt, schon der richtige ist. Das ist, glaube ich, so gemeint, ganz zentral. Ergibt das Sinn für dich?
Amanda:[33:05] Ja, ich finde das nur interessant, weil ich hätte das nie sozusagen im Schulsystem verortet, sondern immer in der Familie. Also zu lernen, jemandem vertrauen zu können, hätte ich primär in der Familie gesehen.
Christoph:[33:16] Ja, ich meine gerade bei den Reformschulen, bei denen das ganz stark war, das sind natürlich auch häufig Internatsstrukturen gewesen. Das muss man vielleicht dazu sagen.
Christoph:[33:25] Grundsätzlich ist es aber auch ein allgemeines erzieherisches Ideal gewesen. Also es ist schon auch in der Familie verortet, aber eben nicht nur. Kommen wir zur Wirtschaft. Also das ist natürlich ein gewisser, ja, wir kommen richtig in die Moderne, also wir haben den Siegeszug der Konsumgesellschaft und in der Konsumgesellschaft ist Vertrauen die Leitwährung. Also einerseits aus einer Konsumentinnenperspektive, aber auch aus Betriebsperspektive. Die Zeiten… Indem man nur, oder die meisten Menschen nur lokal mit Menschen gehandelt haben, die man eh kannte, oder zumindest eine Person, die man kannte, kannte die nächste Person, sind dann irgendwann endgültig vorbei und das heißt, die ersten Ratingagenturen, sowas wie Moody’s, reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück oder auch die, ich weiß nicht, ob du die Schufa kennst, das ist hier in Deutschland eine Agentur, ich habe vergessen, wofür die steht.
Christoph:[34:15] Im Prinzip hat jede deutsche Person, es gibt eine Erhebung über die Kreditwürdigkeit dieser Person und das läuft bei dieser Privatorganisation zusammen. Also wenn du irgendwo etwas, wenn du eine Wohnung mieten möchtest, dann musst du immer eine Schufa-Auskunft mitbringen und die erfassen im Prinzip, welche Verträge bei dir laufen, wie viele Girokonten du hast, wie deine Zahlungszuverlässigkeit ist und dann kriegst du so einen Score und den musst du immer mit einreichen. Und auch bei allen möglichen Transaktionen über irgendwelche Rechnungssysteme billigst du auch immer zu, dass eine Schufa-Abfrage über dich läuft. Ja, das haben wir hier in Deutschland. Ist schon so datenkrakenmäßig relativ gruselig, ehrlicherweise.
Amanda:[35:01] Ja, finde ich auch. Bei uns ist das einfach das Betreibungsregister. Da musst du immer einen Auszug beilegen, aber sonst gibt es das ja nicht in dieser Form.
Christoph:[35:09] Ja, vielleicht besser. Also dafür, dass wir Datenschutz hier immer so hochhalten, gibt es durchaus Kritik dran.
Christoph:[35:22] Genau, es gab so die ersten, habe ich schon gesagt, im 19. Jahrhundert ging das eben los mit den ersten Büros, die irgendwie Karteien darüber geführt haben, welche Personen oder welche Betriebe auch wie zahlungszuverlässig sind. Und das blinde Vertrauen verschwindet halt bei hochgehender Konjunktur, sondern man möchte schon irgendwie Kenntnis haben, weil nicht jeder Betrieb eben Siemens ist. Wenn du wusstest, du hast Siemens als Auftragnehmer, dann ja, das wird schon gut gehen. Und wenn du bei Tante Emma bist, die kennst du auch schon und kaufst da einen, das ist auch kein Problem. Aber wenn du bei irgendwas dazwischen kaufst, irgendeinem mittleren Betrieb, den du halt nicht kennst, schwieriger. Ja. Traditionelle Geschäftsbeziehungen haben schon aber starke familiäre Wurzeln. Also zum Beispiel die Rothschild-Familie hat es so gemacht, dass der Patriarch da quasi seine Söhne in die Bankhäuser der verschiedenen Städte gesteckt hat. Auch Werner Siemens hat seine Brüder auf Niederlassungen angesetzt. Also da ist noch so eine starke familiäre Verstrickung mit drin. Und man leiht sich auch unter Freunden lange wohl, nicht unbedingt Geld, sondern auch bei schlechten Familienbeziehungen fragt man in der Familie nach Geld. So richtig klar wird mir nicht, woran das liegt aber vielleicht waren die.
Christoph:[36:50] Ja, war die Kontrolle da doch nochmal strenger als in Freundschaften, ich weiß es nicht genau aber ja, Freundschaften waren es auf jeden Fall nicht da, die dienten nämlich höheren und idealen Zwecken und nicht sowas profan wie Kate, das fand ich noch ganz spannend sie sagt nicht so richtig, wann sich das ablöst oder ob sich das überhaupt ablöst, wäre vielleicht auch nochmal eine spannende Frage, wie das heute ist ich weiß das gar nicht so genau aber, Ja, es gab dann irgendwann die ersten Kreditgenossenschaften, sowas wie Reifeisen hier in Deutschland oder ein anderer Betriebe war wohl Schulze-Delitz. Das war dann häufig im Land, also auf dem Land, so Bauerngemeinschaften, die irgendwelche Anschaffungen finanzieren mussten. Und das war eben genossenschaftlich organisiert und das hat stark darauf basiert, dass immer jemand jemanden kannte, spätestens wenn jemand nach Kredit gefragt hat, der diese Person kannte und wusste, naja, der Bauer Müller, das passt schon, sagt Bauer Meier, keine Ahnung, so ungefähr. Und man hat natürlich so eine gemeinsame Haftung, das heißt, man ist auch relativ streng miteinander, also da ist es nicht so besonders freundschaftlich, aber die umfassende soziale Durchleuchtung und der kollektive Erwartungsdruck waren essentiell, damit es funktioniert und das Raiffeisensystem, also ich meine, das Buch ist fünf Jahre nach der großen Finanzkrise erschienen, war damals hoch gelobt, das gibt es auch immer noch hier in Deutschland, auf jeden Fall, dieses Genossenschaftliche.
Christoph:[38:20] Und die haben stark damit geworben, zumindest in der Zeit, jetzt 2013, dass Nähevertrauen schafft. Dadurch, dass man irgendwie noch so einen Bezug zueinander hat, da geht dann Vertrauen langsam in diese Bankenwerbung oder Kreditwerbung mit ein. Obwohl Kredite und Vertrauen ursprünglich mal semantisch nicht verknüpft waren. Also man hat nicht unbedingt um das Vertrauen der Kunden geworben, sondern mehr Verlässlichkeit war eher der Begriff, den man genommen hat und das hat sich dann irgendwann geändert. Also die Deutsche Bank zum Beispiel hat das dann als Werbeslogan für sich entdeckt und wirbt ganz viel mit Vertrauen. Das hat sich irgendwann differenziert. Und ja, also die Unterscheidung zwischen sich vertrauen und sich aufeinander verlassen war offenbar mal stärker. Ich würde sagen, die kennen wir heute nicht mehr ganz so stark. Also ich finde, man kann, wenn man darüber nachdenkt, die Differenz noch ziehen, aber sie ist eher nicht so verbreitet, wäre so mein Argument.
Amanda:[39:21] Ja, ich finde das interessant, auch in Bezug jetzt auf, ich meine, das Buch ist vor ein bisschen mehr als zehn Jahren erschienen und jetzt schwindet ja auch auf dem Finanzplatz extrem das Vertrauen, zum Beispiel in eine Leitwährung wie dem Dollar oder auch eben in wie ein Markt funktionieren kann, was man macht und was man nicht, welche Zölle man erhebt und welche man eben nicht erhebt. Und das finde ich schon auch spannend, weil ich glaube, dass so viele Dinge basieren tatsächlich auf Vertrauen, auch ich sage mal blind ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber Vertrauen auf unausgesprochene Gesetze, wie Dinge funktioniert haben in den letzten Jahren und plötzlich wird das alles ein bisschen erschüttert.
Christoph:[40:03] Ja, das stimmt. Bin ich, glaube ich, bei dir. Ja. Sie geht dann auf das ganze Thema Marketing, Verbraucherschutz und so weiter ein. Also da 1939 erscheint das Lehrbuch der Markentechnik und dort wird das erste Mal, sagt sie zumindest, oder da hat sie es gefunden, dafür geworben, dass man doch vielleicht auf öffentliches Vertrauen setzen sollte, wenn man eine Marke hat, die man präsentiert. Und das ging dann auch los. Also in der Zeit hat Omega, hat dann irgendwann den Werbespruch gehabt, also diese Uhrenmarke, Omega hat das Vertrauen der Welt, Nescafé hat geworben mit Vertrauen Sie Nescafé, sehr originell auf jeden Fall. Und da geht es dann so langsam los und was wir dann auf der anderen Seite nochmal haben, ich weiß gar nicht, wie das bei euch in der Schweiz ist, bei uns gibt es hier die Stiftung Warentest, die ist für Kaufentscheidungen, glaube ich, relativ wichtig, die testen alles von Waschmaschinen zu… Kaffeemaschinen über, also sie testen wirklich alles, was man so an Haushaltsprodukten haben kann. Ich weiß nicht, ob ihr da so eine, habt ihr ein vergleichbares Institut?
Amanda:[41:14] Ja, bei uns gibt es einfach, das ist, ich glaube, das ist nicht ein Institut, aber es gibt so eine Publikation und auch im Schweizer Fernsehen gibt es auch so Sendungen, die das machen, also die so Tests machen. Aber was mir hierzu einfällt, ist, ich habe letztens gelesen, es gab in den USA eine Behörde oder ein Institut, das bis in die, ich glaube, in die 50er oder 60er Jahre hinein genau das gemacht hat. Also sie haben eigentlich Verbrauchergüter getestet und dann Empfehlungen rausgegeben, was funktioniert. Also ganz banale Dinge wie diese Seife oder dieses Abwaschmittel oder diese Oberfläche und so weiter. Und das war staatlich. Und der Staat hat sozusagen ein bisschen eine Kontrolle auch auf den Markt ausgeübt und gesagt, hey, eure Produkte funktionieren oder funktionieren nicht mehr. Und das wurde natürlich dann im Zuge der ganzen Deregulation, wurde das alles abgefräst. Und ich finde das interessant, weil du hast ja gesagt, diese Marken, also dieses Vertrauen in Marken, das wurde dann wahrscheinlich zeitgleich mit aufgebaut. Also plötzlich mussten Konsumentinnen, konnten nicht mehr auf eine objektive Institution vertrauen, die dir sagt, das funktioniert das nicht, sondern die Marken selbst mussten jetzt irgendwie dieses Vertrauen sich erkaufen, erarbeiten.
Christoph:[42:30] Das ist interessant, ja.
Amanda:[42:35] Und weil auch das Vertrauen in die staatlichen Institutionen, insbesondere in den USA jetzt, was man auch so hört, ist ja auch sehr stark zurückgegangen. Also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass der Staat dir sozusagen vorschreiben würde, was du jetzt in deiner Küche rumstehen haben solltest und was nicht.
Christoph:[42:50] Ja, das ging tatsächlich aus einer jetzigen Perspektive ein bisschen absurd. Ich habe gerade nochmal bei der Stiftung Warentest nachgeguckt und ich hatte es so im Ohr, aber sie hat einen staatlichen Auftrag, vertreten durch den Bundesminister für Wirtschaft und ist durch Steuermittel gefördert. Also ich weiß nicht, ob komplett dadurch, nee, sie kann nicht komplett dadurch finanziert sein, weil man auf jeden Fall Tests kaufen muss, wenn man sie freischalten möchte, aber das ist schon spannend. Also sie ist hier auf jeden Fall von staatlicher Seite stark unterstützt, mindestens. Ja, ich glaube, ein funktionierender Staat ist total wichtig, damit es, also ich glaube vor allen Dingen funktionierende Infrastruktur ist in meinen Augen der Hebel, mit dem man so politische Verwerfungen am ehesten bekämpfen kann. Also so Rechtsruck und all das, was dazu gehört, das ist so meine These.
Christoph:[43:46] Ich hoffe, dass ich damit richtig liege. Also wir in Deutschland haben ja gerade für unsere Verhältnisse sehr viel Schulden aufgenommen oder werden sie aufnehmen, um das in Gang zu kriegen und die Infrastruktur wieder auf Vordermann zu kriegen. Und wenn das nicht reicht, um die politischen Extrembewegungen einzudämmen, dann bin ich langsam ein bisschen ratlos, glaube ich. Also ich hoffe, dass das klappt. Na ja. Heute sieht die Welt natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Also Rating- und Zertifizierungsagenturen kennen wir, glaube ich, alle aus beruflichen Kontexten. Zertifikate, damit man Vertrauen ausstellen kann, kann man sich ins Praxiszimmer hängen oder in jede Organisation, sind, glaube ich, ganz normal. Wir kennen heute natürlich aber auch den Konsumenten, die Konsumentin als Bewerter. Also das ist natürlich auch nochmal ganz neu und die sind zwar offensichtlich nicht objektiv, sondern sehr subjektiv, aber die gemittelte Bewertung macht dann ja viel aus bei Kaufentscheidungen. Also ich weiß zumindest, dass sie für mich relativ relevant sind, auch wenn ich weiß, dass die häufig fingiert, untergraben, gefakt und alles sind. Mein Gefühl dazu ist auf jeden Fall wohlig. Wenn alle sagen, das ist toll, dann vertraue ich dem und mir geht es gut damit. Und so ganz falsch liegt man ja häufig dann doch auch nicht. Also das finde ich ist schon nochmal spannend. Ja, dann geht sie nochmal auf die Politik ein, also Vertrauen als Grundlage moderner Verfassungsstaaten.
Christoph:[45:15] Da gibt es so eine…
Christoph:[45:19] Ja, doppelte Vertrauensfunktion, also Zitat, in dem Maße, wie sich moderne Verfassungsstaaten entwickeln, gewann Vertrauen als Argument und Ressource Bedeutung, also es ist beides ein bisschen, also es ist ein Argument für den Staat, aber auch eine Ressource, um überhaupt Vertrauen, also Vertrauen, würde ich sagen, reproduziert sich ja auch ein Stück weit selber.
Christoph:[45:43] Und, dann, ja, also wo fangen wir an? Vielleicht wieder im 18., 19. Jahrhundert, wie die ganze Zeit schon. Da haben wir so die Idee des Landesvater-Modells noch, also der Fürst ist der Landesvater und die Untertanen sind seine Kinder unter väterlicher Führung und da geht es los, dass irgendwie im 18. Jahrhundert das erste Mal ans Vertrauen appelliert wird, also an dieses väterliche Vertrauen. Das beste Ansehen der Regierung ist dasjenige, das aus Liebe und dem Vertrauen des Volkes entspringt. Das wurde 1759 gesagt. Und davor war es noch so, dass Treue und Gehorsam verbunden mit Liebe wichtiger waren. Also das ist dann irgendwann im 18. Jahrhundert so ein bisschen gekippt. Also da auch wieder die Differenz zwischen Treue und Vertrauen. Also du bist halt geboren, du lebst in diesem kleinen Staat, du hast treu zu sein und das ist es. Es wird sich schon gekümmert. Und dann später wird ein bisschen, ich würde sagen, ein Unterschied zwischen Vertrauen und Treue ist schon, dass Vertrauen ein bisschen mehr gedankliche Eigenleistung voraussetzt. Treue scheint mir blinder zu sein in der Gefolgschaft auf jeden Fall. Und die Französische Revolution ist dann natürlich ein Wendepunkt, also 1789. Ludwig der 16. nahm die Revolution als flagganten Treuebruch wahr. Das tut mir natürlich ganz doll leid für ihn, aber es gab sicherlich auch gute Gründe.
Christoph:[47:09] Und das erste Mal haben, oder vielleicht vermutlich nicht das erste Mal, aber in der Breite haben die Herrscher das erste Mal um ihren Thron gebangt und konnten ihrer Bevölkerung nicht mehr so richtig vertrauen, also vielleicht aus der Sicht mal betrachtet.
Christoph:[47:26] Und die Treue zum Staat oder zum Staatsoberhaupt war immer weniger Pflicht und mehr eine Eigenschaft, eine Einstellung oder auch eine persönliche Haltung, also eine Frage der Verhandlung. Wie treu bin ich eigentlich meinem Kaiser, meinem Fürsten, wem auch immer ergeben? Da kommt so langsam auf, dass Menschen da eigene Positionierungen zu haben können und dass das nicht mehr einfach vorausgesetzt werden kann. Ja, dann in der preußischen Nationalversammlung machte das Wort des Vertrauensstaates dann das erste Mal die Runde. Also das Zutrauen, wird da 1808 gesagt, veredelt den Menschen, ewige Vormundschaft hemmt sein Reifen. Also man entwickelt auch eine andere Positionierung gegenüber den eigenen Bürgern. Damals natürlich Frauen noch nicht mit gemeint, sondern es ist ein bisschen die Hoffnung, dass wenn man ihnen vertraut, man vielleicht eigenständigere, cleverere, staatsbewusstere Menschen am unteren Ende quasi erzieht. Und wenn man die ganze Zeit nur von oben herabdiktiert, dann hat man da natürlich keinen besonders mündigen Gegenüber bei sich.
Christoph:[48:43] Ja, und ja, die Kaiser, die sind auf jeden Fall, die haben da so ein Thema mit, die deutschen Kaiser, die appellieren ganz häufig an das Vertrauen des eigenen Volkes zum Kaiser. Und dann hat man natürlich so monarchisch treuergebende Menschen, die das auch total toll finden, aber sie sind dann auch so ein bisschen sehr verletzt, wenn sie das Gefühl haben, das Volk vertraut ihnen nicht mehr so, wie es das sollte. Das fand ich irgendwie nochmal spannend, so zu lesen, weil man erkennt so langsam, dass das monarchische Prinzip an Anerkennung verliert. Also das wird daraus deutlich. Willem der Erste wurde nach zwei Attentaten 1878, hat er gesagt, dass sein Vertrauen auf die alte preußische Treue merklich erschüttert war. Kann ich verstehen. Wenn man zweimal ermordet werden soll, dann vertraut man vermutlich seinen Untertanen nicht mehr so richtig. Aber dass es dafür vielleicht auch Gründe für gibt, das scheint den Herren nicht so sehr klar gewesen zu sein.
Christoph:[49:55] Und Wilhelm II., also der letzte deutsche Kaiser, der dann 1918 zum Ende des Ersten Weltkrieges abgedankt ist, wenn ich jetzt nicht völlig falsch bin, hat sich auch in so einer Demutsgeste immer als treuen Fürsten eines treuen Volkes präsentiert. Also da steckt dann natürlich auch viel Appell drin, man macht sich selbst ein bisschen kleiner, als die eigentliche Rolle vielleicht ist, also man dient dem eigenen Volk, man ist dem so treu ergeben, also schon irgendwie in der ganzen Rhetorik finde ich ein bisschen albern. Und so Leute wie Bismarck haben durchaus auch gesagt, dass der deutsche Patriotismus einer Vermittlung dynastischer Anhänglichkeit bedarf. Also da gab es schon noch irgendwie den rhetorischen Konnex und den Glauben daran, dass das deutsche Wesen das auf jeden Fall benötigt und so eine Dynastie auch braucht. Das finde ich irgendwie sehr, sehr merkwürdig.
Christoph:[50:59] Und dann mit dem demokratischen Neuanfang ab 1918 in Deutschland, also der Weimarer Republik dann bis 1933, ist dann die große Vertrauensfrage gestellt, die das alte Deutschland an das neue Deutschland richtet. Also kann man sich noch auf den eigenen Staat verlassen, auch wenn es davor irgendwie schlecht gelaufen ist. Und in den Verfassungsdebatten zu der Zeit war von Vertrauen wohl offenbar auffällig häufig die Rede, sagt Frewert.
Christoph:[51:28] Und es wird so langsam klar, dass es Vertrauen nicht bedingungslos gibt, also der Unterschied zwischen Treue und Vertrauen, sondern es muss gebildet und aufgebaut werden und es braucht so eine Kette an positiven Erfahrungen, damit Menschen dem Staat vertrauen können und, es ist dann nicht mehr so sehr die riskante Vorleistung, die ich am Anfang mit Newman zitiert habe, sondern es wird klar, dass Vertrauen so ein Teil und das Ergebnis von demokratischen Prozessen ist, Also, dass man sich Vertrauen auch erarbeiten kann und das auch notwendig ist. Man hatte ein bisschen die Hoffnung, dass man in der Präsidialdemokratie der Weimarer Republik mit der Direktwahl des Staats überhaupt so eine grundsätzliche persönliche Verbindung herstellen konnte zwischen Volk und dann eben Präsident. Der Korb war ja auch ziemlich mächtig.
Christoph:[52:16] Und Hindenburg war dann natürlich auch so ein sehr alter Präsident, der sich selbst als Held und Retter Deutschlands dargestellt hat und so eine väterlich-großväterliche Ausstrahlung hatte. Ja, und da wird dann so langsam klar, schreibt Fribert, dass so eine Führersehnsucht in den 1920er Jahren auf jeden Fall weit verbreitet war. Also eine Person, die leitet und der man hinterherlaufen kann. Ja, und Hitlers Machtübernahme ist dann, ja, sollte eine Vertrauensdiktatur werden. Ob das so geklappt hat, sei man dahingestellt. Aber die Nazis skizzieren Vertrauen dann auch als seelische Grundkraft und Substanz der Volksgemeinschaft.
Christoph:[52:59] Das ist irgendwie, ja, also es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema für das Regime, was natürlich irgendwie ein bisschen konträr dazu ist, also so sicher sich das Regime präsentiert hat, so intensiv hat es gleichzeitig so eine Politik des Verdachts tatsächlich gelebt. Also es ist ja jetzt nicht so, als wäre, als hätte, oder es geht vermutlich für Regime im Allgemeinen, man soll ihnen stark vertrauen, aber das Vertrauen bringen sie jetzt nicht unbedingt ihren BürgerInnen entgegen. In der DDR wird es dann im Prinzip ein Stück weit weitergeführt, nur vertraut man da nicht mehr dem Führer, sondern halt der Partei.
Christoph:[53:38] Und in der Bundesrepublik wiederum auf der anderen Seite im Nachkriegsdeutschland, weicht diese gefühlsbetonte politische Sprache, die wir bis dato kannten, einem Pathos der Nüchternheit. Also man appelliert stark an den mündigen Bürger und die lebendige Demokratie, basiert halt auf ihnen, wird immer wieder stark gemacht. Und da wird dann auch mal gesagt, dass ein gehöriger Schuss Misstrauen auch zu einer funktionierenden Demokratie gehört. Das finde ich einen spannenden Wandel auf jeden Fall. Die Instrumente des Misstrauensvotums und der Vertrauensfrage, das wissen die deutschen HörerInnen vermutlich haben wir hier in Deutschland zwar, aber sie sind nur selten zum Einsatz gekommen. Also man benutzt die eigentlich nur in Ausnahmefällen. Jo, die Wahlkämpfe verändern sich dann natürlich auch, also die CDU, also die konservative Partei bei uns wirbt einmal mit Mut, Glauben und Vertrauen und die SPD, also die Sozialdemokraten machen das dann auch.
Christoph:[54:39] Auch Schröder zum Beispiel 2005 hat geworben, mit gute Politik schafft mehr als Tatsachen, nämlich Vertrauen. Und ja, da ist das natürlich ein schönes Werbewort. Das kann man, glaube ich, dazu im Prinzip sagen. Was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass, wenn man sie, sie nennt es die V-Waffe, kann natürlich leicht zum politischen Bumerang werden. Also es ist jetzt nicht so, als würde das, ja, wenn man das übermäßig benutzt, dann wird einem auch schnell nicht mehr geglaubt, weil schon klar ist, dass Vertrauen schnell ein moralisch überfrachteter Begriff sein kann, der sich dann eben ins Gegenteil und ins Misstrauen wenden kann. Ja, genau. Dann kommen wir zum Thema Systemvertrauen und Moderne, würde ich sagen. Also ja, sie sagt, dass moderne, hochdifferenzierte Gesellschaften Systemvertrauen fortlaufend verlässlich herstellen. Das Thema, warum stehen wir morgens eigentlich auf, weil wir schon davon ausgehen, dass der Supermarkt offen hat, dass meine Arbeitsstelle noch existiert, all diese Dinge.
Christoph:[55:46] Und ich finde, das ergibt auch Sinn und ich finde, das ist ein ganz schöner Gegensatz zu eben diesen Krisendiagnosen, die wir allen Teilen haben, zu sagen, naja, wenn man es quasi on the long run betrachtet, dann kann man den gesellschaftlichen Prozessen, die wir so haben, schon stärker vertrauen, als man das früher konnte. Also finde ich eine angenehm positive Lesart, das gefällt mir ganz gut, weil Institutionen, die wir heute haben, schon ein hohes Maß an Transparenz und Zurechenbarkeit und Kontrolle möglich machen. Also viele öffentliche Prozesse können wir einfach ganz gut durchdringen und verstehen. Und auch so Dinge wie die Zuverlässigkeit des Rechtssystems. Ich meine, wenn es krasse Fehlurteile gibt oder so, dann wird es sehr stark skandalisiert und darüber gesprochen. Und das ist dann natürlich schon auffällig dafür, wie reibungslos an vielen Stellen, auch wenn wir das vielleicht nicht Tag für Tag so direkt wahrnehmen, vieles doch funktioniert.
Amanda:[56:46] Finde ich einen sehr guten Punkt und ich möchte hier einwenden, dass es nicht überall auf der Welt so funktioniert natürlich. Also ich habe jetzt gerade kürzlich mit einem Rechtsfall auf Kuba zu tun gehabt und da fand ich wirklich erstaunlich, wie intransparent das alles ist. Also du hast keine Chance, nur schon herauszufinden, an welche Behörde du dich wenden musst, mit wem du sprechen kannst, darfst, wer dir welche Informationen geben kann. Und dann ganz banale Dinge, zum Beispiel jemand sagt, man kann auf einem Dollarkonto das in die Währung umwandeln. Und eine andere Person sagt, nee, das geht nicht. Und eine dritte Person sagt, nee, Dollarkonten gibt es gar nicht. Und du kannst, du findest die Wahrheit nicht und du kannst unmöglich dein Vertrauen in irgendeine Institution aufbauen. Du musst auch dir das Vertrauen aussuchen, wem du das schenken willst, unter Leuten, die du eigentlich als deine Freunde bezeichnest. Und das ist mir wirklich vor ein paar Wochen wieder so richtig klar geworden, da leben wir hier, also ich spreche jetzt Deutschland, Schweiz, in einer ganz anderen Gesellschaft. Das ist schon auch ein Privileg, das wir haben, dass wir, wie du gesagt hast, dass das reibungslos und also wirklich ohne Reibung funktioniert.
Christoph:[58:00] Ja, finde ich einen sehr berechtigten und guten Einwand. Ja, danke. Danke dafür. Sie schreibt nochmal, dass moderne Institutionen eben Zuversicht, nicht Vertrauen ermöglichen. Finde ich, ja, weiß ich nicht genau. Sie möchte auf jeden Fall, also sie, ihr ist diese Trennung als Vertrauen ist was, was zwischen Personen existiert und Menschen. Und dem, was auch immer es ist, was man eben Organisationen und so entgegenbringt, das nennt sie eben Zuversicht. Ich weiß nicht genau, ob ich mit der Differenz so glücklich bin, ehrlicherweise, weil ich glaube, ich würde nicht sagen, ich bin zuversichtlich, dass ich morgen einen Termin in meinem Bürgeramt bekomme, sondern ich vertraue darauf, dass ich einen Termin in meinem Bürgeramt bekomme. Also für mich ergibt es nicht ganz so viel Sinn, glaube ich. Aber sie sieht den genuinen Ort in Beziehungen, die auf Nähe, Intimität und Fürsorge kodiert sind. Im Prinzip hängt das Ganze auch am Begriff der Erwartungssicherheit vielleicht, wenn man es ein bisschen soziologischer formulieren möchte. Aber das sind, glaube ich, Feinheiten. Ja, und damit bin ich am Ende des Buches angekommen.
Amanda:[59:16] Vielen Dank. Darf ich noch eine letzte Frage stellen? Im TLDL hast du das vom echten Vertrauen erwähnt. War das, was du eben gerade genannt hast? Meint sie das mit dem echten Vertrauen?
Christoph:[59:28] Ja, ich glaube, das haut hin, ja.
Amanda:[59:31] Okay. Ja, vielen Dank für diesen Abriss.
Amanda:[59:41] Ich erlöse dich kurz und erzähl mal, was mir dazu eingefallen ist an Literatur weiterführend. Und zwar, ich werde den Artikel verlinken, was ich vorhin gerade erwähnt habe, mit diesem Housekeeping Institute, The Government for the Good Life. Das ist auf Nömer erschienen. Ich fand das ganz interessant zu lesen, wie man da früher auch auf Institutionen vertraut hat, die einem Empfehlungen gegeben haben. Und dann als Folgen sind wir zwei eingefallen. Einerseits Rules von Lorraine Destin. Da haben wir eine Folge zu gemacht. Und ein anderes ist Epistemische Ungerechtigkeit von Miranda Fricker. Da geht es eben auch darum, wem kann ich vertrauen, also in Bezug auf eine andere Person, wie kann ich, ich fange nochmal von vorne an, was bedeutet es, wenn ich jemandem vertrauen kann in Bezug auf, was diese Person sagt, also was muss gegeben sein, damit ich jemandem vertrauen kann oder will oder darf und auch systemisch, wie sich das entfaltet. Also ich finde, das ist ein sehr gutes Buch, wo es eben darum geht, um das Vertrauen auch in Wissen, was kann man wissen, geht.
Amanda:[1:00:57] Dann hätte ich ein Buch von Naomi Oreskes, Why Trust Science. Ich finde sie einfach auch eine tolle Autorin, Wissenschaftlerin und da macht sie auch ein Plädoyer dafür, weshalb eben auch so die soziale Komponente von Wissenschaft eben dazu beiträgt, warum man der Wissenschaft eben auch vertrauen kann und soll.
Amanda:[1:01:20] Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Das letzte, ah genau, das ist ein Sachbuch von Bruce Schneier, das heißt Liars and Outliers und das ist auch schon ein bisschen älter, ich glaube 2012 ist das erschienen und darin geht es eigentlich, es geht wirklich um Vertrauen und auch wie Vertrauen in der Gesellschaft hergestellt wird. Also der Titel meint Liars, Lügner und Outliers, Einzelgänger. Also wie man sozusagen die Gesellschaft zum Funktionieren bringt, obwohl man immer auch Personen hat, die eben da ausscheren. Und was das Sicherheit eigentlich der Mittel zum Zweck ist, um dieses Vertrauen eigentlich herzustellen. Und Schneier ist eigentlich ein Kryptologe und macht da einen sehr interdisziplinären Zugang auf zum Thema, den ich sehr lesenswert gefunden habe. Cool. Und als letzten Tipp hätte ich noch einen Roman und zwar, der heißt auf Englisch, heißt der Trust. Die deutsche Übersetzung ist Treue. Also da sind wir gleich schon in diesem Feld von welches Wort nehmen wir denn? Was meinen wir genau? Das ist ein Buch, das ist vor drei Jahren erschienen, 2022, glaube ich, von Hernan Dias und das hat auch den Pulitzerpreis gewonnen. Da geht es so um, also es ist sehr raffiniert aufgebaut und auch erzählt.
Amanda:[1:02:42] Die Erzählweise ist wirklich sehr interessant und es geht aber eigentlich um die 20er Jahre und um den Finanzkapitalismus und darin auch um eine Emanzipation einer Frau und das Vertrauen zu ihrem Mann und eben auch ins Geld und in die Finanzmärkte. Also es ist sehr lesenswert. Ich fand es einen sehr guten Roman.
Christoph:[1:03:02] Cool, Dankeschön. Ich habe an weiteren Folgen noch, wie Gefühle entstehen. Das ist Folge 69 von Lisa Feldman Barrett.
Christoph:[1:03:12] Ich glaube, weil hier ja auch klar oder hätte klar werden sollen, wie Vertrauen durchaus auch prozedural entsteht. Dann das Buch Verfassungsschutz von Ronen Steinke zum Thema Systemvertrauen vielleicht. Im Grunde gut von Rüdger Brechmann oder wie auch immer man ihn ausspricht. Ist, glaube ich, auch ganz passend. Also Verfassungsschutz ist Folge 80, im Grunde gut ist Folge 83. Dann das Buch aus Folge 89, Arbeiten macht Missbrauch von Lemena Marbacher. Das knüpft natürlich schon vom Titel her an. Und Folge 92 ist Gekränkte Freiheit von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey. Ich glaube, die passen alle thematisch ganz gut. Dann hatte ich schon gesagt, die Habilitationsschrift von Ute Frewart lohnt sich auf jeden Fall. Die heißt Ehrenmänner, Das Duell in der bürgerlichen Gesellschaft ist wirklich erstaunlich spannend dafür, auch wenn man vielleicht kein Historiker, keine Historikerin ist. Dann zum Thema Systemvertrauen auch lohnt sich, glaube ich, ein Stück weit von Stefan Schulz die Kinderwüste, wie die Politik Familien im Stich lässt. Weil man da sicherlich dafür argumentieren könnte, dass Familien, zumindest in Deutschland politisch, nicht genügend beachtet und gesehen werden.
Christoph:[1:04:32] Weil dann über Krieg und wie man sie beendet von Jörn Leonhardt, da geht es auch ganz viel darum, wie sich Konfliktparteien vertrauen müssen, damit Frieden in Kriegssituationen geschaffen werden kann. Das ist eine ganz wichtige Ressource, ansonsten kommt man über Waffenruhen, Waffenstillstände und so nie hinaus, wenn Gesellschaften kein Vertrauen zueinander schäupfen können oder auch VerhandlungspartnerInnen.
Christoph:[1:05:02] Dann Niklas Nuhmann ist, glaube ich, soziologisch da. Auf jeden Fall eine feste Adresse, die man im Blick haben muss. Habe ich ja hier auch schon zitiert. Vertrauen, ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität. Ich selber habe es nicht gelesen, aber wurde mir schon oft empfohlen. Und ein weiterer Soziologe im Interview mit Peter Hafner, glaube ich, ist Sigmund Baumann. Von dem habe ich hier im Podcast Modern und Ambivalenz schon vorgestellt. Da gibt es ein Interviewband, der heißt Das Vertraute unvertraut machen. Lohnt sich total, weil Sigmund Baumann einfach eine sehr, sehr spannende Person war, ja auch sehr, sehr alt geworden ist und da eben interviewt wird und sein Ansatz zur Soziologie auf jeden Fall ist, zu sagen, dass die Dinge, die uns so vertraut erscheinen und die wir für so normal halten, können wir soziologisch nur dann gut betrachten und gut analysieren, wenn wir sie uns eben wieder unvertraut machen. damit wir einen neuen Zugang zu ihnen gewinnen. Ja, das wären meine Empfehlungen.
Amanda:[1:06:02] Cool, vielen Dank. Ja, bleibt mir zu sagen, ihr findet uns im Internet, im Netz unter www.zwischenzweideckeln.de. Wir sind jetzt auch auf Blue Sky vertreten unter dem Handel at deckeln und auf mastodon unter czd at podcast.social. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns Sternchen verteilt oder Rezensionen schreibt. Das erhöht auch unsere Sichtbarkeit. Und ja, danke dir Christoph fürs Vorstellen. Sehr gerne. Und wir hören uns in drei Wochen. Tschüss. Macht’s gut.
Christoph:[1:06:33] Tschüss.
Music:[1:06:33] Music
Der Beitrag 095 – „Vertrauensfragen“ von Ute Frevert erschien zuerst auf Zwischen zwei Deckeln.

Jul 3, 2025 • 1h 15min
094 – „Migration: 22 populäre Mythen“ von Hein de Haas
Wir setzen mal wieder unsere inoffizielle Reihe fort, die folgenden Titel tregen sollte: „Dinge, für die einzelne Menschen verantwortlich gemacht werden, deren Ursache eigentlich im dysfunktionalen Kapitalismus liegt“. Diesmal geht es um das Thema Migration:
In ”How Migration really works” widmet sich Hein de Haas verbreiten Annahmen über Migration und zeigt auf, dass viele davon falsch sind, vor allem weil sie nur eine eingeschränkte Sicht auf die Realitäten der Migration und Migranten haben. Er plädiert dafür, auf Daten zu schauen, statt Mythen zu verbreiten und damit einen realitätsnahen Umgang mit Migration zu erreichen.
Transkript (automatisch erstellt)
Music:[0:00] Music
Nils:[0:15] Hallo und herzlich willkommen zu Episode 94 von Zwischen zwei Deckeln, unserem Sachbuch-Podcast, in dem wir euch alle drei Wochen ein neues Sachbuch vorstellen. Mein Name ist Nils Müller und ich habe heute den Holger mit dabei.
Holger:[0:32] Hallo.
Nils:[0:34] Ja, wenn ihr jetzt überrascht seid, warum ihr schon wieder Holgers Stimme hört, den habt ihr doch erst vor drei Wochen hier gehört mit einem Buch. Wir mussten intern ein bisschen umorganisieren, ausgründen und da war Holger schon in Vorleistung gegangen, was das Lesen angeht und konnte deswegen spontan einspringen, in dieser Episode ein Buch vorzustellen. Bevor wir zu dem Buch kommen, aber Holger, womit beschäftigst du dich gerade?
Holger:[0:56] Ja, ich habe gerade so eine interessante Überlegung, die hatte ich die Tage. Und zwar geht es so ein bisschen, also ich war an einem Ort in der Nähe von Bonn, der früher mal ein Club war. Und das war der Club, wo der erste europäische Auftritt, also außerhalb von Großbritannien, der europäische Auftritt von Queen war. Und dann bin ich gestern irgendwie auf so ein Beispiel für so KI-generierte Musik gestoßen. Und das hat bei mir so ein bisschen diese Überlegung ausgelöst, dass dieser Kontrast doch ganz spannend ist. Weil KI kann ja schon wahnsinnig viel und so KI-generierte Musik klingt auch durchaus schon radiotauglich, wenn da jemand das halbwegs ernsthaft macht. Aber wenn man sich ein bisschen überlegt, wie KI funktioniert, dann wird einem klar, dass das natürlich nicht kreativ ist. Und da, finde ich, ist dann Queen halt so ein schöner Kontrast, dass doch da auch viel Kreatives passiert ist.
Nils:[2:03] Ja, stimmt.
Holger:[2:04] Und dann habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, was heißt das denn für so die Entwicklung der Musik? Also ich glaube, das passiert auch ohne KI, ist das durch Spotify auch schon sehr viel passiert, dass Musik irgendwie so, neue Musik, so eine gewisse Tendenz hat, so ein bisschen Einheitsbrei zu werden, was, glaube ich, durch KI dann noch verstärkt werden wird. Und dann frage ich mich so ein bisschen, wo denn dann die kreativen Impulse herkommen. Und ob dann sozusagen, zwar kann dann jeder irgendwie das, was für ihn der Algorithmus irgendwie optimal findet, kriegen. Aber das ist ja nicht unbedingt, also manche Sachen muss man… Erst mal muss jemand kreativ sein und man das präsentiert bekommen, bevor man auf die Idee kommen kann, dass das interessant wäre. Und das war so ein bisschen eine Überlegung, die ich hatte, wie sich auch solche Dinge wie KI auf Kreativität auswirken werden.
Nils:[3:01] Das ist ein schöner Gedanke. Man sagt ja über Kunst immer, es ist eh nur eine Kombination von Dingen, die es schon gab. Aber KI treibt das halt ins Extrem und macht halt wirklich nur eine Kombination von Dingen, die es schon gab daraus.
Holger:[3:13] Ja, und vor allem macht es die Kombination halt nur auf Arten, wie schon mal kombiniert wurde.
Nils:[3:19] Stimmt, ja.
Holger:[3:20] Also da ist ja Bohemian Rhapsody so ein schönes Beispiel. Das Lied wechselt ja einfach mehrfach den Stil in dem Lied. Und du kannst natürlich sagen, dass diese Elemente gab es wahrscheinlich irgendwie schon in anderer Musik, aber nicht in dieser Kombination. Und KI sucht ja immer nach was ähnlich, nach dem, was am häufigsten auf Dinge folgt. Das heißt, irgendwelche unerwarteten Stilwechsel wirst du in KI-Musik wahrscheinlich nicht bekommen. Das ist das allerletzte.
Nils:[3:48] Was sie machen. Du sagst sie ihm ganz explizit. Ich glaube, dann kriege ich das vielleicht hin, aber nicht aus sich heraus. Das stimmt wohl. Spannend. Ja, ich bin auch tatsächlich gerade so ein bisschen ein kleiner Blogbeitrag, Post, Mastodon-Post und dann mit verbundenem Blogbeitrag, hat mich irgendwie nochmal so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Das war ganz spannend. Wo eine schrieb so nach dem Motto, ich habe gerade meine kompletten Notizen der letzten fünf Jahre gelöscht und ich fühle mich komplett befreit. Ganz so weit würde ich dann doch nicht gehen wollen, aber ihr wisst ja, wenn ihr häufiger reinhört, dass ich da so ein bisschen intensiver unterwegs bin oder wenn ihr auch meine Webseite kennt sogar, dass ich das auch ein bisschen exzessiv betreibe und manchmal denkt man sich auch so, ja, was bringt das eigentlich? Was habe ich hier eigentlich? Und ich schreibe nicht so viel wirklich mehr, als ich eigentlich wollte oder als ich vorher tat oder wie ich eigentlich will. Also vielleicht auch mal weniger oder so. Ja, das sind halt so Dinge, die dann mit so Impulsen auf einmal anfangen zu arbeiten. Zumal ich gerade auch wesentlich lieber Romane lese als Sachbücher oder Schreibe- oder Sachtexte oder so. Aber keine Sorge hier für den Podcast. Sachbücher habe ich weiter auf dem Schirm und werde die auch weiter hierfür lesen.
Holger:[5:03] Ich muss ja zugeben, ich mache mir ja Notizen von so normalen Sachbüchern eigentlich nur, wenn ich weiß, dass ich eine Podcast-Folge dazu aufnehme. Ich habe aber auch irgendwie schon die Überlegung, irgendwie mal so ein bisschen auszumisten, was ich noch so aus dem Studium an Notizen irgendwo rumfliegen habe. Aber ganz ehrlich, also die Sachen davon, die einen irgendwie nochmal interessieren, In Zeiten des Internets und auch von alten Lehrbüchern, die man noch rumstehen hat. Also ob das, was man da dann irgendwie so mitgekritzelt hat, irgendwie nützlicher ist als das, was man in einem Buch nachschlagen kann, wenn man es mal braucht.
Nils:[5:45] Ich habe tatsächlich aus meinem Studium noch ein dreibändiges Lehrbuch am Dachboden stehen, wo ich sagen will, das ist so, das umfasst irgendwie, das ist so das Symbol für mein Soziologiestudium, das werde ich wahrscheinlich behalten, aber auch nicht, um da irgendwie nochmal reinzulesen oder so, sondern einfach so als biografisches Element das im Regal stehen zu haben. Das glaube ich dann schon.
Holger:[6:08] Da habe ich noch ein bisschen mehr hier.
Nils:[6:12] Gut. Aber bevor wir uns in Erinnerung an die alten Zeiten ergehen, wechseln wir doch mal zu dem Buch, das du uns heute mitgebracht hast. Du hast uns nach der Klimaschmutz-Lobby in der letzten Episode bringst du uns gleich das nächste heiße Thema mit. Eigentlich müsste mal jemand hier das Steffen Mauer-Buch Triggerpunkte vorstellen.
Holger:[6:34] Ich glaube, ich habe das irgendwo stehen, aber noch nicht gelesen.
Nils:[6:38] Zumindest klapperst du sie gerade anscheinend mit großer Freude ab in anderen Büchern. Du hast uns mitgebracht How Migration Really Works von Hein der Haas. Das Buch heißt auf Deutsch Migration 22 populäre Mythen und was wirklich hinter ihnen steckt. Und ja, es erschien relativ neu, ist glaube ich erst veröffentlicht 2023, vielleicht nochmal 2024 überarbeitet oder zumindest nochmal neu veröffentlicht worden. Und vielleicht magst du uns ja mal eine kurze Zusammenfassung geben.
Holger:[7:12] In How Migration Really Works widmet sich Heine de Haars verbreiteten Annahmen über Migration und zeigt auf, dass viele davon falsch sind, vor allem weil sie nur eine eingeschränkte Sicht auf die Realitäten der Migration und Migranten haben. Er plädiert dafür, auf Daten zu staunen, statt Mythen zu verbreiten und damit einen realitätsnahen Umgang mit Migration zu erreichen.
Nils:[7:38] Ja, danke dir für den kurzen Überblick. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, warum ich gerade sagte, das ist ein Hot-Button-Topic sozusagen. Dann stell uns doch mal die 22 Mythen oder eine Auswahl daraus vor.
Holger:[7:54] Ja, also ich, wie man an einem deutschen Namen merkt, das Buch ist ein bisschen ähnlich aufgebaut wie die 23 Lügen über den Kapitalismus. Es ist also immer so ein Mythos. Was wird erzählt und wie ist es wirklich? Also ich will jetzt nicht so sehr mich die konkreten Fragen hier immer vorlesen, sondern einfach so ein bisschen Punkte, die sich schon an seiner Reihenfolge so ein bisschen orientieren, bringen, die ich für wichtig halte. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist erstmal, dass er davon ausgeht, also Migration gibt es einfach, also es ist ein Fakt, dass es Migration gibt und man sollte sie halt vor allem erstmal untersuchen und verstehen.
Holger:[8:41] Anstatt sie in irgendwelche ideologischen Kategorien reinzupacken. Und wie auch schon in der kurzen Zusammenfassung, sagt er auch, es werden Mythen über Migration weitergetragen und es fängt schon damit an, dass die Sicht, die wir präsentiert bekommen ist oft sehr einsichtig, ja, also Entschuldigung, sehr einseitig also wir kriegen, In gewisser Weise naheliegend kriegen wir immer nur die Sicht aus der Perspektive von Aufnahmeländern. Das, was oft wegfällt, ist die Sicht aus Perspektive der Ursprungsländer. Was aber auch wegfällt, ist die Sicht aus der Perspektive der Personen, die migrieren.
Holger:[9:32] Und das ist auch ein Punkt, der dann später in dem Buch irgendwie noch so richtig schön kommt. Wenn man mal so ein bisschen aus dieser anderen Sicht kommt, dann versteht man manche Dinge auch durchaus anders. So ein erster Mythos, den er gleich am Anfang zerlegt, ist, dass wir heute so viele Migranten haben.
Nils:[9:53] Okay.
Holger:[9:54] Und das ist halt wieder so der klassische Fehler, wenn man auf absolute Zahlen guckt.
Nils:[10:00] Ah, ja.
Holger:[10:01] Also die Weltbevölkerung heute ist natürlich größer als, zumindest soweit wir das sagen können, jemals zuvor. Das heißt, wenn wir einen gleichbleibenden Anteil der Weltbevölkerung nehmen, wird die absolute Zahl immer größer sein.
Nils:[10:14] Ja.
Holger:[10:15] Und das ist auch im Prinzip das, wenn man sich den Anteil der Migranten an der Weltbevölkerung anguckt, dann ist der eigentlich relativ stabil, zumindest so, sagen wir mal, in den letzten 100 Jahren, nämlich etwa drei Prozent.
Nils:[10:34] Sind das Menschen, die migriert sind oder sind das Menschen, die in diesem Jahr ihre Migration beginnen? Drei Prozent, weißt du das spontan?
Holger:[10:42] Nee, spontan weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Aber wahrscheinlich eher die migriert sind.
Nils:[10:49] Aber das sind doch, das schienen mir jetzt sehr wenig. Egal, müssen wir mal gucken. Das ist eher so 3% brechen neu auf. Das ist ja auch ein bisschen viel, ne? 30 Jahre haben wir alle.
Holger:[10:58] Genau, also deswegen glaube ich, ist es eher insgesamt. Also man muss natürlich auch sehen, dass die sich ungleich verteilen. Also es war ja schon, ich hatte ja auch schon mal das Integrationsparadox vorgestellt, und da habe ich dann ja gelernt, dass Deutschland Einwanderungsland Nummer zwei weltweit ist. Das heißt sozusagen, unsere individuelle Perspektive ist wahrscheinlich stark verzerrt.
Nils:[11:21] Okay, das kann wohl sein, ja.
Holger:[11:25] Es ist aber so, also da hat man jetzt nicht so genaue Zahlen, aber wahrscheinlich war es in der Kolonialzeit, was ja auch nur so 150 Jahre her ist, deutlich höher. Wobei da sicher auch viel Zwang dabei war. Ja, ja. Also, es gibt ja durchaus auch einige Menschengruppen, die nicht freiwillig da leben, woanders leben als ihre Vorfahren, ohne die jetzt alle im Einzelnen aufzuzählen. Um 1900 schätzt man, dass es etwa 9% der Weltbevölkerung migriert waren. Krass. Und das auch sehr ungleich verteilt. Es gibt dann das Beispiel, dass zu dieser Zeit etwa 41 Prozent der Bewohner der britischen Inseln ausgewandert sind und aus Italien sogar um die 50 Prozent. Also für Deutschland ist jetzt keine explizite Zahl, habe ich gerade nicht parat, aber man kann sich auch überlegen. Hier gab es auch große Auswanderungswellen, gerade im 19. Jahrhundert nach der 1848er Revolution und ähnlichem. Und das ist auch schon mal eine Sache, die gerade in Europa die Wahrnehmung sehr stark verzerrt. Wir hatten, wir haben schon lange viel Migration gehabt, auch in Europa.
Nils:[12:49] Schon immer.
Holger:[12:49] Wir waren aber lange ein Ursprungsland.
Nils:[12:52] Ah, okay. Ja, stimmt.
Holger:[12:54] Weil die Leute woanders hin wollten, weil es ihnen hier nicht gut ging. Die wollten halt in die USA oder auch nach Südamerika, weil sie da nach Freiheit gesucht haben. Teilweise auch in andere Kolonialländer, weil sie da irgendwie… Der Meinung waren, irgendwie Geschäfte machen zu können und ähnliches. Und das hat dazu geführt, dass relativ viele Europäer aus Europa rausgewandert sind.
Nils:[13:17] Ja, stimmt.
Holger:[13:18] Heute haben wir in Europa bessere Lebensbedingungen, wir haben bessere Sozialsysteme, wir haben stärkere Wirtschaft. Entsprechend sind wir jetzt ein Aufnahmeländer geworden. Nicht nur Deutschland, sondern insgesamt sind wir Aufnahmeländer geworden. Also das ist schon mal das Erste, was man sich klar machen muss. Unsere Wahrnehmung ist halt einfach verzerrt, weil wir in der Weltregion sind, die ihre Rolle stark gewechselt hat.
Nils:[13:46] Ah, okay, ja, macht Sinn.
Holger:[13:48] Aber wenn man es jetzt statistisch global betrachtet und so ein bisschen auf sozusagen Durchschnittszahlen geht, dann haben sich Sachen gar nicht so stark verändert. Auch wenn es bei uns vor Ort sich vielleicht stark verändert hat.
Nils:[14:01] Okay.
Holger:[14:03] Es ist auch so, wenn man sich insgesamt die Migration anguckt, passiert viel Migration und das ist vielleicht auch, ich glaube diese drei Prozent sind zwischenstaatliche Migration, die wir eben hatten. Die meiste Migration passiert innerhalb von Staaten. Und das ist was, was man in der Diskussion auch gerne ausblendet. Also ich kann sagen, ich lebe jetzt nicht da, wo ich aufgewachsen bin. Und ich bin nicht da aufgewachsen, wo ich geboren bin. Aber es war alles in Deutschland. Deswegen würden mich die meisten Deutschen nicht irgendwie als Migranten bezeichnen. In der strikten Definition des Wortes ist es aber so. Meine Eltern sind umgezogen, da war ich anderthalb und auch durchaus einige hundert Kilometer weiter. Ich bin nicht ganz so weit umgezogen, aber ich lebe auch 80 Kilometer weit weg von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin.
Nils:[15:01] Ja, stimmt.
Holger:[15:02] Das ist auch eine Form von Migration. Und diese Schocks bei der Migration, die man hat, die sind oft größer, wenn man in einem Land auch zwischen Stadt und Land wechselt, also meistens eher vom Land in die Stadt, ist der Schock meistens größer, als wenn man jetzt zwischen Ländern, sagen wir mal, von der Stadt zu der Stadt oder vom Land zum Land wechselt. Das ist also was, was man sich dann klar machen muss. Klar, wenn es Sprachbarrieren gibt, ist es noch ein bisschen anders. Aber auch da, je nachdem, wenn ich jetzt in Deutschland in bestimmte Gegenden in Bayern ziehe und die Leute da irgendwie nicht wollen, dass ich sie verstehe, dann werde ich die auch nicht verstehen.
Nils:[15:54] Zumindest in der gesprochenen Sprache, ja.
Holger:[15:57] Also das ist halt auch was, was man sich klar machen kann. Es ist dann natürlich auch, wenn ich in einem kleinen Land bin, dann ist es so, wenn ich jetzt mein Lebensstil verbessern und umziehen will, je kleiner das Land ist, aus dem ich komme, desto eher muss ich in ein anderes Land. Nur ist es so, dass jetzt bei den Luxemburgern redet halt niemand darüber, weil, aus verschiedensten Gründen, aber das sind auch Faktoren, die da reinspielen können. Und man muss einfach sagen, die meisten bleiben lieber zu Hause oder in der Nähe von zu Hause. Also die meisten Migrationsbewegungen gehen halt entweder im eigenen Land oder nur in Nachbarländer und diese weiten über Kontinente überstreitenden Bewegungen, die hat man eigentlich nur einen sehr geringen Anteil.
Nils:[16:49] Ja.
Holger:[16:50] Und es ist auch so, das ist jetzt ein bisschen, ich würde es als eine These beschreiben, die er dann auch aufstellt, die aber durchaus auch mit gewissen Daten untermauert ist, dass moderne Technik es eigentlich möglich macht, dass man auch ohne zu migrieren bessere Möglichkeiten hat.
Nils:[17:10] Ja.
Holger:[17:11] Also so wie wir jetzt hier online gerade einen Podcast aufnehmen können und also ich zumindest auch… Auch viel Homeoffice mache. Und dann ist es natürlich so, je mehr Homeoffice man macht, desto weniger nötig wird es, dann dorthin umzuziehen, wo man arbeitet. Man hat mehr Möglichkeiten, um da zu bleiben, wo man ist. Und das heißt natürlich auch, dass das Faktoren sind, die Migration eigentlich weniger nötig machen für solche Tätigkeiten, wo das möglich ist.
Nils:[17:44] Und wenn es eben keine Flucht ist, sondern eine gewählte Migration, nennen wir es mal so.
Holger:[17:50] Ja, genau. Aber es ist auch so, es sind so circa sieben bis zwölf Prozent der Migranten sind Flüchtlinge.
Nils:[18:00] Okay, das ist nicht viel.
Holger:[18:02] Also der Großteil der Migranten migriert freiwillig. Ja. Also das muss man auch bedenken. Also heute, ich springe jetzt einfach mal kurz dahin. Heute kommt uns das ein bisschen wieder mehr vor mit den Flüchtlingen das liegt aber daran, dass wir eine gewisse ruhige Zeit, hier in Europa hatten wir hatten Anfang der 90er, da kamen viele Flüchtlinge, da gab es halt auch Dinge wie den Kosovo, den Jugoslawienkrieg dann Ende der 90er Kosovo und das waren Dinge, wo dann Flüchtlinge gekommen sind Und ich habe ja gesagt, die meisten Menschen bleiben irgendwo in der Nähe.
Nils:[18:50] Ja.
Holger:[18:52] Und wenn bei uns in der Nähe halt wenig Konflikte waren, dann sind auch weniger Leute gekommen.
Nils:[18:56] Das ist fair, ja.
Holger:[18:58] Und jetzt haben wir wieder mehr auch bei uns näher dran. Das heißt, im Moment haben wir wieder etwas mehr Migranten. Das heißt aber nicht, dass es weltweit mehr gibt, sondern nur, dass es weltweit mehr Flüchtlinge gibt. Das heißt, nur die Flüchtlinge, die es jetzt gerade gibt, Davon sind mehr näher an uns dran.
Nils:[19:15] Ja, okay, macht Sinn.
Holger:[19:18] Genau, und es gibt auch die Asyl, also wenn man jetzt sagt, wir haben sehr viele, ich tue mich schon mit der Formulierung schwer, also sehr viele unberechtigt Asylbeantragende, was ja dann wieder die Kriegsflüchtlinge im Grunde sind, dann kann man sagen, naja, wenn man sich jetzt anguckt, wie hoch ist denn die Ablehnungsquote von Asylanträgen in Europa, Da muss man sagen, naja, also eigentlich ist die relativ stabil und die Mehrheit der Asylanträge wird positiv beschieden. Also den Menschen wird Asyl gewährt in Europa. Das heißt, wenn jetzt irgendwie behauptet wird, dass da so viele sich einschleichen wollen, dann muss man sagen, das passt halt nicht zu der Realität, die man an Daten prüfen kann. Ah ja. Sondern man muss sagen, naja, also wir nehmen nicht alle an, aber wir nehmen die Mehrheit an und das hat sich eigentlich, hat sich das auch nicht über die Zeit groß geändert. Ja. Sondern das, was wir haben, ist, dass die Medien das im Grunde halt irgendwie hochbauschen.
Nils:[20:24] Ja. Kennen wir ja irgendwo her.
Holger:[20:26] Genau. Und nochmal der Punkt, das, was zu Asylsuchenden führt, sind halt vor allem Kriege. Insgesamt wird die Welt friedlicher, das heißt, das führt eigentlich zu weniger Kriegsflüchtlingen.
Nils:[20:41] Okay, zeigt sich das auch in den Zahlen? Also hat der da Zahlen zu?
Holger:[20:49] Jein. Also das ist so ein bisschen das Problem ist, es gibt vom UNHCR, gibt es Zahlen. Das Problem ist, dass sich da die Datenbasis geändert hat über die Zeit.
Nils:[21:01] Ah, wie so oft.
Holger:[21:04] Und wenn du nur auf diese Zahlen guckst, dann ist es so, dass du glaube ich sogar einen Anstieg siehst. Allerdings war da, als die angefangen haben, ich glaube in den 60ern, waren da… Sehr viel weniger Länder drin als heute.
Nils:[21:21] Ah, okay. Ja.
Holger:[21:22] Und dann ist natürlich, kannst du das halt eigentlich nicht wirklich vergleichen. Und also er ist der Meinung, dass es eher andersrum läuft.
Nils:[21:33] Okay.
Holger:[21:33] Ja, aber das, was er vor allem tut, ist, dass er halt erst mal sagt, warum denn die Zahl, die da gerne gezeigt wird, eigentlich falsch ist.
Nils:[21:40] Ja, ist ja auch schon mal ein Schritt, ne?
Holger:[21:43] Das heißt, für mich klingt es eigentlich auch logisch, Weil wenn man jetzt mal zurückgeht, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie viele Menschen sich da so hin und her bewegt haben als Folge dessen. Allein wenn du überlegst, wie viele deutschstämmige, oder weiß ich nicht, wie man das jetzt richtig ausdrückt, also deutsche Minderheitsbevölkerung aus Osteuropa rausgejagt wurden. Und das ist ja nur ein ganz kleiner Anteil von dem, was da alles in Bewegung war. Ja, stimmt. Also da ist ja das, wo wir uns hier drüber aufregen mit Flüchtlingen, ist ja lächerlich.
Nils:[22:25] Ja, also alleine als Zahl ist das lächerlich.
Holger:[22:28] Ja, ja, genau. Und obwohl die Weltbevölkerung inzwischen größer ist. Also das muss man sich auch klar machen. Ja, aber die Frage ist denn, Was führt denn bei der Mehrheit der Leute eigentlich zur Migration? Weil wie gesagt, die Flüchtlinge machen ja irgendwie, sagen wir mal so grob 10% aus Das heißt aber 90% sind keine Flüchtlinge, Und da muss man dann sagen, die meisten der Einwanderer reisen legal in die Länder ein, wo sie hinwollen, Kleines Side-Note, das kommt dann irgendwo später im Buch auch. Das kann durchaus auch sein, dass die mit sowas wie einem Touristenvisum einreisen und dann quasi dadurch zu illegalen Einwanderern werden, dass die halt nicht rechtzeitig das Land verlassen.
Nils:[23:22] Ja, aber sie sind dann trotzdem legal eingereist in der Statistik.
Holger:[23:24] Genau, aber sie wären dann sozusagen unter Umständen schon illegale Einwanderer, aber trotzdem sind die Zahlen, also ich glaube auch wenn du das rausrechnest, du wirst immer dahin kommen, dass die Mehrzahl der Einwanderer legal da ist.
Holger:[23:41] Und es gibt da auch wieder so eine schöne Fehlwahrnehmung es gibt halt bestimmte Ereignisse wo es Peaks gibt, wo besonders viele Menschen einwandern, ja, eins kann man sich überlegen, ist sowas wie wie ein Krieg eine Naturkatastrophe, solche Dinge, aber auch ein Wirtschaftsboom okay wenn ein Wirtschaftsboom ist, dann braucht man nämlich Arbeitskräfte, und dann wirbt man auch gerne im Ausland Arbeitskräfte an. Ja, und das ist ein sehr wichtiger Faktor in der Migration. Also A, Migration generell wegen Arbeit und B, auch bewusste Anwerbung. Was dann passiert, wenn du schon bestimmte Einwanderergruppen im Land hast, dann gibt es auch quasi Anwerbung, die ist dann aber mehr so Mundpropaganda. Also kann man sich überlegen, wenn man jetzt jemanden hat, der meinetwegen in Deutschland lebt, der aus einem anderen Land eingewandert ist und der sieht, ah ja, hier gibt es gerade viele Jobs, dann erzählt der seinen Freunden und Verwandten, mit denen er noch Kontakt hat, ah ja, hier gibt es gerade in der und der Branche viele Jobs und dann gibt es da vielleicht auch Leute, die sagen, ach ja, das wäre ja vielleicht das für mich und die dann, ne?
Holger:[24:57] Was dann in der und solche Peaks werden dann auch in den Medien berichtet, was in der Regel nicht berichtet wird ist, dass auf so einen Peak, wo besonders viele einwandern, dann meistens auch eine Phase kommt, wo besonders wenig einwandern ah ok, also wenn die Naturkatastrophe vorbei ist, dann kommt keiner mehr nach, vielleicht wandern ein paar zurück, wenn der Wirtschaftsboom vorbei ist, werden weniger Stellen das heißt, dann ist die Mundpropaganda eher kommt nicht hierher, dann kommen auch weniger Leute erstmal hierher und es wird auch nicht mehr aktiv angeworben und vielleicht gehen auch einige zurück also das heißt da ist auch wieder eine sehr, eine sehr einseitige Wahrnehmung, Sekunde, Ah ja, genau. Dann finde ich auch sehr schön, es gibt dann immer diese, ich glaube, das ist dann teilweise auch eine positive Darstellung, die dann sagt, die Einwanderung macht uns ja irgendwie diverser, bringt uns so ein bisschen mehr Multikulti rein. Also es gibt Menschen, die finden das gut, es gibt Menschen, die finden das schlecht. Man kann aber sagen, das ist gar nicht so klar, dass wir heute diverser sind als meinetwegen vor 300 Jahren.
Nils:[26:14] Ah, auch schön.
Holger:[26:16] Also vor 300 Jahren war die Gesellschaft auch irgendwie ein bisschen zersplitterter, als wir uns das so denken. Da waren halt die Gruppen, die sich unterschieden haben, andere. Also zum einen gab es natürlich auch schon Einwanderer. Aber dann, also ich kann jetzt sagen, noch vor 70 Jahren war es ein Problem, wenn ein Katholik und ein Protestant heiraten wollten.
Nils:[26:38] Ja, ein Katholik und ein Protestant sowieso.
Holger:[26:41] Ja, oder eine Person katholischen und eine Person protestantischen Glaubens heiraten, das war ein Riesenproblem. Und mit Menschen jüdischen Glaubens, die haben wir da noch gar nicht drin, die es da ja auch gab. Und das ist jetzt nur in Deutschland. Und auch da gab es Einwanderer. Das waren halt andere Gruppen. Also das heißt, dass das heute so viel multikultureller ist, ist gar nicht klar.
Nils:[27:10] Okay.
Holger:[27:11] Sondern was man auch beobachten kann, ist, dass die Einwanderer sich in der Regel in so zwei, drei Generationen immer mehr assimilieren. Das war das schöne Beispiel in dem Buch, dass wenn man sich anguckt, welche Namen den Kindern gegeben werden, so in der ersten Generation sind das noch Namen, die sind sehr so am Herkunftsland orientiert. In der zweiten und dritten Generation ist das gar nicht mehr so klar.
Nils:[27:36] Okay, spannend.
Holger:[27:39] Und das zeigt dann, dass immer eine stärkere Assimilation dann auch passiert. Und dass die Gruppen auch weniger als fremd wahrgenommen werden. Also so das Beispiel, dass auch in den USA Iren, Italiener, Deutsche früher quasi nicht als Teil der weißen Mehrheitsbevölkerung angesehen wurden, wäre dann nur eins davon. Man kann sich auch hier mal überlegen, wenn man irgendwie im Ruhrpott unterwegs ist oder im Telefonbuch guckt, wie viele Menschen haben da Nachnamen, die höchstwahrscheinlich polnisch sind, wo aber jetzt niemand auf die Idee käme, dem zu sagen, hey du Pole.
Nils:[28:20] Ja, klar.
Holger:[28:22] Also, weil die sind dann halt im 19. Jahrhundert irgendwie gekommen, um in Fabriken zu arbeiten. Ja, und da wird jetzt keiner mehr so weit zurückgehen.
Nils:[28:33] Gehört jetzt halt dazu, ne?
Holger:[28:35] Ja, und das zeigt sich teilweise auch bei, ich finde auch das Wort ist ein bisschen kritisch, aber ich benutze es jetzt mal bei so Ghettoisierung, wo du halt bestimmte Stadtviertel hast, wo dann halt Einwanderer sich sammeln, wo du auch das Phänomen hast dass das sozusagen in dem selben Teil der Stadt wenn du so in die Geschichte zurückkommst auch schon andere, die schon von anderen, Einwanderergruppen dominiert waren die dann aber je mehr sie sich integriert haben, halt mehr sozusagen da weggezogen sind, verteilt haben, mehr vermischt haben mit dem Rest der Bevölkerung, und dann kam halt die nächste Einwanderergruppe dahin weil das wahrscheinlich immer noch eine relativ günstige Gegend war und dann hast du hast du solche Prozesse. Genau, also das ist also schon mal zeigt schon mal, dass ich, dass das gar nicht so klar ist, dass wir da irgendwie eine stärkere stärker Multikulti, wie auch immer man es nennen will, haben als früher. Wir haben halt irgendwie nur vielleicht ein verzerrtes Bild darüber, wie es früher war.
Nils:[29:43] Okay, ja, ist auch gut. Auch gut, sich mal vor Augen zu halten.
Holger:[29:46] Ja.
Nils:[29:47] Oder vielleicht ist es auch einfach so, dass es tatsächlich in so viel integrierter ist, als dass man mehr davon mitbekommt. Es gibt ja auch bei Migration, gerade wenn du größere Migrationsgruppen hast, gibt es ja diese zwei Ideen. Einmal, dass du es strategisch auch so für dich planst, dass du halbwegs, dass du sagst, migrantische Gruppen kriegen sozusagen einen Stadtteil. Dann hast du sowas wie Chinatown oder Little Italy oder so, wo sich das halt konzentriert, wo das auch eine bewusste Strategie ist, wo man die aber auch sozusagen einfach ignorieren kann. Oder du hast dich halt, ich sag jetzt mal, dezentral überall in der Gesellschaft, wo man sie eben auch ständig sieht und wahrnimmt. Dann wirkt das natürlich auch so, als wären das viel mehr, obwohl es gar nicht mehr sind.
Holger:[30:30] Ja, du hast mir jetzt aber gerade eine Öffnung gemacht, wo ich eh gerade hinabbiegen wollte.
Nils:[30:34] Ja, sehr schön.
Holger:[30:35] Du hast da nämlich jetzt eine Sache, also du hast das jetzt wieder aus Sicht, ich sag mal, eines Stadtplaners betrachtet. Ja, genau. Es ist natürlich auch, besteht auch die Möglichkeit, aus der Sicht von den Einwandernden zu gucken.
Nils:[30:49] Definitiv.
Holger:[30:50] Und da gibt es natürlich auch Einwanderer, die dann sagen, es ist ja eigentlich ganz nett, wenn ich in einer Gegend bin, wo andere mit einem ähnlichen Hintergrund sind.
Nils:[30:56] Ganz klar, sicher.
Holger:[30:57] Damit ich irgendwie noch bestimmte Möglichkeiten aus der Heimat habe. Und sei es nur, dass ich meine Sprache spreche. Klar. Sei es, dass ich meine Religion da einfacher ausüben kann. Also früher weiß ich nicht, wie stark das war, aber heute sicher auch, dass es da den Supermarkt gibt, der Sachen aus meinem Ursprungsland importiert.
Nils:[31:19] Alles klar.
Holger:[31:20] Und das kann natürlich dazu führen, dass die Menschen, ohne dass da irgendjemand das groß plant.
Nils:[31:25] Sich bewusst irgendwo ansammeln. Definitiv. Das ist sogar wahrscheinlich der Hauptgrund dafür. Also ich meine, planen kann man immer viel, aber was dann wirklich passiert?
Holger:[31:34] Ja, also wo man jetzt einschränken muss, das betrifft uns hier in Europa jetzt nicht so direkt, Aber in den USA gab es durchaus eine Politik, die die farbigen US-Bürger in bestimmte Gegenden und auch schlechte Gegenden gezwungen hat. Also das muss man sagen, das ist einfach ein Fakt. Aber das ist halt dann davon auszugehen, dass das überall so ist, wo sich bestimmte Gruppen sammeln, das ist einfach falsch.
Nils:[32:03] Ja, das stimmt.
Holger:[32:04] Und auch in selbst in Europa, selbst in Gegenden, wo man denkt, ach da ist das ganz extrem, ist das wenn man sich die Daten anguckt, gar nicht so extrem wie man denkt. Also ein Beispiel, das er hat, sind hier die Vororte von Paris, die Bonlieues, heißen sie glaube ich? Bonlieues. Ja, wo diese Vermischung also wo mehr Vermischung ist, als man denken würde, wenn man so auf die Klischees guckt.
Nils:[32:28] Okay.
Holger:[32:29] Wo es sicher auch ein paar Brennpunkte gibt, aber wo es nicht so ist, dass das überall da riesige Trennung nach Herkunft gibt.
Nils:[32:40] Und oft ist das ja dann weniger eine Herkunftstrennung als eine Armutssegregation.
Holger:[32:47] Genau, und das ist auch so ein bisschen ein Punkt, der immer mal wieder durchkommt, dass an vielen Stellen es eigentlich gar nicht so viel Sinn ergibt, primär auf die Herkunft zu gucken, sondern eigentlich primär auf die soziale Herkunft, also schon auf die nationale Herkunft, sondern auf die soziale Herkunft. Das ist nämlich auch zum Beispiel eine Sache, wenn man jetzt so ein bisschen sich wieder die Migranten anguckt, wer denn migriert, dass das oft gar nicht so, also wir nehmen jetzt mal die Flüchtlinge raus, weil A sind die nicht die Mehrheit und B haben die natürlich ganz andere Hintergründe noch. Aber wenn man sich jetzt die anderen, den Rest der Migranten anguckt, dann sind das oft gar nicht so die richtig armen. Okay, stimmt. Kann man sich auch überlegen. Also wenn du jetzt jemanden hast, der eine etwas weitere Strecke zurücklegen muss, dann muss der sich das auch erstmal leisten können.
Nils:[33:42] Ja, fair.
Holger:[33:43] Das heißt, man hat den erstmal etwas konterintuitiven Effekt, dass es sein kann, dass in einem Land, wenn der Wohlstand steigt, auch die Auswanderung steigt.
Nils:[33:58] Okay.
Holger:[34:00] Weil es dann mehr Menschen gibt, die es sich leisten können auszuwandern. Ah, okay, ja. Und da muss man gucken, warum machen die das? Die machen das dann, wenn ihnen in dem Land nicht die richtigen Möglichkeiten geboten werden. Ja. Also wenn sie halt sagen, im Ausland habe ich bessere Perspektiven, sei es, dass ich eine Ausbildung gemacht habe und in meinem Land gibt es entweder nicht genug Stellen für diese Ausbildung oder die werden nicht gut genug bezahlt. Und dann sage ich, ich kann es mir halt leisten, in ein anderes Land auszuwandern, ich habe eine Qualifikation und dann kann ich zum Beispiel auch etwas weiter auswandern, als nur in das nächste Nachbarland. Ja, klar. Und da kann es dann auch sein, dass selbst wenn sie jetzt zum Beispiel nach Europa kommen und hier Arbeitsbedingungen haben, wo wir sagen würden, die sind schlecht im Vergleich zum Beispiel des Landes, kann es aber sein, dass sie auch herkommen und sagen, naja, ich arbeite jetzt hier unter diesen schlechten Bedingungen für eine bestimmte Zeit, verdiene da Geld, mache da Erfahrung und kann das nutzen, um dann wieder in mein Ursprungsland zurückzugehen und da wird es mir dann super gehen.
Nils:[35:12] Ja, klar.
Holger:[35:14] So was kann dann auch wieder Impulse in die Ursprungsländer bringen. Also da gibt es zum Beispiel das Beispiel, dass so diese IT-Industrie in Indien, dass das sehr stark gewachsen ist, weil es halt viele Inder gab, die aus den USA zurückgekommen sind.
Nils:[35:34] Ja klar, macht Sinn.
Holger:[35:35] Das heißt, es kann auch für das Ursprungsland positiv sein über die Zeit, in dem Moment nicht unbedingt. Aber auch, dass es dieser Brain Drain, das ist ja auch so eine Aussage, die gemacht wird, man nimmt den Ursprungsländern die ganze Intelligenz weg. Das ist auch nicht so klar, dass das so ist. Weil zum einen, wenn die gute Perspektiven hätten, würden sie wahrscheinlich gar nicht auswandern. Das ist auch ein Problem im Ursprungsland, dass den Leuten die Perspektive nicht gegeben wird. Und wie gesagt, und es gibt dann zwei mögliche Effekte. Zum einen kommen die vielleicht auch wieder. Und was aber, was man auch beobachten kann, wenn es genug gibt, die auswandern und in den anderen Ländern irgendwie erfolgreich sind, dann gibt es mehr Motivation für die, die da sind, sich um eine gute Bildung zu kümmern.
Nils:[36:25] Ja, klar, macht auch Sinn.
Holger:[36:27] Weil du, weil dann weißt du, wofür es gut ist. Klar, das ist ein Vorbild. Genau, das heißt, es ist wieder so ein Beispiel, wo die Effekte sind, halt nicht diese einfachen Effekte, die man sich immer so erstmal so, ich sag mal naiv überlegt und die naiv auch irgendwie Sinn ergeben, aber wenn man genauer hinguckt, dann ist es so, oh, funktioniert ja ganz anders.
Nils:[36:48] Oder zumindest komplexer, also viel schichtiger.
Holger:[36:52] Ja, ja. Und genauso ist es auch, wenn man jetzt sagt, ob Einwanderer, die in Land kommen, machen da, nehmen da Jobs weg, drücken Preise und so weiter. Dann muss man sagen, dass es im Mittel nicht so ist. Weil zum einen werden Migranten vor allem dann angeworben, wenn die Wirtschaft gut läuft. Ja, sonst würden sie auch nicht kommen. Ja, klar. Sie füllen offene Jobs, das heißt, welche, wo man anscheinend Probleme hatte, sie zu füllen. Und weil sie vor allem kommen, wenn Wachstum herrscht, kommen sie auch in der Zeit, wo viele offene Ställe vorhanden sind. Und das heißt, sie nehmen gar nicht in dem Sinne so viele Jobs weg, weil sie ja vor allem Jobs besetzen, die im Land nicht gefüllt werden können.
Nils:[37:50] Ja, macht Sinn. Was ja auch teilweise gesetzlich quasi vorgegeben ist.
Holger:[37:56] Gut, also es hängt immer ein bisschen vom Land ab.
Nils:[37:58] Ja, natürlich, ja, darüber will ich hinaus. Also das wird ja auch politisch so gesteuert zum Teil zumindest versucht, genau diesen Effekt zu erzielen.
Holger:[38:06] Sie sind auch bereit, schlechter bezahlte Jobs zu übernehmen, wo man im Einwanderungsland, äh, Entschuldigung, doch in dem Land, in das sie einwandern, vielleicht gar nicht genug Leute findet. Da gibt es dieses schöne Beispiel aus der Corona-Zeit. Erinnert sich vielleicht der eine oder andere noch dran. Da gab es ja das Problem irgendwie, dass man nicht genug Leute hatte zum Pflücken auf den Feldern in Deutschland. Und dann hat man versucht, Deutsche dazu zu animieren. Und das Resultat des Ganzen war, dass man die Leute dann doch irgendwo aus Osteuropa eingeflogen hat, weil man im Inland halt nicht genug Leute dafür gefunden hat.
Nils:[38:46] Die hat es länger als eine Stunde machen wollen.
Holger:[38:49] Ja, und das sind auch Migranten. Selbst wenn die nicht dauerhaft hier leben, sind das trotzdem Arbeitsmigranten. Auch wenn die vielleicht nur für einen Monat kommen und dann wieder in die Heimat zurück. Aber das ist nebenbei auch ein Punkt in der Migration, da komme ich später noch zu, dass man guckt immer nur auf die, die reinkommen. Man guckt nie, wie viele gehen raus. Und das führt auch zu ziemlich dummer Politik, wie wir gleich noch lernen werden. Genau, aber man hat auch untersucht, was für Auswirkungen solche Einwanderungsschocks auf Löhne haben, wo plötzlich viele Einwanderer kommen. Und die Auswirkungen sind relativ gering.
Nils:[39:37] Okay.
Holger:[39:38] Und auch der Einfluss auf die Zahl der offenen Stellen ist relativ gering. Das kommt zum einen daher, dass Einwanderer vor allem in bestimmten Bereichen arbeiten. Sie erhöhen aber auch, wenn sie arbeiten, die Wirtschaftsleistung. Und dadurch werden unter Umständen auch wieder neue Jobs geschaffen, sodass der Gesamteffekt eigentlich relativ gering ist.
Nils:[40:00] Ja, macht Sinn.
Holger:[40:02] Auf der anderen Seite sind viele Einwanderer auch sehr innovativ. Viele gründen Firmen oder auch… Also Gründen allgemein. Ich glaube, das ist auch, wenn man so in einer deutschen Großstadt mal ein bisschen rumläuft, wird man auch viele Läden finden, die von Einwanderern betrieben werden. Und sei es das klassische Futter, was da irgendwie organisiert wird oder jetzt Shisha-Bars oder weiß ich nicht was. Ich glaube, jeder wird da tausende Beispiele finden.
Nils:[40:35] Ich glaube, wenn du in die Gastronomie schaust, also wenn man mal verfolgt, so neue Restaurants eröffnet und das müssen ja noch nicht mal dann Restaurants der eigenen Herkunft sein sozusagen. Ich glaube, das ist mittlerweile ein Geschäft, ein Bereich, wo sich da einfach ganz viele Möglichkeiten bieten.
Holger:[40:51] Ja, und da ist halt auch eher so ein bisschen die Offenheit bei Einwanderern, dass sie das dann machen und dann auch einen harten Job machen, einfach weil sie für sich dadurch immer noch eine bessere Perspektive sehen.
Nils:[41:06] Klar.
Holger:[41:07] Und ich habe mir das hier so ein bisschen in meinen Notizen etwas plakativ zu diesem Themenbereich hingeschrieben, dass die Einwanderer werden gern als Sündenböcke für die Folgen von neoliberaler Politik genommen.
Nils:[41:21] Ja, klar.
Holger:[41:22] Also die Zahlen geben es halt nicht herzusagen. Die Einwanderer sind schuld, dass es irgendwie die Löhne sinken, dass es nicht genug Stellen gibt oder dass man keinen günstigen Wohnraum findet. Aber das sind alles politische Entscheidungen gewesen, die mit den Einwanderern überhaupt nichts zu tun haben. Wo sie jetzt aber irgendwie gerne als Sündenböcke genommen werden. Also muss man sich halt nochmal klar machen, dass die Zahlen geben das absolut nicht her, dass das der Fall ist.
Nils:[41:56] Gut zu wissen.
Holger:[41:59] Genau, also jetzt nochmal zum Beispiel, wenn man sich anguckt, wie ist es denn mit dem Sozialsystem, beziehungsweise mit den Staatsfinanzen, wenn man da, je nachdem, wie man versucht, das zu analysieren, gibt es mal positive oder mal negative Effekte, aber die sind immer ziemlich klein.
Nils:[42:20] Okay.
Holger:[42:21] Also egal, ob jemand jetzt sagt, es ist gut, dass wir Einwanderer in unser Sozialsystem haben oder es ist schlecht. Du wirst immer irgendwie eine Studie finden, die dein Argument untermauert, aber das sind immer so Effekte im einstelligen Prozentbereich. Das heißt irgendwie, es ist weder das Riesenproblem noch die Riesenlösung. Ja, gut. Genauso muss man sagen, wenn gesagt wird, wir haben zu wenig Wohnraum, das liegt an den Einwanderern, dann muss man sagen, naja, eigentlich liegt es daran, dass man halt zu wenig Wohnungen gebaut hat und da sind auch die Quoten, also sozusagen wie viel man baut, auch gerade wie viel sozialer Wohnungsbau gemacht wird, sind einen einfach runtergegangen. Hätte man noch dieselben Quoten wie vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren, dann gäbe es das Problem nicht auch mit Einwanderern, weil da hat man einfach noch deutlich mehr gebaut und dann war einfach deutlich mehr an Wohnungen da.
Holger:[43:15] Genau. Wir hatten ja eben schon mal den Punkt, dass vieles eigentlich mehr von der sozialen Klasse abhängt, als von der, ich nenne es jetzt mal nationalen Herkunft. Und das zeigt sich auch beim Bildungserfolg. Ja, und das heißt, wenn man aus einer Familie kommt, die schon gut gebildet ist, egal wo die herstammt, dann hat man eine höhere Chance auf Bildungserfolge. Ja. Ja. Und das ist auch wieder eine Frage des Integrationserfolges. Der hängt nämlich davon ab, wie viele Chancen haben die Einwanderer. Und das hält ab von Bildung, das hängt ab davon, hat man Arbeit und wie gut ist die Arbeit. Und das hängt davon ab, hat man irgendwie einen vernünftigen Wohnraum. Also, die einzige Integrationspolitik, wo man wirklich, das sind ja alles Punkte, die sind gar nicht so direkte Integrationspolitik, die eine integrationspolitische Maßnahme, die wirklich einen messbaren Effekt hat, möchtest du mal raten, was das ist?
Nils:[44:20] Arbeitsgenehmigung.
Holger:[44:22] Nee.
Nils:[44:23] Sprachkurse.
Holger:[44:25] Nee.
Nils:[44:25] Dann weiß ich es nicht.
Holger:[44:27] Wie einfach ist es, Staatsbürger zu werden?
Nils:[44:31] Okay.
Holger:[44:33] Also das ist das Einzige, wo es einen messbaren Effekt gibt. Wenn es einfacher ist, Staatsbürger zu werden, dann hat das einen positiven Effekt.
Nils:[44:40] Lustig, genau das, was wir gerade wieder zurückdrehen.
Holger:[44:42] Genau. Also die Kurzaussage ist, das, was bei uns in den Medien hier immer propagiert wird mit Einwanderungspolitik, ist halt genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich machen sollte.
Nils:[44:54] Das überrascht mich nicht. Bei konservativen Regierungen überrascht mich das einfach nicht.
Holger:[45:00] Es gibt ja auch dieses schöne Klischee, dass Einwanderer halt irgendwie zu mehr Verbrechen führen. Das ist eigentlich nicht klar. Also wenn man für soziale Faktoren so rausrechnet, sprich junge Männer sind gewalttätiger als alte Damen. Wenn man das rausrechnet, dann sind Einwanderer sogar oft gesetzestreuer. Und wenn sie illegal im Land sind, sind sie oft sogar besonders gesetzestreu, weil sie halt möglichst wenig mit dem Gesetz in Konflikt kommen wollen. Und gerade auch, wenn es solche Einwandererviertel gibt, dann gibt es sogar mehr soziale Kontrolle, die dann noch weiter einschränkt, wie viel die Leute machen. Klar, man muss das dann relativieren in dem Sinne, dass man sagt, klar, wenn ich jetzt besonders viele junge Männer an Einwanderern habe, was oft so ist. Junge Männer, egal wo sie herkommen, neigen halt einfach mehr dazu, Probleme zu verursachen.
Nils:[46:03] Ja, definitiv.
Holger:[46:04] Ich war auch mal ein junger Mann, ich darf das dann sagen. Aber das hat halt nichts mit der Herkunft zu tun, sondern einfach damit, dass es junge Männer sind.
Nils:[46:14] Ja, und dann vielleicht auch mit der Alters- und der Herkunftsverteilung. Also ich meine,
Holger:[46:19] Das ist auch so ein Thema demografischer Alterung. Genau, wenn du halt einfach, sehr viel mehr junge Männer hast, die Migrationshintergrund haben, dann steigt auch der Anteil der Verbrechen, die junge Männer mit Migrationshintergrund begehen. Aber wenn du jetzt sozusagen einfach nur guckst, sind diese jungen Männer denn, machen die mehr Unsinn als junge Männer mit einer anderen Herkunft, dann kommst du halt dahin, dass es nicht so ist.
Nils:[46:44] Ja, genau.
Holger:[46:44] Wobei es allerdings gewisse verzerrende Faktoren gibt, durch bestimmte Stereotypen, durch so Sachen wie Racial Profiling, Deswegen werden diese Leute aber dann unter Umständen stärker beobachtet und werden auch, da wird eher vom Gesetz durchgegriffen bei denselben Dingen.
Nils:[47:01] Ja, und es gibt dann noch die Straftaten, die nur sie begehen können. Sowas wie Aufenthaltsrechtsdelikte und so.
Holger:[47:10] Genau, aber die habe ich jetzt gar nicht mal reingenommen. Aber genau, das ist auch eine Verzerrung, die wir haben und auch durch die Medien. Und eigentlich ist es so, wenn man sich die Verbrechenstatistiken mal so einfach insgesamt anguckt, dann geht das Verbrechen einfach zurück. Und auch schon, ich glaube auch, das ist auch schon ein ziemlich lange vorherrschender Trend. Das heißt, da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein, was in den Medien da so erzählt wird.
Nils:[47:43] Wobei wir, glaube ich, in den letzten Jahren so ein bisschen den Effekt hatten, dass, glaube ich, Eigentumsdelikte deutlich abnehmen, aber irgendwie körperliche Gewalt ein bisschen zunimmt. Also jetzt auch nicht in irgendwie besorgniserregenden Zahlen, aber irgendwie so ein bisschen mehr ist es geworden. Also es verschiebt sich auch immer ein bisschen zwischen den Arten der Verbrechenden. Aber wer sie dann wieder begeht, keine Ahnung. Also versteht das jetzt nicht falsch.
Holger:[48:02] Ja. Was man allerdings schon sagen muss, wenn man sich jetzt so insgesamt anguckt, die positiven Effekte der Einwanderung landen vor allem bei denen, die schon wohlhabend sind. Also bei den richtigreichen natürlich, weil die sich darüber freuen, wenn sie günstige Arbeitskräfte haben auch in gewisser Weise bei der Mittelschicht, weil wenn Einwanderer kommen, um bestimmte Services zu geben dann profitieren die auch davon, da wo es das kann schon sein, dass es jetzt in bestimmten Orten dann auch noch andere Probleme gibt, man muss immer gucken, wie gesagt sagen, es ist ein Durchschnittswert Und klar, es kann sein, dass in einem Ort das da zu ernsten Problemen kommt, aber letzten Endes ist es immer wieder so, die, die leiden, sind die sozialen Schwachen. Das liegt aber eher daran, so an unserem neoliberalen Wirtschaftssystem, als an den Einwanderern an sich.
Nils:[49:03] Was ich jetzt wieder schön fand, weil du von sozial Schwachen sprachst, das sind natürlich eigentlich die ökonomisch Schwachen, nicht die sozial Schwachen.
Holger:[49:09] Ja, du hast recht.
Nils:[49:10] Weil die sozialen Strukturen sind natürlich oft besser als bei den ökonomisch Starken.
Holger:[49:17] Ja, also sagen wir bei den ökonomisch Schwachen, die leiden vor allem unter den Effekten der Einwanderung. Also auch die, sagen wir mal, Inländer, die ökonomisch schwach sind. Und die sind dann natürlich auch offen für solche Rhetorik gegen Einwanderung. Beziehungsweise blicken auch, wenn jemand für Einwanderung argumentiert, blicken die auch zu Recht kritisch darauf, weil sie letzten Endes diejenigen sind, die da die Probleme kriegen.
Nils:[49:51] Das finde ich nochmal interessant zu gucken, dass man da einfach nochmal auch unterscheiden muss, wer profitiert eigentlich davon. Aber dass ja dann die Reaktion auch bestimmt, weil ich nicht mehr sagen kann, die Gesellschaft profitiert davon, sondern es gibt halt bestimmte Gruppen, die davon profitieren und solche, die auch tatsächlich einfach manifeste Nachteile haben und dann auch irgendwie nachvollziehbarerweise Schwierigkeiten damit. Was aber wieder nicht an den Einwandernden liegt, sondern, wie du schon sagtest, an den neoliberalen Strukturen, die wir uns so aufgebaut haben.
Holger:[50:20] Ja, das ist, also man muss ja sagen, weiß ich nicht, das ist irgendwie fast schon ein Thema, was bei uns im Podcast immer wieder kommt, finde ich, dass man immer wieder dahin kommt zu sagen, ja, es gibt diese neoliberalen Strukturen, die sind relativ gut da drin, davon abzulenken, dass sie bestimmte Probleme verursachen. Und das auf andere umzulenken. Und das bringt dann an anderer Stelle auch wieder Probleme. Also das ist ja auch letzten Endes in meiner letzten Buchvorstellung mit der Klimaschmutz-Habie. Da waren es ja eigentlich auch immer wieder ähnliche Themen.
Nils:[50:56] Ja. Ja, habe ich letztens tatsächlich ein schönes Buch zugelesen. Es ist nicht lang genug, nicht, also nicht lang genug, um hier einen Podcast zu rechtfertigen, aber Capitalist Realism, der eben genau das argumentiert, wir sind gar nicht mehr in der Lage, uns eine Welt ohne Kapitalismus vorzustellen und deswegen sehen wir den gar nicht mehr als Ursache für Dinge, sondern wir sehen halt nur die Dinge, die wir uns anders vorstellen könnten als Ursache, zum Beispiel weniger Migration.
Holger:[51:22] Ja, aber wie gesagt, wenn man auf die Daten guckt, dann stimmt es halt gar nicht. Das ist dann auch wieder auch wieder so ein interessanter Fakt, dass er sagt, man denkt, also gerade konservative Parteien stellen sich immer gerne als immigrationsfeindlich dar und eher linke Parteien als immigrationsfreundlich.
Nils:[51:43] Ja.
Holger:[51:45] Aber wenn man sich die praktische Politik anguckt, da gibt es eigentlich gar nicht so große Unterschiede. Man kann sogar sagen, je mehr Rhetorik es gegen Einwanderer gibt, da gibt es oft gleichzeitig ich viel mehr legale Einwanderung.
Nils:[52:00] Ja.
Holger:[52:02] Und, ähm, Und zumindest so in den modernen westlichen Demokratien ist es auch schwierig, Einwanderer auszuweisen, weil da immer sozusagen der Wert der Menschenrechte immer weiter hochgegangen ist und es ist schwerer, sie auszuweisen. Deswegen will man halt eine härtere Politik bei der Einreise machen. Auf der anderen Seite, wenn die Wirtschaft die Arbeitskräfte braucht, dann wird auch ein konservativer Politiker oder ein rechter Politiker die Einwanderung ins Land zulassen, weil ihm sonst die Wirtschaftsleute auf die Füße treten.
Nils:[52:41] Ja, das sieht man ja gerade in den USA, wo es ja genau jetzt kürzlich, also wir nehmen jetzt auf Mitte Ende Juni 2025, wo man jetzt gerade gesehen hat, dass der gute Herr Trump in den USA dann wirklich seine Anti-Immigrationspolitik tatsächlich, dass er bestimmte Wirtschaftsbranchen davon ausnimmt, nämlich Hotellerie und Gastro und ich glaube Landwirtschaft auch, einfach weil die sonst an anderer Stelle ein Problem kriegen.
Holger:[53:09] Ja, und das ist ja bei uns auch nicht anders. Egal, was bei uns der Herr Merz sagt. Wenn man hier eine funktionierende Wirtschaft weiterhaben will, dann wird man diese Einwanderer brauchen.
Nils:[53:23] Ja, definitiv.
Holger:[53:24] Das ist einfach so. Und auf der anderen Seite gibt es durchaus auch linke Parteien, die einwanderungskritisch sind, wenn die nämlich irgendwie noch mit Gewerkschaften verbandelt sind und die Gewerkschaften sehen das halt erstmal als Billiglohnkonkurrenz. Zumindest so lange, bis die entsprechenden Einwanderergruppen nach ein, zwei Generationen hier integriert sind, dann werden sie als potenzielle Gewerkschaftsmitglieder gesehen. Und du hast auch in rechten Parteien, gerade wenn die so einen religiösen Hintergrund haben, wo gesagt wird, man soll sich halt um die Schwachen kümmern, die sind dann wieder einwanderungsfreundlich und am Ende führt es dann dazu, dass du sagen kannst, dass viele politische Parteien, egal wie ihre Rhetorik ist, intern eigentlich relativ gespalten zu dem Thema sind.
Nils:[54:09] Macht ja auch Sinn. Es ist halt wieder, weil die Realität halt anders ist als die Erzählung, haben wir halt die, die an die Erzählung glauben und die, die auf die Realität gucken.
Holger:[54:18] Genau. Und die Erzählung ist halt, wie wir jetzt schon festgestellt haben, in vielerlei Hinsicht einfach falsch. Und auch nicht hilfreich. Interessanterweise ist es auch so, dass wenn man jetzt etwas differenzierte Umfragen in den Bevölkerungen in westlichen Ländern macht, dass die meisten Menschen eine eher nuancierte Meinung dazu haben. Ja, also dass sie eben nicht einfach Anti-Einwanderung sind, sondern dass sie durchaus unterscheiden können, dass es ein kompliziertes Thema ist und man das nicht so einfach abgestücken kann, wie es die Politik gerne tut. Egal jetzt auf welcher Seite. Was im Grunde der Autor, also Heide Haas, dann auch irgendwie als so ein Hoffnungsschimmer sieht, dass es irgendwie die Polarisierung ja vielleicht in vielen Dingen mehr herbeigeredet ist als faktisch da und auch Potenzial.
Nils:[55:12] Aber wenn ich sie genug herbeirede, ist sie dann irgendwann auch faktisch da, ne?
Holger:[55:17] Sicher, sicher. Das ist so ein Problem. Also ich erinnere mich dran, weiß ich nicht, vor so ein, zwei Monaten haben meine Frau und ich eine Folge der Heute-Show geguckt. Und da war dann auch irgendwie so gegen diese Einwanderung, gegen Aussagen zur Einwanderung, wo dann der Moderator sagte, auch wenn es ein Problem ist, und meine Frau meinte, es ist interessant, wie noch nicht mal hinterfragt wird, ob das überhaupt ein Problem ist. Selbst wenn man da kritisch gegenüber den Methoden ist, sagt man trotzdem nicht, das ist ja eigentlich ein herbeigegeltes Problem. Soweit sind wir schon in der öffentlichen Diskussion.
Nils:[55:55] Ja, definitiv.
Holger:[55:58] Dann ein Phänomen, das sicher bekannt ist, dass in Gegenden, wo es wenig Einwanderer gibt, es herrscht eine negative Meinung gegenüber Einwanderern. Einfach, weil man irgendwie nur solche Horrorbilder kennt, aber nicht irgendwie die faktische Erfahrung gemacht hat.
Nils:[56:21] Den Alltag einfach lebt.
Holger:[56:22] Genau. Und ich würde das mal so jetzt in meinen Worten einfach sagen, wenn man nicht die faktische Erfahrung macht, dass es in einer Gruppe halt die meisten Gruppen von Menschen sind gleich. Es gibt viele nette Menschen und ein paar Menschen, die es nicht sind und mit denen man nichts zu tun haben will. Genau. Wenn man diese Erfahrung dann halt nicht gemacht hat, dann hört man nur die Geschichten über die schlechten Menschen und hat halt ein verzerrtes Bild. Also das ist Ganz klar. Und es gibt natürlich auch noch, also muss man auch ehrlicherweise sagen, es gibt auch noch Rassismus, der eine Rolle spielt. Sicher. Der aber im Verhältnis zur Vergangenheit schon deutlich weniger ist. Also da macht man sich wahrscheinlich oft auch gar nicht klar, wie schlimm das früher schon mal war. Genau, dann hätte ich jetzt noch einen Punkt, den ich ziemlich spannend finde. Nämlich, was ist denn, wenn man solche Einreisekontrollen macht und Grenzen zumacht? Was bewirkt das denn wirklich? Und da war wieder, dass man halt nicht so richtig, dass man nur auf eine Seite der Gleichung guckt. Also man sagt, okay, wir haben ein Problem, wir haben Einwanderung, wir wollen, dass wir weniger Einwanderer im Land haben, dann machen wir die Grenze zu. Was ist das Resultat?
Nils:[57:49] Weiß ich nicht, du guckst mich, wir sehen uns gegenseitig, du guckst mich so an, so fragend.
Holger:[57:54] Das Resultat ist, dass ich nachher mehr Einwanderer im Land habe.
Nils:[57:58] Okay, ja.
Holger:[57:59] Warum ist das so? Weil ich in meiner Gleichung halt einen Teil ignoriere. Was an der Grenze passiert ist, wenn die relativ offen ist, dann gibt es Leute, die kommen rein, Leute, die gehen raus.
Nils:[58:11] Ah.
Holger:[58:12] Wenn ich die Grenze zumache, dann wird es immer noch Leute geben, die wollen reinkommen, wenn es dafür wirtschaftliche Gründe gibt. Und die wollen dann aber nicht mehr raus, weil wenn sie einmal raus sind, dann kommen sie nie mehr rein. Das ist ein Effekt, den kann man in den USA an der Grenze zu Mexiko hervorragend beobachten. Das ist ein Effekt, den kann man auch hier am Mittelmeer beobachten, wo früher die Leute aus Marokko zum Beispiel relativ einfach in die europäischen Anrainerstaaten ein- und ausreisen konnten.
Nils:[58:48] Als Saisonarbeiter oder so.
Holger:[58:49] Genau, als Saisonarbeiter oder auch so wie es heute gibt, ja, die Möglichkeit in Australien so ein Arbeitsvisum zu machen und so ein bisschen Abenteuer rumreisen. Und das haben früher viele von diesen Menschen halt genauso in Europa gemacht. So, jetzt geht das nicht mehr. Jetzt müssen sie die Entscheidung treffen. Das heißt, sie reisen ein und sie reisen dann aber nicht aus, zumindest nicht, wenn sie nicht irgendeine legale Möglichkeit kriegen, wieder einzuwandern.
Nils:[59:18] Macht Sinn, ja.
Holger:[59:18] Das kann paradoxerweise dazu führen, dass sie dann mit einer permanenten Aufenthaltsgenehmigung wieder in die Heimat zurückgehen, weil sie ja jederzeit die Möglichkeit haben, zurückzukommen.
Nils:[59:26] Ja, klar.
Holger:[59:27] Und dann halt auch wirklich sagen können, ich bin halt mal zwei Monate im Jahr für irgendeine Ernte in Italien oder Spanien, verdiene mir da gut Geld dazu, sonst bin ich zu Hause.
Nils:[59:37] Ja, macht Sinn, ja.
Holger:[59:39] Das heißt, auch da ist das, was als Politik gemacht wird, weil halt einfach die eine Hälfte der Gleichung nicht gesehen wird, nämlich dass Leute ja auch rausgehen und dass ich da irgendwie so ein Gleichgewicht habe, das wird ignoriert, ich mache das Gleichgewicht kaputt und erreiche genau das Gegenteil von dem, was ich möchte.
Nils:[59:55] Ich fand das ganz spannend. Ich habe, als ich meine Disc geschrieben habe, bei mir ging es jetzt nicht um Migration, aber es gibt ja in der Migrationstheorie diese Push-and-Pull-Faktoren, die immer irgendwie diskutiert werden. Also was sind Faktoren, die Leute aus ihrem Land wegtreiben und was sind Faktoren, die Leute in ein bestimmtes Land hineintreiben. Und irgendwie ein Autor sagte da mal, ja, das ist immer schön, dass wir über diese beiden Ebenen reden, aber wir vergessen, wie du gerade sagtest, die zweite Hälfte der Gleichung, wir vergessen nämlich die Keep- und die Repel-Faktoren. Also wir vergessen die Faktoren, die die Leute in ihrem Heimatland halten und wir vergessen die Faktoren, die die Leute von ihrem Zielland abstoßen. Das würde die Gleichung dann halt vervollständigen.
Holger:[1:00:31] Und da gibt es sogar so richtig Beispiele. Wenn angekündigt wird, dass Grenzen zugemacht werden, dann kriegst du einen Einwanderungspiek.
Nils:[1:00:40] Ja, klar.
Holger:[1:00:41] Weil dann viele halt sagen, ja, jetzt möchte ich das noch schnell nutzen. Klar. Und es gibt da, er hat ein sehr schönes Beispiel, es gibt Suriname-Goyana und Französisch-Goyana.
Nils:[1:00:52] Ja.
Holger:[1:00:53] Französisch-Goyana ist ein Departement von Frankreich. Das heißt, die Menschen da haben einen französischen Pass. Bei Suriname und Goyana, ich überlege gerade, was da das Kolonialmacht war, ob das Großbritannien war, ich bin gerade nicht sicher.
Nils:[1:01:09] Das weiß ich auch nicht.
Holger:[1:01:10] Aber auf jeden Fall wurde da dann von den ehemaligen Kolonialmächten gesagt, wir werden hier die Einwanderung aus diesen Ländern einschränken. Das hat zu Rieseneinwanderungswellen oder Auswanderungswellen aus diesen Ländern geführt.
Nils:[1:01:24] Nach Französisch-Goyana?
Holger:[1:01:26] Nee, nee, in die ehemalige Kolonialmächte. Also wenn du mal in Holland unterwegs bist, also surinamesisches Essen kriegst du ja überall. Also das ist auch gut. Kann ich aus Erfahrung sagen. Aber du merkst, wenn du in Holland ein bisschen häufiger mal unterwegs bist, Surinamesen gibt es da viele. Als Resultat dessen.
Nils:[1:01:48] Ja, okay, macht Sinn.
Holger:[1:01:50] Aus Französisch-Goyana gibt es nicht viele Menschen, in Festland Frankreich. Also gibt die natürlich. Aber weil die einfach jederzeit kommen und gehen können, wie sie wollen, gab es halt nie so einen Peak, nie so eine Welle. Also das heißt, da hat man so ein richtig schönes Beispiel dafür, wie diese Politik eigentlich genau das Gegenteil von dem erreicht, was man will.
Nils:[1:02:11] Stimmt, ja.
Holger:[1:02:14] Also das finde ich halt… Finde ich halt so ein sehr schönes Beispiel dafür, wie einfach diese ganze Politik irgendwie in so eine ganz, ganz komische und dumme Richtung läuft.
Nils:[1:02:28] Ja, verstehe ich.
Holger:[1:02:31] Genau, also wir sind jetzt im Grunde auch so durch meine Hauptpunkte durch. Es gibt klar, es gibt noch so ein paar kleine, ich habe jetzt nicht alles ausführlich gehabt, es gibt noch so ein paar kleine Sachen, die man noch ermähnen kann. Zum Beispiel führt er aus, dass das mit den Klimaflüchtlingen, dass das gar nicht so klar ist, wie es manchmal dargestellt wird, weil Menschen schon immer sich auch in gefährlichen Gegenden angesiedelt haben, also nahe dem Fluss, der häufig überflutet. Das heißt, also er sagt jetzt nicht, dass es die nicht gibt, aber es ist halt nicht so klar, wie immer gesagt wird, dass es da Riesenbewegungen geben wird. Auch sehr schön, dass wenn Leute sagen, wir müssen, um den demogrammischen Wandel auszugleichen, das wollen wir durch Einwanderung lösen, da da so die schöne Beispiel, naja, dafür müssten wir die jetzt zum Beispiel in Deutschland die Einwanderung in etwa verzehnfachen, da müssten wir also um die drei Millionen Menschen pro Jahr annehmen, das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so die Lösung.
Nils:[1:03:39] Das wird nicht passieren.
Holger:[1:03:40] Also, auch ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt sagt, das stimmt, das ist noch ein wichtiger Punkt, man sagt, dass Menschenschmuggel ist ja sowas, wo die armen Menschen, die einwandern wollen, ausgenutzt werden. Man muss sagen, naja, also Menschenschmuggel gibt es deswegen, weil die Einreisekontrollen so streng sind und diejenigen, die es sich leisten können und bereit sind, das Risiko einzugehen, dann halt zu Menschenschmuggel angreifen müssen. Das heißt, die beste Politik gegen Menschenschmuggel ist halt aufzuhören mit irgendwelchen übertriebenen Anwendungsregelungen. Genau. Und auch so diesen modernen Sklavenhandel, der irgendwie gerne auch in irgendwelchen Dokumentationen mal dargestellt wird, ist oft eher eine Ausbeutung als eine richtige Sklaverei. Das heißt, die Leute unterschreiben das schon freiwillig und sind oft nicht sich dessen klar, wie ausgebeutet sie sind, aber es ist halt auch nicht so, dass die gegen ihren Willen da entführt werden.
Nils:[1:04:55] Okay, aber das ist dann auch eine Frage von Tomato, Tomato irgendwann. Also, ich hatte lange Diskussionen mit meinem Theorie-Prof, ob es freier Wille ist, wenn man eine Pistole an den Kopf gesetzt kriegt und gesagt kriegt, jetzt unterschreibt mal bitte. Also ein bisschen überspitzt natürlich. Ja, okay, ich habe tendenziell eine freie Entscheidung, aber habe ich die wirklich?
Holger:[1:05:15] Naja gut, wobei hier der Unterschied ist, dass du ja unterschreibst, bevor die Pistole an deinen Kopf gesetzt wird und dann vielleicht feststellen.
Nils:[1:05:22] Ja, aber Drohne, Hungersnot und Versprechen von gutem Einkommen sind in ökonomisch angespannten Zeiten schon, können eine ähnliche Macht entfalten, formulieren wir es mal so.
Holger:[1:05:33] Ja, wobei ich sagen würde, es ist nicht unbedingt direkt die Hungersnot, sondern es ist erstmal die Aussicht auf ökonomische Verbesserung. Ja, gut. Ja und da muss man dann auch sehen, muss man in den Einzelfällen gucken, ob die Leute das dann, wie gesagt, es ist ein komplexes Thema, deswegen sage ich auch, Ausbeutung ist es sicher. Aber es gibt halt noch einen Unterschied zwischen Ausbeutung und Sklaverei. Also Ausbeutung kannst du halt.
Nils:[1:06:00] Die im Neoliberalismus rechtfertigbare Ausbeutung, äh Sklaverei es geht so weit man es ausdehnen kann ohne dass es Sklaverei wird dehnt man es halt aus
Holger:[1:06:12] Ja aber da ist jetzt ja auch wieder das Problem dann der Neoliberalismus.
Nils:[1:06:16] Ja natürlich, immer, also nicht immer, aber oft fast immer ich suche nach einer Ausnahme
Holger:[1:06:24] Genau damit wäre ich jetzt aber jetzt wirklich durch die Kernthemen des Buches durch. Wie gesagt, also das Buch ist sehr dicht. Es sind wirklich, 370 Seiten, die sehr dicht mit Input sind. Insofern, wer das jetzt spannend fand und da noch mal in die Tiefe gehen will, dem würde ich auch empfehlen, dass ich das Buch selber noch mal zu Gemüte zu führen. Würde jetzt an dieser Stelle aus meiner Perspektive das dann aber beenden.
Nils:[1:07:06] Alles klar. Danke dir, Holger, für die Vorstellung von How Migration Really Works oder Migration 22, populäre Mythen und was wirklich hinter ihnen steckt. Gut, schön, dass du uns das Buch vorgestellt hast. Ich habe natürlich gleich parallel an meine letzte Episode denken müssen, an die Folge 92, Gekränkte Freiheit, wo ja genau diese Mechanismen, die du beschrieben hast, sie werden zu Sündenböcken gemacht. Oder es gibt die Experten, die sich zum Thema äußern, die nicht wirklich eine Ahnung davon haben. All diese Themen genau im Grunde aufgezeigt werden.
Nils:[1:07:43] Und eigentlich schön geschildert wird, warum diese Gruppen, die Migranten zu Sündenböcken machen, warum die gerade einen Sündenbock suchen. Und warum da Migranten auch näher liegen. Auch wenn es nicht unbedingt, das fand ich auch ganz spannend, dass sich das hier widerspiegelt, nicht unbedingt inhärent, was mit Rassismus zu tun hat, das machen die Autoren da auch, sondern tatsächlich auch dieser ökonomische Aspekt, der sozioökonomische Aspekt, die nutzen uns oder die kosten zu viel. Im Mittelpunkt steht und weniger eine inhärente Abwertung, auch wenn die natürlich mit den ganzen Klischees und Vorurteilen irgendwie noch dazuspielt oder wenn die einen fruchtbaren Boden bietet. Aber das ist nicht das primäre Argument an der Stelle. Das macht es nicht unbedingt besser. Aber es eröffnet vielleicht noch mal andere Ansatzpunkte, um damit umzugehen. Und das war das eine Buch, also gekränkte Freiheit von Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey ist mir eingefallen. Dann, wir haben es auch schon thematisch ein, zweimal angesprochen, das Nomadische Jahrhundert von Gaia Wins, Episode 77, wo es eben genau um diese anstehende Klimavölkerwanderung, wie sie das ja nennt, das hat mit klassischen Fluchtbewegungen ihrer Schilderung nach nicht mehr viel zu tun oder wird nicht viel damit zu tun haben, sondern nochmal auf ein ganz anderes Niveau sich bewegen. Kann man jetzt wahrscheinlich den guten Herrn De Hain und Frau Winz einmal gegeneinander diskutieren lassen. Das fände ich mal ganz spannend.
Holger:[1:09:03] Da sind sie auf jeden Fall unterschiedlicher Meinung. Aber das ist ja auch okay.
Nils:[1:09:06] Ja, natürlich. Und dann habe ich noch so ein paar, diese allgemeinen Zeitdiagnose, Krisenbücher, Lage der Nation, die Klimaschmutzen, glaube ich auch alleine deine letzte Folge. Die spielt ja auch schon so ein bisschen rein, so die Verzerrung von Themen oder wie irgendwie zugrunde liegende Realitäten, medial und politisch irgendwie geframed werden, merkt man ja auch ganz schön. Du hattest ja auch, glaube ich, Merchants of Doubt, hattest du ja auch vorgestellt von Naomi Oreskes. Das geht ja auch in dieselbe Richtung. Dann haben wir natürlich die Altenrepublik zum Thema demografischer Wandel. Das haben wir ja auch hier ein bisschen gestreift. Und die Episode 42, Europa, Infrastrukturen, De-Externalisierung. Auch ganz schön, weil da auch dieses Motiv, Afrika ist unser Ressourcenlieferant hier in Europa, einmal schön auseinandergenommen wird. Und wenn wir gerade geredet haben, damit wir irgendwie unseren Arbeitskräftemangel ausgleichen können, müssen wir Menschen aus Südafrika importieren, aus Afrika importieren oder aus anderen Teilen der Welt, da ist ja auch schon wieder diese, die versorgen uns mit Ressourcenlogik irgendwie eingebettet und ja, auch spannend, sich da mal ein bisschen genauer, ein bisschen ausführlicher mit auseinanderzusetzen. Hast du noch Bücher, Ideen, die ich jetzt nicht genannt habe?
Holger:[1:10:15] Ja, also ich habe auch noch ein paar alte Folgen zuerst. Zum einen, Die Folge 89, Arbeit macht Missbrauch, wo es ja auch so ein bisschen darum geht, da kommt ja auch unter anderem vor, wie dann auch Einwanderer vielleicht mehr bestimmten Machtmissbräuchen ausgesetzt sind. zum Thema.
Holger:[1:10:41] Neoliberalismus noch die Folge 79, der Allesfresser von Nancy Fraser, ich glaube da, das ist, wie wir auch festgestellt haben ein Thema, was immer wieder kommt wie der Neoliberalismus sich so auswirkt und dann auch noch eine alte Folge das Integrationsparadox, wo ja auch schon Über jetzt sozusagen dann aus der deutschen Sicht, wie wir mit Einwanderung umgehen, das finde ich sehr schön beschrieben ist und auch in gewisser Weise, dass manche Sachen vielleicht gar nicht so schlimm sind, wie sie gerne erzählt werden oder dass manches auch sozusagen manches, was problematisch erscheint, eigentlich auch zeigt, dass wir schon so weit sind, dass wir überhaupt uns damit befassen können. Dann habe ich noch drei Bücher. Zum einen als erstes von Marcel Fratscher, Verteilungskampf, warum Deutschland immer ungleicher wird. Ich denke, da ist klar, in welche Richtung das geht. Dann habe ich möglicherweise auch schon mal empfohlen, Michael Hartmann, die Abgehobenen. Das ist also ein Elitenforscher, also auch Soziologe, der da so ein bisschen beschreibt, wie so die Eliten so denken und warum sie vielleicht auch nicht so verstehen, was für den Rest der Bevölkerung so wichtig ist. Ja.
Holger:[1:12:09] Was dann vielleicht nochmal hilft, so ein bisschen zu verstehen, wie so gewisse Politiker sich äußern. Und Naomi Oreskes hatten wir eben schon mal erwähnt. Und sie und Eric Conway haben nach Merchants of Doubt noch ein zweites meiner Meinung nach extrem wichtiges Buch geschrieben, The Big Myth, in dem sie darstellen, wie denn sich so dieses ganze neoliberale Denken, wie das so verbreitet und in die Mehrheit der Bevölkerung gebracht wurde. Also so ein bisschen, warum sind wir denn an dem Punkt, wo wir uns gar nichts anderes mehr vorstellen können? Und das ist halt auch von bestimmten Interessengruppen bewusst herbeigeführt worden und das nehmen sie da sehr schön auseinander. Und dann habe ich als letztes noch, wer noch Interesse hat, jetzt an der Migration. Es gibt auch einen Vortrag von Heinde Haas selber, der im Hörsaal vom Deutschlandfunk erschienen ist, etwa nicht ganz eine Stunde lang. Er macht es auch auf Deutsch, entschuldigt sich am Anfang des Vortrags dafür, dass es das erste Mal ist, dass er einen Vortrag auf Deutsch hält. Ist aber alles sehr gut zu verstehen. Also er spricht ziemlich gut Deutsch, halt mit so ein bisschen holländischem Akzent. Aber das ist ja überhaupt kein Problem. Das heißt, wer dann nochmal ihn selber zu dem Thema hören möchte, das tun wir dann auch noch in die Shownotes. Genau.
Nils:[1:13:33] Ich habe jetzt ein Buch gerade noch vergessen, Capitalist Realism von Mark Fischer. Das hatte ich im Podcast auch einmal angesprochen. Das scheint so ein bisschen in die gleiche Richtung zu schlagen, wie das von Naomi Oreskes und Conor die du gerade angesprochen hattest. Also diese Etablierung, dieser Selbstverständlichkeit des Kapitalismus, die spielen wahrscheinlich ganz gut zusammen.
Holger:[1:13:53] Ja, kann ich mir vorstellen.
Nils:[1:13:56] Gut, hast du noch Punkte, die nicht angesprochen worden sind, die du noch loswerden möchtest?
Holger:[1:14:03] Nö, ich konnte ja erzählen, was ich wollte.
Nils:[1:14:07] Dann bleibt mir nur, euch auf unsere Webseite zu verweisen. Wenn ihr diesen Podcast spannend fandet, mehr zu uns wissen wollt, mehr Episoden finden wollt, könnt ihr das natürlich auf unserer Webseite tun, zwischenzweideckeln.de. Dann sind wir aber auch zu finden auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts und so weiter und so fort. Hinterlasst uns da auch gerne Sterne, Kommentare, Bewertungen. Wir freuen uns, von euch zu hören. Mittlerweile auch wieder zuverlässig auf YouTube sonst in den sozialen Medien könnt ihr uns folgen bei Mastodon sind wir at ZZD at podcasts.social und auf Blue Sky sind wir glaube ich at Deckeln folgt uns da gerne rein und verpasst keine neuen Episoden ihr könnt uns aber natürlich einfach da abonnieren wo ihr all eure Podcasts ohnehin abonniert habt jetzt bleibt mir nur bis zum nächsten Mal euch zu wünschen viel Spaß beim Lesen Tschüss
Music:[1:15:04] Music
Quellen und so
Intro und Outro der Episode stammen aus dem Stück Maxixe von Agustin Barrios Mangore, eingespielt von Edson Lopes (CC-BY).
Das Umblättern zwischen den Teilen des Podcasts kommt hingegen von hoerspielbox.de.
Zwischen zwei Deckeln findest du auch im sozialen Medium deiner Wahl: Mastodon und Bluesky.
Der Beitrag 094 – „Migration: 22 populäre Mythen“ von Hein de Haas erschien zuerst auf Zwischen zwei Deckeln.


