
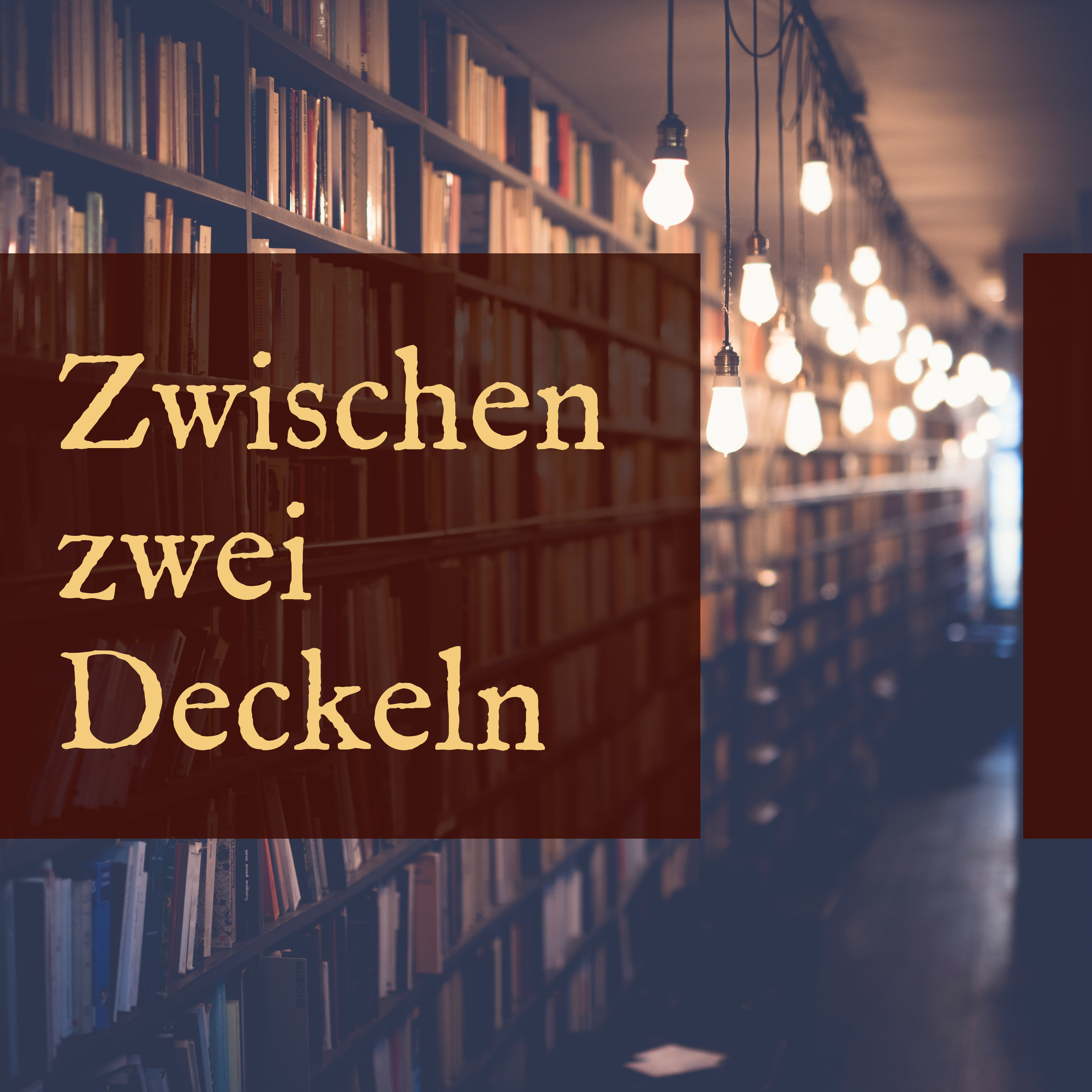
Zwischen Zwei Deckeln
Zwischen zwei Deckeln
Sachbücher zu Wissenschaft, Gesellschaft und dem guten Leben
Episodes
Mentioned books

May 22, 2025 • 1h 21min
092 – „Gekränkte Freiheit“ von Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey
In „Gekränkte Freiheit“ entwickeln Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey einen Erklärungsansatz für das Erstarken rechtspopulistischer und rechtsextremistischer politischer Einstellungen. Sie sehen die Ursache dafür in erster Linie in den überzogenen Versprechen individueller Freiheit, die durch den real existierenden Kapitalismus aber nicht eingelöst werden können. Dies wiederum löst eine Kränkung aus, weswegen sich die Menschen gegen das bestehende System wenden.
Transkript (automatisch erstellt)
Music:[0:00] Music
Amanda:[0:17] Hallo und herzlich willkommen zur 92. Folge von Zwischen zwei Deckeln. Ich bin Amanda und habe heute Nils mit dabei.
Nils:[0:26] Hallo zusammen.
Amanda:[0:28] Uns ist gerade aufgefallen, dass ich jetzt zum vierten Mal in Folge hier dabei bin. Deswegen habe ich gedacht, ich ziehe mir ein bisschen eine Erkältung zu, damit er auch zumindest von der Stimme her ein bisschen eine Modulation hört. Nee, Quatsch. Also ich freue mich sehr, heute Nils zuhören zu dürfen. Und ihr kennt das ja, wir beginnen ein bisschen so, womit wir uns aktuell beschäftigen. Und tatsächlich bin ich nicht so ganz zum Lesen gekommen in der letzten Zeit. Habe aber was ganz Cooles hier aufgesetzt gekriegt von meinen Freunden. Und zwar haben wir einen Chat, in dem wir uns jetzt so gegenseitig interessante Artikel zusenden. Und man kennt das so ein bisschen aus der Wissenschaft. Da teilt man halt so Publikationen und hat so geteilte zum Beispiel Literaturlisten und so weiter. Und ich hatte das bisher nicht so im Freundeskreis und es passiert ja schon oft, dass man dann diskutiert man über was und jemand hat da was gelesen oder einen Podcast gehört. Und jetzt haben wir das so aufgesetzt in einem Chat und ich finde das echt mega cool. Das ist so eine demokratisierte, geteilte Wissensbasis eigentlich.
Nils:[1:34] Das ist ein cooles Konzept, da ich beruflich Wissensmanagement mache, finde ich das natürlich immer spannend.
Amanda:[1:40] Ja, also ich kann das sehr empfehlen, dass man sich da sowas zutut mit interessierten Freundinnen und Freunden, also das ist echt bereichernd.
Nils:[1:50] Ich würde jetzt sagen, dafür habe ich Mastodon, aber ja, das macht natürlich nochmal was anderes, wenn es persönlich bekannte Menschen sind.
Amanda:[1:57] Ich finde schon, es ist so, je länger, desto mehr finde ich so wieder das persönlich Kuratierte einfach unschlagbar. Also wenn man jemanden kennt und auch abschätzen kann, ob das der Person passt oder nicht, dann finde ich das echt, das sind die besten Empfehlungen.
Nils:[2:12] Ja, definitiv.
Amanda:[2:14] Was steht bei dir an, Nils?
Nils:[2:15] Ja, tatsächlich gelesen, klappt in letzter Zeit ganz gut. Ich habe jetzt auch passend zu diesem Buch letzte Woche gelesen von Mark Fischer, Capitalist Realism. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das war wohl in UK, Ende der 2000, der Nullerjahre, wie man so schön sagt. So ein bisschen ein gehyptes Buch und ich fand es auch tatsächlich ganz cool. Es ist ein relativ kurzes Büchlein von 100 Seiten. und es geht vor allen Dingen darum, wie wir uns gar keine andere Gesellschaft als die kapitalistische mehr vorstellen können und wie wir da hingekommen sind und was das für Konsequenzen hat und das schließt tatsächlich auch ziemlich gut an das Buch an, was ich euch heute vorstellen möchte, deswegen passt das ganz hervorragend.
Amanda:[2:59] Perfekt, ja das Buch, das du uns heute vorstellst, das nennt sich gekränkte Freiheit, ist geschrieben von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey Und ich kenne das schon sehr gut aus den Bücherregeln, weil das hat so ganz ein prägnantes Cover mit so weiß und so einem gelben Kreuz darauf. Ist nicht mehr ganz so neu. Das ist 2022 bei Surkamp erschienen. Und die Autorin ist Literatursoziologin an der Uni Basel. Und Nachtwey ist Professor der Sozialstrukturanalyse, auch an der Uni Basel. Ich weiß nicht ganz genau, was das ist oder was das bedeutet, aber beide sind wohl an der Uni tätig, sind SoziologInnen und deswegen bin ich sehr erfreut, dass du uns das Buch vorstellst. Ich bin vielleicht nicht ganz die perfekte Zuhörerin dafür, da müsst ihr wohl Christoph fachlich unterstützen, aber trotzdem, ich höre dir sehr gerne zu.
Nils:[3:58] Ja, immer gerne. Und ich glaube, das Buch profitiert davon, wenn nicht nur FachexpertInnen in dem konkreten Thema und der konkreten Disziplin sozusagen darüber reden. Dann gewinnt das nochmal an Verständlichkeit.
Amanda:[4:14] Sehr gut. Ja, magst du uns das TLDA geben?
Nils:[4:17] Ja, sicher, sehr gerne.
Nils:[4:24] In gekränkte Freiheit entwickeln Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey einen Erklärungsansatz für das Erstarken rechtspopulistischer und rechtsextremistischer politischer Einstellungen. Sie sehen die Ursache dafür in erster Linie in den überzogenen Versprechen individueller Freiheit, die durch den real existierenden Kapitalismus dann aber nicht eingelöst werden können. Dies wiederum löst eine Kränkung aus, weswegen sich die Menschen gegen das bestehende System wenden.
Amanda:[4:56] Okay, das klingt hochaktuell.
Nils:[4:58] Genau, ja, ja, also du sagtest gerade, das Buch ist ein bisschen älter, aber es ist ehrlich gesagt, ja okay, die Beispiele, es wird vielleicht heute andere, bessere Beispiele geben, aber an der inhaltlichen Argumentation hat sich sehr, sehr wenig geändert, die hat sich eher weiter bestätigt, insofern ist das definitiv hier keine Schwäche des Buchs.
Amanda:[5:19] Okay.
Nils:[5:21] Gut, ja. Ein paar Vorworte zum Buch. Ich habe, das ist glaube ich so das Buch, wo ich am meisten habe, puzzeln müssen, um irgendwie die Stränge, die so da durchziehen, durch die verschiedenen Kapitel so zusammenzufügen, dass sie irgendwie einen konsistenten Argumentationsstrang geben. Also ich glaube, ich habe noch kein Buch gehabt, wo ich so das Gefühl hatte, die sagen irgendwie in jedem Kapitel zu zehn Argumentationssträngen jeweils einen Schritt, anstatt einfach mal einen Strang durchzugehen und dann den nächsten Strang durchzugehen. Entsprechend ist es von der Struktur her, orientiere ich mich jetzt wenig an der Struktur des Buchs, sondern habe eher versucht, da mal so eine Argumentationsstruktur durchzubringen, weil die ist tatsächlich, finde ich, sehr überzeugend und sehr hilfreich zumindest, auch wenn sie, ja, es ist halt sehr soziologisch-theoretisch, es kommt auch aus einer gewissen marxistischen Lesart. Und das sind ja so Texte, die dazu neigen, nicht immer die zugänglichsten zu sein. Deswegen auch nochmal ist es vielleicht sogar ganz gut, dass du die Fragen stellen kannst, die wir SoziologInnen glauben, verstanden zu haben. Und dass es dann meistens aber die besten Fragen sind.
Nils:[6:32] Genau, also ich habe die Grundthese gerade im TLDL schon angetickt, ich werde die jetzt noch ein bisschen aufmachen natürlich und einen Punkt, den man ein bisschen vorweg schicken will, was den beiden ganz, ganz wichtig ist, dass sie sozusagen einen Gleichklang oder einen engen Zusammenhang sehen zwischen Fortschritt und Regression. Also zwischen, es entwickelt sich an vielen Stellen weiter, es wird für viele Menschen besser, es wird vieles besser, aber gleichzeitig birgt diese Entwicklung sozusagen auch ihren eigenen Rückschritt wieder in sich. Das ist so eine Doppelung, sie nennen das regressive Modernisierung, dass wir eben nicht ein, wie man das klassisch-historisch, so ein historisches Bild, alles wird irgendwie immer besser. So eine Zeit kommt der Fortschritt oder wie war das, der Bogen der Weltgeschichte ist lang, aber er tendiert Richtung Freiheit oder was das war. Ich glaube, es war Martin Luther King, der das mal gesagt hat. Und die beiden sind da halt ein bisschen
Nils:[7:37] Skeptischer oder kommen halt eher von so einer Perspektive, es ist immer beides irgendwie da, beides gleichzeitig und wenn die Modernisierung beschleunigt, dann wird auch die Regression stärker und schärfer, weil eben Konflikte aufbrechen, weil eben ja einfach, wenn sich Dinge verändern, haben wir Menschen dann doch auch ab und an mal ein Problem damit. Genau, das so ein bisschen vorweg geschickt. Ich habe so ein bisschen überlegt, was ist so das eine zentrale Argumentum, dass sich fast alles rankt und bin dann lustigerweise bei einer Songtextzeile gelandet aus einem Song von ach, jetzt habe ich vergessen, wie die Band heißt, das ist natürlich ganz clever das kann ich mal kurz nachgucken, die Zeile ist auf jeden Fall Give me something to believe in this hell you call a dream genau, das ist von The Warning aus dem Lied
Nils:[8:31] Wie das Lied heißt, weiß ich nicht, es ist vom Album Keep me fed. Und dieser Satz, also give me something to believe in this hell you call a dream, gerade dieser zweite Teilsatz in this hell you call a dream, das beschreibt, glaube ich, so das Kernargument von Armlinger und Nachtweih sehr, sehr gut, weil es eben, weil wir auf der einen Seite ein Gesellschaftssystem haben, dass sich Freiheit ganz, ganz groß auf die Fahnen geschrieben hat, dass sich auch Individualismus ganz, ganz groß auf die Fahnen geschrieben hat, individuelle Selbstverwirklichung, es wird immer alles besser und besser und Fortschritt und Freiheit. Diese Freiheit existiert, wenn man genau hinguckt, aber erstmal mehr oder weniger nur auf dem Papier. Oder in der Rhetorik. Das, was viele, viele, viele Menschen, die allermeisten Menschen faktisch erleben, ist in gewisser Weise eine Art der, da kommt jetzt der Marxismus durch, der Unterdrückung durch den Kapitalismus. So. Das heißt, wir haben ein System, was Freiheit verspricht, aber nicht liefert.
Amanda:[9:31] Machen Sie eine Definition von Freiheit? Was verstehen Sie darunter?
Nils:[9:37] Jein, also Sie sind sich sehr dessen bewusst, dass man darunter sehr viele verschiedene Dinge verstehen kann. Ich weiß gar nicht, ob Sie an der Stelle so viel von Freiheit reden. Das Buch heißt schon gekränkte Freiheit. Sie machen nicht selber einen Begriff von was Sie unter Freiheit verstehen, sondern Sie diskutieren eher, was Menschen unter Freiheit verstehen. Okay. Also Sie an der Stelle reden, Sie viel von individueller Selbstverwirklichung und all diesen Methoden. Sie kommen dann, ich komme da auch gleich noch zu dem Thema, zu der Freiheit konkret hin.
Nils:[10:11] Wir haben halt irgendwie dieses individualisierte System, das uns aber dann durch seine Dynamiken, durch sein Funktionieren, im Grunde zu einer Konformität zwingt und wo wir ständig an irgendwelche Grenzen stoßen. Ich würde das jetzt gerne machen. Das ist das, was ich machen will, aber dann erlaubt mir dieses System das nicht. Das ist ein ständiges an Grenzenstoßen in einem System, was irgendwie die große Freiheit verspricht, was auch Selbstwirksamkeit verspricht. Du kannst es schaffen, du kannst es ändern, aber wenn man es dann versucht, hat man dann nicht wirklich irgendwie eine Chance, was zu tun. Erfährt diese Selbstwirksamkeit halt nicht tatsächlich. Und auch die ganzen Optionen, die man hat, Und ja, man hat vielleicht viele Optionen, aber man wird eben doch auch dafür bestraft, also ich bin jetzt ein bisschen in dieser marxistischen Rhetorik, man wird eben auch dafür bestraft, wenn man die falsche Wahl trifft. Man wird eben dafür bestraft, wenn man Literaturgeschichte studiert und Gedichte schreiben möchte. Ja, man hat die Wahl, das zu tun, aber das hat sehr viele Konsequenzen auf das Leben und auf das, was man sonst noch so tun kann im Leben potenziell. Aber
Nils:[11:23] Dazu kommt dann auch, das fand ich auch ein schönes Beispiel, dass wir in diesem System auch, das ist jetzt eine Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre, dass sowas wie Aufstieg nicht mehr wirklich planbar ist. Das ist jetzt eine Entwicklung, wenn man so den klassischen 50er, 60er, 70er Jahre Kapitalismus hat, wo man eben durch konstantes Arbeiten, durch gutes Arbeiten im Unternehmen aufsteigen konnte, irgendwie eine gewisse Sicherheit hatte,
Nils:[11:47] Auf die man irgendwie sich verlassen konnte. Also das gibt es in dem Fall, in diesem Maße nicht mehr.
Nils:[11:56] Was unter anderem dazu führt, das ist jetzt eher Nebenstranken, aber den fand ich ganz spannend, dass so Abkürzungen interessant werden. Sowas wie, ich will YouTuber werden oder ich will Popstar werden oder so, dass das auf einmal interessant klingt. Weil wenn ich mich durch ehrliche Arbeit in irgendeinem klassischen Beruf sowieso nicht nach oben arbeiten kann, dann kann ich auch versuchen eine Abkürzung zu nehmen. Oder es wirkt irgendwie realistischer. Also das fand ich ein spannendes Nebenargument. Und wir haben auf der einen Seite diesen Punkt, dass der Aufstieg nicht mehr planbar ist. Auf der anderen Seite haben wir aber auch den Punkt, dass es im Grunde keinen, nicht wirklich einen sicheren Rückfallpunkt mehr gibt wie eine Normalbiografie. Also dass man sagt, ja, ich werde jetzt vielleicht nicht aufsteigen und Abteilungsleiter werden, aber wenn ich hier meinen Job mache, bin ich für die 30 Jahre meines Berufslebens, muss ich mir zumindest ökonomisch keine Gedanken darum machen. Was wir stattdessen haben, ist irgendwie dieses Versprechen, du kannst dich selbst verwirklichen, aber du musst dich halt auch ständig irgendwie in dem System halten und irgendwie neu erfinden und neue Wege finden, weil das, was du die letzten drei Jahre gemacht hast, das braucht jetzt keiner mehr. Und es verändert sich halt alles in einem ganz anderen Tempo. Das ist so ein bisschen dieses Unsicherheitsgefühl. Ich habe mich da auch so ein bisschen an Hartmut Rosa erinnert gefühlt, mit seiner, wie heißt das, dynamischen Stabilisierung. Man muss in Bewegung bleiben, damit man nicht zurückfällt. Und das ist so ein bisschen das System, was einen dazu sehr viel zwingt und gleichzeitig eben große Freiheit verspricht.
Amanda:[13:25] Okay.
Nils:[13:27] Der damit eng verbunden ist auch, dass wir sehr gut darin sind oder eigentlich als Gesellschaft mittlerweile so denken, dass gesellschaftliche Probleme zu individuellen Problemen werden. Also nicht die Gesellschaft ist dafür, es verändert sich mittlerweile ein bisschen, aber nicht die Gesellschaft ist dafür verantwortlich, dass Menschen im Rollstuhl irgendwie öffentliche Gebäude betreten können, sondern die sollen sich halt selber darum kümmern, wie sie das hinkriegen. Oder du bist in Armut, ja, dann hast du wohl was falsch gemacht. Oder du bist krank geworden, ja, dann hast du wohl die falsche Medizin gewählt und warst nicht bei den richtigen Ärzten. Also diese Individualisierung von gesellschaftlichen Schwierigkeiten, gesellschaftlichen Problemen, was auch einfach dazu führt, dass man es als Individuum immer schwieriger wird, sozusagen mildere Umstände für sich gelten zu machen. Da sind sie nicht so ganz klar, weil ich finde, da ist so, dass das europäische Gesellschaftsbild schon noch ein anderes als das US-amerikanische und beide sind ja eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob sie ursprünglich Schweizer oder Deutsche sind, also sie kommen ja eigentlich aus dem europäischen Kultursystem und da finde ich, überziehen sie dieses Argument ein kleines bisschen, aber ich glaube, die Tendenz ist zumindest in gewissen Bereichen definitiv da.
Nils:[14:42] Und wo sie dann hinkommen bei dieser Individualisierung des Scheiterns dass das zwei Dinge ganz stark stärkt, die dann sich nachher irgendwie die uns, die zum Problem werden sozusagen, das sind Gefühle von Scham und von Schuld ich bin selber schuld und ich schäme mich dafür dass ich irgendwie arm bin oder und das führt zu drei unterschiedlichen Arten von Gefühlen, da differenzieren sie jetzt Das fand ich ganz spannend. Da greifen sie auch irgendjemanden auf, ich weiß aber gerade nicht mehr wen. Groll, Zorn und Ressentiment. Das fand ich eine sehr schöne Unterscheidung, sie differenzieren das tatsächlich.
Nils:[15:21] Während der Groll so ein bisschen dann in den Punkt geht, ich will nicht länger das Opfer sein, ich will irgendwie selber ins Handeln kommen, ich will mich von diesem System nicht so zwingen lassen. und der richtet sich dann im Grunde nach oben, so auf das System, auf die Eliten. Dann haben wir den Zorn, der richtet sich dann schon so ein bisschen konkreter auf irgendetwas ganz Konkretes, auf die Grünen, wenn wir das jetzt in Deutschland mal sehen. Und dann haben wir das Ressentiment, das ist so ein verallgemeinertes Gefühl der Missgunst. Also das ist das, was man jetzt eben im Kontrast in der Diskussion um Migration und so weiter dann erlebt und gefühlt so dieses verallgemeine Gefühl, das sind die, die nehmen uns das weg, die haben das, was wir eigentlich kriegen sollten oder die sind verantwortlich dafür, dass wir das nicht kriegen, warum auch immer und das ist so ein bisschen, das sind so diese drei Gefühle, Groll, Zorn und Ressentiment, die sie da einmal differenzieren. Das fand ich ganz spannend, sich da mal ein bisschen Gedanken zu machen.
Nils:[16:20] Was wir in dem System auch noch haben, das fand ich auch noch ein ganz spannendes Argument, wir sind immer noch bei diesem Thema, das System erlaubt uns die Freiheit nicht oder der Kapitalismus, das System klingt immer nach einer großen Verschwörungstheorie, so ist es nicht gemeint, der Kapitalismus erlaubt uns nicht die Freiheit, die er uns verspricht. Und da ist noch ein schöner Punkt, dass wir als Individuen nicht mehr so abhängig sind von Einzelpersonen, wie das vielleicht historisch früher war, also von irgendwie einem Gutsherrn oder einem konkreten Einzelherrscher, aber dass wir dafür vielmehr darauf angewiesen sind, dass die Infrastrukturen unserer Gesellschaft funktionieren. Man kriegt das mit, wenn der öffentliche Dienststreik, also die Bahnen nicht fahren oder der Müll nicht abgeholt wird, dann wird das ganz schnell schwierig. Ja.
Amanda:[17:09] Da setzt bei mir dann immer so ein bisschen auch das Problem an, wenn es um Libertarismus geht, wo das reinkommt. Also ich verstehe nicht ganz, wie man auf diesem Auge blind sein kann.
Nils:[17:19] Ja. Könnte man jetzt an anderer Stelle darüber diskutieren. Ich glaube, das war in dem Buch Unterwerfung von Philipp Blom, war das so ein bisschen Thema, dass wir in unserer christlich geprägten westlichen Gesellschaft vergessen haben, dass das Materielle irgendwie auch eine Rolle spielt. Dass wir zu verkopft geworden sind, sozusagen. Vielleicht, also wir immer als kollektives ideologisches Grundgerüst dessen, wie wir die Welt sehen. Nicht als konkreter Personenkreis, das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis. Und eben diese Angewiesenheit auf die Infrastruktur, die ist halt auch wieder, ich soll so frei sein, aber ich kann jetzt nicht da hinfahren, weil da fährt keine U-Bahn hin. Oder weil, ich soll so frei sein, aber die wollen mir jetzt mein Tempo 200 auf der Autobahn wegnehmen. Also die U-Bahn fährt nicht, finde ich schlimmer, als ich darf nur 120 auf der Autobahn fahren, aber das sehen andere vielleicht auch anders, weil sie keine U-Bahn fahren. Und gleichzeitig ist diese Welt, diese Strukturen, auf die wir so angewiesen sind, wirken die irgendwie feindlich auf uns und nicht durchschaubar, also jetzt in der U-Bahn vielleicht noch, aber was jetzt bestimmt, warum wir einen Job kriegen, warum wir irgendwie einen anderen Job kriegen, warum wir befördert werden oder entlassen werden, warum unsere Firma jetzt aufgekauft wird und auf einmal alles anders passiert.
Nils:[18:43] Da hat man so keinerlei Einfluss drauf und es wird immer mehr, eben weil diese grundlegende Sicherheit fehlt, eben auch als Bedrohung wahrgenommen. Und das finde ich auch noch einen guten Punkt, der einfach diese Unsicherheit, diese diffuse Unzufriedenheit sehr, sehr gut erfasst. Das Ganze ist dann noch verbunden mit einer großen Ungleichheit. Also wenn man sich zurückdenkt so an die historischen Prozesse um Freiheit, da ging es immer um Freiheit und Gleichheit. Was wir jetzt haben ist, Für eine Ungleichheit in der Freiheit, drücken wir es mal so aus, sie nennen es selber nicht so, aber in gewisser Maße eine Ungleichheit in der Freiheit, weil die oberen Klassen, wer Geld hat, wer Bildung hat, wer es einmal geschafft hat, so ein bisschen den Fuß auf den Boden zu kriegen, der wird tendenziell auch freier.
Nils:[19:30] Also die, wir haben das bei Corona gesehen, die in dem Homeoffice arbeiten können die irgendwie die Möglichkeit haben eben nicht sich die Infektionsgefahr im selben Maß aussetzen zu müssen das sind die, die auf einmal Freiheitsgrade gewinnen und irgendwie Mitarbeitende im medizinischen System, Ärzte Pflegekräfte und ähnliches die müssen auf einmal sogar irgendwie zu Hause in separaten Zimmern wohnen, um sich bloß nicht anzustecken oder werden irgendwie in Wohnheimen untergebracht in der heißen Phase gab es glaube ich das ein oder andere Mal und verlieren dadurch auf einmal ein massives Maß an Freiheit. Während die einen anfangen Sauerteigbrot zu backen, sind die anderen froh, wenn sie sich in ihren 12-Stunden-Schichten nicht irgendwie mit Corona anstecken. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber strukturell ist es halt oft sehr ähnlich.
Nils:[20:21] Und das ist halt auch, dass wir diese Ungleichheit ins System auch an der Stelle reinkriegen und dass wir dann gleichzeitig auch ja, halt Vergleiche ermöglichen. Auf einmal sehen wir, wie andere leben und was andere tun und wir haben eben auch den Anspruch, ja, warum sollte ich denn, ich arbeite nicht weniger hart und so weiter und so fort, warum schaffe ich das nicht, was die schaffen? Auch da wieder, gerade wenn wir in diese Performance reinkommen, also irgendwelche Influencer, die irgendwie ihr Bling-Bling-Leben zeigen, was natürlich auch für die Kamera inszeniert ist im Normalfall, werden aber trotzdem dann irgendwie zu so einem Vergleichsmaßstab Was halt auch dann irgendwie schwierig ist. Und wir haben auch noch ein stärkeres Unrechtsbewusstsein dafür. Da kommt diese regressive Modernisierung ins Spiel. Auf der einen Seite werden sich immer größere Teile der Gesellschaft dieses Unrechts bewusst. Und auf der anderen Seite merken sie aber auch, dass sie halt eventuell am negativen Ende dieses Unrechtes stehen und entwickeln dadurch eben genau, was wir gerade hatten, Groll, Zorn, Ressentiment aus guten Gründen auch zum Teil, was dann dagegen arbeitet im Grunde.
Amanda:[21:30] Finde ich spannend. Ich habe das von ein paar Freunden gehört, die so ein bisschen im Krisenmanagement mit Jugendlichen arbeiten. Und interessant ist, dass insbesondere auch Jugendliche aus, ich sag mal, sozial benachteiligten Schichten das ganz anders wahrnehmen. Da sind die Beispiele und die Vorbilder, das sind genau diese Personen, die sie sein möchten. Und da ist gar keine Ungleichheit, das wird nicht so wahrgenommen oder eine Ungerechtigkeit, sondern im Gegensatz zu, ich kann das auch schaffen. Und zwar aber komplett realitätsfremd, also das geht, das finde ich interessant, weil ich frage mich dann, bei wem das tatsächlich diesen Neid auslöst, also wo man dann hinkommen muss, um das zu empfinden.
Nils:[22:24] Also ich glaube, das ist tatsächlich, hier geht’s wie, also das sieht man ja auch, wenn man in die ganzen Bewegungen guckt, also sie haben nachher noch eine Analyse von drei solcher Bewegungen, von Querdenkern, von wie nennen sie das, gefallenen intellektuellen und von tatsächlich dann eher rassistisch-rechtsextremistisch eingestellten Menschen. Da geht es selten um die Jugend. Da geht es eher so um um die gesetzten Erwachsenen.
Amanda:[22:52] Okay, man hat was probiert im Leben und das hat nicht funktioniert und dann schaut man sich mal so.
Nils:[22:57] Ja, oder es hat sogar funktioniert, nur man ist sich nicht mehr so sicher, ob es noch weiter funktioniert. Das ist, glaube ich, fast eher der Punkt, weil wenn man jetzt gerade auch so in Deutschland auf die AfD-Wählerschaft guckt, das sind nicht nur die Gruppen, die man typischerweise als gesellschaftlich benachladigt verstehen würde. Das sind auch die Gruppen, die eben genau so ein bisschen ja, die Einfamilienhausbesitzer in den baden-württembergischen Kleinstädten und Dörfern. So, das sind jetzt nicht ökonomisch benachteiligte Gruppen im Normalfall. Wo aber trotzdem diese Dynamiken und dieses Unwohlsein im Grunde entsteht.
Amanda:[23:35] Okay.
Nils:[23:37] Genau. Ja, das ist dann tatsächlich noch ein Punkt, der da auch reinkommt, weil genau diese Einschränkung, die es gibt, das widerspricht sich jetzt diesem, die oberen Klassen sind freier als die Unteren, das spricht ihm eigentlich nicht, weil genau diese Einschränkungen sich jetzt auf einmal auch auf sozioökonomisch wohlhabendere Menschen erstrecken. Da ist natürlich das klassische Beispiel Corona, weil auf einmal sagt der Staat auch mir, was ich zu tun habe, wo ich hinzugehen habe und was ich nicht darf. Das sind die Empfänger von Hartz-IV oder Bürgergeld in Deutschland, die sind das schon immer gewohnt. Die kennen das nicht anders, die kennen den Staat nicht anders. Aber auf einmal, wenn ich jetzt ein oberer Mittelschicht-Dude bin, dem irgendwie ein Haus gehört und so. Auf einmal geht der Staat mir so um wie mit den Armen, das geht ja gar nicht.
Amanda:[24:24] Ja. Wobei ich da, ich verstehe ein bisschen, wenn man wieder das Individualisierungsargument nimmt, bei Impfungen ist das natürlich schon so, die positiven Effekte, die werden ja gesamtgesellschaftlich getragen. Wohingegen die negativen, da bist du wirklich als Individuum ganz alleine auf dich gestellt. Also klar, im besten Fall kriegst du da Unterstützung und so weiter, aber die Folgen, die trägst du als Einzelperson und ich glaube insbesondere in dieser Individualisierungstendenz hat das einfach ein größeres Gewicht gekriegt.
Nils:[24:54] Ja, das ist ein super Beispiel. Würden die auch, glaube ich, genauso mitgehen. Weil es auch genau, das ist jetzt ein Argument, das bringen sie dann, das ist deren Kernargument, was ich am Ende bringen wollte, aber gehe ich jetzt schon mal darauf ein, dass es tatsächlich darum geht, um so eine Absolutsetzung von Freiheit. Also um eine und vor allen Dingen eine Individualisierung von Freiheit. Also es ist meine Entscheidung, was ich darf und was nicht und jede Einschränkung dieser Entscheidung ist erstmal illegitim, egal ob ich die eventuell sogar mittrage. Also vielleicht sage ich sogar, ja, ich habe kein Problem damit, mich impfen zu lassen, aber ich finde die Impfpflicht scheiße. So, um an dem Beispiel zu bleiben. Das ist genau diese Verabsolutierung, ich darf das für mich entscheiden und ich entscheide mich so, aber alle, jeder soll das auch für sich entscheiden dürfen, egal was das gesellschaftlich bedeutet. Das ist ein schönes Beispiel dafür.
Nils:[25:43] Genau, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir so ein bisschen in die kleineren, diffizileren Einzelargumente erstmal gehen, bevor wir dann nochmal zu diesen drei großen Gruppen kommen, von denen ich gerade sprach. Also das ist so der ganz große argumentative Bogen im Grunde, der das Buch durchzieht. Es gibt noch so ein paar Nebenargumente, die in einzelnen Teilen auftauchen. Da haben wir einmal den Punkt, dass unsere moderne Gesellschaft ja nicht mehr so sehr darauf setzt, durch eine externalisierte Kontrolle, also so sehr der Staat irgendwelche Regeln macht. Wir sind in einer massiv weniger regulierten und einer offeneren Gesellschaft, als man das vor 100, 200, 300, 400 Jahren war, wo eben irgendwelche religiösen Autoritäten oder ähnliches wirklich sehr detailliert Dinge vorgeschrieben haben und auch sehr minutiös kontrolliert wurde. Das merkt man alleine schon irgendwie auch in Familien, dass irgendwie Erziehungsziele sich verändert haben und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben weniger so eine Beherrschung von außen. Was wir aber haben, das ist jetzt auch kein neues Argument, gerade aus der Theorielinie der kritischen Theorie, ist, dass wir diese Unterdrückung oder diese Herrschaft im Grunde internalisiert haben. Also, dass nicht mehr der Chef hinter mir stehen muss, so du arbeitest jetzt aber, sondern dass wir selber ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir mal länger Pause machen als alle anderen.
Nils:[27:06] Und das sind ja auch Motive, die immer weitergehen, auch wenn man so Richtung New Work und Flexibilisierung der Arbeit, zumindest in manchen Wirtschaftsbereichen geht, da funktioniert das ja auch genauso. Die funktionieren dann besonders gut, wenn die Leute nicht mehr angetrieben werden müssen, sondern das selber tun. Das ist wieder eine sehr kapitalismuskritische Perspektive. Man hat da sicherlich auch positive Aspekte drin, wenn man frei genug und sicher genug und etabliert genug ist und selbstbewusst ist und genug gebildet ist und so weiter und so fort, um sich dann da auch wieder seine eigenen Freiräume zu schaffen, ist das was anderes. Aber wenn man das eben nicht hat, dann fehlt dann diese Unterdrückung da einfach immer stärker und eben auch sozial verstärkt. So was, was bist du schon vor 18 Uhr gegangen, so ungefähr.
Nils:[27:52] Wir sind auch an dem Punkt, wo trotz allem das Leben für viele Menschen in gewisser Weise leichter geworden ist. Weil wir für bestimmte Dinge halt nicht mehr so viel tun müssen. Also bestes Beispiel, wie komme ich an Musik? Sie ist billiger geworden, sie ist zugänglicher geworden, ich muss jetzt nur noch suchen und klicken.
Nils:[28:15] All das, also das Leben ist leichter geworden, auch Grundnahrungsmittel sind billiger geworden und ähnliches. Es nicht heißt, dass es nicht immer noch Leute gibt, denen das schwerfällt, das zu finanzieren, das will ich gar nicht implizieren und dann ergreifen sie dann auf Sloterdijk zurück, das fand ich auch ganz spannend ist aber auch ein Argument, das kommt nicht nur von ihm dass wir natürlich eine Gesellschaft leben, der es immer schwieriger fällt irgendwelche Gratifikationen irgendwelche positiven Gefühle aufzuschieben zu sagen, ich spare jetzt mal zwei Jahre und dann kaufe ich mir irgendwie den Computer, nein, ich kaufe den Computer jetzt und finanziere ihn so, das vielleicht auch nochmal als Beispiel und dass wir da immer weiter uns hin bewegen und das auch nicht aufhört bis jetzt und jede Forderung nach einer Zügelung als Überforderung wirkt. Also wie, ich kann das nicht jetzt sofort, das kann ja nicht sein und das darf ja nicht und ich muss das aber jetzt sofort kriegen.
Nils:[29:08] Und interessanterweise, das machen sie jetzt glaube ich nicht explizit, ist ja genau dieses Aufschieben von Belohnung, ist ja im Grunde das, was Weber als Kern der protestantischen Ethik ausmacht. Und so im Grunde ja als Grundlage des Kapitalismus und das haben wir uns jetzt aber wieder abgewöhnt und dann wird es halt schwierig, dann kommen wir halt in Konflikte. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt, weil sie auch von einem libertären Autoritarismus reden, das klingt ja auch erstmal nach einem begrifflichen Widerspruch und das machen sie jetzt hier das erste Mal auf, weil sie sagen, im klassischen Autoritarismus ist dieser Triebverzicht, also diese Fähigkeit, irgendwie Belohnung aufzuschieben oder zu warten, bis irgendwie was passiert oder auf etwas hinzuarbeiten, ist die an eine Führungsperson gebunden. Hängt das an einem Menschen, der sozusagen uns hilft, uns zu kontrollieren? So, kann man jetzt gut finden, also hat seine Vorteile, hat seine Nachteile an der Stelle.
Nils:[30:09] Im libertären Autoritarismus, also das, was die beiden diagnostizieren, Da unterwirft man sich eben nicht der Person, sondern dem eigenen Gefühl sozusagen, dem eigenen Blick auf die Welt, der eigenen Freiheit. Und das ist, glaube ich, das, was sie mit diesem libertären Autoritarismus meinen, dass ich mich nicht mehr der Person, einer externen Person unterwerfe, sondern irgendwie einem, ja im Grunde, wenn man es mit Freud sagen will, dem Ich, komplett. Und dass ich gleichzeitig geschwächt wird, weil wir eben immer mehr, immer stärker diese sofortige Gratifikation irgendwie anstreben und dann dem, bei Freud wäre es das eh, dem S irgendwie den Raum lassen und uns dem dann auch noch komplett unterwerfen, weil es eben anders als den klassischen Autoritarismus nicht die Führungsperson von außen gibt, die das sozusagen verstärkt. Ich weiß nicht, ob ich das Autoritarismus, Ich finde das eher so ein Paternalismus oder sowas irgendwie in den begrifflich nehmen, aber der Kontrast wird, glaube ich, trotzdem deutlich.
Nils:[31:18] So, was haben wir noch? Wir haben noch eine andere Sache, wo wir so ein bisschen das Problem haben, dass wir so eine gewisse Unterwerfung irgendwie brauchen. Das ist nämlich, dass unsere Gesellschaft immer abhängiger geworden ist vom Wissen. Vom Wissen, wie Dinge funktionieren, wie unsere Technologie funktioniert, wie irgendwelche bürokratischen Abläufe funktionieren und so weiter. Und dass die Risiken, die wir in dieser Gesellschaft haben, immer diffuser werden.
Nils:[31:48] Also das große Risiko ist im Normalfall bei den meisten Menschen in unseren Gesellschaften nicht, dass wir diese Woche verhungern. Das Risiko ist eher, dass wir in einem Jahr unseren Job verlieren, weil KI. Oder dass wir in zehn Jahren irgendwie wegmigrieren müssen, weil unsere Region zu heiß wird. Das sind eher so diffuse Risiken, die weit weg sind und die erleben wir nicht mehr selbst. Dafür brauchen wir jemanden, der sie uns nennt. Das sind irgendwie Experten logischerweise oder ExpertInnen, die gleichzeitig dabei auch noch immer spezialisierter werden. Ich fand das sehr, sehr schön, sehr, sehr spannend zu beobachten, als wir mitten in Corona steckten. Gab es ja in Deutschland diesen Corona-Podcast mit Christoph Trosten, dem Virologen, der dann wirklich irgendwie gefragt wurde nach dem Vergleich zur Grippe. Und der dann erstmal ansetzte und drei Minuten erzählte, wie wenig er eigentlich über die Grippe weiß und dass er da nicht Experte für ist. Dass er jetzt erstmal nur so als allgemeiner Mediziner antworten kann, dass es da aber bessere Experten gibt, die das besser erklären können. Er wäre ja nur Experte für die Coronaviren.
Nils:[32:53] So, das ist genau diese Spezialisierung, wo sich die Experten, ExpertInnen dessen auch meistens sehr bewusst sind. Manchmal auch nicht, wenn sie dann irgendwie über gesellschaftliche Themen reden, von denen sie weniger Ahnung haben als andere, aber da kommen wir nachher noch zu. Aber diese Experten werden dann eben auf einmal, gerade wenn wir in so Situationen sind, wo wir im hohen Maß von Wissen abhängig sind, wie Klimakatastrophe, wie Corona-Pandemie, werden die auf einmal auch als politische Machtfiguren wahrgenommen. Was sie ja faktisch auch in gewisser Weise sind. So, da wird dann auch, ja, ich bin hier nur der Wissenschaftler, ich gebe hier nur die Wissenschaft wieder. Ich verstehe das aus der einen Position, aber andererseits, nee, tust du nicht, weil wissenschaftliche Autorität hat eine Machtposition. Und wenn du die gerade äußerst, dann machst du auch eine politische Äußerung in gewisser Weise. Das muss ich zumindest nicht wundern, wenn es so wahrgenommen wird. Weil wir da auch als Gesellschaft einfach schlecht gelernt haben, mit umzugehen. Und so gibt es halt auch einfach in den Spezialgebieten immer mehr Wissen und es gibt immer weniger Menschen, die die Welt wirklich verstehen. So in ihren komplexen, groben Zusammenhängen auch einfach. Weil dieses Wissen eben immer spezialisierter wird und immer genauer wird und man eigentlich selbst bei den gut gebildeten Leuten immer weniger Leute hat, die so alles im Großen und Ganzen verstehen, meistens immer nur in ihren Teilgebieten sind.
Amanda:[34:17] Würdest du das so unterschreiben? Für mich klingt das so, ich verstehe das, wenn man sich 300, 400 Jahre zurück begibt und dann irgendwie so eine allgemeine Gelehrtheit, konstatieren kann. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so als aktuelle Gegenwartsdiagnose auch so sehen würde?
Nils:[34:40] Doch, würde ich schon. Einfach weil die Prozesse so komplex sind. Also wenn man jetzt, also wenn man darauf blickt, was passiert, warum schaffen wir es nicht, auch wenn 90 Prozent der Leute sagen, wir brauchen mehr Klimaschutz, warum schaffen wir es nicht ernsthaft, das Thema ernsthaft anzugehen? Das ist ein ganz komplexer Prozess im Hintergrund. Nicht nur einer, sondern ganz viele.
Amanda:[35:03] Ich frage mich dann, ob der Prozess, dass der komplex ist, das verstehe ich, dass die Sache an sich komplex ist auch, aber es ist ja, ich sage mal, der Output von Klimakrise oder was wir tun müssen, das ist ja eigentlich ganz einfach.
Nils:[35:17] Ja, aber das ist richtig, aber wie man es hinkriegt.
Amanda:[35:21] Und da meinst du, würde es helfen, also da gäbe es Leute oder da gab es früher Leute, die das besser überblicken konnten.
Nils:[35:30] Weil die Strukturen einfacher waren.
Amanda:[35:31] Im Sinne von…
Nils:[35:31] Also auch wenn wir jetzt in den Kalten Krieg zurückdenken, geopolitisch, ließ sich dann doch ein sehr gewaltig großer Teil aller Entwicklungen auf die zwei Blöcke reduzieren mit China, das irgendwie noch so ein bisschen die Füße stillgehalten hat. Wenn man jetzt da reinguckt, ist das an so vielen Stellen so unterschiedlich individuell komplexe Dynamiken. Ich meine, vielleicht kennt man sie jetzt auch nur besser, dass man jetzt weiß, dass man jetzt zumindest eine Ahnung hat, wie komplex es ist, ohne es wirklich zu durchdringen. Dass man früher noch nicht mal geahnt hat, wie komplex es eigentlich ist, das könnte auch sein.
Nils:[36:04] Aber wir haben, wie war das mit dem, wer sagte doch auch immer, es gibt wahrscheinlich keinen Menschen auf der Welt mehr, der wirklich komplett weiß, wie ein Computer funktioniert. So, es gibt Leute, die irgendwie die Hardware-Architektur kennen, es gibt Leute, die die Physik und die Elektrotechnik dahinter kennen, ein bisschen ins Detail, es gibt die Leute, die das kennen, die jenes kennen, aber jemand, der so wirklich alles kennt, was wir da gebaut haben, gibt es in der Form nicht mehr. Das ist glaube ich so ein bisschen eher die Richtung in die das geht, das geht eher so in dieses wir haben nicht mehr das ausreichende Wissen über die Welt um uns selbstwirksam in ihr bewegen zu können das ging früher vielleicht auch noch einfacher, weil die Strukturen, in denen wir uns bewegen mussten einfachere waren da war es halt der Dorfstammtisch mit 20 Leuten und nicht mehr Twitter mit 200 Millionen Nutzenden so, also das ist glaube ich eher der Punkt das ist ein berechtigter Einwand
Nils:[37:05] Genau. Was sie dann eben auch sagen, wir haben immer mehr Bildung, aber immer weniger Wissen. Fand ich auch ganz spannend. Also der Anteil dessen, was wir in der Bildung noch vermitteln können, von dem, was man eigentlich wissen müsste, wird immer kleiner. So würde ich das jetzt interpretieren. und wir sind auch in der Gesellschaft, die auf der einen Seite berechtigterweise aus so einer sozialkonstruktivistischen Wissenschaftskritik, also die auch einfach mal so ein bisschen den sozialen Aspekt von Wissenschaft betont, so dieses Thema feministische Mathematik, das sind ja so Dinge, die dann gerne mal weggelacht werden auf der einen Ebene, dass das auf der einen Ebene ein ganz wichtiger Punkt ist, dass das auf der anderen Ebene aber auch ein Aspekt ist, der Wissenschaftsskeptiker eine Munition liefert. Weil das ist ja auch nur eine Meinung. Wenn Wissenschaftler sich nicht so sicher sind, wenn die das nicht sicher wissen, dann ist meine Meinung genauso viel wert wie deren. Auch ein Top-Hosen-Motiv, was wir in der Corona-Zeit doch immer wieder gesehen haben.
Nils:[38:05] Damit sind wir in einer Struktur, wo eigentlich mehr Vertrauen in Experten, Expertinnen nötig wäre. Die wissen schon, wo dieses Vertrauen aber erodiert. Und das ist natürlich eine gefährliche Situation, weil das ist genau der Moment, wo dann so Individualperspektiven entstehen. Sieht das auch ganz schön, muss ich gerade dran denken, ich glaube, ich habe das Buch nicht hier vorgestellt. Ich habe hier vorgestellt von Christoph zusammen, haben wir die Vereindeutung der Welt in der Episode 20, haben wir das, glaube ich, gemeinsam vorgestellt. Da gibt es noch ein ausführlicheres Buch zu und auch Bücher von anderen Autoren, die eben auch sowas wie religiösen Extremismus darauf zurückführen, dass wir eine Individualisierung haben. Klingt erstmal paradox, aber die halt sagen, ja, weil es eben nicht mehr die eine Autorität gibt oder in anderen Religionen noch nie gab, die gesagt hat, so ist die Auslegung und die auch mal eine Änderung der Auslegung, eine Anpassung der Auslegung an moderne gesellschaftliche Gegebenheiten irgendwie vorgenommen hat, ist es jetzt so, ja, interpretier du das mal für dich. So, und das führt dazu, dass es dann eben nicht offizielle und individuelle Gurus, sag ich jetzt mal halbwegs religiös neutral, gibt, die ihre Interpretation anbieten und die dann natürlich einfach, weil sie einfach ist, weil sie attraktiv ist, irgendwie aufgegriffen wird und dann diese Menschen mobilisieren können, für was auch immer sie sie mobilisieren wollen. Ich versuche mal, das möglichst neutral zu formulieren.
Nils:[39:32] Fand ich auch ein spannendes Argument. Das machen die jetzt hier nicht explizit, aber ich glaube, das ist ziemlich genau dieses Motiv, was wir da auch nochmal sehen.
Amanda:[39:39] Okay.
Nils:[39:41] Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir eben als Gesellschaft dieses Nicht-Wissen-Können, das tut uns irgendwie in unserem Weltbild weh. Da sind wir auch wieder bei dem Philipp Blom und wir dominieren die Welt und wir können das alles und wir Menschen sind die Größten und die Besten. Und jetzt auf einmal haben wir das Gefühl, wir wissen da ganz viele Dinge nicht und da passieren Dinge, die wir nicht abschätzen können. Und da sehen Sie so zwei Reaktionen. Das eine nennen Sie sehr schön epistemische Regression. Das heißt, wir kündigen einfach das Prinzip auf, dass es sowas gibt wie eine echte Realität. So, da sind wir jetzt im Grunde bei den linken Sozialkonstruktivisten in der Soziologie. Faktisch nutzen tut das aber irgendwie so die Regierung Trump, die man jetzt nicht als linke Sozialkonstruktivisten beschreiben würde.
Amanda:[40:31] Ja, nicht ganz.
Nils:[40:32] Aber da sehen wir auch wieder, wie dieses wissenschaftliche Motiv, Argument, wie das in einem anderen Kontext gesetzt, höchst destruktive Folgen hat. Weil es eben nicht mehr ein wissenschaftliches Prinzip bleibt, sondern absolut gesetzt wird.
Amanda:[40:47] Ja.
Nils:[40:47] Was natürlich auch mal ein dummer Gedanke ist. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist, dass sich so, das ist auch wieder was, was Sie, glaube ich, primär aus Corona abgeleitet haben, so eine Identität über geteiltes, exklusives Wissen. Also sagen, ja, wir sind hier die Insider, wir wissen, wie es wirklich ist und das ist nicht das, was der Mainstream sagt und es geht dabei eigentlich gar nicht so sehr um das Wissen und irgendwie um das Handlungsfähigsein und darum Corona zu verhindern, sondern es geht darum, eine soziale Kohäsion in einer bestimmten Gruppe herzustellen und Identität zu schaffen. Und in dieser sozialen Gruppe gibt es dann eben genau wieder dieses, ich habe das Gefühl, ich verstehe das, ich kenne das. Es gibt die eine Person oder die zwei Personen, die sagen mir dieselbe Wahrheit. Und so ergibt sich eben eine soziale Kohäsion, bei der es ums Inhaltliche eigentlich gar nicht mehr geht. Das fand ich auch einen spannenden Punkt. Also wir haben da auch einfach dieses andere Verhältnis zum Wissen.
Amanda:[41:42] Und anders auf welchen Bezugspunkt hingesehen als früher?
Nils:[41:52] Ich glaube, sie würden das tatsächlich sowohl als eine Entwicklung auf der Ebene der Jahrzehnte als auch der Jahrhunderte verstehen. Weil ich glaube, es ist eher eine Entwicklung dieser Aspekt, eher der Jahrzehnte tatsächlich. Also ich glaube nicht, dass sie da jetzt so eine 17., 16., 17., 18. Jahrhundertwelt vor Augen haben im Kontrast. Weil da war ja einfach der Zugang zu Wissen generell noch ganz anders strukturiert. Also ich glaube schon, dass sie das jetzt gegenüber so einer 50er, 60er, 70er, 80er-Jahre-Welt, der Welt des 20. Jahrhunderts, wie man so schön sagen kann, glaube ich, da machen sie den Kontrast auf. Und dann so die letzten 10, 20 Jahre, dass sich das massiv verschoben hat.
Amanda:[42:31] Ja, ich finde das interessant, das mit der epistemischen Regression. Ich finde halt auch diese ganze Diskussion mit ExpertInnen, vertrauen wir darauf. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man früher das einfach akzeptiert hat. Man hat akzeptiert, dass es Menschen gibt, die mehr wissen als man selbst. Und man musste nicht versuchen, das zu hinterfragen. Ich hatte mal eine Diskussion geführt, da hat mir eine Person gesagt, Corona gibt es nicht, weil man hat den Virus noch nie gesehen. Und dann, klar, wo beginnt man dann? Also wenn man nur an Dinge glaubt, die man selbst gesehen hat, ja dann ist man, also dann, das muss, da kommt man zu keinem geteilten Weltbild mehr. Also da verstehe ich diese epistemische Regression, dass das darin mündet, finde ich dann ganz plausibel. Also ich tue mich ein bisschen schwer mit dieser ExpertInnen-Diskussion. Deshalb, weil ja schon auch jetzt in den Entwicklungen, sagen wir in den USA, ist es ja schon so, dass diese eigentlich meiner Meinung nach aus demokratischer Sicht viel zu viel Gewicht kriegen. Also im Sinne von nicht mehr legitimiert demokratisch, sondern ich sage mal auch viel selbsternannte ExpertInnen.
Nils:[43:57] Und da ist auch wieder die große Gefahr, wer bestimmt eigentlich, wer ein Experte ist und da kommen genau die sozialen Strukturen wieder ins Spiel, das ist natürlich eine demokratische Partei, andere Personen als Experten benennt, als eine republikanische Partei ja, exakt aber ich glaube, da sind wir genau an diesem Punkt, wo wir auch bei der Spezialisierung sind und wo wir auch dieses Gesamtwissen irgendwie da nicht mehr haben, also wenn selbst ein Experte, wie jetzt ein Virologe wie jetzt ein Christoph Drosten, was man von halten mag oder auch nicht Ich glaube, sein Hintergrund ist erstmal unbestreitbar. Wenn selbst der halt sagt, ich kann nicht sagen, wie wir politisch darauf reagieren sollen. Wenn der selbst sagt, ich kann nur über diesen einen Virus was sagen. Weil da spielen aber natürlich so viele Dinge zusammen, gerade auch in der Zeit, als man noch nicht so viel wusste. Wenn dann selbst die Experten sagen, wir wissen nicht so genau und wir versuchen jetzt mal und wir gucken mal, es müsste eigentlich in diese Richtung gehen, dann braucht das schon sehr, sehr viel Reflexion, gerade wenn man noch eine Gesellschaft kennt, in der das Expertenwort das Armen war, sozusagen, ist das sehr, sehr schwierig, damit umzugehen, glaube ich.
Amanda:[45:07] Ich finde aber sogar, dass es eigentlich in eine lernunfreundliche Situation mündet. Nehmen wir mal als Beispiel, wenn es um Ökonomie geht. Da gibt es viele ExpertInnen. Aber was nimmst du denn als Referenzpunkt? Du kannst sagen, diese Ökonomie, keine Ahnung, hat in den 20 Jahren von 1940 bis 1960 funktioniert. Sind das jetzt nun die ExpertInnen, die, ich sage mal, valide Argumente haben? Sind es diejenigen, die danach gekommen sind? was auch für eine Zeitspanne sehr wohl funktioniert. Und da sehe ich halt ein bisschen das Problem, ja, also was nimmt man denn da? Weil für mich mündet das, du kannst nicht die Daten nehmen und kommst dann zu einer informierten Entscheidung, sondern du bist in einem System drin, das eben Lernen unfreundlich ist, in dem Sinne, dass du keine, also die Entscheidung, die wir treffen müssen, die muss oder die wird insofern einfach getroffen, weil wir sie demokratisch treffen jetzt bei uns. Ja, aber das.
Nils:[46:03] Ist ja glaube ich glaube ich, genau dieses Argument, was die beim Thema Wissen machen. Es gibt, oder wo wir auch gerade über dieses, niemanden, der das Gesamte mehr überblickt. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Es gibt die Experten für die neoklassische Ökonomie, für den Keynesianismus, für den Neokensianismus und jetzt auch für die Modern Monetary Theory und ich habe nicht einen Experten, der alles kennt und dazwischen abwägt, sondern ich habe für jede Theorie ihre ExpertInnen. Und alleine diese Entscheidung, die ich dann treffen muss für die brauche ich im Grunde auch schon wieder jemanden, der mir diese Expertise geben kann, zu sagen okay, was ist denn jetzt für die jetzige Welt das Bessere, was immer das auch heißt dann kommen wieder die demokratisch bestimmten Ziele ins Spiel das ist glaube ich genau die Schwierigkeit, diese Abgrenzung zwischen wo sind wir bei demokratischen Entscheidungen und wo sind wir bei einfach ja, wenn du Corona verhindern willst, haben wir nichts Besseres als Impfen. So, jetzt entscheide ich, ob du das verhindern willst oder nicht. Und diskutiere nicht, ob eventuell Pferdebleiche wirkt.
Nils:[47:13] Ich glaube, das ist genau dieses Spannungsfeld, was die da aufmachen. Und wo man sich als, gerade wenn man nicht diese Debatten jetzt seit Jahren verfolgt mit einer gewissen Reflexion, einfach weil man durch eine wissenschaftliche Ausbildung gegangen ist, auch zum Teil, oder auch durch eine, die gleichzeitig noch Selbstreflexion ermöglicht, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, wenn man das nicht hat, dann ist das extrem schwierig, sich da drin zu orientieren es fällt ja uns schon schwierig wenn wir gerade in Diskussion gemerkt haben wir haben da ja nun wirklich alle Vorteile mitbekommen, die man so mitbekommen kann genau, so jetzt haben wir noch zwei kleine Punkte, das erste ist auch eine gewisse Frustration mit der Demokratie weil sie einfach durch diese Vielschichtigkeit und die Pluralisierung einfach langsam wird und während die Gesamtgesellschaft sich immer schneller entwickelt und die Technologie sich immer schneller entwickelt, sind wir in der Entscheidungsfähigkeit werden wir immer langsamer was einfach die Demokratie mit sich bringt wenn man sie plural denkt, was wir ja im Grunde dann doch wollen und nach das ist wieder eine Enttäuschung vom System das verspricht so viel, aber es hält es nicht
Nils:[48:23] Und dann haben wir auch, dann kommen wir auch genau zu diesem Aspekt, den du gerade angesprochen hast, zu dem Thema Alternativlosigkeit Dann kann man halt am Ende nur noch auf die zwei Experten hören, die man gerade halt mal berufen hat, weil sie aus irgendeinem Grund im sozialen System Wissenschaft gerade an der Stelle sind, dass sie halt die Personen sind, die man fragen muss. So, und dann ist die Selbstwirksamkeit für den Einzelnen endgültig weg. Und auch noch ein Aspekt, da kommt jetzt das Buch, was ich vorhin kurz angeschnitten habe raus von Mark Fischer, der Capitalist Realism dass wir auch einfach nicht mehr in der Lage sind, ganz viele dieser Krisen und dieser Entwicklungen auf ihre gemeinsame Ursache zurückzuführen das ist nämlich der Kapitalismus den setzen wir als gegeben und hinterfragen ihn nicht mehr und dann haben wir auf einmal 10 verschiedene Probleme wo wir sagen würden 6 von denen ließen sich vielleicht dadurch beheben wenn wir mal ernsthaft nachdenken ob wir das nicht ein bisschen anders an der Stelle zuschneiden. Und das ist auch nochmal so ein, es wirkt irgendwie so unkontrollierbar, weil wir über das eine, was vielleicht tatsächlich ein gemeinsames Problem sein könnte, nicht nachdenken können oder wollen.
Nils:[49:29] Und vor allem diesem diffusen Hintergrund, wozu hat das geführt, dass wir Freiheit anfangen, das ist jetzt ein bisschen deren theoretisches Fazit, dass wir anfangen, Freiheit als einen individuellen Besitzstand zu verstehen und nicht als einen gesellschaftlichen Zustand. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Begrifflichkeit, dass wir sagen, ich besitze meine Freiheit, nicht wir als Gesellschaft sind frei. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, weil es eben ignoriert, dass Freiheit durch Gesellschaft und Staat durchgesetzt werden muss. Ich bin nur dann wirklich frei, wenn der Staat oder irgendjemand meinen Nachbar daran hindert, mich zu verkloppen, wenn ich aus der Wohnungstür gehe. So, ich überspitze jetzt mal. Also im Grunde schon mal Thomas Hobbes.
Nils:[50:18] Und wozu führt das, dass wir eben sämtliche gesellschaftliche Anforderungen, nicht nur staatliche Anforderungen, sondern auch so moralische Anforderungen in gewisser Weise als eine Zumutung empfinden. Also diese negative Konnotierung des Begriffs moralisieren, finde ich da sehr, sehr, sehr schön. Seit wann ist Moral was Negatives geworden? Wo sind moralische Anforderungen auf einmal was Negatives geworden, was Böses, wo man ausweichen muss? Dass man mal mit ihnen spielt und mal sich nicht so ganz an sie hält und mal bei ein oder zwei Sachen sagen, ja das ist jetzt irgendwie das ist jetzt nicht so meins, okay aber dass Moral an sich etwas Negatives geworden ist es führt eben dazu, dass dieses neue Freiheitsbild nicht nur gegenüber dem Staat gilt, sondern gegenüber allen Normen und dann fängt es halt an schwierig zu werden
Nils:[51:13] Ja und was wir dann haben ist eben auch, dass sich im Grunde so unser Begriff des Freiheitskampfes im Grunde verändern muss der Freiheitskampf üblicherweise war wir müssen das Subjekt befreien aus der individuellen Unterdrückung das haben wir jetzt zum Großteil geschafft wo wir jetzt hin müssen ist die gesellschaftliche Bedingtheit der Freiheit wieder klar zu machen
Nils:[51:40] Da gab es doch, wer war es? Joachim Gauck mit seinem Buch Freiheit in Bezogenheit. Ich habe es nicht selber gelesen, aber der Titel klingt sehr genau nach dem, was gemeint ist. Dass Freiheit eben ein gesellschaftlicher Zustand ist und nicht ein individueller Besitzstand. Und dass es eben auch dazu gehört, um die gesellschaftliche Freiheit zu sichern, die individuelle Freiheit einzuschränken. An gewissen Stellen. Und das ist eben genau das, wo dieser libertäre Autoritarismus eben sagt, nein, die Gesellschaft hat kein Recht, die individuelle Freiheit einzuschränken. So, und wenn wir das dann wieder ernst nehmen, dann kommen wir genau an den Punkt, weil da sind wir ja jetzt auch in vielen Bereichen schon, wo genau diejenigen, die halt eine gewisse Machtposition haben, über Machtmittel verfügen, die können sich genau diese Art von Freiheit leisten und kaufen und sichern. Die, die nicht haben, können das eben nicht. Und da kommt jetzt der nächste Punkt, die sind das aber nicht individuell schuld, dass sie das nicht können, das ist ein gesellschaftliches Problem, dass sie das nicht können. So, und dann schließt sich im Grunde der Kreis zu dem Argument, was wir vorhin hatten. Sie haben da noch, weil wir gerade über den historischen Bogen gesprochen haben, einen ganz schönen Dreiklang, den sie so ein bisschen historisch über das 20., bis ins 21. Jahrhundert ziehen. Ja, schon eher vom 19., 18. Jahrhundert Anfang dann darüber.
Nils:[53:01] Freiheit hieß es erstmal Bürger zu sein. Oder erst wollte das Individuum Bürger sein, dann wollte das Individuum Angestellter sein und jetzt will es kreativer, selbstverwirklicher sein. Das fand ich einen schönen Sprünger sozusagen, nur als Motiv. Genau, das war der theoretische Rahmen. So, und jetzt kommen wir noch zu diesen drei kurzen Gruppen. Das halte ich jetzt aber mal bewusst ein bisschen kurz, weil wir sind schon fast an der Stunde dran. Also sie beschreiben dann noch drei Gruppen von libertär-autoritären sozusagen. Sagen, das sind einmal die gefallenen Intellektuellen, das sind die Querdenker, ich weiß nicht, ob sie sie Rassisten nennen, aber im Endeffekt ist es genau das. So, und die klassischen Intellektuellen, oder die gefallenen Intellektuellen, das sind klassische Intellektuelle, die keinen Platz mehr in der Gesellschaft haben, weil ihnen eben all ihre Funktionen, all ihre Rollen weggenommen worden sind. Es sind nicht mehr die progressiven Aufklärer an den Universitäten, weil das ist mittlerweile so differenziert, diffundiert, das machen so viele Leute an so vielen Stellen, das ist so Mainstream geworden, damit kann man irgendwie keine Position mehr beziehen. Eine andere Position ist die revolutionären Aufwiegler.
Nils:[54:24] Ja, so diese progressive Revolution, die haben wir gerade nicht, die ist gerade nicht, die hat gewonnen im Grunde, erst mal, auf einer gewissen Ebene würde ich das schon so sagen, und ist der Anwalt für Schwache. Dafür braucht es die auch nicht mehr, weil die Schwachen können das mittlerweile auch selber.
Nils:[54:44] Und sie sind halt auch eher Generalisten und die Generalisten schaffen es nicht mehr, das ganze Spezialwissen tatsächlich angemessen zu generalisieren das heißt, sie haben im Grunde all ihre Rollen verloren und brauchen jetzt irgendwie so ein bisschen eine neue Rolle, sag ich jetzt mal
Nils:[55:09] Sie werden dann auch noch ständig durch die Wissenschaft widerlegt, weil das, was sie vor 30 Jahren mal irgendwann in ihrem Studium gelernt haben oder sich auch mühsam selbst erarbeitet haben, will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Das gilt halt in der Form nicht mehr. Und auf einmal fehlt irgendwie so ein bisschen das, ja, was mache ich hier eigentlich noch? Und dann kommen wir genau wieder zu diesen Gruppen mit dem Spezialwissen. Das sind halt genau so Gruppen, die noch einen revolutionären Aufwiegler brauchen, die sich als Schwache fühlen und Anwalt wollen und wo es auch wieder Aufklärung braucht, nämlich von diesem Spezialwissen, was eben nicht irgendwie im Mainstreaming-System etabliert ist. Ja, das ist so ein bisschen deren Charakterisierung ein bisschen zugespitzt. Ich sehe dich lachen, ich höre dich lachen. Du scheinst das nachvollziehen zu können.
Amanda:[56:02] Ja, klar.
Nils:[56:06] Und in dem Kapitel, das hat aber eigentlich jetzt gar nicht mit dem Thema so viel zu tun, kommt noch ein schöner Gegensatz. Der progressive Blick will einen geregelten Markt und eine freie Gesellschaft. Der konservative Blick will einen freien Markt und eine geregelte Gesellschaft. Fand ich einen schönen, fand ich auch ein schönes Schlaglicht sozusagen aus dem Buch. So, das waren die gefallenen Intellektuellen. Dann kommen wir zu den Querdenkern. Ich weiß nicht, gibt es diese Diskussion unter dem Namen, gab es die in der Schweiz auch in der Form oder
Amanda:[56:36] Ähm, ja, ich frage mich gerade, sag mal, mach mal das Argument und dann weiß ich vielleicht den Begriff.
Nils:[56:46] Also Querdenker sind an der Stelle, das war halt primär in der Corona-Zeit eben die, die sich so dem Corona-politischen Mainstream entgegengestellt haben aus der Perspektive, das ist Freiheitseinschränken, Corona gibt es doch nicht und das ist alles eine Verschwörung und die Pharmaindustrie und so weiter und so fort. Also diese Kritiklinie im Grunde an der Corona-Politik nicht die Kritiklinie, es macht zu wenig, das ist nicht und so weiter und so fort, sondern eher so dieses, was jetzt in Deutschland sich in echten Rechtspopulismus im Grunde bewegt hat. Genau da sehen die, wolltest du was sagen?
Amanda:[57:19] Ja, also die gab es natürlich bei uns auch, ja. leider dann oft so ein bisschen als Schwurbler bezeichnet, wenn dann halt wieder so Elemente von Verschwörungsideologien reinkommen. Ich bin da nicht so Fan von solchen Charakterisierungen, weil das, ja, ich finde das, man muss das definieren, was man damit meint.
Nils:[57:39] Ja, ja, genau. Also Sie haben halt, in Deutschland gab es halt diese politische Bewegung, wo man eben geguckt hat, die war inhaltlich auch sehr diffus, die ließ sich schwer und Sie versuchen jetzt halt so ein bisschen das zusammenzubringen. Warum treffen sich genau diese Gruppen? Und das hast du gerade schon den Schwurbler-Aspekt sozusagen angesprochen. Das kommt dann tatsächlich, das taucht auch auf. Also bei denen, sie argumentieren einmal diesen Aspekt, auf einmal greift der Staat auch in das Leben der Mittel- und Oberklasse ein. Auf einmal merken die auch mal staatliche Regressionen, staatliche Regulierung, wie sie bei den Armen, bei den Benachteiligten schon immer war. So, das ist natürlich erstmal eine Kränkung. dann haben wir eben tatsächlich auch diese enge Verzahnung von Wissenschaft und Politik. Wir haben eine politische Wissenschaft und eine wissenschaftliche Politik. Es klingelt kurz an meiner Tür. Ich bin in einer Minute wieder da. Dass wir da dann genau diesen Aspekt auch haben, ich muss kompliziert, es ist sehr komplex, ich muss sehr schnell handeln, also komme ich genau in diese Alternativlosigkeit rein sozusagen, von der wir gerade auch schon gesprochen haben, wo das im Grunde so Entscheidungen einfach entpolitisiert werden.
Nils:[59:04] Und das berechtigterweise, haben wir ja gerade auch schon angesprochen, führt natürlich auch zu einer gewissen Reaktion und zu einer gewissen Reaktanz vor allen Dingen auch. So will ich das nicht und dann stelle ich mich dem entgegen. Dann ist das tatsächlich auch so dass diese Gruppe und jetzt kommen wir in dieses Identitätsthema rein sich auch einfach als eine nicht respektierte Minderheit verstehen und sehen wobei dieses nicht respektiert da kann man jetzt sehr viel drüber diskutieren weil wenn es um Talkshowpositionen und ähnliches geht kann man nicht behaupten, dass das nicht Thema gewesen wäre und nicht irgendwie angesprochen worden wäre es hat sich halt nachher im demokratischen Prozess nicht politisch durchgesetzt oder ich würde auch nicht sagen, dass es sich nicht durchgesetzt hat es hat halt einfach Einfluss genommen vielleicht in dem Auge nicht weit genug politisch durchgesetzt. Aber dann sind wir wieder im demokratischen Prozess und da haben sie dann auch noch mal so ein schönes, nee, dann ziehen sie noch den Bogen zu dem, die Verbindung eben zum linksökologischen Milieu, also zu dem, was man so Richtung Esoterik oder das, was du jetzt gerade als Schwurbler, also in Deutschland war das weniger die Verschwörungstheorie als eher so dieses esoterische, es gibt ja keine Viren, weil ich habe sie noch nie gesehen, was du gerade auch angesprochen hast, wo sich dann auch Esoterik und Verschwörungstheorie so ein bisschen vermischen, die ja schon immer so ein bisschen den Aspekt des exklusiven Wissens und
Nils:[1:00:27] Der Gegenposition gegen das Mainstream und auch gerade gegen eine Naturwissenschaft sozusagen hatten, ist das natürlich für die dann massiv anschlussfähig. Weswegen dann auch eben genau Menschen, die sich immer eher als links gesehen haben, auf einmal auch in diese Gruppe, in diese Bewegungen fallen oder sich da zuordnen und dann auch verständlicherweise ein Problem damit haben, wenn sie auf einmal rechtspopulistisch genannt werden, weil sie sich ja selber immer irgendwie als links gesehen haben. Aber sich da eben genau, weil dieses Gegenwissen Motiv so ein bisschen die politische Seite gewechselt hat,
Nils:[1:01:01] Sich jetzt auf einmal mit ungewohnten Verbündeten sozusagen konfrontiert sehen. Fand ich ein spannender Punkt. Und diese Gruppe zieht dann eben ihre Legitimation so ein bisschen aus dem Widerstand zur Mainstream. Das ist so ein bisschen dieses, wir stellen uns dagegen, weil die respektieren uns nicht. Das ist eine kalte Gesellschaft und nicht eine warme Gemeinschaft. Das ist auch noch so eine Rhetorik, die sie aufgreifen, wo sich dann eben genau so eine Blase sozusagen bildet.
Amanda:[1:01:32] Okay, aber dann wieder Mainstream aus deren Sicht.
Nils:[1:01:35] Ja, genau, klar. Ja gut, ich meine, das ist glaube ich genau dieser Punkt, wo Nachtwey und Amlinger auch sagen, also ich glaube, sie würden sagen, der progressive Blick hat auf vielen Ebenen gesellschaftlich tatsächlich, gewonnen ist übertrieben, aber es ist der Mainstream geworden an vielen Punkten. Da ist ja auch eine Menge dran. Weil man sieht jetzt gerade in den USA mit der Regierung Trump 2, sieht man mal, was es eigentlich alles an Errungenschaften gab, die gerade wieder abgesägt werden. Also aus so einer Perspektive denken sie, glaube ich, daran. Das ist ja auch dieses Motiv, der Fortschritt ist da, aber er bringt sozusagen seinen eigenen Downfall gleich mit sich. Das ist ja auch was, was dem Marxismus als Motiv, als Argument jetzt nicht fremd ist. Und ich glaube, das würden sie schon sagen, Dass wir sehr, sehr weit gekommen sind in vielen Dingen und das, was früher eben nicht der Mainstream war, das ist jetzt immer mehr Mainstream geworden, aber weil es dann halt doch nicht um das Inhaltliche ging, sondern eher um die Gemeinschaft des gegen den Mainstream-Seins, hat man jetzt auf einmal aus einer politischen Perspektive von oben gewisserweise die Seite gewechselt. Das ist, glaube ich, ein bisschen das Argumentationsmotiv, was da drin steckt.
Amanda:[1:02:55] Ja, ist ja auch so ein bisschen das Selbstverständnis. Wir sind weder links noch rechts. Genau.
Nils:[1:03:00] Wir sind dagegen.
Amanda:[1:03:01] Genau.
Nils:[1:03:03] Da ist tatsächlich nach dem Argumentationsmotiv ist da auch was dran. Das wird halt nur gerade in erster Linie von der politischen Rechten mobilisiert. So. Und warum? Das ist jetzt der dritte Punkt. Das schließt jetzt gut an. Das ist nämlich genau die dritte Gruppe, die die Amlinger und Nachtweide aufmachen. Das sind nämlich die Gruppe, die, ich weiß nicht, wie sie sie nennen, ich habe sie jetzt in meinen Notizen Rassisten genannt. Also aber jetzt eher als ein politischer Offengelebter, weniger als der Internalisierte, den wir dann doch zum Großteil mit uns rumtragen.
Nils:[1:03:33] Die haben ganz oft in ihrem Leben irgendwelche Arten von Brüchen erlebt. Also ich muss vielleicht nur dazu sagen, diese drei Gruppen, die wir da haben, sie haben qualitative Interviews geführt. Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Das ist nicht nur eine theoretische Herleitung. Das sind nicht unendlich viele. Sie haben, ich glaube, 20 qualitative Interviews eben geführt mit AktivistInnen aus den verschiedenen Bewegungen und haben daraus dann im Grunde diese Klassifikation gebaut und auch diese Analyse hergezogen. Das hätte ich vielleicht noch im Vorhinein schon sagen sollen. Also was sie bei denen, die sie Rassisten nennen, erlebt haben, die ja meistens irgendwelche Brüche erlebt und machen dafür jetzt erstmal ganz diffus das System verantwortlich. So, weil irgendwer das System heißt jetzt nicht die Politik oder irgendeine verschwörerische Gruppe sondern das kann auch der Chef sein oder das kann irgendwie der Bürgermeister wäre jetzt wieder Politik aber das kann irgendwie alles mögliche sein was ihnen irgendwie von außen aufgedrängt wird, was sie nicht selber irgendwie in der Kontrolle und im Blick haben und dieses diese Brüche und dieser Gräuel gegen das System führt dann zum destruktiven Misstrauen und nicht einer konstruktiven Kritik. So, das ist so ein bisschen so die Gabel, habe ich so das Gefühl, wo die sagen, man kann halt entweder in Richtung konstruktive Kritik und aktives Gestalten erstmal abbiegen oder in Richtung destruktives Misstrauen und dann auch einfach ein Gefühl der Ohnmacht. Weil eben die Selbstwirksamkeit nicht ins Spiel kommt. Das System verspricht uns, wir werden alle gehört, wir dürfen uns alle beteiligen, aber was passiert denn faktisch? Da ist auch wieder genau dieses Motiv.
Amanda:[1:05:03] Ja, wobei ich dann finde, ich verstehe dann die politischen Auswirkungen, sagen wir mal, in einem Zweiparteien-System, wo das hingeht, aber schauen wir auf Deutschland. Das wurde ja dann demokratisch kanalisiert, Wobei damit, also wir haben jetzt da ein Problem konkret mit der AfD, wo man sich dann fragt, ja lassen wir das dann doch zu oder nicht.
Nils:[1:05:27] Ja genau, nur weil es eine Partei in einem demokratischen System ist, so muss ich es formulieren, ist es halt noch nicht unbedingt eine demokratische Partei. Und das ist ja genau das, was wir jetzt auch, wenn ihr das hier hört, vor ein paar Wochen oder noch früher, also wir reden jetzt gerade im Mai 2025. Was wir ja genau gerade hatten durch eben diese Erklärung, diese Einstufung als gesichert rechtsextrem. Das ist genau der Punkt, wo das hinkommt. Und diese politischen Konsequenzen finde ich ganz spannend, dass du das jetzt ansprichst, weil das ist genau der Punkt, den ich als nächstes stehen habe. Warum sich das so wendet, wie es sich gewendet hat. Da ist also dieses Gefühl der Ohnmacht, dieses Misstrauen, dieses Skepsis, dieses Brodelnde auch schon da. Und dann kommt 2015 die große die große Flüchtlingsbewegung. Auch gerade nach Deutschland, dann kommt der markante Satz, wir schaffen das.
Nils:[1:06:25] Und mein Eindruck ist, wir haben das auch geschafft, wenn man mal auf die Fakten guckt. So, das ist ein anderes Thema. Aber das bietet auf einmal einen Kristallisationspunkt für diese diffusen Gefühle. Auf einmal gibt es für zentrale Akteure wieder, oder nicht für zentrale, oder für einzelne Akteure wieder die Möglichkeit, das auf die Ausländer zu schieben. Weil es ist politisch auf einmal groß, es wird drüber geredet und wir hatten das tatsächlich in Deutschland eine ganze Zeit ganz gut gefühlt im Griff, dieses Thema, aber dann 2015 wendet sich das eben mit der AfD steht auch eben eine politische Partei bereit, die das irgendwie aufgreifen kann und dann bietet sich das so ein bisschen als Kristallisationspunkt an, weil es auf einmal etwas gibt, worauf ich diese Gefühle projiziere und wo ich sie andocken kann. Auf einmal bin ich wieder, habe ich wieder handlungsmächtig, weil ich habe jetzt sowas, was ich zu verstehen glaube, wo ich was tun kann, ich kann dagegen demonstrieren und dann wird sich das schon so, dann machen die das schon so. Ich habe auf einmal dieses Thema. Das merkt man auch daran, das geben die jetzt aus ihren Interviews so wieder, da würden mich größere Umfragen tatsächlich interessieren,
Nils:[1:07:36] Dass diesen Rassismus oder diese Forderung nach einer ausgrenzenden Politik, dass die weniger stark, also nicht gar nicht, aber weniger stark kulturalistisch geprägt ist. Klar, das wird immer mal wieder, das ist ein Motiv, aber dann eher aus den schon immer eher rechtsextremistischen Kreisen, sondern ganz stark eher so eine soziopolitische Kritik ist. So, die bekommen das Geld, die nehmen uns irgendwie die Jobs weg, die nehmen uns irgendwie die Wohnungen weg.
Nils:[1:08:07] So, und eben nicht eine kulturalistisch explizite Ablehnung von dem Fremden oder den Ausländern. Weil sonst hätte man ja auch nicht diese Unterscheidung, die man ja auch immer wieder hat von den guten und den bösen Ausländern. Das ist ja auch so ein Motiv. Die, die uns was bringen dürfen, bleiben und die, die uns nichts bringen dürfen, gehen. Das ist eigentlich kein kulturalistisches Argument, weil man zumindest schon mal zugesteht, es liegt nicht daran, dass die Ausländer sind. Sondern es liegt nur daran, dass die Ausländer sind und uns nichts bringen. Ich hoffe, du verstehst die Anführungszeichen und das, was ich gerade da zitiere, auch als solches. Und da ist auch, glaube ich, was dran, so mein Eindruck. Weil mein Eindruck war irgendwie, wenn man in die 90er zurückdenkt in Deutschland mit Solingen und den Brandanschlägen, die es da gab und ähnliches, Da war das, oder Roland Kochs Kinder statt Inder, das war noch ein etwas anderes Argument. So, ich bin froh, dass, man sieht es in der AfD jetzt aber wieder hochkommen. Das ist, glaube ich, auch genau so ein bisschen der Punkt, dass es jetzt über diesen soziopolitischen Weg irgendwie wieder anschlussfähiger wird und auf einmal man dem dann auch zustimmt.
Nils:[1:09:21] Genau, so, und dann kommen wir noch zu zwei Gruppen, die sie unter diesen ich weiß jetzt nicht, ob es nur bei den Rassisten ist oder bei, ich glaube, es geht über alle Gruppen hinweg, unterscheiden sie noch zwei Gruppen, nämlich die autoritären Innovatoren und die regressiven Rebellen. Das finde ich auch noch zwei sehr schöne Wörter. Also die autoritären Innovatoren, das sind die, die sagen, das bestehende System ist nicht in der Lage, das Problem, was auch immer jetzt genau das Problem ist, zu lösen. Das sind oft die Menschen, die so eine diffuse Angst haben, obwohl sie eigentlich persönlich es ihnen ganz gut geht. Die haben nur so eine diffuse Angst, dass das vielleicht nicht so bleibt. Wo dann auch vielleicht so ein bisschen eine Reaktanz darauf herkommt, warum die so empfindlich reagieren, wenn man sich auf die Klimakatastrophe anspricht. Das macht es nicht unbedingt einfacher zu glauben, dass es einem in Zukunft noch immer so gut gehen wird.
Nils:[1:10:20] Und dann haben wir auch, da sieht man eben genau, nee stopp, wo bin ich jetzt gerade in meinen Notizen, genau, was bei denen aber der große Vorteil sozusagen noch ist, die stehen zumindest noch auf dem Boden der geteilten Realität. So, die sind irgendwie argumentativ auf eine gewisse Weise noch zugänglich, irgendwie Sachargumenten in der Realität, aber sind halt sehr, sehr frustriert, weil sie große Erwartungen ans demokratische System hatten, die aber nicht erfüllt worden sind, ans demokratisch-kapitalistische System. Und da wir den Kapitalismus komplett internalisiert haben und die Demokratie auch irgendwie eigentlich noch in Ordnung finden, richten sie sich halt auf die Fremden.
Nils:[1:11:01] So, also das ist so ein bisschen das Motiv an der Stelle. Und dann haben wir noch die regastriven Rebellen. Das sind, sagen sie hier, oft kleine Selbstständige oder Dienstleister, das sind die, die die Macht des Kapitalismus im eigenen Leib erfahren, die Macht des Marktes und den Kunden so unmittelbar unterworfen sind und die sich so gegen die Sozialordnung als Ganzes irgendwie wenden. Die sich irgendwie auch nicht mehr komisch fühlen in der Gesellschaft, nicht mehr wertgeschätzt fühlen in der Gesellschaft und dafür andere verantwortlich machen. Und da bieten sich halt einfach die Fremden als das Ziel genau dieser Affekte einfach an, ohne dass sie jetzt sachlich oder inhaltlich irgendwas damit zu tun haben müssten. Und da gibt es noch ein schöner, ich glaube es ist ein Zitat, der Selbsthass ist trotz Anstrengung nicht geschafft zu haben, verwandelt sich in Hass auf Fremde. Und dieser internalisierte Selbsthass, da kommen wir dann aus der Internalisierung des Scheiterns und der Individualisierung des Scheiterns raus, genau zu diesem Prozess hin, dass sich der dann externalisiert. Und die nehmen sich halt die Macht, die sie sich nehmen wollen. Das ist dann so eine gewisse Selbstermächtigung. Ich lasse mir das jetzt nicht länger von irgendwem sagen, ich nehme das jetzt selber in die Hand.
Amanda:[1:12:17] Ist auch so eine gewisse eine beicht abstinenz also wir sehen die schuld nicht mehr bei uns.
Nils:[1:12:24] Ja sondern
Amanda:[1:12:25] Nur noch bei den anderen.
Nils:[1:12:26] Genau und eben nicht beim system was auch immer jetzt genau darunter versteht beim kapitalismus bei konkreten politikern bei konkreten entscheidungen sondern bei den fremden ja Also auf die wird es ja auch gerade kommunikativ immer mal wieder gerichtet.
Nils:[1:12:43] Genau, das war im Grunde der ganz große Bogen. Nochmal kurz zusammengefasst, was diagnostizieren die beiden? Also diese Verabsolutierung individueller Freiheit. Meine eigene Freiheit steht über allem. Aber gleichzeitig eben von dem Gefühl, dass diese Freiheit in einem ganz engen Korsett von Zwängen steckt. Und das gibt natürlich irgendwie eine Spannung, Frustrationstoleranz. Sie haben auch das schöne Zitat, es sind Machtfragen, die im Register der Moral ausgetragen werden.
Nils:[1:13:12] Das fand ich sehr, sehr schön, weil wer hat eigentlich noch Einfluss in dieser Gesellschaft? Es sind halt nicht mehr die alten Eliten, also nicht mehr die alten Intellektuellen, jetzt bei den gefallenen Intellektuellen, oder die mittelständischen Eigenheimbesitzer aus den baden-württembergischen Kleinstädten. Zumindest sind sie nicht mehr alleine. So. Und was sie dem Linksliberalismus vorwerfen, sagen es ist in gewisser Weise ein progressiver Neoliberalismus, da ist ja auch was dran, green growth und sowas, das sind ja genau diese Motive, der unterschätzt die materiellen Fragen. Und Schatz schafft damit so ein bisschen Raum für das Libertärautoritäre, also genau die gesellschaftlichen Verteidigungsfragen, die Frage nach der gefühlten Sicherheit und so weiter, das fand ich auch ein ganz schönes Argument, das ist ja auch so ein bisschen das Kernargument bei Bell Hooks, ich weiß nicht mehr, wie das Buch hieß, das wir ja auch im Podcast vorgestellt haben, gewesen, warum Klasse noch zählt oder sowas.
Nils:[1:14:14] Was schlagen Sie vor, und das sind natürlich super abstrakte Vorschläge. Das eine ist Freiheit anzufangen, immer etwas Soziales zu begreifen. Nicht als etwas Individuelles. Wenn wir das hätten, wären wir schon weit. Und dann kommt auch wieder der Vorschlag, den ich aus ihrer Analyse raus teile, der aber auch an vielen Stellen wieder schwierig ist, wo man unglaublich aufpassen muss. Das ist Alternativen offenlegen und transparent kommunizieren und diskutieren. Das ist im Grunde genau das, was du auch gerade sagtest, dieses Expertise offenlegen, demokratisch offen diskutieren, das ist aber natürlich auch sehr, sehr voraussetzungsvoll, dass das funktioniert.
Nils:[1:14:54] Was man noch so ein bisschen ausgelesen hat, das war so meine Schlussfolgerung raus, was vielleicht reichen würde, wäre zumindest mal anzufangen, den aktuellen Stand nicht so als bestmöglichen zu kommunizieren. Man merkt es ja jetzt wieder mit der Regierungsbildung in Deutschland, ich weiß nicht wie du das mitkriegst so ja und wir werden das lösen und wir werden das verbessern und wir werden das verändern und es glaubt im Grunde schon niemand mehr dass die wirklich Dinge lösen, verbessern oder verändern das war ja auch so ein Politikstil, den man jetzt im Wahlkampf zumindest bei den Grünen sehr gesehen und der auch sehr gelobt wurde von vielen dieses offene und wir müssen da gucken und wir müssen da abwägen und wir sind uns da nicht sicher demokratisch belohnt worden ist es nicht auch wenn ich persönlich es für das Richtige halte man muss konstatieren, dass es demokratisch nicht belohnt worden ist deswegen bin ich mir da auch nicht so sicher, wie weit das eine Lösung ist auch wenn das ist im Grunde erstmal das Zielbild wenn wir da sind, dass wir das können, dann haben wir eine Menge gewonnen, aber wie kommen wir da hin, dass wir das können und da sagen sie leider nichts zu aber das war jetzt auch der Ritt durch dieses Buch durch diese 400 Seiten und hast du noch Fragen?
Amanda:[1:16:05] Nein, vielen Dank Nils für die Vorstellung.
Amanda:[1:16:12] Sollte ich gleich mal überleiten, was mir an Literatur eingefallen ist? Ja, gerne. Okay. Ich mache es kurz mit den Episoden. Ich glaube, ganz viele Episoden würden zum Thema passen, die wir aufgenommen haben. Du hast die Unterwerfung von Philipp Blum erwähnt. Das ist Folge 81. Mir ist noch der Allesfresser von Nancy Fraser in den Sinn gekommen, wo es auch so um Kapitalismus geht und wie der halt seine eigenen Grundlagen eigentlich auffrisst und zerstört. Kann man so ein bisschen auch übertragen auf diese Regression, die sie konstatieren, also Fortschritt und Regression. An Büchern hätte ich drei Empfehlungen. Und zwar einerseits ist das ein kleines Büchlein herausgegeben von Steffen Mau und Nadine Schöneck, Ungerechte Ungleichheiten. Wobei das UN immer in, wie sagt man? Klammern. Klammern steht, genau. Da sind verschiedene kleine Essays zum Thema. Ein anderes Buch, das ist von Christoph Möllers und heißt Freiheitsgrade. Das passt auch sehr gut zum Thema. Auch da wird diskutiert, natürlich aus verschiedenen Sichtweisen, wie kann Freiheit verstanden werden? Auch eben, wie kann individuelle Freiheit die gesellschaftliche Freiheit einschränken? Und auch umgekehrt.
Amanda:[1:17:33] Ich tue mich ein bisschen schwer als Laie, wie man dann liberal, libertär und so genau voneinander abgrenzen kann. Aber ja, das kann man sehr gut lesen. Es ist sehr gut oder sehr klar strukturiert, das Buch. Ich kann man sich mal anschauen. Und die letzte Empfehlung … Es springt da ein bisschen ab. Hier liegt Bitterkeit begraben über Ressentiment und ihre Heilung von Fleury. Ich weiß nicht mehr, ich habe den Vornamen vergessen. Das ist ein Buch, das wurde sehr gefeiert und unternimmt den Versuch, dieses Gefühl des Ressentiments, das du auch genannt hast, auch psychoanalytisch und gesellschaftlich zu verknüpfen. Also was ist das Verhältnis davon, wie kann man das aufgreifen und ich finde das, also es ist wirklich ein sehr gutes Buch und kann ich sehr empfehlen.
Nils:[1:18:37] Ja, danke dir. Ja, ich habe glaube ich tatsächlich so die meisten Züge, die ich gezogen habe, im Text schon gemacht. Ich habe das nochmal kurz angesprochen, die Vereindeutung der Welt, weiß ich gerade nicht mehr, wie der Autor heißt, haben wir in Episode 20 vorgestellt. Bietet sich da auch noch eben an Hartmut Rosas Resonanz, zumindest der erste Teil, der so ein bisschen seine Gesellschaftsdiagnose ist. Da kann man sicherlich aber auch seine Beschleunigung für lesen. Und dann eben das Buch von Bell Hooks, das wir hier im Podcast vorgestellt haben, das ist mir auch noch eingefallen. Das lässt sich da sicherlich auch noch mal ganz gut anschließen, eben genau für diesen Aspekt des Materiellen. Und dann tatsächlich das Buch, was ich euch ganz am Anfang des Podcasts schon angesprochen habe von Mark Fischer, Capitalist Realism. Das sind tatsächlich nur 100 Seiten, aber das fasst das einmal sehr schön zusammen, wie wir irgendwie in diese Situation gekommen sind, dass wir diesen komischen Kapitalismus so absolut setzen und eigentlich als eine Gegebenheit unserer Welt sehen, fast schon naturgesetzlich und nicht als ein gesellschaftlich gestaltetes Ding, mit dem man irgendwie auch anders umgehen könnte, wenn man das wollen würde. So, genau, das wären jetzt meine Vorschläge auch schon gewesen. Es gibt da draußen noch unglaublich viel andere Literatur. Wer mir auf Mastodon folgt oder meinen Blog liest oder abonniert oder so, der kriegt da auch regelmäßig Texte und Argumente, die genau in diese Richtung gehen, noch weiter frei Haus geliefert.
Amanda:[1:20:02] Sehr schön. Vielen Dank, Nils. Es bleibt mir zu sagen, ihr könnt uns hören auf Zwischenzweidecken.de. Das ist unsere Webseite. Dort findet ihr auch alle Infos zu den Folgen, zu unserem Podcast. Natürlich könnt ihr euch die Folgen runterladen, von welchem Podcatcher auch immer ihr nutzt. Wir freuen uns immer auf Rezensionen, auf Sternchen, was auch immer, ihr uns da verteilen mögt. Zu finden auf Social Media sind wir auf Blue Sky unter dem Handy Deckeln und auf Mastodon unter zcd-podcast.social. Ich bedanke mich nochmals Nils für die Vorstellung und ich freue mich auf das nächste Mal.
Nils:[1:20:45] Tschüss zusammen. Sehr gerne, bis dann.
Music:[1:20:47] Music
Quellen und so
Intro und Outro der Episode stammen aus dem Stück Maxixe von Agustin Barrios Mangore, eingespielt von Edson Lopes (CC-BY).
Das Umblättern zwischen den Teilen des Podcasts kommt hingegen von hoerspielbox.de.
Zwischen zwei Deckeln findest du auch im sozialen Medium deiner Wahl: Mastodon und Bluesky.
Der Beitrag 092 – „Gekränkte Freiheit“ von Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey erschien zuerst auf Zwischen zwei Deckeln.

May 1, 2025 • 1h 25min
091 – „Leben und Sterben“ von Alena Buyx
Alena Buyx stellt in „Leben und Sterben“ die großen Fragen. Wann und wie darf die moderne Medizin vor, während und direkt nach der Lebensentstehung eingreifen? Wann ist sie vielleicht sogar moralisch dazu aufgefordert? Was bedeutet modernes Sterben? Wie kann es besser gelingen – und welche Vorsorgemaßnahmen sollten wir alle dafür treffen? Buyx stellt auch dar, wie ein gelingendes Ärzt*in-Patient*innen-Verhältnis unter aktuellen Bedingungen von Zeitknappheit möglicherweise besser gelingen kann. Zuletzt widmet sich sie dem Einsatz moderne KI und Algorithmen in der Medizin.
Shownotes
ganz viele Rasierhobel in einer Übersicht (mr-razor.com)
Film: „Konklave“ (deutsche Wikipedia)
Buch: „Leben und Sterben“ von Alena Buyx (Verlagswebseite)
Advance Care Planning (deutsche Wikipedia)
zum Themenkomplex Sterbehilfe (Stiftung Warentest)
Pressemitteilung vom Bundesverfassungsgericht: „Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung verfassungswidrig“ (Webseite des BVerfG)
Verweise
Podcast: Freakonomics, Episode 40: The Suicide Paradox
Buch: „5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen“ von Bronnie Ware (Verlagswebseite)
Film: „Gattaca“ (deutsche Wikipedia)
Buch: „Der Tod meiner Mutter“ von Georg Diez (Verlagswebseite)
Buch: „Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen“ von Norbert Elias (Verlagswebseite)
Buch: „Die Pest“ von Albert Camus (Verlagswebseite)
ZZD011: „Religion für Atheisten“ von Alain de Botton
ZZD086: „Regeln“ von Lorraine Daston
ZZD015: „Roboterethik“ von Janina Loh
Transkript
Music:[0:00] Music
Holger:[0:16] Herzlich willkommen zu unserer 91. Folge von Zwischen zwei Deckeln. Heute stellt Christoph uns ein Buch vor und ich bin Holger, um das ein bisschen zu moderieren.
Christoph:[0:30] Hallo zusammen.
Holger:[0:33] Genau. Wie geht’s dir?
Christoph:[0:36] Mir geht es gut soweit. Ich habe 2018 auf einem Flohmarkt in Südfrankreich mir einen Rasierhobel von Gillette gekauft. Und ich wusste, der ist alt. Und ich habe irgendwann schon mal recherchiert und nicht rausgefunden, wie alt und welches Modell genau. Ich habe bei Gillette sehr viele unterschiedliche Rasierhobel hergestellt. Und es gibt erschreckenderweise eine große Online-Community, die sich damit beschäftigt. Und ich habe mich nochmal in die Recherche diesbezüglich gestürzt und habe es jetzt rausgefunden. Und genau, weiß jetzt, welches Modell ich habe. Es ist ein bisschen jünger, als ich dachte. Kommt aus den frühen 50ern, aber trotzdem habe ich mich jetzt sehr darüber gefreut, dass ich mich mit einem bald 70 Jahre alten Rasierhobel rasiere, nach allem, was ich weiß. Das fand ich irgendwie witzig darüber. Genau, das war so ein kleines Rabbit Hole die letzten Tage. Genau, so geht es mir gut und mit solchen Dingen beschäftige ich mich manchmal in meiner Freizeit. Wie ist die Lage bei dir?
Holger:[1:40] Ich bin jetzt gerade verwirrt, ein Rasierhobel ist das das, wo man sich mit eincremt?
Christoph:[1:47] Nee, das ist der Rasierpinsel. Der Rasierhobel ist der Vorläufer des modernen Systemrasierers mit Dreifachklingen und so. Aber in so einen Rasierhobel setzt du einfach eine Rasierklinge ein. Die sind genormt und haben auf jeder Seite eine Klinge. Viele kennen das noch von ihrem Großvater zum Beispiel. Ich werde euch was verlinken in den Shownotes.
Holger:[2:15] Das ist ja spannend. Man lernt doch immer wieder was Neues.
Holger:[2:21] Das stimmt. Ja, was beschäftigt mich? Also ich muss sagen, ich bin also nur zur Referenz. Wir nehmen hier jetzt.
Holger:[2:31] Ende April 2025 auf, falls jemand das später mal hört. Und wir sind also so noch nicht mal eine woche nachdem der papst franziskus gestorben ist und das beschäftigt mich so ein bisschen auch einfach daraus was das so bedeutet an interner politik der kirche aber auch wie man da immer noch mal so ein bisschen merkt was für tradition und strukturen dahinter stecken und wie man kann jetzt da natürlich jede meinung zur katholischen küche haben die man haben möchte es ist aber auf jeden fall eine organisation die schon ziemlich lange bestand hat und irgendwie auch eine Kontinuität oder zumindest den Anschein einer Kontinuität, sehr gut vermittelt und auch immer wieder in ihren Prozessen, zeigt, dass sie so ein bisschen mit ihrer Tradition auch anders ist als so der Mainstream und das ist, ich bin mal gespannt ich finde das immer ganz spannend, wenn dann so die Konklave anfängt oder das Konklave, ich bin da selber nicht sicher, ich glaube das Konklave.
Christoph:[3:52] Ich glaube auch das Konklave,
Holger:[3:54] Ja Genau, also das ist bei mir so ein bisschen gerade im Kopf, also auch wenn ich mich damit gerade nicht super intensiv beschäftige, aber ich habe das in der Vergangenheit schon mal etwas intensiver getan und dann erkennt man natürlich immer wieder die Täter.
Christoph:[4:12] Hast du den Film Konklave geguckt, der letztes Jahr ins Kino kam?
Holger:[4:19] Nein, und ehrlich gesagt hatte ich den auch gar nicht so auf dem Schirm, bis er jetzt irgendwie erwähnt wurde, weil mal wieder ein Konklave ansteht. Also ich habe weder den Roman gelesen, noch den Film gesehen. Insofern ist vielleicht was, wo man mal gucken kann, ob der irgendwie irgendwo relativ einfach zur Verfügung steht. Das habe ich noch nicht gecheckt.
Christoph:[4:46] Ich habe ihn im Kino gesehen und fand ihn wirklich gut. Also er ist ja jetzt keine Reportage und auch keine Dokumentation, deswegen weiß ich nicht, wie akkurat er ist, aber macht auf jeden Fall Freude, den zu gucken und man hat schon das Gefühl, mal nah an so einem Prozess dabei zu sein und wenn das halbwegs solide recherchiert ist, nimmt man inhaltlich halt auch nochmal ein bisschen was mit. Also zumindest das Thema der verschiedenen Richtungen in der katholischen Kirche und wer wird da wie repräsentiert und welche Allianzen gibt es und genau, nimmt man jetzt den italienischen konservativen Hardliner oder probiert man sich irgendwie weiter zu öffnen, das wird da schon spannend abgebildet. Also ich fand den Film lohnenswert und gut und habe mich gut unterhalten gefühlt und passt dann jetzt natürlich auch.
Holger:[5:36] Ja, es ist natürlich so, dass offiziell man ja auch nicht wirklich viel aus dem Konklave wissen darf. Klar, ja. Ich habe aber zumindest in Bezug auf den Roman, hatte ein Journalist die Tage dann auch kommentiert, dass er mal mit einem Insider gesprochen hat, der meinte, das wäre nicht so schlecht. Also wäre jetzt keine so schlechte Abbildung von dem, was passiert, aber das offiziell darf da ja eigentlich nicht viel gesagt werden. Das ist ja auch Teil des Besonderen daran, dass es halt so einer der wenigen Räume ist, wo noch so etwas alte Regeln gelten sollen in der Praxis. Gibt es da Leute, die da irgendwas verkünden im Voraus. Also ich weiß noch, als Benedictic der 16. gewählt wurde, hat ein Bekannter von mir, zu der Zeit Theologiestudent gemeint, dass irgendwie in Bonn das Gerücht gab, dass die Glocken ein bisschen früher geläutet haben, als offiziell angekündigt wurde, dass der Papst gewählt wurde. Und ob da dann jemand in Bonner Münster da irgendeinen Draht hatte.
Holger:[6:52] Weiß man natürlich alles nicht. Das ist jetzt auch sowas, was natürlich niemand jetzt überprüfen kann im Nachhinein. Aber ich glaube, was auf jeden Fall ist, dass es da diese politischen Richtungen gibt und dass da durchaus auch Konflikte stattfinden. Ich glaube, dass wenn man halbwegs informiert ist, dann ist es eigentlich klar.
Christoph:[7:15] Ja, das auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ja, ach und solche Spekulationen machen ja auch, die bringen ja ein bisschen Freude ins Leben. Das ist ja irgendwie ganz interessant, sich darüber den Kopf zu zerbrechen.
Holger:[7:26] Ja, da fällt mir ein, ich weiß nicht, ob man das noch online gut findet. Es gab, als Johannes Paul II. gestorben ist von der Daily Show, so eine lustige Nummer, wo dann damals Stephen Colbert, der jetzt ja auch recht erfolgreich mit seiner eigenen Show ist, irgendwie mit Jon Stewart so eine Nummer macht und dann so die verschiedenen Kandidaten vorstellt und am Ende meint, ach ja, ist eigentlich egal, das wird eh Ratzinger. Und damit auch recht hatte. Genau, ist ganz amüsant, ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben.
Christoph:[7:58] Spannend, wobei ich die Tage habe ich gelesen, dass es wohl den Spruch eigentlich gibt, wer als Papst in das Konklave geht, geht als Kardinal wieder raus. Also, dass dieses große, jemand ist ein Favorit und der wird es auf jeden Fall historisch nicht so gut hingehauen hat. Aber ja, wir werden es sehen. Ich bin ganz gespannt. Ja, da kann natürlich auch jetzt viel konservativer Backlash passieren, der mich persönlich jetzt nicht so begeistern würde. Also es ist die Frage, gibt es vielleicht dann mal einen Papst aus konservativeren Weltregionen oder geht man wieder zurück nach Europa? Und also, ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, das ja auch immer noch viele Menschen betrifft und ich meine, wir kennen das in Deutschland als mit vielen Austritten und so, aber das ist ja nicht repräsentativ für die ganze Welt.
Holger:[8:51] Ja, und es ist natürlich auch immer die Frage, dieses simple Muster, konservativ, progressiv, das ist ja vielleicht dann auch ein bisschen zu schlicht.
Christoph:[9:02] Ja.
Holger:[9:03] Es kann ja durchaus sein, dass man Kandidaten hat, aus aus einem Entwicklungsland wieder und der dann in einigen Themen, sich einordnet auf eine Art, die wir eher als progressiv bezeichnen würden, vielleicht bei sozialen Fragen, wirtschaftlichen Fragen, vielleicht auch Umweltschutzfragen und der dann in anderen Fragen, gerade wenn es um um, ich sage jetzt mal ganz breit, Geschlechter Verhältnisse geht, eher auf der sehr konservativen Seite ist. Also dieses, da hatte ich jetzt die Tage auch nochmal drüber nachgedacht, jetzt über dieses Thema hinaus, dass dieses einfache Einteilen in, ja es gibt immer zwei Seiten und es gibt progressiv, konservativ, das ist natürlich auch viel zu einfach. Also selbst bei mir selber, ich habe Themen, also insgesamt würde ich mich schon als ganz klar progressiv entscheiden, aber es gibt auch so ein, zwei Themen, wo ich merke, dass ich in meiner Meinung vielleicht auch eher etwas konservativ bin. Also und ich glaube, das ist ja bei den meisten Menschen so und dann muss man sich das im Einzelnen angucken, was dann passieren wird.
Christoph:[10:16] Ja, wir dürfen gespannt sein. Bei der nächsten Folge ist es vermutlich schon geklärt. Ja, vermutlich schon, könnte zumindest.
Holger:[10:25] Ja, hängt ein bisschen davon ab, wie lange sie brauchen mit der Wahl. Das gab es in der Geschichte, das war jetzt auch in einem Podcast, das ich gehört habe, die längste das längste konklave hat wohl ich glaube noch 1000 tage und wie sowas um den dreh also deutlich über zwei jahre gedauert wo.
Christoph:[10:49] Das ist also
Holger:[10:50] Deswegen gab es dann ja irgendwie auch die tradition dass die eingemauert werden um das ein bisschen zu verkürzen und den druck zu erhöhen weil es dann irgendwann auch unangenehm für die Kardinale geworden ist. Wobei sie jetzt ja irgendwie doch wieder etwas angenehmere Bedingungen haben. Aber wer weiß. Aber ich denke, wir richten uns dann mal auf, oder unsere Aufmerksamkeit mal auf das Buch, das du uns vorstellen möchtest. Und zwar ist das Leben und Sterben von Alena Büx. Also Alena Büchs ist Professionin für Medizinethik Sie ist Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der TU München Sie ist auch die ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats Und ich glaube, wer so ein bisschen Talkshows in der Corona-Zeit verfolgt hat Wird sie da vielleicht auch mal gesehen haben Also ich weiß, dass ich sie da irgendwie auf jeden Fall mehr als einmal gesehen habe, Also das Buch ist erschienen beim S. Fischer Verlag und zwar dieses Jahr, ist also ganz frisch.
Holger:[12:05] Und genau, ich freue mich auf die Vorstellung. Ich hatte das, bevor wir aufgenommen haben, schon gesagt, das hatte ich die Tage mal im Buchladen gesehen und überlegt, ob das was wäre, was man mal kaufen könnte. Insofern ist jetzt natürlich bei mir offene Türen eingerannt, dass ich das vorgestellt bekomme. Genau, ich bin also gespannt.
Christoph:[12:33] Sehr gut. Ja, ich kenne Alena Büx, ich kannte die nicht, weil ich extrem wenig Talkshows gucke. Von daher hat sie mir nichts gesagt. Aber ja, ich starte mal mit der Zusammenfassung. Alena Büx stellt in Leben und Sterben die großen Fragen. Wann und wie darf die moderne Medizin vor, während und direkt nach der Lebensentstehung eingreifen? Wann ist sie vielleicht sogar moralisch dazu aufgefordert? Was bedeutet modernes Sterben? Wie kann es besser gelingen und welche Vorsorgemaßnahmen sollten wir alle dafür treffen? Büx stellt auch klar, wie ein gelingendes Ärzt-Innen-Patient-Innen-Verhältnis unter aktuellen Bedingungen von Zeitknappheit möglicherweise besser gelingen kann. Zuletzt widmet sie sich dem Einsatz von moderner KI und Algorithmen in der Medizin.
Christoph:[13:23] Also du merkst, es sind wirklich die großen Fragen.
Christoph:[13:30] Dadurch, dass sie Professorin ist und aus der Medizin kommt, hat sie viele Fallbeispiele an der Hand und damit garniert sie das Buch. Das macht es, finde ich, einfach zu lesen, vielleicht einfach. Also falls ihr da draußen das euch selbst aneignen wollt, ich würde sagen, wenn ihr keine absoluten Berührungsängste von den Themen, also mit den Themen habt, dann kann man das auf jeden Fall gut machen. Und sie hat vier Kapitel, also das erste, da beschäftigt sie sich mit, das ist überschrieben mit Leben, dann das zweite ist Sterben und das dritte widmet sich dann eben, wie gesagt, dem ganzen Thema Arzt, Ärztin, Patient in Verhältnis und wie das aussehen kann vor moderner Realität im Medizinsystem, die wir alle kennen. Und dann am Ende geht es in meinen Augen um eben moderne Techniken, Algorithmen, KI. Das sind so die vier Sachen. Und sie startet in das Buch damit, dass sie erstmal sagt, woran sich Medizinethik heute eigentlich orientiert als Fach. Also oder was eine Rolle spielen soll in Behandlung von PatientInnen. Es sind vier Prinzipien. Zum einen ist das das Prinzip des Respekts vor Selbstbestimmung von PatientInnen. Das ist ihr immer wieder ganz wichtig und das hat sich sicherlich auch ein Stück weit gewandelt, weil wir früher hatten wir es mit Halbgöttern und Halbgötterinnen zu tun. Ich weiß nicht, wie man das vernünftig gendert.
Holger:[15:00] Halbgöttinnen.
Christoph:[15:00] Halbgöttinnen, so, ja, genau. Und das ist halt ein bisschen vorbei, da ist ein bisschen mehr Symmetrie, Augenhöhe eingekehrt. Und dann gibt es das Prinzip des Nichtschadens. Da geht es dann darum, dass die Behandlungen, die man durchführt, nicht mehr Schaden anrichten sollen, als sie Nutzen bringen und dass man auf jeden Fall unerwünschte, also oder Nebenwirkungen und dann, die sind dann eben unerwünscht, dass man die auf jeden Fall im Blick hat bei den Behandlungen, die man durchführt. Und genau, Prinzip der Fürsorge und des Wohltuens ist das dritte, das ist, glaube ich, auch klar. Und genau, das Prinzip der Gerechtigkeit, das war mir nicht so klar, da geht es vor allen Dingen um die Ressourcenverteilung, also wie viel wendet man für einen Patienten, eine Patientin auf und inwiefern führt das dann zu einer Ressourcenknappheit bei anderen Menschen, die man zu behandeln hat. Also dass man da durchaus in Abwägungsprozessen ist. Genau.
Holger:[16:03] Ja, und ich glaube gerade dieser letzte Punkt mit der Gerechtigkeit ist ja auch eigentlich der entscheidende Punkt gewesen in der ganzen Diskussion der Corona-Zeit.
Christoph:[16:14] Oh ja, absolut.
Holger:[16:15] Da gab es ja auch dieses Missverständnis, dass man gesagt hat, die Angst ist, dass so viele Menschen sterben. Also die war natürlich auch da. Aber gar nicht nur wegen dem Virus selber, sondern auch, weil Viruserkrankte dann Plätze für andere blockieren. Und dann hätte es halt sein können, also das war ein Grund für die ganzen Lockdowns, dass man halt verhindern wollte, dass die Krankenhäuser so überlastet sind. Sind, dass man dann vor diesen harten Entscheidungen steht, wen behandelt man und wen nicht.
Christoph:[16:50] Ja, finde ich einen wichtigen Punkt. Was sollte ich dazu sagen? Ja, wir hatten es dann ja auch ganz häufig damit zu tun, dass es auch so Personalknappheiten einfach gab, also es jemanden, der sie bestellen konnte, solche Sachen ja auch.
Holger:[17:09] Naja, also man muss da, denke ich, einfach vielleicht einfacher sagen, die Betreuung, also wie viele Patienten können sinnvoll betreut werden. Und unter dem Gesichtspunkt ist es ja dann auch immer wieder eine Frage, wenn im Gesundheitswesen zusammengekürzt werden soll. Also wenn ich mich recht erinnere, gab es irgendwo mal die Aussage in der Corona-Zeit, dass wir eigentlich Glück hatten, dass wir nicht so viel das Gesundheitssystem zusammengekürzt haben, wie es manche Leute in der Vergangenheit wollten, weil wir dann noch wesentlich knapper mit den verfügbaren Kapazitäten gewesen wären. Das ist jetzt aber, ich weiß nicht mehr genau, wo es war und wie vertrauenswürdig, aber ich habe da irgendwie sowas im Hinterkopf, dass mir das irgendwo mal begegnet ist.
Christoph:[17:58] Genau, ich lasse das einfach so stehen und springe zurück ins Buch. Am Anfang startet sie mit einem Fallbeispiel von Zwillingen, die als Frühgeburten auf die Welt kommen und das eine Kind entwickelt sich ziemlich gut und das andere hat Hirnblutung. Und genau, es ist ein bisschen die Frage, wie sich dieses Kind entwickeln wird und welche Rechte hat dieses sehr junge Leben. Und die Eltern sehen ihr Kind mit irgendwie Schläuchen und Reanimation und Hirnblutung und entscheiden irgendwann oder möchten entscheiden, dass ihr Kind nicht mehr weiter am Leben erhalten wird. Und die Behandlung der Ärztinenschaft ist aber absolut dagegen und sagt, naja, für dieses Kind ist es weiterhin das einzige Leben, das es hat und die Chancen, dass es überlebt, sind eigentlich ziemlich gut. Und ob es eine leichte geistige Beeinträchtigung hat oder nicht, ja, kann sein, muss aber nicht.
Christoph:[19:08] Kann sich eigentlich auch noch ganz, also relativ normal entwickeln. Und ja, Da macht sie eben dieses Spannungsfeld auf, dieses Thema der Selbstbestimmung, gerade am Anfang bei sehr jungen Menschen. Wer entscheidet darüber? Weil natürlich sind die Eltern irgendwie relevante Bezugspersonen, aber sie dürfen nicht alleine einfach, also sie dürfen bei vielen Dingen alleine entscheiden, aber da eben nicht, weil man eine Annahme darüber treffen muss, was dieses Kind wollen würde. Und die Ärztinnschaft hat da offensichtlich auch überlegt, als die Eltern nicht nachgeben wollten, ob man nicht probiert, den Eltern das Sorgerecht zumindest temporär zu entziehen, um es weiter behandeln zu können.
Christoph:[19:50] Ja, damit startet das Buch, das ist schon irgendwie ganz spannend und am Ende stellt sich dann raus, genau, in vielen Gesprächen und in viel Kontakt konnte man die Eltern dann offensichtlich überzeugen, muss man in dem Fall einfach sagen, dass man sich weiter um dieses Kind kümmert, es nicht versterben lässt und dann konnte man gemeinsam entscheiden, ohne Sorgerechtsentzug, dass dieses Kind überlebt und es scheint sie auch gut entwickelt zu haben, aber genau, sie macht da eben auf, wie schwierig das gerade am Anfang ist, wenn man auf der einen Seite Ärztinnen hat, dann eine noch nicht mündige Person, die wirklich auch noch gar nicht sich irgendwie mitteilen kann und deren Prognose man annehmen muss und ja, Eltern, die das eine oder das andere wollen können, das kann sicherlich auch in die andere Richtung kippen, dass man vielleicht sagt, dieses Kind ist so schwer krank, alles was wir hier jetzt weiter behandeln, führt zu noch mehr Leid und bringt möglicherweise keine Linderung. Und die Eltern würden dann nicht wollen, dass dieses Kind, würden unbedingt wollen, dass das Kind weiter behandelt wird und wie schwierig da so Kompromissfindungen sind. Das ist so ihr erster Punkt.
Christoph:[21:07] Und das, worum es natürlich dann geht, ist die Frage von, ja, was ist eigentlich ein lebenswertes Leben und wer kann das entscheiden? Ja, so startet das Buch. Also es ist auf jeden Fall ein steiler Einstieg und auch ohne Lösung in dem Sinne. Also ich glaube, viel von Büx, also Büx geht, glaube ich, viel darum, dass man sich einfach mal mit zentralen Fragen auseinandersetzt, um da ins Denken zu kommen, was ich erstmal sehr sympathisch finde.
Holger:[21:36] Naja, und es ist ja auch es sind ja auch immer die Fragen, die eben nicht so klar sind wo dann die Diskussion kommt also ich denke, Dinge, die eigentlich vollkommen klar sind, erfordern halt auch einfach keine Diskussion Ja, ja und das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem mit der Innenansicht, die man halt einfach nicht haben kann, also des Anderen, Und gerade wenn sich jemand noch nicht mal äußern kann, also es ist ja teilweise unter manchen Umständen, selbst wenn jemand sich äußern kann, die Frage, wie sicher man diese Aussage dann sehen kann. Das ist ja auch, ich glaube, bei vielen Sterbehilfedebatten immer wieder ein Thema, wo gesagt wird, wissen wir denn, ob die Person das wirklich will oder nur nicht zur Last fallen will oder Ähnliches. Und die können sich ja sogar äußern.
Christoph:[22:36] Was da natürlich dann auch eine Rolle spielt, oder was ich da nochmal wichtig hervorzuheben finde in diesem Fallbeispiel, ist eben, man hat dieses schwerkranke Kind und dann kann man natürlich, also die Eltern sehen, das Kind leiden am Anfang und möchten das nicht, das finde ich erstmal nachvollziehbar und die Eltern haben ihren Standard davon, was offensichtlich ein lebenswertes Leben ist. Und entscheiden dann, wenn dieses Kind mit einer geistigen Behinderung groß werden würde, das würde nicht unserem Standard unbedingt entsprechen oder wie auch immer.
Christoph:[23:06] Und das, was Bücks stark macht, es geht aber nicht darum, was die Eltern wollen, weil man quasi einfach den Interessenstandpunkt dieses Kindes einnehmen muss und sich überlegen muss, was würde dieses Kind wohl wollen. Und da es nun mal nur dieses eine Leben hat nach allem, was wir gesichert wissen, ist eben das in den Blick zu nehmen und auch nicht die Betreuungslasten der Eltern oder so später, sollte es da welche geben, das darf alles keine Rolle spielen, weil es um diesen einen Patienten gehen muss, den man da in den Blick nimmt, das fand ich nochmal wichtig, dass man nicht darauf achtet, was macht denn, wie ist das Umfeld belastet und sonst wie, sondern welche gesellschaftlichen Herausforderungen in Form von sonderpädagogischer Förderung oder was auch immer man sich vorstellen könnte, kommen da auf uns zu, sondern es geht darum, was könnte oder sollte oder würde dieser Mensch wollen. Und ja, naja, das geht auf jeden Fall gut aus, aber so, dann habt ihr eine Vorstellung davon, wie dieses Buch strukturiert ist. Mit solchen Fallbeispielen wird da immer wieder gearbeitet.
Holger:[24:09] Dann kommt mir jetzt so eine etwas abstraktere Frage. Nimmt sie denn einen Standpunkt ein, also so wie du es jetzt beschreibst, klingt es so, dass sie doch eher… Also ihr Ethikansatz eher als einzelne Individuum zielt.
Christoph:[24:25] Ja, absolut.
Holger:[24:26] Weil es gibt ja auch das Gegenmodell, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, der utilitaristische Ansatz, der dann sagen würde, man guckt ja eigentlich in dem auf die Gruppe und versucht es für die Gruppe nach irgendwelchen Maßstäben optimal rauszuholen. Und da würde man natürlich schon in Betracht ziehen, was für ein Aufwand ist das und wäre das sozusagen das, was an Leben und Lebensqualität für das Kind erreichbar wäre, ist das den Aufwand wert. Also ich persönlich würde jetzt auch zum individualistischen Ansatz neigen, aber es ist vielleicht doch auch ganz gut zu wissen, dass es den anderen gibt.
Christoph:[25:15] Ja, ich glaube, der macht in der Medizinethik einfach begrenzt viel Sinn, weil dann kannst du fast jede Behandlung abschreiben. Also gerade, wenn es nicht ist, ja, ich habe mir den Knöchel verstaucht, sondern du kommst da, also es geht dann um schwere Erkrankungen, dann kannst du das einfach lassen. Also dann, ich glaube, deswegen kommt er hier einfach nicht so explizit vor. Sie thematisiert häufig die Gegenposition, die es zu ihrer Haltung gibt, aber genau das, ich glaube, an der Stelle macht es für sie, glaube ich, nicht so viel Sinn, das zu skizzieren.
Christoph:[25:52] Ja, genau, mit Blick auf die Zeit spricht sie als nächstes über künstliche Befruchtung und Präimplantationsdiagnostik. Ich weiß noch, dass das bei mir auf jeden Fall in der Schulzeit schon irgendwie ein großes Thema war.
Christoph:[26:07] Und genau, sie führt dann erstmal auf, welche Argumente es gegen künstliche Befruchtung gibt. Also IVF ist die, glaube ich, die künstliche, die gängige Abkürzung in Vitro-Fertilisation.
Christoph:[26:24] Also erstmal gibt es Menschen, die Fortpflanzung nicht als Teil privater Lebensführung verstehen wollen und deswegen, also die passiert halt, wenn überhaupt natürlich und ist im Zweifel durch Natur, Gott, wen auch immer vorgegeben und deswegen, ja, könnte man dagegen sein, weil wenn es dann nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Und das sind halt eben häufig religiöse Gründe und die lehnt sie ab, weil sie sagt, naja, religiöse Argumente mögen ja für die persönliche Lebensführung spannend sein, aber erstmal sind das partikulare ethische Argumente und deswegen dürfen sie in so einer allgemeinen Betrachtung keine Rolle spielen. Wenn man für sich persönlich künstliche Befruchtung aus religiösen Gründen ablehnt, ist das ja das eine. Wenn man das aber für andere zum Standard erhebt, dann funktioniert das irgendwie nicht. Und sie sagt, diese Natürlichkeitsargumente machen irgendwie begrenzt viel Sinn, weil wo fängt man an, wo hört man auf? Also, keine Ahnung, dürfen wir dann kein Insulin mehr verabreichen, weil das so künstlich ist? Und wie ist es mit der Unfallchirurgie? Dürfen wir die dann auch nicht mehr haben? Was ist mit der Krebsbehandlung? Das sind ja auch alles künstliche Eingriffe, deswegen macht das für sie nicht so richtig viel Sinn.
Christoph:[27:45] Da zu sagen, deswegen sollte man das ablehnen und genau, dann sagt sie, gibt es noch das sogenannte Slippery Slope Argument, beziehungsweise das Argument der schiefen Ebene, wobei es darum geht, dass wenn man in vitro Fertilisation zulässt und sie ist ja zugelassen, das muss man vielleicht auch einmal dazu sagen, dass man dann von, dass man gleich in so ein Rutschen kommt. Also von der einen Technologie zur nächsten Technologie und am Ende sind dann die viel beschworenen Designer-Babys und sie meint, naja, das ist irgendwie ein schwaches Argument. Also erstmal basiert es auf der Annahme, dass medizinisch-gesellschaftliche Entwicklungen meist negativ sind und sie meint, das können wir einfach historisch so nicht nachzeichnen. Zum anderen ist es mega spekulativ. Also wir wissen das einfach nicht. Und genau, also wir haben schon auch historisch gesehen, dass medizinische Entwicklungen gestoppt werden können. Also keine Ahnung, Kokain und Heroin als Stärkungsmittel haben wir auch wieder gelassen. Problematische Eingriffe in der Psychochirurgie, keine Ahnung, ich schätze sie später auf Dobotomin an, haben wir auch wieder gelassen. Oder Elektroschocktherapien, qualvolle. Also sie meint, naja, diese Automatismen gibt es historisch einfach nicht. Genau. Und ja, das finde ich erstmal irgendwie ganz, ganz gut.
Holger:[29:08] Ja, ich finde das schlüssig. Ich habe, also ich glaube, dass sie vielleicht den religiösen Punkt etwas unterkomplex dargestellt hat. Ich habe… Ich habe irgendwie auch hier wieder im Hinterkopf, dass ein Kritikpunkt auch ist, also auch aus religiösen Kreisen, dass bei einer künstlichen Befruchtung mehr als ein Embryo erzeugt wird in der Regel und dann wird halt ausgewählt, welcher davon eingepflanzt wird, also der mit der höchstens Überlebenschance. Und wenn man das jetzt sehr extrem betrachten will, wenn man jetzt die Sicht hat, dass Leben mit der Befruchtung anfängt, dann würde man natürlich dann auch Leben schaffen, das entweder irgendwie eingefroren wird oder vernichtet wird. In dem Fall, dann ist man bei einer ähnlichen Argumentation wie einer Abtreibungsdiskussion, wo es aus meiner Beobachtung auch sehr stark davon abhängt, ob man jetzt glaubt, dass es sowas wie eine menschliche Seele gibt und in welchem Moment die menschliche Seele in den Körper kommt. Und wenn man halt sagt, mit der Befuchtung passiert das, ist man eher gegen Abtreibung. Und hier hätte man eigentlich eine ähnliche Problematik. Also müsste jemand, der aus diesem Argument gegen Abtreibung ist, dann auch zumindest ein prinzipielles Problem mit künstlicher Befuchtung haben.
Christoph:[30:34] Ja, ich glaube, das ist noch nicht unbedingt bei künstlicher Befruchtung so, aber, und das sagt sie, das ist die Kernfrage des Ganzen, was sie erfasst, mindestens bei Präimplantationsdiagnostik ist das eben so. Da hast du dann mehrere Embryonen und davon, da guckst du dann halt entsprechend drauf, welche, wenn du nach zum Beispiel genetischen Prädispositionen guckst für Krankheiten, dann schaust du da eben drauf. Und dann ist eben die Frage, wann beginnt eigentlich das menschliche Leben und welcher Zustand hat welche moralischen Rechte. So, genau. Und ja, dass die befruchtete Eizelle der Beginn des menschlichen Lebens ist, das ist soweit Konsens, aber umstritten ist eben die Frage danach, ab wann der volle moralische Status und die vollen Schutzrechte eintreten. Und da gibt es eben schon die Position, die du skizziert hast. Der Embryo hat von der Befruchtung an die vollen Schutzansprüche. Und genau das Argument ist, dass es die potenzielle Fähigkeit gibt, sich zu einem vollständigen Menschen zu entwickeln. Ja.
Holger:[31:50] Oder wie gesagt, in religiösen Kontexten dann in die Frage, wann kommt die Seele in den Körper. Und die wird auch nicht von jeder Religion gleich geantwortet. Nebenbei auch im Christentum gab es da auch Änderungen der Vorstellungen. Also lange Zeit hat auch die katholische Kirche, die, ich glaube, das geht auf Aristoteles, die Meinung vertreten, dass das, ich glaube, nach 90 Tagen die Seele in den Körper kommt.
Christoph:[32:17] Ja.
Holger:[32:17] Also dann nochmal unterschieden irgendwie bei Männern, ich glaube bei männlichen Kindern nach 90 und bei weiblichen irgendwie nach 180, also das ist auch wieder so eine Frage. Aber gut, das alte Giechenland war in vieler Hinsicht fortschrittlich, aber in der Hinsicht nun wohl nicht. Ja, ja, ja. Und erst mit, das hat mir auch mal ein bekannter Theologe erzählt, dass erst mit dem Dogma, dass Maria schon unbefleckt geboren wurde, dann irgendein Papst gesagt hat, naja, das kann ja gar nicht sein, dass deren Seele dann nicht schon von Befruchtung an nimmt. Da war irgendwie. Und erst dann wurde das geändert.
Christoph:[32:59] Ja. Das ist spannend. Also das mit dem Seele-Ding mit 90 und 180 Tagen finde ich weht.
Holger:[33:09] Ja, aber das sind halt so Sachen, auch da können sich Meinungen ändern. Und hätte jetzt jemand, der sagt, die Seele kommt halt erst, ich glaube, es gibt auch Religionen, die dann sagen, es kommt halt erst mit der Geburt in den Körper. und in den kontexten ist abtreibung halt auch wenig diskussionsthema.
Christoph:[33:29] Was natürlich noch ein wichtiger Zeitpunkt ist, ist die Nidation, also die Einnistung der Eizelle und die erfolgt auch bei der PID erst zwischen dem 10. und 14. Tag nach Befruchtung. Genau, also das ist noch so ein weiterer Punkt. Und durchgesetzt haben sich natürlich irgendwie, zumindest hier bei uns, so gradualistische, also so Mittelpositionen. Also der moralische Status eines Embryos nimmt mit seiner Entwicklung zu, hat von Anfang an eine gewisse Schutzwürdigkeit, aber entwickelt sich erst zum Menschen nach eben der Nidation. Und in Deutschland hat sich dann zur Präimplantationsdiagnostik auch diese gradualistische Position etabliert. Also unter sehr eng gesetzten Bedingungen ist sie erlaubt.
Christoph:[34:18] Dazu gehört aber immer auf eine Ethikkommission, die jeden Fall individuell bewertet. Und das führt bei ihr dazu, dass sie sagt, okay, also man darf das dann nur zur Vermeidung von schwerwiegenden Erkrankungen, was auch immer das dann jetzt genau meint. In dem Beispiel ist, glaube ich, ein Fall von diesem Angelina Jolie-Gen wird es genannt, also einer genetischen Prädisposition für eine Form von Brustkrebs. Und da wurde es, glaube ich, nicht zugelassen, obwohl Eltern das haben wollten, weil dann gesagt wurde, naja, also die Chance, dass das Kind diese Mutation bekommt, liegt nur bei 50 Prozent, weil beide Eltern haben einen Anteil und selbst mit der Mutation ist es keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Brustkrebs entsteht. Und ja, Brustkrebs ist schlimm, aber nicht schwerwiegend genug. Und die Chancen, dass es tatsächlich eintritt, sind auch nicht hoch genug, als dass man dann so eine PID da genehmigt hat. Das fand ich spannend. Genauso schwerwiegende Erkrankungen, Tod und Fehlgeburten.
Christoph:[35:23] Genau und ja, sie sagt auf jeden Fall, so ein Dammbruch-Szenario gibt es bisher auf jeden Fall nicht, weil wir halt so einen hohen Verfahrensaufwand haben und damit kommt sie, das fand ich erstmal, fand ich das ganz gut, weil dieses Dammbruch-Argument, merke ich, habe ich auch im Kopf, dieses, wenn wir damit erstmal anfangen und das zulassen, dann kommt doch bestimmt ganz schnell, kommen wir zu so Selektionsverfahren und so weiter. Und das bricht sich dann bestimmt Bahn und in 20 Jahren sieht die Welt ganz, ganz anders aus als heute und sie sagt, naja, empirisch können wir das bis jetzt einfach noch nicht nachweisen und das fand ich irgendwie eine angenehme Position. Ja, und das ist das erste Kapitel, würde ich sagen.
Holger:[36:06] Ja, ich glaube, generell ist es ja auch wahnsinnig schwer, vorher zu sagen, wie sich die Zukunft entwickelt.
Christoph:[36:14] Ja, ja, das mit der Zukunft ist notorisch schwierig, das stimmt.
Holger:[36:18] Da sind ja, wie war das, so Leute, die ja professionell die Zukunft vorhersagen, die liegen oft nicht so richtig. Witzigerweise sind Science-Fiction-Autoren, also haben immer mal wieder ganz gute Treffer. Also jetzt nicht von dem ganz Konkreten, aber so von den Ideen her.
Christoph:[36:39] Die Frage, wie sehr sich die Zukunft an der Vergangenheit orientiert und ob nicht ein paar interessante Ideen dazu, technischen Durchbrüchen, Innovationen und so weiter in der Vergangenheit liegen könnten.
Holger:[36:51] Ja, das ist das schöne iPad-Beispiel. Da gibt es irgendwelche alten Folgen von Star Trek Next Generation, wo sowas vorkommt. Und dann ist halt die Frage, wie sehr die Entwickler durch die Fernsehserie inspiriert waren. Ich glaube, das hat dann eine Rolle gespielt, als es da irgendeinen Patentstreit gab, wegen der Form, ob dann jeder Apple Geld zahlen muss und dann war ein Argument der Gegenseite, dass es das ja schon, diese alten Fernsehserien hier sowas gab und dass es deswegen die Idee ja eigentlich… Gar nicht so innovativ und damit patentwürdig wäre. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie der Prozess ausgegangen ist.
Christoph:[37:32] Also nach dem ersten Kapitel zum Thema Sterben geht es dann weiter. Nein, das erste war zum Thema Leben, das zweite ist zum Thema Sterben. Und da startet sie mit dem allseits bekannten Wunsch, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich wünscht, friedlich im eigenen Bett irgendwann einzuschlafen und nicht wieder aufzuwachen. Und dann der harten Realität, dass mindestens über 70 Prozent der Menschen in medizinischen Einrichtungen sterben und die Tendenz ist steigend. Und da ist ein bisschen die Frage, wie geht man damit um, wenn das Sterben nicht den Vorstellungen und Wünschen der sterbenden Menschen entspricht? Das ist ja irgendwie doof.
Christoph:[38:11] Ja, man muss einfach sagen, seit den 1960er Jahren hat sich der medizinische Fortschritt beim Sterben dramatisch verändert, also Dinge wie Wiederbelebung sind deutlich besser geworden, künstliche Beatmung, das sind alles noch, also naja, die 1960er Jahre sind in meinem Kopf nicht so lange her, aber sie sind es mittlerweile ja schon doch auch, aber sie sind zumindest nicht so ultra alt, in zumindest guter Qualität. Und ja, wenn früher Sterbenteil des Familienlebens war und meist zu Hause stattfand, ist das halt heute im medizinischen System. Und ja, wir können auch eine gewisse Wertverschiebung sehen. Also früher war ein bisschen die Idee, dass halt Gott darüber entscheidet, wann er dich zu sich holt. Und heute haben wir halt den Prozess hin zu mehr Selbstbestimmung. Und ja, sie macht dann zwei Fallbeispiele auf. Das ist einmal ein Herr, der mit fortgeschrittener chronischer Lungenerkrankung ins Krankenhaus kommt. Und er hat keine Patientenverfügung, keine Vorsorge vollmacht. Keine Angehörigen sind direkt erreichbar und er wird wiederholt wiederbelebt.
Christoph:[39:14] Obwohl er eine schlechte Prognose hat. Und ja, die Pflegekräfte äußern so ein bisschen das Bauchgefühl, dass der möglicherweise eine andere Behandlung sich gewünscht hätte. Aber wenn man es nicht weiß, dann ist man natürlich dazu angehalten, die Person, solange es geht, am Leben zu erhalten und auch immer wieder zurückzubringen. Und genau, da ist so ein bisschen die implizite Kritik, die sie aufmacht, dass in dem Pflegeheim, in dem der Herr war, sich offensichtlich nicht darum gekümmert wurde, was denn so die Wünsche am Lebensende von diesen Personen dort sind. Und ja, entsprechend wurden dann keine Dokumente aufgesetzt, niemand ist informiert und am Ende verstirbt die Person, ohne dass jemand weiß, ob das so war, wie der Herr sich das gewünscht hat. Und das genaue Gegenteil ist eine Frau, die eingeliefert wird oder ins Krankenhaus kommt und sie hat fortgeschrittenen Brustkrebs, war schon mehrfach in Therapie und hat aber die klare Entscheidung für sich getroffen bei klarem Verstand, dass sie keine weitere Krebsbehandlung mehr möchte. Das ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren sie in Therapie war. Und genau, sie hat klar festgelegt, dass ihr Mann im Zweifel entscheiden darf. Der ist genau darüber informiert, was sie möchte. Also er ist eingesetzt, ich habe schon wieder den Begriff dafür vergessen. Und sie entscheiden sich dann in Kombination mit dem behandelnden Ärzteteam für eine palliative Behandlung. Sie wechselt auf die Palliativstationen. Ich glaube, nach Hause hat sie es nicht geschafft, auch wenn das ihr Wunsch war.
Christoph:[40:43] Und die Familie ist beteiligt und unterstützt und man hat so das Gefühl eines guten Endes mit entsprechender Begleitung und das ist eben gelungen, weil die Person sich damit auseinandergesetzt hat, was sie denn mal möchte, ihr Umfeld informiert hat. Und ja, genau, also Büx spricht sich dafür aus, dass man sich auf jeden Fall mit dem Thema mal auseinandersetzen sollte und sich überlegt, wie man das gerne hätte, also Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, möchte man, dass jemand vom Gericht eingesetzt wird oder nicht, möchte man, dass die Person, die man selbst als entscheidende Person einsetzt, vom Gericht begutachtet wird oder kontrolliert wird, ja, all sowas.
Christoph:[41:28] Es gibt dann natürlich trotzdem noch Auslegungsprobleme, weil Patientenverfügungen nie jede Situation perfekt abdecken können. Also man kann ja nicht alles perfekt beschreiben, aber trotzdem sind sie natürlich erste Anhaltspunkte. Genau, da wünscht sie sich auf jeden Fall, glaube ich, einen anderen Umgang und ich möchte euch Hörende auf jeden Fall auch mal dazu ermuntern, sich damit auseinanderzusetzen und wenn es das vielleicht noch nicht ist, vielleicht zumindest mal einen Organspendeausweis auszufüllen und sich auch in das Organspenderegister, das es jetzt gibt, einzutragen. Genau, ihr könnt zu allem Ja oder Nein sagen, aber es ist cool, wenn ihr was sagt, damit niemand raten muss, was im Falle des Falles passieren soll. So, das, genau, ich glaube, das ist nicht so überraschend. Wenn man diese Fallbeispiele liest, ist das auf jeden Fall sehr, sehr eindringlich. Das lohnt sich, solltet ihr ins Buch mal reingucken wollen.
Holger:[42:30] Ja, es ist natürlich auch für die Angehörigen auch gar nicht mal so einfach unbedingt.
Christoph:[42:38] Ja, absolut.
Holger:[42:39] Ja, also wir hatten jetzt auch in der Familie eine Operation vor kurzem, wo dann vorher auch so ein Gespräch war. Und das ist dann halt auch, wo man als Angehöriger denkt, ja, jetzt geht es um Entscheidungen, die ich dann nachher gar nicht treffen will. Also selbst wenn man sich gut informiert, also wenn man irgendwie Anweisungen bekommen hat, wo man sagt, alles klar, und einem das Vertrauen ausgesprochen wurde.
Christoph:[43:10] Ja, ich finde, man kann auch sehr begründet zu dem Schluss kommen, dass man sagt, möchte ich eine Person, die ich gut kenne, die in einem emotionalisierten Zustand ist, im Zweifel darüber entscheiden lassen. Man kann ja auch zu dem Schluss kommen, ich hätte ganz gerne, dass die versammelte Ärztinnenschaft entscheidet, wobei auch die, glaube ich, immer probieren wird, zu gucken, was denn vielleicht gewollt worden wäre und auch dann wird man eben mit möglichst nahestehenden Personen sprechen. Deswegen, ich glaube, so ganz kommt man nicht raus, aber ich finde es zumindest mal, also ich finde in der Diskussion klingt es immer so wie, naja, man sollte sich halt eine Person suchen, der man vertraut und die man mag und mit der über alles sprechen und dann macht die das schon und dann denke ich, naja, das ist halt auch sehr, sehr viel… Sehr, sehr viel Verantwortung, die man da einer Person gibt und eben in einer emotional nicht so einfachen Position. Von daher kann man sich, glaube ich, vielleicht auch auf das Fachpersonal verlegen, aber genau, da bin ich nicht tief genug drin. Aber es lohnt sich, ich habe es mir jetzt auf jeden Fall auch vorgenommen, nochmal in das Thema reinzugehen und zu gucken, was man so an Vorsorgevollmachten, PatientInnenvollmachten und so ausfüllen sollte. Genau.
Christoph:[44:24] Sie spricht sich dann noch für das Konzept der vorausschauenden Versorgungsplanung aus, Advanced Care Planning, das sind immer so Sachen, bei denen ich denke, hä, also dafür brauchen wir einen eigenen Namen, geht es dann im Prinzip darum, dass PatientInnen, VertreterInnen und die Behandelnden in einen Dialog treten, kontinuierlich, gerade bei solchen degenerativ verlaufenden Krankheiten ist das natürlich gut machbar oder auch bei eben schweren Krebserkrankungen oder so, bei denen irgendwie die Prognose nicht so optimal ist, damit man da immer wieder im Dialog ist, was die Person jetzt möchte und ob sie das verändert sehen will und so weiter. Und sie plädiert auf jeden Fall dafür, dass es in Pflegeheimen auch mehr kommt. Und da denke ich mir immer, also schön, dass wir dafür jetzt einen coolen Namen haben und dass der Goldstandard ist, aber das klingt eigentlich so wie so ein No-Brainer, aber scheint es offenbar nicht zu sein.
Holger:[45:16] Ja gut, aber da gibt es ja immer mal wieder Beispiele, dass das eigentlich recht simple Sachen dann gebrandet werden, wahrscheinlich auch, weil irgendjemand dann da Schulungen für anbieten will, um damit Geld zu machen. Also ich habe das auch schon gehört, dass es Leute gibt, die im Prinzip anbieten, oder als Therapieform etwas anbieten, was sie Waldbaden nennen und letzten Endes ist das halt ein Waldspaziergang. Also mit Therapeuten dann, aber es ist jetzt nicht Also wahrscheinlich spielen bei solchen Labeling-Sachen auch solche Geschichten immer mal wieder in der Rolle.
Christoph:[45:56] Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Sie kommt dann auf das ganze Thema Sterbehilfe zu sprechen und dazu, was so in Deutschland erlaubt ist und was noch in der Grauzone stattfindet und was eben auch verboten ist. Und ja, da können wir auf jeden Fall auch einmal durchgehen. Erlaubt ist die passive Sterbehilfe, also das Zulassen des Sterbens durch Unterlassen oder Beenden lebensverlängernder Maßnahmen. Und genau, das ist halt, das ist erlaubt und also da geht es dann um sowas wie das Einstellen von künstlicher Beatmung, was dann überhaupt gar kein passiver Vorgang für die behandelnden ÄrztInnen mehr ist. Also es kann sehr aktiv sein, das zu machen. Und die Frage, die sich dabei immer wieder stellt, ist, wann beginnt die Phase, in der Sterben zugelassen werden soll. Also den Zeitpunkt da zu treffen, dass Personen konkret im Sterben liegen. Und ja, das ist nicht so ganz trivial.
Holger:[46:58] Und natürlich kommen da dann auch wieder so, ja letzten Endes auch wieder die Gerechtigkeitsgedanken mit rein. Also wenn das Krankenhaus halt nur eine bestimmte Anzahl von Geräten hat, um Menschen am Leben zu halten und da kommt jemand rein, wo man das braucht und dann stellt sich ja schon die Frage. Also ich weiß, es ist natürlich immer ein bisschen hypothetisch, also man weiß nicht, wie oft das wirklich vorkommt, aber ich glaube, ein Teil von solchen ethischen Überlegungen ist ja, dass man sich zumindest mal auf den Fall vorbereitet.
Christoph:[47:33] Ja, Triage behandelt sie gar nicht in dem Buch. Vielleicht ein guter Kritikpunkt, weil das auf jeden Fall was ist, was die Medizinethik betrifft. Kommt aber, wenn ich jetzt nichts vergesse, überhaupt nicht vor. Und das wäre in dem Kontext sicherlich richtig. Bei der passiven Sterbehilfe spricht sie da jetzt aber zumindest auf gar keinen Fall drüber.
Christoph:[47:55] Sie meint, dass es für ÄrztInnen echt ein Problem ist, passive Sterbehilfe manchmal durchzuführen, weil eben eine Beatmungsmaschine abzustellen, zwar unter passive Sterbehilfe fällt, sich aber überhaupt nicht danach anfühlen muss. Und da werden dann, glaube ich, teilweise auch Leben verlängert, die rein vom PatientInnenwunsch heraus nicht mehr verlängert hätten werden sollen. So, genau. Was, glaube ich, sehr unumstritten ist, ist die indirekte Sterbehilfe, also die nicht beabsichtigte, in Kauf genommene Lebensverkürzung als Nebenwirkung einer palliativen Maßnahme, sowas wie das Geben von Morphium oder so. Also da sprechen wir dann nie immer Monate oder so, um die es da geht, sondern meist empirisch, man kann das nicht so genau differenzieren, geht es da um wenige Stunden, vielleicht mal einen halben Tag, vielleicht auch mal zwei Tage, aber nie um so ganz… Krass verkürzende Maßnahmen und genau, da geht sie auf die Lehre von der Doppelwirkung nochmal kurz ein. Also es ist völlig zulässig, Handlungen durchzuführen, die gute und schlechte Folgen haben, also die Schmerzlinderung oder vielleicht die Linderung der Atemnot bei gleichzeitiger Verkürzung des Lebens.
Holger:[49:16] Ja, ich denke, dass es, wenn sich jemand schon in der Palliativbehandlung befindet, dann ist es ja eigentlich schon klar, dass der Sterbevorgang im Gange ist. Und dann, ich glaube, das macht dann auch nochmal einen Unterschied. Während wenn man jetzt eine Person in Behandlung hat und dann einfach zum bestimmten Zeitpunkt feststellt, eigentlich müssen wir jetzt in Palliativ übergehen, indem wir zum Beispiel ein Gerät abschalten. Das ist dann, glaube ich, einfach nochmal eine andere Frage. Oder wenn es Fälle gibt, wo man sagen würde, eigentlich diese Person ist körperlich, wäre sie bei einer vernünftigen Behandlung noch in der Lage, über einen längeren Zeitraum zu leben. Dann ist es auch nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube schon, dass man ja in Palliativbehandlungen zu einem Zeitpunkt kommt, wo klar ist, okay, wir reden hier bestenfalls von Monaten, wahrscheinlich eher nur von Wochen, vielleicht sogar nur von Tagen.
Christoph:[50:21] Was in Deutschland verboten ist, ist die aktive Sterbehilfe bzw. Tötung auf Verlangen. Das ist, glaube ich, auch soweit bekannt, vermute ich. Also die absichtliche Tötung eines unheilbar kranken Menschen durch ärztliche Medikamentengabe. Das dürfen wir in Deutschland nicht. Die Argumente dafür sind offensichtlich. Also Selbstbestimmung, der Wunsch nach einem selbstbestimmten Sterben und auch der Leidvermeidung. Und auch da gibt es dann so Dammbruch-Argumente als Gegenargumente. Und ja, die Sorge vor Missbrauch, also inwiefern werden solche Menschen gedrängt von ihrem Umfeld, das in Anspruch zu nehmen, inwiefern, was macht das mit einer Gesellschaft, wenn das als Beispiel um sich greift, also das sind so die Gegenargumente. Ja und dann gibt es natürlich auch ich hatte das schon angeführt ich glaube bei der PED die Vorstellung dass Gott oder das Schicksal die letzte Entscheidung über das eigene Leben zu treffen haben und eben nicht man selbst ja genau ich glaube Selbstmord
Holger:[51:33] Ist ja nicht strafbar wenn ich das richtig im Kopf.
Christoph:[51:38] Habe. Ich bin jetzt kein Jurist, aber ich glaube, mich zu erinnern.
Holger:[51:42] Also es wäre natürlich auch irgendwie relativ sinnfrei, das strafbar zu machen.
Christoph:[51:47] Aber eine Sünde ist es doch schon im Christentum, oder?
Holger:[51:52] Ja, zumindest traditionell, wobei auch da gibt es ja Entwicklungen. Ich weiß nicht, wie jetzt die neueste Ausrichtung da ist. Das kann ich gerade nicht sagen, weil ich diese Diskussion nicht so verfolgt habe. Also geht mir jetzt gerade nur vom Gedanken her, die Differenzierung, man bestraft Menschen, die da helfen, also nur um das klarzustellen, das finde ich auch richtig. Wenn eine Person das selber will, die kann man dann ja gar nicht bestrafen.
Christoph:[52:30] Ja, also genau, Bestrafung ist da in meinen Augen auch völlig albern. Ja, also Dammbruchargumente genau hatte ich schon gesagt
Christoph:[52:42] Dann gibt es natürlich noch das Gegenargument dass man gar nicht psychisch gesund zu dem Schluss kommen könnte dass man sterben wollte und da sagt sie naja, das stimmt nicht, also es gibt selbstbestimmte Sterbewünsche die nicht einem Missverständnis und einer psychischen Erkrankung entspringen das kann man sich ja auch einfach von entsprechenden Fachpersonen bestätigen lassen und sie meint, naja, der Gedanke Also Zitat, der Gedanke, wenn es mal ganz schlimm wird, kann ich mich an jemanden wenden, muss ja nicht automatisch als Drohkulisse einer kalten gesellschaftlichen Normalität schlimmer Tode aufgefasst werden. Das finde ich ist auch richtig.
Christoph:[53:19] Ja, und was ich noch spannend finde, ist, dass sie sagt, in Deutschland kann man diese Debatte deutlich schlechter und viel befangener wird sich hier geführt als in anderen Ländern aufgrund der historischen Vergangenheit, die wir eben haben. Das fand ich nochmal ganz spannend sie meinen, also ne, KollegInnen von ihr mindestens meinen, naja, in den Benelux-Staaten kann man da, oder in Großbritannien kann man da einfach viel unbefangener drüber sprechen weil nicht gleich irgendwie Argumente der Nazi, mit der Nazi-Keule quasi kommen ja, und apropos Benelux-Staaten empirisch, das finde ich spannend, gegen diese Dammbruch-Argumente da ist ja aktive Sterbehilfe erlaubt, also ich weiß nicht, ob in allen drei Ländern gleich, aber ne, prinzipiell ist das zumindest mal möglich und die Zahlen sind über die letzten 20 Jahre ziemlich stabil geblieben, aber sie steigen in den letzten Jahren wohl etwas. Das finde ich erstmal, also sie meinten, das muss man beobachten, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, aber das ist irgendwie interessant.
Holger:[54:24] Ja, das ist, hätte ich jetzt den Gedanken, inwieweit das vielleicht auch so generell, mit so generellen, wirtschaftlichen sozialen entwicklungen zu tun hat aber ja das ist jetzt nicht mein gebiet da bist du dann näher dran zumindest was die sozialen entwicklungen angeht und, Ich glaube, ich habe auch diese dunkle Erinnerung, dass es auch wieder kulturell ein bisschen damit zusammenhängt, wie anerkannt solche Dinge sind. Ich erinnere mich, es gab mal eine Folge von Revisionist History, ein Podcast von Malcolm Gladwell, wo es um Ungarn ging und die Tatsache, dass da eine relativ hohe Selbstmordrate ist. Aber dann, also in diesem Podcast ging es auch so ein bisschen darum, dass das auch mit der anderen Kultur zusammenhängt. Dass der Stellenwert oder die Art, wie die Kultur drauf guckt, eine andere ist. Und ich glaube, dasselbe ist auch mit Japan der Fall. Die auch verhältnismäßig hohe Selbstmordraten haben. Also da gibt es auch so kulturelle Ideen, die da, glaube ich, auch stark reinspielen.
Christoph:[55:41] Ja, auf jeden Fall. Also das ganz sicher. Sie spricht sich dann am Ende auch nicht direkt für das Einführen aktiver Sterbehilfe ein. Also sie hält sie prinzipiell für ethisch zulässig, aber sie plädiert nicht aktiv dafür, sie einzuführen. Also genau so formuliert sie es, weil sie eben die steigenden Zahlen in den Nachbarländern schon für einen schleichenden Prozess der Normalisierung halten könnte. Und sie meint, da muss man auf jeden Fall nochmal ein bisschen das im Blick behalten. Vielleicht ist ein Ausweg ja der assistierte Suizid. Und die, ja, wir haben nämlich von 2020 gibt es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, das sagt, dass das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ein Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist und das umfasst auch die Freiheit, sich das Leben zu nehmen und dabei Hilfe zu suchen, anzunehmen.
Christoph:[56:43] Und genau, da geht es dann im Prinzip um solche Verfahren, wie wir das aus der Schweiz kennen. Wie heißt der Verein Dignitas, die das durchführen? Ich glaube, dass man da einen Medikamenten-Cocktail dann im Normalfall trinkt, das ist glaube ich so das Standardmodell, das halt aber eigenständig tut und das eben nicht von außen durch einen Arzt, eine Ärztin durchgeführt wird. Und Bücks ist diese Unterscheidung auch sehr wichtig, dass bei der aktiven Sterbehilfe eben eine Person von außen das Medikament zuführt und man nicht bis zum letzten Moment die Entscheidungsgewalt darüber hat. Aber wenn man durch ein Strohhalm einen Medikamentencocktail trinkt, das natürlich anders ist. Man kann das noch im Mund haben und da könnte man noch in der letzten Sekunde vor dem Schlucken entscheiden, ich möchte das wieder ausspucken, ich will das nicht.
Christoph:[57:34] Und diese prinzipielle Offenheit der Entscheidung bis zur letzten Sekunde hält sie für sehr wichtig und dem kann ich zumindest folgen. Also ich glaube, meine Haltung zur aktiven Scherbehilfe ist dann letztlich eine andere als die von Böcks. Aber genau, mir war gar nicht so klar oder ich hatte das nicht so präsent, dass eben grundsätzlich dieser ärztlich assistierte Suizid jetzt durch das Bundesverfassungsgericht zugestanden wird, auch wenn wir glaube ich noch keine, ja also es muss neu geregelt werden gesetzlich. Wir haben da noch keine Regelung vernünftig für, wie das stattfinden kann und so. Aber ja, das finde ich erstmal spannend. Und ich meine, es gibt dann sicherlich auch Krankheitsverläufe, in denen dann vielleicht selbst das nicht mehr möglich ist, weil man eigentlich festgeschrieben hat, keine Ahnung, wenn ich ins Koma falle. Naja, wobei, das ist ein schlechtes Beispiel, da reicht dann die passive Sterbehilfe. Also man kann sich ja sicherlich Krankheitsverläufe vorstellen, in denen dann auch ein assistierter Suizid einem selbst nicht mehr möglich ist, aber grundsätzlich finde ich spannend, dass das zugestanden wird. Ja, genau, das noch dazu.
Holger:[58:48] Ich finde es auch ein sehr schwieriges Thema.
Christoph:[58:50] Ja, es ist schwierig, aber ich finde es total notwendig, dass wir da auf jeden Fall, also ich finde es notwendig, dass man sich als aufgeklärter Bürger, als aufgeklärter Bürgerin mit diesen Fragen auseinandersetzt und eine Haltung entwickelt. So, ja. Dann geht es um das Arzt-Patienten-Ärztin-Patientinnen-Verhältnis. Da gehe ich jetzt so ein bisschen drüber, weil ich das jetzt wirklich intellektuell nicht so unfassbar spannend fand, plattgesprochen. Genau, also partnerschaftliches Modell gilt heute als Goldstandard, also man hat so den Ansatz des Shared Decision Making, also Austausch auf Augenhöhe zwischen Ärztin und Patientin und da muss dann natürlich Vertrauen vorherrschen und alternativ gab es früher mal das paternalistische Modell. Also man hat irgendwie den Arzt als Halbgöttin und das tritt immer nochmal ein. In Notfällen geht es nicht anders, da muss einfach entschieden werden. Genau, und dann gibt es noch modern das Konsumentenmodell, also man hört als Patient, Patientin nur noch Vorschläge und entscheidet dann allein und man geht direkt in so einen Bestellcharakter, das findet sie auch nicht gut.
Christoph:[1:00:10] Und dann spricht sie über Selbstbestimmung und Frühsorge. Sie hat da das Beispiel einer Patientin, die nach einem komplizierten Bruch, der nicht heilen will und dann eine Infektion hat, ist eine Patientin, die eine Amputation ablehnt als letztes Mittel. Die ist noch jung und möchte das nicht, aber es steht eine lebensbedrohliche Sepsis für sie ins Haus und trotzdem sagt sie, ich möchte nicht amputiert werden, ich will das einfach nicht. Für mich ist das kein Leben, das ich mir vorstellen möchte. Und das Ärztinenteam verzweifelt daran regelrecht und kann das nicht verstehen, weil moderne Prothesen so gut sind und was soll das denn überhaupt und die Frau ist doch noch jung und hat das ganze Leben vor sich. Und trotzdem geht da eben, die Person ist einwilligungsfähig, das wird von ExpertInnen bestätigt und genau, die verstirbt dann letztlich selbstbestimmt an der Sepsis, die dann tatsächlich eintritt.
Christoph:[1:01:09] Und sie meint, das gilt es zu respektieren, auch wenn es schwierig ist. Und dann macht sie noch das ganze Thema Umgang mit Fehlinformationen auf, was sicherlich auch wichtig wird. Wie geht man damit um, dass das liebeweite Internet voll ist mit Fehlinformationen? Und genau, Aufklärung wird immer wichtiger, weil das, was man so findet, das wissen wir alle, nicht unbedingt richtig ist. Und wie kriegt man es hin, dass man den eigenen ÄrztInnen vertraut? Das ist natürlich auch gar nicht so einfach, weil die Zeit knapp ist und die Zeit für Aufklärungsgespräche auch knapp ist. Und ja, das fand ich nochmal einen wichtigen Punkt, ohne dass sie da jetzt rausgeht mit der zündenden Idee, wie man es lösen kann.
Holger:[1:01:56] Ja, das ist natürlich… Also so hart formuliert, diese alte Logik mit den Ärzten als, mir ist nebenbei geschlechtsneutral, halb Gottheiten.
Christoph:[1:02:11] Oh, sehr gut, ja.
Holger:[1:02:13] In weiß, das ist natürlich eine gewisse Art, das Problem zu lösen, indem man halt sagt, okay, das sind halt die, die am Ende, wo man auf deren Wissen vertraut. Jetzt weiß man natürlich das auch klar, dass auch Ärzte nicht immer alles wissen. Aber wir haben ja sozusagen heute das Paradox, dass wir zum einen immer selbstbestimmter sein können, aber dadurch haben wir natürlich auch das Problem, dass wir uns eigentlich mit immer mehr Informationen selber beschäftigen müssen. Und wir können es auch, aber wir haben eben auch nicht immer gute Filter, weil eben jeder mitreden kann. Das heißt, es reden halt auch viele mit, die nicht so viel Ahnung haben.
Christoph:[1:02:59] Ja, das kommt mir aber bei ihr tatsächlich ein bisschen zu kurz, dass man unter Bedingungen von Zeitknappheit, ist es schon sehr lohnenswert und ein wichtiger Skill, würde ich auch sagen, Gesundheitsinformationen selbst sich erschließen zu können, selbst auch vielleicht im Zweifel auch Hypothesen gebildet in Ärztinnengespräche zu gehen, weil die einfach keine Zeit für irgendwas haben. Und das ist, glaube ich, total komplex, also ich glaube, ja, als informierter, als informierter zu behandelnde Person in Gespräche zu gehen, ist echt nicht verkehrt, aber das hat halt einfach das Problem von Missinformationen, bringt es mit sich und das, finde ich, ist ein total schwieriges Spannungsfeld und da einfach nur, sie rekurriert dann drauf zu sagen, naja, eure Ärzte und Ärztin meinen es schon wirklich gut mit euch und die geben sich echt Mühe und die sind voll auf eurer Seite,
Christoph:[1:03:56] Ja, okay, aber die sind auch überarbeitet und überlastet und ich bin nur ein Patient von keine Ahnung wie viel Tausenden deswegen, ich glaube schon, dass die es gut mit mir meinen, aber ob sie alles im Blick haben können weiß ich nicht so genau also deswegen, ich finde es total schwierig und genau entsprechend fand ich sie da so ein bisschen wohlfeil irgendwie zu sagen, naja, die kriegen das schon hin ist zwar stressig, aber die wollen das Beste und das vertraut denen mal, also jetzt überspitzt formuliert.
Christoph:[1:04:30] Also ich meine, sie hat schon das Thema Augenhöhe mit drin, das schwingt da schon mit, aber ja.
Holger:[1:04:36] Es kann natürlich auch sein, dass sie da selber auch einfach keinen guten Lösungsvorschlag hat und das Thema nicht weiter vertiefen wollte.
Christoph:[1:04:44] Ja, das kann natürlich sein.
Holger:[1:04:47] Was ja auch legitim ist. Klar, du kannst dann noch mehr auf die Problematik hinweisen und das ist vielleicht auch ein Problem unserer Zeit, dass es immer schwerer zu sein scheint, einfach mal zu sagen, ich weiß das nicht oder ich verstehe das Problem, aber ich habe auch keine Lösung. Also da vielleicht ist das auch ein bisschen das Problem, dass man heute dafür dann auch mehr abgestraft wird oder generell dafür abgestraft wird. Ob es jetzt früher generell besser war, das weiß ich eigentlich auch nicht. Das hängt vielleicht auch ein bisschen vom Kontext ab. Also jetzt in einem wissenschaftlichen Kontext würde man hoffen, zumindest hoffen, dass man nicht abgestraft wird, wenn man sagt, man weiß was nicht. Ich glaube, gerade so im Medienkontext funktioniert das eher nicht so gut. Und sie war ja auch eine Zeit lang sehr medienpräsent.
Christoph:[1:05:46] Ja, das stimmt.
Holger:[1:05:47] Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es im Moment ist. Also auch wenn das eben so klang, ich gucke eigentlich auch nicht so viele Talkshows. Ja, Corona-Zeit hatte man halt weniger andere Abendaktivitäten, dann hat man das hin und wieder doch mal gemacht, aber…
Christoph:[1:06:04] Ja, ich kann vielleicht ja nochmal aufmachen, was sie damit meint. Also sie hat da wieder ein Fallbeispiel von einem Herrn, der ein Prostatakarzinom hat und dann gibt es im Prinzip drei Behandlungswege. Das eine ist, man operiert dann bei der Prostata mit möglichen Folgeschäden, wie du triffst Nerven, kannst dann Erektile Dysfunktion entwickeln, kannst Inkontinenzprobleme entwickeln. Du kannst Prostatakarzinome wohl auch einfach erstmal beobachten, weil die meisten, also ich glaube über 50% der Männer sterben mit einem Prostatakarzinom, das wird halt häufig nur nicht entdeckt, aber selten sterben sie an einem Prostatakarzinom, also kannst du einfach einen Blick behalten und erstmal gar nichts machen, oder du kannst halt bestrahlen. Und da wird halt beschrieben, wie dieser Mann von seinem Arzt gut beraten wird,
Christoph:[1:07:06] Trotzdem für sich eine informierte Entscheidung fällt und er sagt, er möchte auf jeden Fall, dass es operiert wird, aber er hat halt die drei Auswahloptionen quasi und die Entscheidung wird gemeinsam getroffen, also er kann informiert da reingehen, kann sich alles anhören, genau, das ist so, ja, so wie man sich es halt wünschen würde und es geht dann natürlich auch gut aus, schön, aber genau, es geht ja dabei um das Ganze, also informierte Einwilligung, also Also man muss einwilligungsfähig sein, man muss informiert sein als Patient, Patientin und das Verständnis für das Problem haben und die Möglichkeiten der Behandlung. Und das Ganze findet eben freiwillig statt, siehe die Person, die an ihrer Sepsis verstorben ist. Ja, genau.
Christoph:[1:07:52] Ja, so zuletzt mit Blick auf die Zeit geht sie auf das ganze Thema KI ein. Denn ja, KI ist es im Großen und Ganzen, beziehungsweise das, was wir halt dafür halten oder was wir so nennen. Da geht es dann einerseits, also sie hat vier kleine Beispiele. Es gibt Narkose-Algorithmen mittlerweile, also eine Anästhesie und die kriegen, genau, da kann dann eine KI die verlaufende Narkose überwachen, steuern und so weiter. Und die ist auch ein paar Prozentpunkte besser als die ÄrztInnen in der Kontrolle.
Christoph:[1:08:33] Man kann in therapeutischen Settings KIs einsetzen, also bei Kindern mit schwerem Autismus gibt es wohl eine Puppe, die einem Kasper recht ähnlich sieht und die Kinder können entweder unter Beaufsichtigung oder unbeaufsichtigt mit dieser Puppe spielen, die wohl auch ein bisschen sprechen kann um
Christoph:[1:08:55] Und halt irgendwie ein mehr oder minder nettes Gesicht hat. Und die Kinder machen Fortschritte in ihren sozialen und sprachlichen Fähigkeiten, wenn sie regelmäßig mit dieser Puppe spielen. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie viel KI da jetzt schon drin ist, aber so überhaupt, das ist halt ein Roboter, mit dem gespielt wird. Dann Psychotherapie-Chatbots, kann man sich vorstellen, ermöglichen kontinuierliche Betreuung. Wer hilft einem, wenn man nachts um drei aufwacht in seiner Depression und jetzt genau ein therapeutisches Gespräch haben möchte? Das macht eher nicht der Therapeut, die Therapeutin. Was macht man, wenn man keine Plätze bekommt und so weiter?
Christoph:[1:09:30] Dann die Frage natürlich nach, naja, tägliche Stimmungsabfrage und Diagnose, dann vielleicht ein bisschen zugeschnittene Übungen und ja, genau, das ist so das dritte Beispiel. Und das vierte Pflegeroboter, das ist jetzt nicht so sehr KI, aber Pflegeroboter für Alltagsaufgaben, die irgendwie beim Aufstehen helfen können, beim Toilettengang, vielleicht irgendwann auch mal beim Anziehen. Die haben dann im Zweifel auch Avatare, mit denen man irgendwie interagieren kann. Da kannst du dann natürlich auch die LLMs, die wir alle kennen, ChatGBT und so, könnte man da auch einbauen und dann eventuell, keine Ahnung, auch Gedächtnistraining oder Rätsel mit den zu betreuenden Personen durchführen. Und das sind so Beispiele. Und ja, viel davon ist noch in der Forschungs- und Erprobungsphase, aber sie meinten, naja, da wird halt was auf uns zukommen und wir müssen gucken, dass wir, wie wir es in der Medizin, das ist ja ihr Argument, immer wieder bisher immer gut hingekriegt haben, dass wir nicht einfach in Technologien rein stolpern, sondern das als gezielten Prozess nutzen.
Christoph:[1:10:36] Und sie meint, KI hat da einfach so einen klassischen Dual-Use-Charakter. Also kann er total hilfreich eingesetzt werden oder kann total Schreckliches schaffen und da müssen wir auf jeden Fall uns beim Hilfreichen bewegen und sie stellt ein bisschen im Prinzip dann die Frage an den Leser, die Leserin, wo man selbst die Grenze zieht, was von diesen Fallbeispielen man für sich selbst sich vorstellen könnte, was man für sinnvoll hält, was vielleicht auch ethisch problematische Dinge mit sich bringt. Also täuscht man da zum Beispiel demente Personen, wenn man die mit so Pflegerobotern interagieren lässt? Oder auch die Kinder mit Autismus, mit der Puppe, sind die dann getäuscht und glauben, das ist irgendwie ein echtes Gegenüber? Ja, solche Fragen stellen sich dann. Wo man ja auch wieder die Frage ist,
Holger:[1:11:26] Was denn echt ist.
Christoph:[1:11:27] Ja, ja.
Holger:[1:11:29] Also ich persönlich hätte jetzt so spontan, hätte ich eher die Sorge, wenn man viel KI einsetzt, dass dann auch so die Schwächen von KI mit solchen, also im Moment im Gespräch, dass es diese KI-Halluzinationen gibt, also dass KI halt einfach irgendwie, also man würde sagen klassisch bullshittet, also irgendwelche Sachen einfach erfindet, weil es eben nicht auf Fakten checkt, sondern, was sprachlich plausibel ist, also das ist ja das, was diese LLMs größtenteils machen, dass sie einfach plausible Sätze erstellen die aber nicht unbedingt faktisch korrekt sind und, da würde ich jetzt mir dann Gedanken machen und da können halt auch, je nachdem wo und wie die trainiert wurden halt auch unerwünschte Sachen dann bei rauskommen. Das heißt, dass dann zum Beispiel Suizid vorgeschlagen wird oder sowas. Das kann dann durchaus passieren, auch wenn man das vielleicht gar nicht normal total abwegig wäre. Und dann können diese Halluzinationen auch wirklich gefährlich werden.
Christoph:[1:12:44] Ja, voll. Was wollte ich gerade noch genau, Genau, das zu meinen, bei diesem Anästhesie-Thema zum Beispiel ist schon auch, also die sind im Schnitt ein bisschen besser. Das Ding ist, man braucht auf jeden Fall einen Menschen in dem Loop, weil also wenn die was verbocken, dann verbocken die es richtig heftig. Also keine Ahnung, wenn du, die scheinen wohl auch mal auf die Idee gekommen zu sein, dass du Salz, also Natriumchlorid-Lösung einfach zur Anästhesie einsetzt.
Christoph:[1:13:16] Also die Fehler, die die machen, sind dann im Zweifel halt heftig, wenn man die dann einfach blind befolgt und das, genau, aber das passiert halt auch nicht, das muss man auch sagen, die sind noch nicht völlig, die sind nicht autonom, aber sie plädiert einfach dafür, dass Menschen da drin bleiben, weil die Fehler, die Menschen machen, einfach nicht ganz so gravierend sind.
Christoph:[1:13:36] Genau, jetzt überlege ich gerade, sie hatte noch ein anderes, ah, für Tuberkulose, Befundentwicklung, genau, hat man auch festgestellt, Algorithmen sind in der Erkennung, also Tuberkulose ist schwierig zu erkennen, die Bilder, die es dafür braucht, genau, die Röntgenbilder hat eine KI auf jeden Fall besser erkannt und man hat irgendwann festgestellt, ah ja, warum erkennt ihr das so gut? Und es hat sich einfach nur die Ränder der Röntgenbilder angeguckt und hat geguckt, ob das ein mobiles Gerät ist oder ein stationäres Gerät. Tuberkulose tritt in reichen Ländern eher nicht mehr so auf. Wir haben stationäre Röntgenbilder und mobile Röntgengeräte werden eher in ärmeren Ländern eingesetzt, indem man in irgendwelche entlegenen Regionen muss. Und genau, also es ist die Frage, worauf trainiert man seine KI. Und offensichtlich ist die Randbetrachtung eines Bildes keine medizinische Indikation. Also solche Fehler muss man auf jeden Fall ausmerzen. Also sie plädiert dafür, dass KI keine vollständige Blackbox sein darf, also diese Algorithmen. Das ist, glaube ich, aber auch soweit selbstverständlich und entsprechend muss auch das medizinische Personal zumindest im Ansatz verstehen, wie diese KI-Technologien funktionieren. Und natürlich Daten, Datensensibilität und Datenschutz ist auch wichtig.
Holger:[1:14:59] Ja, und ich glaube, man muss sich da klar machen, dass es immer mal wieder so Buzzwords gibt, die dann überall einfach reingeschrieben werden. Und KI ist halt eins davon. Ja, voll. Ein anderes ist Blockchain, wo dann irgendwie so ein paar Jahre lang durch die ganzen Kryptowährungsgeschichten dann irgendwie jeder gesagt hat, wir machen irgendwas mit Blockchain und man dann, aber irgendwie, also meines Wissens noch niemand mit einer wirklich sinnvollen Anwendung für Blockchain angekommen ist.
Christoph:[1:15:34] Ja.
Holger:[1:15:37] Und genauso wird wahrscheinlich jetzt überall immer KI reingeschrieben. Ja, ja. Ohne, dass immer so ganz klar ist, wie KI denn da wirklich sinnvoll nutzbar ist und was denn da die praktischen Use Cases für überhaupt sind. Deswegen glaube ich, ist man ganz gut beraten, wenn man da eine gewisse Vorsicht behält bei dem ganzen Thema. Also gerade wenn irgendwas als Lösung für alles angeboten wird, dann spricht das tendenziell vielleicht auch dafür, dass es gehypt ist.
Christoph:[1:16:14] Ja, voll. Ja, damit bin ich mit dem Buch soweit zu Ende und wir können zu Empfehlungen, Verlinkungen und so weiter übergehen, wenn du magst, außer du möchtest noch was hinzufügen.
Holger:[1:16:30] Nee, also ich fand es das Buch wirft viele spannende Fragen auf, ich glaube es ist auch ein bisschen in der Natur dieser Themen, dass jeder auch für sich selber ein bisschen immer die Antwort dazu finden muss was er dafür richtig hält, aber ich hatte es ja schon am Anfang gesagt das sind komplizierte Fragen, auch deswegen, weil die Antwort nicht immer so einfach ist und ich glaube dann auch, wenn es ans Politische geht, es auch nicht immer so einfach ist, bei den Themen sinnvolle Kompromisse zu finden. Und deswegen glaube ich, dass das auch immer aktuell bleiben wird.
Christoph:[1:17:10] Voll, voll. Das wird es und genau, einfach mein Plädoyer dafür, sich mit den Fragen auseinanderzusetzen. Ich halte das einfach für wichtig.
Christoph:[1:17:26] Ja, wenn du magst, kann ich kann ich starten ich hatte ja
Holger:[1:17:29] Schon also ich habe jetzt nicht so viel ja.
Christoph:[1:17:33] Ich habe auch mir aber ja
Holger:[1:17:34] Also mir ist dann auch aufgefallen wie lese ich anscheinend nicht so viel über ethische themen also zumindest nicht so dass ich das jetzt noch so richtig im kopf hätte also lange her dass ich was über ethik gelesen habe und ja, Ob ich jetzt irgendwie auf Kant dann verweisen will, weiß ich gerade nicht. Insofern habe ich jetzt eigentlich nur drei Sachen. Zum einen eine Korrektur. Also ich habe jetzt nochmal gerade gecheckt. Der Podcast, den ich erwähnt habe über so auch kulturelle unterschiedliche Ansichten zu Suizid, war von Freakonomics Radio. Da hatte ich irgendwie zwei Podcasts durcheinander geworfen, die Folge 40. Dann auch eher seichte Kost, würde ich sagen es gab das vor so zehn, ich schätze etwa zehn Jahren war das auch glaube ich so ein bisschen Bestseller The Top Five Regrets of the Dying, von Brownie Ware.
Holger:[1:18:47] Die halt als quasi als Sterbebegleiterin gearbeitet hat und dann ja, also sehr anekdotenreich so ein bisschen, schreibt, wo darüber schreibt, was sie wahrgenommen hat, als so die Dinge, die die Menschen am Lebensende so ein bisschen bereuen. Natürlich hat dann, wie gesagt, es ist nicht besonders tief, hat auch so ein bisschen einen Selbsthilfe-Touch, aber wenn man sich mit dem Thema nochmal beschäftigen möchte, ist es vielleicht eine Idee. Und dann noch ein Film, der ist mir ganz am Anfang eingefallen zum Thema Designer-Babys. Da gibt es den großartigen Film Gattaca.
Christoph:[1:19:31] Wie schreibt man das?
Holger:[1:19:34] Also ich werde es für die Shownotes richtig schreiben. Ich glaube G-A-T-T-A-C-A. Aber ich check das nochmal für die Shownotes, dass es auch wirklich so geschrieben wird. Der ist auch schon.
Holger:[1:19:53] Späte 90er frühe 2000er muss der gewesen sein also der hat jetzt auch schon sicher also gut über 20 Jahre, wahrscheinlich auch schon über 25 Jahre auf dem Buckel und ist ein hervorragender Film, der so ein bisschen, so ein bisschen eine Welt in der Designer-Babys die Norm sind.
Holger:[1:20:20] So ein bisschen erforscht und das Ganze mit einer auch ganz spannenden Geschichte verknüpft über jemanden, der kein Designer-Baby ist und was für Aufwand der macht, um das System zu… Zu umgehen. Also für mich auch ein Beispiel dafür, dass gute Science Fiction wirklich sehr zum Nachdenken anregen kann. Und ich würde auch sagen, ich habe sogar irgendwann vor ein paar Monaten, es gibt ja auf YouTube manchmal so Reviews von alten Filmen und habe da eine zu dem Film gesehen, die auch gesagt hat, dass der Film immer noch ist, immer noch wert ist, gesehen zu werden. sehr gut gealtert ist. Ich muss gestehen, ich habe ihn jetzt auch wahrscheinlich seit 20 Jahren nicht gesehen, aber ich denke, wer mal so einen Film zu dem Thema sehen will, dieser Film, meiner Meinung nach, wird er sich lohnen.
Christoph:[1:21:24] Super, vielen Dank. Gut, ich kann euch empfehlen, das Buch Der Tod meiner Mutter von Georg Dietz, der, ich kenne ihn als Autoren bei der Süddeutschen Zeitung und des Buchs von 2009. Genau, da geht es um die Krebserkrankung seiner Mutter und er erzählt ein bisschen nach. Ich habe das damals gelesen, das ist jetzt schon lange her, aber ich fand das wirklich ausgesprochen gut. Und genau, diejenigen von euch, die mit so längerfristigen Erkrankungen oder schweren Krebserkrankungen schon selbst konfrontiert waren, ich habe da viel drin wiedererkannt, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie verallgemeinerbar diese Erfahrungen sind und diese emotionalen Haushalte, aber genau, ich fand das einfach sehr, sehr gut.
Christoph:[1:22:14] Dann aus ein bisschen einer wissenschaftlicheren Perspektive, aus einer soziologischen Perspektive, ist die sehr dünne Schrift über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen von Norbert Elias, ich glaube aus den 80er Jahren, finde ich sehr, sehr gut. Da geht es darum, wie der Tod ja im Prinzip immer stärker Individualsache wird und aus der Familie, aus der Gesellschaft an den Rand gedrängt wird. Kann man sicherlich darüber streiten, ob die Diagnose auch gute 40 Jahre später noch trägt, aber ich finde es auf jeden Fall eine spannende Lektüre. Genau, und so ein bisschen, einfach weil wir alle eine Pandemie durch haben oder die, genau, doch alle, die das hier hören, werden es mitgekriegt haben. Der Rest ist noch zu jung. Die Pest von Albert Camus lohnt sich sicherlich auch. Und Verlinkungen zu alten Folgen. Religion für Atheisten von Alain de Botton. Das ist Folge 11, ist, glaube ich, eine vernünftige Referenz. Und Regeln von Lorraine Destin, Folge 86. könnte, glaube ich, auch taugen. Und jetzt weiß ich nicht, in welcher Folge ich das vorgestellt habe, aber Roboterethik von Janina Loh fällt mir so ein zum letzten Kapitel.
Christoph:[1:23:30] Sollte, glaube ich, auch ein, zwei Einsatzpunkte haben, auch zum Thema was ist eigentlich echte Kommunikation und was ist authentisch und wie müssen wir damit umgehen und was bedeutet das? Ja, das war es dann aber auch mit meinen Empfehlungen.
Holger:[1:23:47] Sehr schön. Dann sind wir am Ende unserer Folge. Wir möchten noch mal darauf hinweisen, ihr findet uns natürlich bei den Podcast-Playern eurer Wahl, teilweise inzwischen auch bei YouTube, aber ich glaube, da sind noch nicht alle Folgen online, aber auch da kann man uns hören. Ansonsten auf Social Media sind wir auf Mastodon unter podcast.social at slash at zzd und bei Blue Sky unter at deckeln, hinterlasst uns gerne Bewertungen, auch gerne positive Bewertungen auf den Plattformen eurer Wahl und wir freuen uns dann aufs nächste Mal.
Christoph:[1:24:43] Alles klar, macht’s gut Tschüss
Music:[1:24:46] Music
Quellen
Intro und Outro der Episode stammen aus dem Stück Maxixe von Agustin Barrios Mangore, eingespielt von Edson Lopes (CC-BY).
Das Umblättern zwischen den Teilen des Podcasts kommt hingegen von hoerspielbox.de.
Zwischen zwei Deckeln findest du auch im sozialen Medium deiner Wahl: Mastodon und Bluesky.
Der Beitrag 091 – „Leben und Sterben“ von Alena Buyx erschien zuerst auf Zwischen zwei Deckeln.

Apr 10, 2025 • 1h 3min
090 – „Gegen Wahlen“ von David van Reybrouck
David Van Reybrouck kritisiert das traditionelle Wahlsystem und schlägt innovative Modelle vor, wie etwa das Losverfahren. Er zeigt auf, dass diese Konzepte historisch nicht neu sind und bereits heute umgesetzt werden könnten. Die Diskussion thematisiert die Herausforderungen der Demokratie und die Rolle der Bürgerbeteiligung, während die Verbindung von Wissenschaft und Politik hinterfragt wird. Zudem wird über die Bedeutung von deliberativen Verfahren und Bürgerräten zur Stärkung der politischen Mitbestimmung gesprochen.

Mar 20, 2025 • 1h 6min
089 – „Arbeit. Macht. Missbrauch.“ von Lena Marbacher
In dieser Folge geht es um die komplexe Beziehung zwischen Macht und Missbrauch in unserer Gesellschaft. Es wird herausgearbeitet, wie Machtverhältnisse in Schulen und am Arbeitsplatz Missbrauch begünstigen können. Flache Hierarchien werden hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile analysiert, während die Dynamiken in der Altenpflege beleuchtet werden. Zudem wird diskutiert, welche Herausforderungen Opfer von Machtmissbrauch gegenüberstehen und wie gesellschaftliche Strukturen das Verhalten von Menschen beeinflussen.

Feb 27, 2025 • 1h 7min
088 – „Das Auge des Meisters“ von Matteo Pasquinelli
Das Buch, das Nils uns in dieser Episode vorstellt, führt einige Stränge zusammen, die uns schon seit längerem in diesem Podcast begleiten: von der Digitalisierung der Arbeit über KI und den Kapitalismus bis hin zur Kritik am westlichen reduktionistischen Weltbild:
In „Das Auge des Meisters“ zeichnet der italienische Philosoph Matteo Pasquinelli eine Kulturgeschichte der künstlichen Intelligenz – oder besser der Automatisierung der Arbeit. Er betont dabei die enge Verbindung zwischen sozialen Formen der Arbeitsteilung und deren Automatisierung und weist darauf hin, dass Automatisierung eine Akkumulation von Wissen im Sinne der marxschen Theorie ist. Dies gilt umsomehr für die aktuellen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz.
Shownotes
ZZD086: „Regeln“ von Lorraine Daston
ZZD082: „Demokratie ohne Gesetze“ von C. L. Skach
ZZD081: „Unterwerfung“ von Philip Blom
ZZD079: „Der Allesfresser“ von Nancy Fraeser
ZZD078: „Der Code des Kapitals“ von Katharina Pistor
ZZD064: „Web of Meaning“ Jeremy Lent
ZZD059: „Todesalgorithmus“ von Roberto Simanowski
ZZD022: „Natural Born Cyborg“ von Andy Clark
ZZD018: „Muster“ von Armin Nassehi
ZZD017: „Hello World“ von Hannah Fry
Buch: „James“ von Percival Everett
Buch: „Die Abschaffung des Todes“ von Andreas Eschbach
Buch: „Über Kriege und wie man sie beendet“ von Jörn Leonhard
Buch: „Über soziale Arbeitsteilung“ von Emile Durkheim
Buch: „Zusammenarbeit“ von Richard Sennett
Podcast „Hard Fork“ von der New York Times
Podcast: „Tech wont save us“
Newsletter: „Blood in the machine“ (Newsletter)
Artikel: „What Is ChatGPT Doing … and Why Does It Work?“ von Stephen Wolfram
Transkript (automatisch erstellt)
Music:[0:00] Music
Christoph:[0:16] Herzlich willkommen zu Folge 88 von Zwischenzweideckeln, eurem Sachbuch-Podcast. Ich bin Christoph und habe heute Nils mit dabei.
Nils:[0:24] Hallo zusammen.
Christoph:[0:26] Wir haben im Vorbildgeplänkel uns überlegt, ob die Folge als Folge 88 erscheinen soll oder als 87 plus 1 oder 89 minus 1 oder irgendwie so. Aber wir haben gesagt, wir haben auch Folge 18 einfach so gemacht und deswegen geht auch die jetzt einfach so durch. Aber unsere politische Verortung im Groben und Ganzen kennt ihr ja. Von daher ist es einfach die stringente Durchnummerierung, die wir jetzt schon relativ lange durchhalten. Und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Und meine erste Frage geht an dich, Nils. Das kennst du schon. Was treibt dich gerade um? Womit beschäftigst du dich? Was macht das Leben?
Nils:[0:58] Ja, das Leben hat mich gerade mit meiner zweiten Runde Corona beschert. Das war so letzte Woche so ein bisschen das Dominierende. Da bin ich jetzt aber mittlerweile gefühlt wieder raus. Nur falls meine Stimme noch so ein bisschen belegt klingt, wisst ihr, wo es herkommt. Genutzt habe ich die Zeit, um ein bisschen zu lesen. Ich bin tatsächlich ein bisschen eingestiegen ins Manga-Lesen, paradoxerweise. Da gibt es sehr, sehr spannende, sehr, sehr coole Geschichten. Gerade lese ich To Your Eternity. Das ist irgendwie die Geschichte von einem Geistwesen, das irgendwie unterschiedliche Körperformen annehmen kann und so langsam lernen muss, Mensch zu werden und mit all den Emotionen, die man als Mensch hat, umzugehen und klarzukommen. Sehr, sehr spannend. Übrigens eine Empfehlung irgendwo online mal vor Jahren von einer meiner Lieblingsautorinnen, Ada Palmer. Den Namen habt ihr von mir bestimmt auch schon das ein oder andere Mal gehört. Genau, das ist so das, was mich beschäftigt. Und als Gelegenheitscomputerspieler freue ich mich natürlich gerade über Civilization 7. Da werde ich jetzt diese Woche, die ich Urlaub habe, hoffentlich auch mal Gelegenheit haben, ein paar mehr Stunden reinzustecken.
Christoph:[2:04] Genau. Ja, da wünsche ich dir viel Spaß bei. Ich weiß nicht, wie die Kritiken die ersten so ausgefallen sind, aber ich bin mit Civ irgendwie nie so warm geworden. Ich war immer eher so Team-Siedler und halt irgendwie, also es war mir zu rundenbasiert, glaube ich.
Nils:[2:20] Ja.
Christoph:[2:20] Vielleicht dann auch zu kleinteilig in den Entwicklungslinien und so. Also das war irgendwie nicht immer so meins.
Nils:[2:26] Ja, die Mischungen, die Rezensionen sind sehr gespalten, weil Civ 7 macht was, was Computerspieler fordern immer, aber nicht mögen. Nämlich das macht viele Sachen neu und anders. Und gleichzeitig nicht so super polished. Also schon von den Systemen, von den Mechaniken her sehr gut, aber noch nicht so bis ins letzte Detail immer ganz perfekt. Und das fällt dann natürlich auf viel Kritik, die wahrscheinlich bei einem anderen Spiel, wo nicht dieser Name dran steht, erst mal niemanden gestört hätte. Aber so ist es halt.
Christoph:[2:58] Ja, also ich wünsche viel Spaß auf jeden Fall. Ich kann da kurz einwerfen. Ich wusste nicht, dass wir diese Parallele haben. Ich habe letztes Jahr das erste Mal einen Manga gelesen. Ich habe mich ja ein bisschen mit dem asiatischen Brettspiel Go beschäftigt und da gibt es die Manga-Reihe Hikaru no Go über einen Jungen in Japan, der das alte Go-Brett seines Großvaters findet und darüber mit einem ehemalig erfolgreichem Go-Spieler, der als Geist weiterlebt, in Kontakt tritt und Go ist eigentlich total langweilig bei den jungen Menschen und darüber Begeisterung für das Spiel findet. Und halt quasi so einen cleveren Geist dann im Kopf hat, der die immer mit ihm spielen will. Und ja, so erkunden sie das Spiel. Das habe ich gelesen.
Nils:[3:51] Ah, cool.
Christoph:[3:53] Genau.
Nils:[3:54] Was beschäftigt dich?
Christoph:[3:57] Einerseits sind es Renovierungen. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. Ich glaube, da war das gerade auch aktuell. Meine Großtante musste umziehen und da habe ich mitgeholfen. Und dann hat ein sehr guter Freund eine sehr verwinkelte Wohnung mit sehr hohen Decken, die direkt unterm Dach ist. Also sehr, sehr viele absurde Schrägen in höchsten Höhen. Und die haben wir letztes Wochenende gestrichen. Mit solchen Dingen treibe ich mich rum. Und ansonsten lese ich gerade über Kriege und wie man sie beendet von Jörn Leonhardt. Das Buch ist, glaube ich, aus 2022, 23. Ich weiß es nicht genau, weil ich so das Gefühl habe, eine theoretische Beschäftigung damit, wie Kriege enden, wäre mal vielleicht angebracht. Von dem habe ich in letzter Zeit auch ein paar Podcasts gehört, in denen er eingeladen war. Und genau, ansonsten habe ich gerade noch einen sehr guten Roman, den ich lese. Das ist James, heißt der, von Percival Everett. Und da geht’s, also es ist quasi die Geschichte von Huckleberry Finn, aber aus Perspektive von Jim, dem Sklaven, erzählt und geschrieben. Das ist ziemlich gut, muss ich sagen. Bis hierhin zumindest. Ich habe ein Drittel oder so durch. Genau, das sind die Sachen, die mich umtreiben. Ja, du hast uns heute mitgebracht, das Auge des Meisters von Matteo Paschinelli, Wie man hört, ist der ein Italiener. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, er kommt aus der italienischen marxistischen Tradition.
Nils:[5:23] Ja, zumindest bezieht er sich ganz stark auf sie.
Christoph:[5:25] Okay, na gut, dann zumindest das. Und er ist Philosoph. Und im Vorhinein ist irgendwie, also deine Recherche hat zu einem anderen Ergebnis geführt als meine. Also Nils hat herausgefunden, dass er an der Sarfuskari-Universität in Venedig lehrt oder arbeitet und da offenbar in einem Projekt für KI-Modelle drin ist. Und bei mir ist rausgekommen, dass er Professor für Medienphilosophie an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe ist. So oder so ist er irgendwie mit seiner Forschung, womit er sich beschäftigt, so an der Schnittstelle zwischen kognitiver Wissenschaft, digitaler Wirtschaft und maschinellem Lernen, Wissenschaftstheorie, so der Einschlag. Also genau, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, wird es heute um KI gehen und wenn du magst, gib uns doch eine Kurzzusammenfassung.
Nils:[6:17] Ja, herzlich gerne.
Nils:[6:23] In das Auge des Meisters zeichnet italienische Philosoph Matteo Pasquinelli eine Kulturgeschichte der künstlichen Intelligenz oder besser eine Kulturgeschichte der Automatisierung der Arbeit. Er betont dabei die enge Verbindung zwischen sozialen Formen der Arbeitsteilung und deren Automatisierung. Er weist darauf hin, dass Automatisierung eine Akkumulation von Wissen im Sinne der marxischen Theorie ist. Dies gilt umso mehr für die aktuellen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz.
Christoph:[6:53] Vielen Dank. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass das Ganze im Unrast Verlag erschienen ist, auf Deutsch zumindest, und das letztes Jahr, 2024. Genau, von daher, wenn du möchtest, starte gerne in die komplette Buchvorstellung.
Nils:[7:07] Gerne. Auf Englisch ist es im Verso Verlag erschienen, wem das was sagt. Das ist ja auch nicht ganz unbekannter, etwas linkerer Verlag sozusagen. Und das merkt man dem Buch auch an, sagen wir es mal so. Ihr werdet merken in der Vorstellung das schicke ich vielleicht vorweg das Buch ist inhaltlich sehr sehr spannend ich habe ganz viele Sachen daraus gelernt ganz viele Sachen daraus mitgenommen es ist aber nicht wirklich gut darin seine übergreifende Argumentation irgendwie rauszuarbeiten oder deutlich zu machen oder klar zu machen das heißt ganz viel von dem was ich euch jetzt so als den übergreifenden Bogen schildere ist nicht immer unbedingt explizit in dem Buch auch so angelegt Sondern es ist eher so der Versuch, da einen Bogen reinzubringen in die vielen sehr spannenden Einzelgedanken und Zusammenhänge, die Pass-Queen Nelly da aufzeigt. Aber es ist jetzt ja auch so, dass gerade so die linke marxistische Theorie nicht unbedingt dafür berüchtigt ist, gut lesbare Bücher zu schreiben. Das haben wir hier ähnlich, wobei es jetzt an sich lesbar ist. Es ist jetzt nicht irgendwie begrifflich, irgendwie eine gigantische Schlacht oder so. Im Fehlt so ein bisschen der übergreifende Bogen.
Christoph:[8:23] Nils hat im Vorhinein darauf hingewiesen, dass das natürlich für die Vorbereitung des Podcasts nicht so trivial war, aber unser Format jetzt noch mehr Mehrwert quasi relativ zum Buch gesehen für euch bietet, weil Nils die Argumente für uns extrahiert hat.
Nils:[8:37] Ja, genau, so ungefähr. Das schicke ich vorweg, weil das auch dann was damit zu tun hat, was eigentlich das Ziel des Buches ist, was das ganze Buch macht. Pasquinelli sagt nämlich, dass es ihm in der Einleitung, dass es ihm ganz stark darum geht zu zeigen, dass die Einführung von KI, dass die ganz viel mit Messung und Kontrolle von Arbeitnehmern und Arbeitern zu tun hat. Das macht er auch irgendwie in dem Buch, aber ich habe das eigentlich den Eindruck, er macht noch viel mehr und das, was er sagt mit der Quantifizierung und der Kontrolle, das ist eigentlich nur so ein Nebenaspekt er sagt aber, das sei der Hauptaspekt und das, gut, ja, das kann er gerne so sagen ich habe noch mehr daraus mitgenommen, nämlich das, was ich gerade im TLDL auch schon angedeutet hatte dass es ganz stark um das Verhältnis von Arbeitsteilung und Automatisierung geht Und dass es auch ganz stark um die Ideengeschichte der künstlichen Intelligenz geht. Also dessen, was wir heute künstliche Intelligenz nennen, formulieren wir es vielleicht mal so.
Christoph:[9:36] Darauf bin ich besonders gespannt, weil ich da wirklich völlig blank bin. Für mich ist das so ein bisschen, okay, ChatGPT kam 2022 oder so raus in so allgemein verfügbarer Form und dann musste man halt mal so nacharbeiten. Aber genau, für mich ist es erst so ein kurzfristiges Phänomen in meiner Lebenswelt, von daher bin ich da sehr gespannt.
Nils:[9:59] Und ja und nein, ich meine, Dinge, die sich KI nennen, kennen wir auch schon seit ein paar Jahren. Also auch ChatGPT war jetzt technologisch, zumindest softwaretechnisch, nicht die gigantische Revolution, sondern es hat mal jemand geschafft, genug Ressourcen draufzuschmeißen und ein vernünftiges Produkt rauszudrehen. Die grundlegenden Technologien und Ideen sind alle schon gar nicht so neu.
Christoph:[10:18] Ja, haben wir auch schon vorher hier im Podcast ja auch schon verhandelt. Eben, das stimmt.
Nils:[10:24] Genau, also wir fangen erstmal an mit dem Begriff Algorithmus oder auch Pasquinelli fängt mit dem Begriff Algorithmus an und schickt erstmal was vorweg, was eigentlich ganz wichtig ist, weil den Begriff Algorithmus habt ihr jetzt in der politischen Diskussion und kriegt man immer wieder mit, die Algorithmen bestimmen, was wir tun und so weiter und so fort. Es ist irgendwie nicht auszuweichen, dem Begriff aktuell, aber Pasquinenisch sagt eigentlich, wir haben eigentlich gar nicht so genau klar, was das ist. Was ist eigentlich ein Algorithmus? Und was aber noch viel wichtiger ist, als das, was genau ist das eigentlich, ist, dass er sagt, das ist überhaupt nichts Neues. Das haben wir schon seit Jahrhunderten in der einen oder anderen Form.
Christoph:[11:11] Muss man sich dafür gedanklich sehr verrenken, um das nachvollziehen zu können, oder ist das intuitiv plausibel?
Nils:[11:17] Das finde ich intuitiv sehr plausibel, gerade weil das auch nachher seine Argumentation stark aufbaut. Er sagt halt, also wenn man Algorithmen so als Vereinbarung darüber, wie bestimmte Abläufe ablaufen, sozusagen versteht, was ja sicherlich auch eine verteidigbare Position sozusagen an diesem Thema ist, dann unterscheidet er drei Arten von Algorithmen. Dann hat er nämlich einmal sowas wie soziale Algorithmen, dann formale Algorithmen und dann automatisierte Algorithmen. So, das gucken wir uns mal ganz kurz an. Soziale Algorithmen sind einfach nur Dinge, wo sich irgendwelche Gruppen oder irgendwelche, ja, am einfachsten macht man es am Produktionsunternehmen, da bleibt das Beispiel auch nachher konsistent, wo sich irgendwie darauf geeinigt wird, wir machen das jetzt so, erst machst du das, dann mache ich das, dann machst du wieder das, dann machst du das und wir sozusagen so einen Ablauf haben, der über mehrere Personen geht, die sich irgendwie absprechen, wer was macht, damit dann am Ende im Beispiel irgendwie ein bestimmtes Produkt rauskommt oder ein Klinik. Kind betreut ist oder was auch immer. So, ne? Als soziale Absprache zwischen Menschen, die das irgendwie dann so machen. Sei es entweder, weil sie es wirklich sich hinsetzen und absprechen oder weil es einfach die Routine ist, die Tradition und es schon immer so gemacht wurde.
Nils:[12:31] So. Das ist ein sozialer Algorithmus im Grunde. Wie funktionieren bestimmte Dinge, wie organisiert sich irgendwie eine soziale Gruppe? Dann hat er die formalen Algorithmen. Das sind im Grunde Algorithmen, die man auf Papier schreiben kann. Also klassisch ist eine mathematische Formulierung. Wenn ich da irgendwie eine Formel draus machen kann oder irgendwie eine Formel draus machen kann oder irgendwie auf Papier bringen kann, dann formalisiere ich ihn. Zum Beispiel auch in Gesetzen oder in Verfahrensanweisungen habe ich in gewisser Weise auch Algorithmen verortet. Da muss ich jetzt zum Beispiel ganz viel an Webers Bürokratie-Theorie denken, wo bestimmte Abläufe einfach, jetzt machst du das und dann geht die Akte dahin und dann passiert da das und dann passiert da der Schritt und dann hat das den Status und dann geht das dahin. Auch das ist eine Art von Algorithmus in gewisser Weise. Und dann kommt im Grunde der dritte Schritt, das ist dann die Automatisierung. Das heißt, das automatische Ablaufen dieser Algorithmen, ohne dass da Menschen noch irgendwie groß daran beteiligt sind. Und das ist jetzt schon so der erste Punkt, wenn ich mich recht entsinne, macht er das gar nicht explizit, aber für mich war das relativ offensichtlich, dass da auch eine historische Entwicklung zu beobachten ist. Weil das auch eigentlich eine seiner Kernthesen nachher wird, dass jeder Algorithmus auf der sozialen Ebene anfängt. Dann formalisiert wird und dann automatisiert wird.
Christoph:[13:52] Ja, okay, ja.
Nils:[13:54] Klingt ja auch erstmal irgendwie sehr logisch. Was daran wichtig ist, was sich daraus ergibt, das ist im Grunde eine zweite Perspektive, dass diese Algorithmen oder auch jede Abstraktion, also ein Algorithmus ist in gewisser Weise eine Abstraktion, weil es etwas Konkretes nimmt und irgendwie in so eine allgemeine Form zu gießen versucht. Und das betont er eben genau, dass sich jede Abstraktion aus etwas Konkretem ergibt und in einem Konkretes. konkreten historischen Kontext steht. Das heißt, irgendwie ein Algorithmus, der jetzt formal entwickelt wurde, kommt nicht aus dem Nichts und steht nicht irgendwie außerhalb jedes Kontextes für sich alleine, sondern er kommt aus etwas ganz Konkretem und ist halt auch aus einem bestimmten Grund irgendwie entstanden und entwickelt worden. Pasquinelli geht halt sogar so weit zu sagen, dass es am Ende immer darum geht, physische oder mentale Arbeit zu sparen dabei.
Christoph:[14:53] Ja, okay, auf dem abstrakten Level dann ja sowieso, aber ich meine, das, was wir jetzt so kennen und im Alltag nutzen, also diese ganzen, diese bisschen cleveren Textantwort-Ausspuckmaschinen, die sind ja jetzt erstmal nicht so spezialisiert. Also die sind ja deutlich allgemeiner gehalten. Also sie sind natürlich keine offensichtlich allgemeinen Intelligenzen. Es ist keine General-KI. Aber weißt du, was ich meine?
Nils:[15:20] Ja, also soweit ist er an der Stelle noch gar nicht. Er ist tatsächlich jetzt eher noch so irgendwie im 19. Jahrhundert bei der Industrialisierung. Aber zudem, jein, also man muss bei diesen LLMs, also Large Language Models, das was wir heute mit dem TGPT und so, was wir KI nennen in der Diskussion heute ganz oft, ganz klar sagen, die sind in gewisser Weise allgemein, als dass sie zu jedem Thema irgendwas fabrizieren können. Die sind aber im Kern doch wieder hochspezialisiert. Die sind nämlich hochspezialisiert darauf, plausibel wirkende Texte zu produzieren.
Christoph:[15:53] Ja, das stimmt natürlich.
Nils:[15:55] Also das merkt man bei denen auch, sobald die rechnen sollen. Aktuellen Modelle sind irgendwann so clever, sie erkennen eine Rechenaufgabe und lassen einfach einen normalen Rechenalgorithmus drauf los, anstatt dass das LLM da drauf geht. Aber das LLM selber kann nicht rechnen. Also da gab es ja auch mal so diese Themen, wie viele R sind im Wort Strawberry oder so.
Christoph:[16:18] Das hat mich völlig kaputt gemacht. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe es dann selber auch gefragt und dachte, das funktioniert ja wirklich nicht. Was soll das?
Nils:[16:26] Da kommen wir nachher zu, aber weil das System eben nicht versteht. Das weiß nicht, was ein R ist und dass das Wort Strawberry ist. Es generiert einfach einen Antworttext, wie die Textvervollständigung am Handy, der den Text nach dieser Frage plausibel fortsetzt. Ja. So, und da hat das nichts mit der eigentlichen Frage zu tun, inhaltlich. Da kommen wir aber tatsächlich im zweiten Teil des Buches dann auch ein bisschen zu, weil da steckt eine ganz spezielle ideengeschichtliche Entwicklung hinter. Genau, jetzt habe ich schon gesagt, er macht dann im Anschluss an diese kurze Einleitung zwei Teile. Historisch relativ klar abgrenzbar auf 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert. Also industrielle Revolution und Informationszeitalter nennt er die beiden, Aber faktisch ist es irgendwie so die Grenze so in den 20ern, 30ern des 20. Jahrhunderts. Und er geht im Grunde von derselben Stelle aus, die ich auch schon in meinem Podcast zu Regeln von Lorraine Dest vorgestellt habe, nämlich dem ersten Computer oder der ersten automatisierten Rechenmaschine, muss man ja genauer sagen. Das war die Difference Engine von Charles Babbage. Und ich erzähle die Geschichte jetzt nochmal, weil vielleicht nicht jeder von euch den Regel-Podcast von Lorraine Destin oder über Regeln von Lorraine Destin gehört hat.
Nils:[17:48] Es gab im, ich bin jetzt in den Jahrhunderten verrutscht, aber es müsste, glaube ich, Ende des 18. Jahrhunderts gewesen sein, gab es den großen Plan, oder für astronomische Berechnungen braucht man gigantische Logarithmentabellen. Also wirklich bücherweise hunderte von Seiten, tausende von Seiten Tabellen mit Logarithmen, die berechnet werden mussten. Und was man da gemacht hat, ist eben, man hat eine Rechenmethode gefunden, diese Logarithmen zu berechnen, die nur auf Summen und Differenzen basiert, die also relativ einfach zu berechnen ist. Und dann hat man diese Aufgaben, diese tausenden Aufgaben sozusagen über hunderte Leute im ganzen Land verteilt, die dann nach diesem einfachen Rechenverfahren einzelne Rechenschritte sozusagen dieser Berechnung durchgeführt haben. Für die man halt nur addieren und subtrahieren können musste und nicht halt tatsächlich irgendwie Logarithmen berechnen.
Nils:[18:43] Und das war auch schon bei Destin, so ein paar Skrini, die sieht das auch so, das war im Grunde so die Geburtsstunde des Computers. Diese Art, so eine intellektuelle Aufgabe, eine Berechnung von Logarithmen auf einen einfacheren Prozess runterzubrechen und den dann irgendwie dezentral auszulagern, auf Arbeitskraft, die nicht so viel können muss, formulieren wir es mal neutral. Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, sowohl bei Destin als jetzt auch hier bei Pasquinelli, dass eben diese Arbeitsteilung, diese Aufteilung auf die Menschen es Babbage überhaupt erst ermöglicht hat zu sagen, okay, jetzt haben wir diese Aufteilung auf die Menschen geschafft, jetzt können wir die Menschen automatisieren. Jetzt können wir diese
Nils:[19:27] Weniger anspruchsvolle Arbeit, die die Menschen machen können, die können wir jetzt automatisieren und daraus ergibt sich dann am Ende diese logarithmisierte Berechnung. Das heißt, es ist nicht, das ist der zentrale Punkt von Pasquinelli, vielleicht der zentrale Punkt des ganzen Buchs, es kommt nicht erst die technische Idee, so können wir das automatisieren und jetzt automatisiere ich das, sondern es kommt als erstes die soziale Form der Arbeitsteilung, die soziale Organisation und dann wird diese soziale Organisation automatisiert. Das heißt, die Technik geht sozusagen der sozialen Innovation nach und nicht voraus.
Christoph:[20:06] Okay, ja, finde ich plausibel.
Nils:[20:10] So, das ist natürlich, wenn man das jetzt überträgt auf sämtliche Innovationsdebatten so nach dem Motto, ja hier, die Technologie treibt die Innovation voran. Da würde Pasquinelli eben sagen, halt stopp, es ist andersrum. Die Technologie läuft der Innovation hinterher, die Innovation kommt aus dem gesellschaftlich-sozialen Bereich. Die Technologie sucht sich dann nur die Stellen, wo sie irgendwie einhaken kann, wo sie gerade die Möglichkeiten hat für Automatisierung, für Verstärkung und so weiter und so fort. Das ist so einer der Kernpunkte, glaube ich, des ganzen Buchs, zu dem wir jetzt schon relativ früh schon kommen.
Nils:[20:49] Das heißt,
Nils:[20:52] Dass wir hier die Entwicklung des Computers, also jetzt hier Charles Babbage, den ich in dem Buch jetzt nicht erwartet hätte, erstmal von dem, wie ich das Thema hatte, und auch Ada Loveless, die ja eng mit ihm zusammengearbeitet hat. Ada Loveless war dann diejenige, die erkannt hat, man kann nicht nur sagen, also die Differenz-Engine von Charles Babbage, das war diese erste Maschine, die hat dann dieses eine konkrete Verfahren in Hardware kodiert und umgesetzt. In gewisser Weise. Das heißt, diese Maschine konnte nur genau das. Und Ada Loveless war dann diejenige, die die Idee hatte, dass man im Grunde auch einem Computer sagen kann, dass er was anderes tun soll. Dass er nicht nur dieses eine erfahren kann, sondern dass man ihm irgendwie sagen kann, jetzt rechne an der Stelle mal Minus und nicht Plus. So, dass man da eben diese Trennung von Hardware und Software, die uns heute relativ selbstverständlich ist, die ist im Grunde da entstanden in dieser Interaktion zwischen den beiden.
Nils:[21:44] So, das vielleicht noch als historische Einordnung. Also jetzt sind wir also in der Situation, dass wir in der industriellen Revolution genau da sind, dass wir immer mehr Formen haben, wo eben Arbeit erstmal arbeitsgeteilt wird und auf eine Manufaktur oder auf eine quasi industrielle Produktion umgestellt wird mit kleinen Arbeitsschritten, die irgendwie automatisiert werden und die dann automatisiert werden können. Das haben wir ja in der Zeit, das haben wir auch Anfang des 20. Jahrhunderts, das haben wir auch über das 20. Jahrhundert immer weiter gehabt, also das endet erstmal nicht so direkt der Prozess und jetzt sind wir an diesem Punkt,
Nils:[22:25] Und wenn wir uns das jetzt angucken, dass Produktion, also Dinge zu produzieren, ja, Auto ist ein schlechtes Beispiel, weil das wurde im 20. Jahrhundert erst angefangen, aber irgendwelche Wagenräder, Eisenbahnen oder ähnliches zu produzieren, braucht Wissen und Expertise. Ich kann nur etwas produzieren, sei es automatisiert oder nicht automatisiert, wenn ich das entsprechende Wissen habe, die entsprechende Erfahrung habe, die entsprechende Expertise habe. Das braucht es einmal auf der Führungsebene, bei den Vorarbeitenden oder später dann eben auch auf der planenden Ebene, die ja erst entstanden ist später. Und aber natürlich besonders bei den Mitarbeitenden. Und die Automatisierung ist dann, da kommen wir jetzt wieder zu einem Marxischen Begriff, im Grunde so etwas wie eine ursprüngliche Akkumulation. So, das ist jetzt auch wieder ein Begriff, den wir uns erstmal angucken müssen. Es gibt im Griff der ursprünglichen Akkumulation, der wird meistens darauf bezogen, dass Dinge, die früher Gemeingut waren, wie zum Beispiel Land oder wie Ressourcen, die halt irgendwie im Boden lagen, die gehören ja erstmal keinem. Ursprüngliche Akkumulation ist in der, ich meine es ist in der marxistischen Theorie der Moment, wo die jemandem zugeschlagen wurde. Wo jemand sagen wird, okay diese Kohle gehört jetzt mir.
Nils:[23:43] Und genau so und diese Person dann darüber verfügen könnte, das kontrollieren konnte und genau so sieht Pasquinelli in der Automatisierung eben die Akkumulation von Wissen. Das heißt, wenn ich auf einmal eine Maschine habe, die einen Teppich produzieren kann, dann brauche ich das Wissen der Arbeitenden nicht mehr in der Form beziehungsweise ich habe es hier und dann kann ich es kontrollieren. Ich kann sagen, wird es jetzt eingesetzt, wird es nicht eingesetzt. Wer darf es nutzen? Das liegt nicht mehr bei den Personen selbst. Und das gibt einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil das eben genau diese Form der Arbeit, diese arbeitsteilige Produktion, die praktische Routine, die ganz viele Leute haben, in den konkreten Arbeitsschritten irgendwie Dinge zusammenzubauen, Teppich zu weben, was auch immer, als auch die soziale Form, in der das vorher organisiert wurde, weil es die im Grunde auflöst und in die Maschine packt. Und damit aber auch den Arbeitern wieder unzugänglich macht. Weil die es nicht mehr machen müssen, weil die es nicht mehr lernen müssen, lernt sie es eben auch nicht mehr und dann verschwindet das Wissen sozusagen aus der Arbeiterschaft und bleibt nur noch in dieser Maschine versteckt.
Christoph:[24:55] Ja, ist ja auch das Bedrohungsszenario im Prinzip bei Berufssubstituierungen, also es ist wirklich genau das, also dieses euer Wissen wird dann irrelevant, sobald wir es automatisieren können und in eine irgendwie geartete Maschine packen können.
Nils:[25:16] Ja, es geht sogar noch weiter, man lernt das halt auch nicht mehr. Das ist so ein Thema, was beim Thema KI zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie KI irgendwelche Texte schreibt oder irgendwelche Beratung durchführt und man dann sagt, ja, dann brauchst du halt einen Menschen, der nochmal drauf guckt, ob das auch stimmt, ist richtig, keine Frage, da will ich überhaupt nicht bestreiten, aber woher lernen denn die Menschen, was gute Texte sind und gute Beratung sind, wenn die einfachen Sachen von der KI gemacht werden?
Christoph:[25:41] Ja, das geht dann verloren.
Nils:[25:44] Ja klar Also diese Verbindung macht Pasquenelli zum Beispiel nicht explizit auch wenn sie für mich offen auf der Hand liegt an der Stelle
Christoph:[25:50] Ist ja auch bei, je nachdem wann mal wirklich autonomes Fahren kommt und diese, Assistenzsysteme ist das ja glaube ich, also das scheint mir mit die gefährlichste Variante zu sein dass wir alle also was einfach Unfall-Szenarien und so angeht, dass du, dich zu sehr auf die automatisierten Systeme verlässt, deswegen selbst nicht mehr gut fahren kannst und im Zweifel, wenn die KI versagt, eben nicht mehr gut eingreifen kannst.
Nils:[26:16] Genau, exakt. Und genau das gibt es im Grunde an jeder Stelle, wo das zu viel automatisiert wird. Das ist exakt der Punkt. Was wir dann auch haben, ist wir haben eine Spaltung in der Arbeiterschaft zwischen dem, was im Englischen gerne White Collar und Blue Collar genannt wird oder bei uns Das ist vielleicht Wissensarbeit und physische Arbeit oder so.
Nils:[26:44] Und dann hat das dazu geführt, das war tatsächlich auch eine bewusste Strategie wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, auch wenn das jetzt eher aus der Marxischen Theorie kommt, also wie sehr das empirisch abgesichert ist, ist natürlich immer schwer zu sagen. Wo sich dann auch diese Spaltung ergeben hat zwischen White und Blue Collar, diese Abgrenzung und wo es dann eben auch gelungen ist White Collar nicht länger als Arbeit im engeren Sinne anzusehen also White Collar im Sinne von das sind die, die irgendwelche Produktionsprozesse planen Management, Verwaltung und so weiter und so fort, die nicht jetzt die eigentlich physische Arbeit machen, sondern das drumrum und die Planung und die Konzeption dass das nicht als Arbeit angesehen wird und auch nicht Teil des Klassenkampfes ist.
Nils:[27:32] Das sehen wir ja jetzt auch, wenn wir auf gewerkschaftliche Durchdringung und sowas gucken in verschiedenen Bereichen, dann ist das im Produktionsbereich trotz allen Rückgangs immer noch deutlich höher, als wir das in Dienstleistungs- oder in der klassischen Wissensarbeit im Grunde haben. Da ist Pasquinelli, finde ich nicht so ganz eindeutig, ob er einen Grund dafür sieht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, an einer Stelle sagt er, Marx hat mal irgendwann gedacht, es ist einfacher, wenn wir uns auf die Blau- und die Blue-Collar konzentrieren und deswegen hat er die White-Collar rausgeschmissen. Und das setzt sich im Grunde bis heute fort. Talking about kleine Entscheidungen, große Wirkung. Aber das könnte tatsächlich ein Grund sein, warum wir bis heute, was wir gerade angesprochen haben, in der Wissensarbeit eine wesentlich geringere Durchdringung, was Gewerkschaften und so weiter angeht.
Christoph:[28:20] Es sind im Prinzip Es gibt ja auch Arbeitsformen, die genuin weniger kollektivistisch sind. Ja. In dem Sinne, dass sie stärker individualisiert sind. In deinem Erleben bist du, glaube ich, Teil einer Organisation meistens, aber nicht Teil einer Arbeiterinnenschaft, die gemeinsam in Schichtbetrieben und so immer wieder das Gleiche abruft und wiederholt und ja dann auch sehr, sehr offensichtlich ist, dass du im Kern durch die anderen prinzipiell ersetzbar bist, weil die anderen genau, also jemand löst ja deinen Betriebsschritt am Ende deiner Schicht ab. Ja. Und macht genau das, was du vorher gemacht hast, auch weiter. Also ich glaube, und das hast du dann in Berufen wie deinem oder meinem sicherlich deutlich weniger.
Nils:[29:11] Wobei das vielleicht auch ein Thema der Betriebsgröße dann an der Stelle ist. Weil es halt nicht so viele, weil der Bedarf danach nicht so groß ist, dass es nicht so viele Leute gibt, die das könnten. Also ich bin bei dir im Erleben, ist es definitiv so, ganz klar. Wobei ich mir da auch nicht sicher bin, ob man da nicht aus unserer Perspektive was projiziert. Weil das Glauben heißt, jetzt kommt der nach mir, der kriegt da wieder nicht hin, dann muss ich das nachher wieder reparieren, weil die Sachen zurückkommen oder so. Ich glaube, so Prozesse gibt es da auch.
Christoph:[29:38] Also ich glaube, du hast auf jeden Fall diese Kollektivstrukturen deutlich stärker. Also im Handwerk haben wir auch keine hohe gewerkschaftliche Organisation und trotzdem ist es keine Wissensarbeit in dem Sinne.
Nils:[29:51] Ja gut, aber da würde, das ist aber eben die nicht automatisierte Produktion würden, das ist ja genau der Punkt, das ist ja im Grunde so ein bisschen der Vorsprung, also der Vorzustand, wobei das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, es wird ja oft so, gegen der automatisierten Produktion wird so dieses begnadete Kunsthandwerk gegenübergestellt, so der begnadete Handwerker. Das ist nicht das Bild, was Pasquinelli von der Arbeit vor der Automatisierung hat, also geht es da schon wie heißt es, Mindful Hand also das heißt, es geht schon um eine Routine und um gewisse Erfahrungen in bestimmten Produktionsschritten aber es geht nicht um eine quasi künstlerische Handwerkskunst so in dem Sinne sondern um eine Produktionsroutine dass man das eben einfach machen kann also das wird auch die die Stopfarbeit in Heimarbeit von irgendwelchen Kleidungsstücken oder sowas ist damit auch gemeint. Wo eben ganz viel Praxis, Routine, Erfahrung und Wissen reinfließt in die unmittelbare Produktion, ohne dass es ist, ich mach jetzt hier den goldenen Tisch für den König.
Nils:[31:01] Das ist vielleicht auch noch wichtig, diesen Gegenpol klar zu machen, dass das hier nicht so eine idealisierte Handwerksform ist, sondern es schon um eine echte Produktionsform geht, die er da im Vorhinein sieht. Und dann erfolgt eben genau diese Trennung, dass ich in der Arbeiterschaft immer weniger dieses Wissen und diese konkrete Erfahrung brauche, weil die sich eben in der Maschine sozusagen akkumuliert.
Nils:[31:25] Und damit, das ist jetzt der letzte Punkt im Grunde aus diesem Abschnitt zur industriellen Revolution, wird die Arbeit im Grunde zur reinen Rechengröße. Weil ich die Arbeit ganz einfach automatisieren kann, also Energie reingeben kann im Grunde, mit Dampfmaschinen oder mit Strom. Und da spielt die Kohle eine ganz große Rolle, weil mit der Kohle kann ich die Arbeit auf einmal sogar berechenbar machen. Ich weiß hier, für diesen Arbeitsschritt oder für diesen Tag Fabrik brauche ich so und so viel Tonnen Kohle. Punkt. Und dann ist Arbeit, physische Energie, nichts anderes mehr als eine Rechengröße. Ob das jetzt Kohle ist, ob das jetzt Strom ist, ob das jetzt Öl ist, was diese Energie liefert, ist letztendlich für die Arbeit erstmal egal, vor irgendwelchen Preis- oder Umwelteffekten oder so. Was viel wichtiger ist, ist das Wissen, dass eben in den Maschinen
Nils:[32:20] Akkumuliert ist, eben die Produktionsfaktoren. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man sich hier nochmal klar machen muss, dass das wohl auch bei Marx, zumindest in früheren Texten, das kommt wohl in seinen späteren, bekannteren Texten nicht mehr so raus, aber das, und das jetzt auch wieder erstaunlich aktuell wird, diese Akkumulation von Wissen in einzelnen Maschinen, in einzelnen Systemen, dass die letztlich auch eine Gefahr für Kapitalismus darstellt. Weil sie eben so sehr wenn man es einmal geschafft hat dann ist es für andere noch schwerer dagegen anzustinken und das ist jetzt was was wir ja genau bei kannst
Christoph:[33:01] Du das nochmal genau erklären also.
Nils:[33:02] Wir sind jetzt in der Situation dass Arbeit sehr einfach zu automatisieren ich kaufe Kohle, packe die in eine Dampfmaschine und dann habe ich die Energie da die Frage ist was mache ich mit dieser Energie und wenn ich es einmal schaffe dieses Wissen aus den Menschen rauszuholen, in eine Maschine zu packen. Während andere das nicht schaffen, dann habe ich denen gegenüber natürlich einen massiven Wettbewerbsvorteil. Weil ich über dieses Wissen auf einmal unabhängig von den Arbeitenden verfügen kann. Und das ist jetzt ein Phänomen, was wir beim aktuellen KI-Thema wieder sehen. Wo wir ein paar große Modelle haben, die es geschafft haben, die behaupten es geschafft zu haben, dieses Wissen in welcher Form auch immer in sich zu ziehen. Und jetzt natürlich versuchen andere auch daran zu hindern und das weiter abzusichern. So, da haben wir auch einen schönen Bezug zum Jogpoint-Capitalism von Cory Doctorow, den ich auch gar nicht in meiner Liste habe für nachher.
Nils:[33:58] Genau, also das ist so ein bisschen der Punkt, den wir hier haben. Wir haben diese Akkumulation von Wissen und in Maschinen, in Automatisierung, die auf einmal zum zentralen Wettbewerbsfaktor im Grunde im Kapitalismus wird und gar nicht mehr so sehr das Thema Arbeit. Wer hat mehr Arbeitskräfte oder wer hat die besseren Arbeitskräfte oder so, das ist aus dieser Perspektive erstmal weniger wichtig. Wichtiger ist, wer hat die besseren Maschinen, möglicherweise. Was sich aus dieser Perspektive dann entwickelt, ist die Idee der Kybernetik. Da geht es darum, komplexe Systeme zu kontrollieren und zwar, in denen Menschen und Arbeiter irgendwie ineinander interagieren. So ein ganz klassisches Bild, so ein Produktionsablauf, wie man ihn sich klischeehaft vorstellt. kommt aus der Maschine raus, der Arbeiter legt das dann rüber auf die Maschine, dann wird in der Maschine das gemacht und dann geht das weiter, also die klassische Fließbandproduktion im Grunde, wie man sie sich vorstellt. Das ist der erste Abschnitt zur industriellen Revolution. Da ging es vor allen Dingen um diese Idee, dass die Automatisierung der sozialen Arbeitsteilung nachgelagert ist und dass wir eben in Maschinen im Grunde eine Monopolisierung, eine Akkumulation von Wissen im Grunde verankert haben. So, jetzt kommt das Informationszeitalter, in dem er nichts von diesen Argumenten wirklich aufgreift, was ich sehr schade finde. Er macht jetzt eine komplett neue Argumentationslinie im Grunde auf, die an sich auch wieder spannend ist, die er aber nicht so richtig mit der ersten verbindet und verknüpft und zeigt, wie spielt das jetzt zusammen.
Christoph:[35:27] Das ist schade.
Nils:[35:28] Das werde ich jetzt in meiner Vorstellung so ein bisschen versuchen zu machen. Genau, wir haben also diese Idee der Kybernetik. Kybernetik heißt klassische Idee. Es gibt im Grunde die klassische terroristische Produktion. Es ist jemand da, der den Produktionsprozess plant. Und dann sind da diejenigen, die nur noch wie belebte Roboter im Grunde die einzelnen Arbeitsschritte nacheinander ausführen. Was wir jetzt aber haben, ist, dass sich im Laufe des 20. Jahrhunderts zu Anfang in den 30er, 40er Jahren, Mitte, Ende der 40er Jahre, ein neues Paradigma entsteht. Und zwar so ein bisschen als Reaktion auf die Veränderungen der Kommunikationsstruktur. Also wenn man ins 19. Jahrhundert guckt, da steht sozusagen diese Idee der Dampfmaschine im Zentrum, die irgendwie in einem zentralisierten Punkt ist, aus dem irgendwie Energie kommt und diese Energie muss dann irgendwie kontrolliert und genutzt werden.
Nils:[36:31] Kommt im 20. Jahrhundert immer mehr, oder auch Ende des 19. Jahrhunderts, das sind natürlich immer so fließende Übergänge und Überlagerungen und so, nehmt das jetzt bitte nicht als harte Grenzen, aber kommt immer mehr so ein bisschen diese Idee des Netzwerkes auf, weil Pasquinelli bezieht das so ein bisschen aus der Idee der Kommunikationsnetzwerke, weil Telegrafen immer relevanter werden, weil immer mehr so ein Netzwerk von dezentralen Positionen besteht, die irgendwie miteinander interagieren, und was sich daraus dann ergibt, ist das Paradigmen der Informationsverarbeitung. Also dass es im Grunde nicht mehr darum geht, Energie zu steuern, sondern Informationen zu verarbeiten. Und genau dieser Schritt… Den wir gerade auch schon hatten. Und da entsteht dann irgendwann die Grundidee, oder auch aus der Hirnforschung, die Idee der Neuronen. So dieses Grundgedanke. Es gibt Schaltungen oder Punkte, die für sich sehr einfach funktionieren. So ein Neuron ist an sich erstmal nicht komplex im engeren Sinne. Es funktioniert relativ einfach. Es lässt sich relativ einfach bauen. Aber weil sehr viele davon nach bestimmten Regeln miteinander interagieren, entsteht halt irgendwie was Neues.
Christoph:[37:47] Ja.
Nils:[37:48] Das ist so ein bisschen die Grundidee. Und aus dieser Grundidee ergeben sich dann zwei Herangehensweisen. Wie man Wissen oder Lernen automatisiert. Also jetzt geht es nicht mehr darum, Produktion zu automatisieren, sondern Wissen zu automatisieren. Also diesen Teilaspekt von Produktion oder den Wissenserwerb zu automatisieren. Da gibt es einmal den sogenannten Symbolismus und den Konnexionismus. Und das ist tatsächlich auch ein Kontrast, den wir heute in der KI-Diskussion noch wiederfinden. Der Symbolismus ist im Grunde der Gedanke, ich bilde die Welt in Symbolen ab und operiere dann auf diesen Symbolen. Das heißt Beispiel
Christoph:[38:37] Also die verschiedentlichen Verdopplungen der Welten die wir schon so erlebt haben.
Nils:[38:42] Ja aber auf eine bestimmte Art der Verdopplung also beides in gewisser Weise Verdopplung Konnexionismus auch sondern es geht im Grunde darum zu sagen ich versuche durch eine bestimmte Verknüpfung von also es gibt dieses schöne Beispiel was von KI was bei KI genannt wird König minus Mann plus Frau gleich Königin oder König minus Mann gleich Herrschaft diese Logik zu denken, es gibt so Eigenschaften in der Welt Symbole in der Welt, die sind da und die interagieren nach bestimmten Regeln miteinander das ist eng verbunden mit der Gestalttheorie wo es eben darum geht zu sagen wir sehen nicht Einzelteile und schließen darauf auf das Ganze sondern wir sehen im Grunde erst das Ganze und entwickeln daraus irgendwie einen Bezug, also eine klassische Frage Ihr kennt das Beispiel vielleicht, es gibt so eine Zeichnung von einem Dreieck, wo gar nicht das Dreieck gezeichnet ist, sondern nur so die drei Ecken so angedeutet. Und dann sind die Linien, sind aber gar nicht durchgezogen, sondern da sind Lücken. Und trotzdem sehen wir ein Dreieck. Das ist so ein Beispiel der Gestalttheorie, weil das wie ein Dreieck aussieht. Deswegen ist das ein Dreieck. Auch wenn es eigentlich Dreiecken sind, die nicht miteinander verbunden sind. Wir nehmen es trotzdem als Dreieck wahr. Das ist so ein bisschen der Gedanke, wir haben diese ganzen Einheiten, die wir als solche wahrnehmen.
Nils:[40:08] Und im Grunde ist das auch, wenn man will, so ein bisschen, wenn wir uns auf einen logischen Begriff überziehen, die deduktive Logik. Wir haben so das Ganze und daraus schließen wir dann auf kleinere Teile.
Christoph:[40:19] Okay, also ist damit aber nicht, sind nicht so Emergenz-Phänomene gemeint. Im Sinne von, ist doch gemeint?
Nils:[40:26] Was meinst du genau? Entschuldigung, jetzt bin ich viel zu ehrlich eingegangen.
Christoph:[40:28] Mit Emergenz, ich denke, also mein Lieblingsbeispiel für Emergenz ist ein Bildhauer, eine Bildhauerin guckt auf seinen ihren Block Marmor, schaut da drauf und sieht vor dem geistigen Auge dann schon die Figur, die er sie da rausschlagen möchte. Also die Figur emergiert quasi aus dem Block, aus dem man schöpft. Und vor allen Dingen auch, also für mich ist Emergenz auch stark mit Spontanität verknüpft.
Nils:[40:59] Also diese Art von Emergenz würde ich jetzt tatsächlich eher auf die Gestalttheorie sehen. Es gibt ja auch diese Art von Emergenz, so wenn viele Leute eine Sache machen, dann entsteht irgendwie was Großes daraus. Weil wir alle jetzt irgendwie auf X rumhängen oder rumgehangen sind, entstand daraus irgendwie so ein großes globaler Marktplatz der Informationen. Das ist ja auch so ein bisschen Emergenz, das wäre dann eher Konnexionismus. So bei ist, halt immer darum geht, welche Ebene betont man. Also der Symbolismus geht jetzt eher davon aus, okay, es ist relevant, dass X, ehemals Twitter, dieser Marktplatz ist. Wie das jetzt unten genau mit der Interaktion aussieht und so, das ist gar nicht so relevant. Dieser Marktplatz ist da.
Christoph:[41:45] Okay.
Nils:[41:46] Und es ist dieser Marktplatz. Oder es ist die Königin. Ob die jetzt, wie genau das darunter aussieht, ist gar nicht so wichtig. Und die Gesellschaft. Also im Grunde immer diese Emergenz im Sinne von, wir haben eine höhere Ebene, irgendwie viele kleine Teile ergeben was Ganzes und der Symbolismus würde in dem Moment jetzt, zumindest wie Pasquinelli Ihnen vorstellt, sagen, uns ist wichtig, dieses Ganze abzubilden und diesem Ganzen seine eigene Logik zuzustreiben, also das, was man im Bereich der Emergenz starke Emergenz nennen würde. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, um es jetzt mal salopp zu schrecken. Da gibt es in den Konnexionismus, da geht es im Grunde darum, im Kern zu sagen, das Ganze ergibt sich aus seinen Teilen. Da geht es darum, ich finde statistische Muster und operiere mit denen. Ich operiere nicht auf der Ebene der Symbole, Königin, sondern ich operiere auf der Ebene des statistischen Muster, wie das auch zum Beispiel heutige KI tut oder heutige LLMs zumindest tun, die nicht sagen, das ist die Königin, sondern das ist ein Begriff, der taucht oft im Kontext so und so, so und so auf. Er taucht oft mit weiblichen Artikeln oder Adjektiven auf und so ein Begriff ist das.
Nils:[43:08] Also das ist der Unterschied, wo es darum geht, in Einzelteilen Muster zu erkennen und mit diesen Mustern dann im Grunde zu arbeiten. Also im Grunde eine induktive Vorgehensweise. Ich gucke erst auf die Mikroebene und suche nach Mustern in der Mikroebene und das ist dann meine Makroebene. Und der Symbolismus anerkennt eher, dass diese Makroebene tatsächlich nochmal was anderes ist mit eigenen Regeln und eigenen Eigenschaften. So, das ist so ein bisschen der Gedanke. Und da findet tatsächlich schon in den 40er Jahren im Grunde ein Wechsel statt, nämlich vom Symbolismus zum Konnexionismus. Dass wir weniger darauf gucken, okay, was ist das Konzept des Königs im Hirn, sozusagen, sondern wir gucken eher, okay, welche Neuronen feuern da und gibt es da eventuell Muster? Und aha, wenn wir an Herrschaft denken, dann feuern so ungefähr diese Regionen. Ja, das ist so ein bisschen der Gedanke. Und daraus ergibt sich dann eben auch ganz schnell ein klassisches KI-Thema, das ist nämlich das Thema der Bilderkennung. Das kennen wir ja auch schon in Weilchen. Nämlich aus, ich habe hier irgendwie so Daten von einem Sensor und jetzt will ich daraus irgendwie berechnen, was ist das? Wenn wir Menschen gucken, wir sehen ein Auto und wir erkennen durch den groben Umriss und durch den Kontext und durch die Gestalt erkennen wir, das ist ein Auto.
Nils:[44:33] Moderne KI funktioniert so nicht, die hat ja nicht diesen Blick, diesen optischen. Die hat irgendwie Sensorik-Daten und muss dann daraus irgendwie schließen, das könnte ein Auto sein.
Nils:[44:46] Weil sie diesen Blick auf die Gestalt nicht hat. Oder sich ihre eigene Gestalt baut, könnte man vielleicht auch sagen. Wenn man so weit gehen wollen würde. Und das ist tatsächlich auch der Weg, den KI schließlich gegangen ist. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der Pasquinelle wichtig ist, dass es irgendwann nicht mehr darum geht, wirklich das Funktionieren des Gehirns nachzubilden, sondern kollektive Intelligenz einzufangen und kontrollierbar zu machen. Also ich will nicht mehr wirklich gucken, wie funktioniert das Gehirn und das nachbilden, also einzelne Neuronen schrauben und gucken und verknüpfen und so weiter und so fort. Und auch wenn das heute neuronale Netze heißt, haben die in ihrer Anlage nicht mehr viel damit zu tun, wie unser Gehirn funktioniert, auch wenn da auch Neuronen miteinander vernetzt sind. Das ist vielleicht auch noch eine begriffliche Unschärfe. die sich mittlerweile in die Debatte eingeschlichen hat. Also das Funktionieren eines solchen neuronalen Netzwerks hatte relativ wenig mit dem zu tun, wie unser Hirn tatsächlich funktioniert. Es nutzt nur eine ganz ähnliche Grundidee.
Christoph:[45:48] Spannend. Ich finde, es ist ein schönes, also wenn wir über soziale Evolution sprechen, sind gerade diese Large Language Models ein schönes Beispiel für so konvergente Evolution. Also sie kriegen so gut hin, uns zu vermitteln, dass sie die Welt so begreifen, wie wir das tun, obwohl sie das offensichtlich nicht tun, rein vom Funktionsprinzip her. Aber in der alltäglichen Benutzung ist das ja völlig irrelevant und ich finde, man kann das sehr schnell verdrängen, gerade wenn es um Sachen geht wie Replika-AI, wenn du deine eigene Partnerin da erstellst oder du ChatGBT als TherapeutIn nutzt, ob das jetzt bis in alle Feinheiten perfekt ist oder nicht und wünschenswert ist und so. Aber dass es zumindest erstmal von der Grundidee her so gut funktioniert, ist ja schon wirklich beeindruckend.
Nils:[46:43] Aber das ist ein guter Punkt, den macht Pasquinelli auch ganz am Ende nochmal, dass die ganze Arbeit dieser Systeme eben nicht irgendwie auf objektive Standards setzt, sondern genau auf das, was du gerade gesagt hast. Das, was die Menschen wahrnehmen. Es agiert nicht mehr darauf, wenn man aufs Essen guckt, es agiert nicht mehr auf die Ebene, gibt es mir wirklich die Nährstoffe, die ich brauche? Und so weiter und so fort. Sondern es setzt auf, schmeckt es mir. Und dass das ja auseinandergehen kann, sieht man, glaube ich, gerade im Ernährungsbeispiel sehr deutlich. So, jetzt haben wir uns so ein bisschen auf die informationstheoretische Grundlage von KI geguckt.
Nils:[47:24] Und da bleibe ich jetzt noch mal ganz kurz, das geht jetzt weiter, das macht wieder Pasquinelli nicht ganz explizit, aber dass wir mit KI im Grunde dann letztlich genau das zu versuchen zu automatisieren, dass wir versuchen die Automatisierung zu automatisieren im Grunde, also dass wir nicht nur sagen, wir automatisieren jetzt die Produktion, sondern wir automatisieren sogar die Planung von Produktionen. Und die Automatisierung von Produktionen, was nachher gar kein Mensch mehr irgendwas damit zu tun hat. Und damit natürlich noch mal wieder eine andere Form von Wissen, nämlich das Wissen über die Automatisierung, dann auch noch wieder eingefangen wird. Sozusagen. Die Frage, wie viele Schritte nach oben das jetzt geht, wie viele schleifen das sozusagen, die Automatisierung der Automatisierung der Automatisierung und so. Aber da ist die Technologie, so wie sie jetzt behauptet zu sein, zumindest erstmal grundsätzlich nicht begrenzt. Weil sie jetzt eben halt nur noch auf Wissen arbeitet und das Wissen über das Wissen ist halt auch immer noch Wissen
Nils:[48:22] So, also da haben wir auch nochmal so einen Punkt und was sich eben auch etabliert, das hattest du aber auch schon angesprochen sind so Standards maschineller Intelligenz also das ist auch ein Thema, wenn man über KI im Arbeitsumfeld redet dass man immer fragen muss, wer ist eigentlich hier unter Rechtfertigungsdruck? Der Mensch, wenn er was anderes macht, als die KI behauptet oder die KI wenn sie was anderes macht, als der Mensch behauptet so Klassiker, ich muss irgendwie eine Entscheidung treffen und das Computersystem sagt mir, du musst Nein sagen, ich mache meine Erfahrung, sage ich aber Ja und das geht dann schief und dann werde ich nachher angeranzt dafür, du hast nur Ja gesagt, die KI hat doch Nein gesagt. Jetzt rechtfertige dich mal. In Zukunft werde ich dir wahrscheinlich nicht mehr widersprechen. Nicht, weil ich weniger Recht gehabt hätte oder weil es tatsächlich falsche Entscheidung war oder so, sondern einfach, weil ich den sozialen Druck auf einmal bekomme, der nicht zu widersprechen. Oder es riskant wird für mich, der zu widersprechen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. So, also das ist so dieser KI-Gedanke. Jetzt kommen wir noch zum zweiten Phänomen, dieses Idee der Informationsverarbeitung, der dezentralen Informationsverarbeitung, wie wir sie mit den Neuronen angelegt haben. Und da taucht schon wieder ein Name auf, den ich an der Stelle nicht erwartet hätte, nämlich Friedrich von Hayek. Der sagt dem einen oder der anderen vielleicht auch was, ähm …
Nils:[49:41] Aus der ökonomischen Theorie, das ist so ein marktliberal-libertärer Philosoph gewesen, der gerne herangezogen wird. Es gibt ja die Hayek-Gesellschaft, die da ganz aktiv ist in Deutschland. Ich glaube, ich bin in Österreich, aber ursprünglich nicht mehr gewesen. Der war tatsächlich von Anfang an an diesen ganzen auch neurowissenschaftlichen Debatten sehr stark beteiligt und auch bei relevanten Symposien und Konferenzen wohl anwesend. Und er hat diese Idee dann übertragen auf die Gesellschaft, beziehungsweise auf die Gestaltung, die Planbarkeit, die Kontrollierbarkeit von Märkten. Weil er nämlich gesagt hat, wenn wir so einen gesellschaftlichen Markt irgendwie haben, da hat keiner vollständig die Information. Der Markt an sich hat keine übergeordnete Gestalt. Der besteht aus tausenden, zehntausenden, hunderttausenden von täglichen Interaktionen auf verschiedenen Ebenen und ergibt sich daraus ein bisschen Emergenz. Und du ahnst jetzt schon vielleicht, worauf das hinausläuft.
Nils:[50:45] Aber Hayek sagt dann eben auch, dass in diesen vielen Informationen, die in den vielen Transaktionen liegen, dass daraus sich dann im Grunde eine übergeordnete Bedeutung, eine übergeordnete Berechnung ergibt. Ihr kennt so eine Art so ein gesellschaftliches Bewusstsein, das irgendwie dann arbeitet und für sich selber arbeitet. Und so groß ist das, dass es mit Computern im Grunde nicht einzufangen ist, weil es eben nicht nur ein einzelnes Gehirn ist, sondern irgendwie hunderttausende Menschen, die da miteinander interagieren. Und da kommt zum Beispiel diese ganze Idee her, das war, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so groß, aber das war, ich glaube so, in den 2000er Jahren war das ein großes Thema, so Informationsmärkte, wo man irgendwie darauf wetten konnte, ob bestimmte Dinge passieren und dann war irgendwie so, kannst du irgendwie 20 Euro darauf setzen, dass jetzt der die Wahl gewinnt oder 15 Euro, dass jetzt der die Wahl gewinnt und dann wird das nicht als Wette genutzt, so nach dem Motto, dass man damit Geld verdient, sondern aus diesen Sätzen wird quasi Information abgeleitet. Weil jetzt auf diesen Märkten sich zeigt, dass mehr Leute darauf setzen, dass Person A gewinnt als Person B gewinnt, heißt das, dass es wahrscheinlicher ist, dass Person A gewinnt als Person B gewinnt.
Christoph:[51:55] Das ist jetzt so richtig gefährliches Halbwissen, aber in meiner Erinnerung waren das auch ganz gute Modelle, die sich daraus ergeben haben, oder? Also die waren einfach nicht schlecht in gesellschaftlichen Prognosen, oder?
Nils:[52:06] Also über die Qualität, die waren nicht offensichtlich katastrophal schlecht. Wobei ich weiß auch nicht, ob sie systematisch gut waren. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Es gab immer mal wieder so einzelne Highlights im Grunde davon, dass das irgendwie super toll war. Wobei ich nie weiß, wie viele Fälle es gab, wo das halt eigentlich voll daneben gelegen hat. Und man halt nur von denen gehört hat, wo es super toll war. Das ist halt jetzt im Rückblick, wenn man sich da nicht tief reinbegibt, schwer zu sagen. Aber genau, das ist auf jeden Fall, aber da steckt genau dieser selbe Informationsverarbeitungsgedanke hinter. Und Hayek hat das dann eben weitergetragen, so nach dem Motto, dass dieser Markt im Grunde keine Fehler machen kann und so. Da kommen wir dann in so eine normative Diskussion da will ich jetzt gar nicht rein aber das ist glaube ich hier auch nochmal eine wichtige Parallele und nochmal eine wichtige Beobachtung, dass diese Idee die entstammt nicht der Beobachtung ökonomischer Phänomene
Nils:[52:59] Hayek hat sich nicht Ökonomie angeguckt und gesagt, das passiert da und so und dann ergibt sich und jetzt sehen wir hier an dem Beispiel und so, sondern er hat diese neurobiologische Idee gesehen und hat dann gesagt oh ich modelliere den Markt mal so ja und das ist auch wieder hier, das ist glaube ich so der wichtigste Punkt, den Pasquinelli hier macht, dass wir hier eine Übertragung von Ideen aus Bereichen in andere Bereiche haben, die gar nicht erstmal aus den Bereichen heraus gerechtfertigt ist und die auch heutzutage gar nicht mehr in der Form bekannt ist. Wo dann halt gesagt wird, ja, wir übertragen jetzt diesen Gedanken da rein und jetzt ist das so. Aber wir wissen ja eigentlich gar nicht, ob das in dem Markt tatsächlich so ist. Der Markt wird halt so gestaltet, als wäre es so. Und dann wird das natürlich auch in gewisser Weise zu einer selbst erfüllenden Prophezeiung.
Nils:[53:46] Genau. So, das war der Ritt. Durch das Buch. Es ist am Ende irgendwie so unbefriedigend, weil er das nicht zusammenzieht. Also, wir haben das ja schon so ein bisschen angedeutet mit dem Thema KI heute, als Versuch jetzt tatsächlich eben auch das Wissen der White-Collar-Worker sozusagen zu automatisieren und zu capturen, dass wir jetzt heute natürlich dann auch in dem Bereich auf einmal eine höhere gewerkschaftliche Organisation sehen. Zumindest in den USA hat man das jetzt im Bereich der Drehbuchautor internen Synchronsprecher und so hat man das zum Beispiel erlebt dass da auf einmal eine Mobilisierung stattfindet weil genau diese Capture von Wissen auf einmal droht die vorher eher aus dem physischen Bereich bekannt war, die wir jetzt aber eben auch in der Wissensarbeit oder in der weitesten Sinne Wissensarbeit im Grunde beobachten können, also da wären glaube ich noch viele, ein guter Übertrag irgendwie möglich gewesen. Ich weiß nicht, ob er das mal irgendwann in Interviews oder in weiteren Artikeln gemacht hat. Da habe ich jetzt nicht nachgesucht.
Christoph:[54:45] Naja, aber es gehört ja in so ein Buch ein. Unabhängig, wo er das sonst noch getan hat.
Nils:[54:51] In dem Buch fehlt es mir auf jeden Fall. Aber das sind für mich so ein bisschen diese vier Kernpunkte, vielleicht nochmal zusammenzufassen. Erstmal diese Idee, dass die soziale Form der Automatisierung vorausgeht und nicht die technische Innovation. Dann haben wir diese Idee, dass Automatisierung im Grunde eine Akkumulation von Wissen darstellt, also den Arbeitern jetzt in der industriellen Revolution ihr Wissen raubt und es in die Maschine packt, dass nicht mehr sie davon profitieren, sondern der Inhaber, die Inhaberin der Maschine. Dann haben wir eben dieses neue Paradigma der Selbstorganisation, was dann eigentlich aus der Hirnforschung kommt, aber dann sowohl in die Informationstechnologie als auch in die Marktgestaltung im Grunde übertragen wurde und keineswegs so selbstverständlich oder notwendig sich daraus ergibt, wie es uns das heute erscheint. Das waren im Grunde so ein bisschen die Kerngedanken und dann eben der Schritt dazu, dass KI im Grunde nochmal dieses Element ist, dass wir eine industrielle Revolution mit der physischen Arbeit hatten, was wir jetzt eben immer mehr in der Wissensarbeit sehen. Genau. Das war der Ritt durchs Buch.
Christoph:[55:57] Vielen Dank. Thema Zusammenbinden, Argumentationsstränge abschließen und so. Vielleicht hilft es euch, wenn ihr in andere Folgen von uns reinhört, weil ich glaube, wir haben mittlerweile schon ein paar Dinge, die irgendwie mehr oder minder lose vernetzt sind zum Thema. Vielleicht, weil es schon 2019 erschienen ist und das Buch und das so ein schnelllebiges Feld ist, zumindest erlebe ich das so ich habe in Folge 17 Hello World von Hannah Fry vorgestellt, wo es eben auch um Algorithmen geht und wie sie eingesetzt werden können und so weiter Hannah Fry ist Mathematikerin, es lohnt sich sehr ihr auf verschiedensten Kanälen zu folgen sie macht hervorragende Videos vor allen Dingen auch, und ich glaube der Kontrast kann ganz spannend sein, wenn man jetzt das Buch aus 2024 24 gehört hat und sich dann einmal anhört, wie vor fünf Jahren das Thema behandelt wurde. Dann haben wir in Folge 59, ich meine das hat Holger vorgestellt oder Amanda, ich weiß es nicht, aber Todesalgorithmus von Roberto Simonovski, in dem Buch geht es ein bisschen um die Frage von unserem Verhältnis als Mensch, Menschheit, wie auch immer, zu KI, also Todesalgorithmus bezieht sich auf autonomes Fahren. Dann, weil wir über ursprüngliche Akkumulation gesprochen haben und wie das eigentlich verteilt wird, dachte ich, wäre der Code des Kapitals von Katharina Pistor, Folge 78, vielleicht auch ganz spannend, weil es so um die rechtliche Durchdringung der Welt geht und wann Eigentumstitel eigentlich wie verteilt wurden.
Christoph:[57:24] War jetzt in dem Buch nicht so drin, aber das ganze Thema Energieverbrauch, KI und ja, wie breitet sich Kapitalismus eigentlich in der Gesellschaft aus und frisst er alles auf? Ist in Folge 79 verhandelt, der Allesfresser von Nancy Fraser. Das finde ich spannend, weil halt auch das ganze, also auch das Thema, wie wirkt sich KI auf unsere demokratischen Systeme aus, finde ich, ist einfach sehr relevant. Und daran anschließend, Demokratie braucht aktive BürgerInnen, ist das auch bei KI so, brauchen wir einen vielleicht reflektierteren Umgang, Demokratie ohne Gesetze, Folge 82.
Christoph:[58:05] Ja, und dann habe ich noch mehrere Hinweise. Zum einen den Podcast Hard Fork von der New York Times. Hat einen sehr, also einfach einen Silicon Valley Fokus und probiert die Dinge, die sich da entwickeln zu beobachten und das hängt dann ja stark mit unserem Thema heute zusammen und will sich mit Zukunftsthemen beschäftigen, finde ich, ist immer mal ganz gut. Ich höre nicht jede Folge, aber lohnt sich im Prinzip, weil wir über Arbeitsteilung gesprochen haben. Ein soziologischer Klassiker ist von Emil Dürkheim über soziale Arbeitsteilung im Sokabem Verlag, weil wir über Neuronen nachbilden und so gesprochen haben und wie die funktionieren. Ich erinnere mich noch ganz dunkel. Ich glaube, das Blue Brain Project ist aus 2005, glaube ich. Und da hat man so, in meinem Verständnis, da war ich dann zwölf, das erste Mal probiert. Da war so die Idee groß, wir bauen ein Gehirn nach. Und daher dann werden wir, also wenn wir das richtig gut hinkriegen, dann muss das ja so funktionieren wie ein menschliches Gehirn auch oder irgendein Gehirn. Genau, und sich das nochmal anzuschauen, ist glaube ich ganz spannend. Ja, und dabei belasse ich es. Der letzte Reling passt doch nicht.
Nils:[59:15] Schon eine gute Menge. Ja, ich habe ja schon eben in der Vorstellung immer mal wieder Querbezüge gemacht zu meiner letzten Episode, ich glaube es war die Episode 86 zu Rules von Lorraine Destin. Oder Regeln. Ich finde, es passt auch sehr gut zu meiner Folge davor, Unterwerfung von Philipp Blom, wo es ja um dieses Kontrollnarrativ im Grunde ganz stark geht. Also generell diese drei Bücher, die lesen sich perfekt zusammen und Pasquinelli zitiert tatsächlich sogar Destin in seinem Buch. Ah ja, spannend, sehr gut. Gerade mit dieser Anfangsgeschichte zu Gaspar de Pony und Charles Babbage, da bezieht er sich tatsächlich auch auf sie. Dann habe ich tatsächlich noch so ein bisschen diese Folge Web of Meaning von Jeremy Lent. Auch wieder so ein bisschen allgemein diese Perspektive auf die Welt, so wir kontrollieren die Welt, wir zerteilen sie, wir zerlegen sie, wir automatisieren sie, so ein bisschen als Grundideologie der westlichen Wissenschaftler, des westlichen Lebens. Dann haben wir die enge Verbindung zwischen Mensch und Technologie Natural Born Cyborg von Andy Clark in Episode 22 wo es auch immer ganz stark eben um die Interaktion von Mensch und Technologie geht ist als Buch ein bisschen älter ich glaube das Ende der 90er vielleicht Anfang der 2000er aber auch da sehr sehr spannend und gut zu lesen und dann haben wir noch Muster von Amin Nasehi stimmt das hattest du ja auch mal schon angedeutet dass es da so um diese Verzwillingung der Welt im Grunde geht das ist tatsächlich ein Aspekt den wir hier auch haben.
Christoph:[1:00:42] Das ist ein klassisches systemtheoretisches Argument. Auch Buchdruck und so sind alles Verdeplungen der Welten.
Nils:[1:00:48] Das haben wir in Episode 18 vorgestellt. Ein weiteres Buch habe ich noch, weil wir das Thema Zusammenarbeit hatten oder auch soziale Form von Arbeit. Das ist von Richard Sennett. Sein Buch Zusammenarbeit, das habe ich auch mal gelesen, ist aber schon ziemlich lange her und war vor diesem Podcast. Ich erinnere mich aber noch, dass ich es sehr gerne und mit sehr viel Gewinn gelesen habe damals, wo es eben genau auch um Zusammenarbeit, sowohl in der Produktion aber auch im allgemeinen gesellschaftlichen ging.
Nils:[1:01:16] Ein Buch als Roman, den ich tatsächlich gerade gelesen bzw. Gehört habe, der einfach gut passt, weil er auch dieses Thema Automatisierung von Gehirn und Abbildung von Gehirn irgendwie aufgreift und dabei gleichzeitig modern und spannend zu lesen ist, ist der neueste Roman von Andreas Eschbach, Die Abschaffung des Todes. Das ist Popcorn-Kino, bei dem man ein bisschen was lernt, um es mal salopp zu formulieren. Wenn ihr euch ein bisschen mehr für das Thema KI und vor allen Dingen KI-Kritik interessiert, hat sich mittlerweile dann doch eine gar nicht so kleine Community online entwickelt, die sich selber tatsächlich als Luddites, also Luditen bezeichnen. Das ist auch eine Protestbewegung, ich glaube aus dem 18., 19. Jahrhundert gegen die Automatisierung, gegen die Industrialisierung, die eben genau diesen Aspekt in den Mittelpunkt gerückt haben, nicht im Sinne von, wir wollen die Maschinen nicht, das wird ihnen ja heute oft vorgeworfen, das sind so die Luditen, die wollen keine Automatisierung, das stimmt nicht, was sie wollten ist, sie wollten von der Automatisierung auch profitieren. Also da geht es genau um diesen Akkumulationsaspekt im Grunde zu sagen, halt stopp, ja, das ist unser Wissen, das ist unsere Erfahrung, die wir hier einbringen, die hier in dieser Maschine steckt, wir wollen da auch von profitieren und nicht nur du, der dem die Maschine gehört. Das ist ein großes Missverständnis wohl über diese Bewegung und entsprechend gibt es heute auch wieder ein bisschen eine Bewegung, da gibt es unter anderem einen sehr guten Podcast, Tech World Savers der da tatsächlich sehr empfehlenswert ist,
Christoph:[1:02:44] Wenn man den hört, kriegt man glaube ich die, ja den habe ich auch schon mal mitbekommen.
Nils:[1:02:47] Kriegt man die wichtigsten Linien und Kritikformen auf jeden Fall mit und ich habe jetzt noch ein Newsletter den ich seit ein paar Wochen lese Blood in the Machine oder Blood in the Machinery, ich weiß es gerade nicht, der auch in dieselbe Richtung geht, den man da abonnieren kann. Und wer sich so ein bisschen für das Funktionieren von KI interessiert, also von den modernen LLMs, wie die technisch funktionieren, da gibt es einen sehr langen, aber sehr guten und ich will nicht sagen leicht verständlichen, aber für die Komplexität und die Tiefe, die er erreicht, relativ leicht verständlichen Artikel von Stephen Wolfram.
Nils:[1:03:22] Auf Englisch ist er, glaube ich, kostenlos, auf Deutsch ist er, glaube ich, bei Golem hinter einer Firewall, hinter einer Paywall, den werde ich nochmal verlinken, also da lernt man tatsächlich ein bisschen, wie diese LLMs funktionieren, was für Statistik dahinter steckt, wie die bestimmte Sachen hinkriegen, also was ich gerade sagte, warum sowas tatsächlich, LLMs können sowas zum Teil, dass sie sagen, König minus Mann plus Frau gleich Königin, sowas können die tatsächlich zum Teil abbilden, warum die das können und wo das herkommt und warum das nichts damit zu tun hat, dass sie verstanden haben, was das ist. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist einfach nur, Also in dem Fall könnte man salopp sagen, König und Königin tauchen in Texten immer im ähnlichen Kontext auf. Bei einer Königin sind nur häufiger weibliche Artikel und Adjektive drumherum als bei einem König. Und deswegen ergibt sich sozusagen diese Rechenmöglichkeit. So, salopp formuliert, aber guckt da gerne mal rein, wie ihr euch da ein bisschen vertieft interessieren wollt. Ein bisschen mathematische Vorbildung, schade dafür, aber definitiv nicht. Genau, das war’s. Und meine Lesetipps, die kommen natürlich in die Show Notes.
Christoph:[1:04:30] Sehr gut. Ein Video, was überhaupt nicht so kompliziert ist dann, also vielleicht, wenn ihr nicht so deep-diben wollt, ich fand es neulich ganz gut und habe erst spät verstanden, wer es eigentlich hergestellt hat, ist das Video AI is Dumber Than You Think, von dem Technikgerätehersteller Nothing. Die haben eh einen ganz spannenden YouTube-Kanal. Also die gehen irgendwie sehr transparent mit ihren Produkten um und zeigen auch, was sie wo bei Apple abgekupfert haben. Android-Apple-Vergleiche und so und für wen es was wohl besser und es wirkt alles so gar nicht so biased. Naja, und die haben auf jeden Fall auch ein Video zur Funktionsweise von KI.
Nils:[1:05:10] Das ist bestimmt spannend. Das werde ich mir auf jeden Fall gleich angucken.
Christoph:[1:05:13] Das sind nur vier Minuten oder so, das verlinke ich.
Nils:[1:05:16] Das ist auf jeden Fall kürzer und vermutlich leichter verdauern als der Wolframatik. Ich würde auch nicht behaupten, dass ich den bis ins Letzte verstanden habe, aber ich habe eine Menge daraus gelernt.
Christoph:[1:05:24] Sehr gut. Okay, ich glaube, du bist auch durch, ne?
Christoph:[1:05:34] Wenn ihr uns Kommentare zu dieser Folge hinterlassen wollt, dann macht es doch auf unserer Webseite www.zwischenzweideckeln.de. Wenn ihr auf einer App unterwegs seid, bei der man Sternchen oder so verteilen kann, dann gebt uns gerne die maximale Anzahl. Und wenn ihr uns auf Social Media besuchen wollt, dann könnt ihr das auf dem Mastodon-Server podcast.social unter dem Handel at zz.d. Und wir werden auch einen Blue Sky Account einrichten. Leider muss ich mit mir jetzt gleich noch verhandeln, welches Handel wir dafür nehmen, weil das, was wir haben wollten, gibt es nicht mehr. Wir werden die ganzen Meta-Dinger einstellen. Also Facebook, Instagram und so gibt es nicht mehr. Aus, ich glaube, breit diskutierten Gründen und so. Leider nicht mehr in einer ganz so coole Firma. Auch schon länger nicht, aber es zieht sich bedenklich zu und zieht bedenklich an. Genau, deswegen werden die eingestellt. Und damit entlasse ich euch in die Welt und freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder zuhört. Macht’s gut. Tschüss.
Nils:[1:06:31] Tschüss.
Music:[1:06:31] Music
Quellen und so
Intro und Outro der Episode stammen aus dem Stück Maxixe von Agustin Barrios Mangore, eingespielt von Edson Lopes (CC-BY).
Das Umblättern zwischen den Teilen des Podcasts kommt hingegen von hoerspielbox.de.
Zwischen zwei Deckeln findest du auch im sozialen Medium deiner Wahl: Mastodon und Bluesky.
Der Beitrag 088 – „Das Auge des Meisters“ von Matteo Pasquinelli erschien zuerst auf Zwischen zwei Deckeln.

Feb 6, 2025 • 1h 13min
087 – „Kinder – Minderheit ohne Schutz“
In „Kinder – Minderheit ohne Schutz: Aufwachsen in der alternden Gesellschaft“ kommen die Autoren zu dem Schluss, dass unsere Gesellschaft den in ihr lebenden Kindern nicht gerecht wird. In allen gesellschaftlichen Subsystemen spielen sie nicht die Rolle, die wir ihnen zugestehen müssten, damit sich die Gesellschaft in Zukunft auf sie als Bürger*innen wird verlassen können. Glücklicherweise kann man die überforderten Bildungsinstitutionen wie Schule oder Kita neu denken, Ressourcen wie die fitte Rentner*innen einbinden und Potenziale in gut funktionierenden Nachbarschaften heben.
Shownotes
„Kinder – Minderheit ohne Schutz“ von Aladin El-Mafaalani, Sebastian Kurtenbach und Klaus Peter Strohmeier (Verlagswebseite)
Superdiversität bei der Heinrich-Böll-Stiftung
UWE-Studie bei der Bertelsmann Stiftung
Broken Windows bei SozTheo
ZZD048: „Die Altenrepublik“ von Stefan Schulz
ZZD061: „Die gespaltene Gesellschaft” von Jürgen Kaube und André Kieserling
ZZD065: „Baustellen der Nation“ von Philip Banse und Ulf Buermeyer
ZZD076: „Das Integrationsparadox“ von Aladin El-Mafaalani
ZZD077: „Das nomadische Jahrhundert“ von Gaia Vince
Podcast: „Jung und Naiv 751: Aladin El-Mafaalani über den Rechtsruck & Kinder als Minderheit ohne Schutz“ (YouTube; in der Folge haben wir die Folge nicht erwähnt, weil sie einen Tag nach der Aufnahme erst erschienen ist)
Podcast: „Durchgefallen – Wie Schule uns als Gesellschaft spaltet“ (ARD Audiothek)
Buch: „Globale Migration“ von Jochen Oltmer (Verlagswebseite)
Buch: „Dschinns“ von Fatma Aydemir (Verlagswebseite)
Buch: „Die Knappheit der Zeit und die Vordringlichkeit des Befristeten“ von Christian Geyer und Niklas Luhmann (Verlagswebseite)
Vortrag: „Schule in der superdiversen Gesellschaft“ von Aladin El-Mafaalani (Keynote RUB Teachers Day 2024 auf YouTube)
Transkript
Music:[0:00] Music
Holger:[0:17] Herzlich willkommen bei Zwischen zwei Deckeln. Heute die Episode 87. Und ich bin hier mit Christoph.
Christoph:[0:25] Hallo zusammen.
Holger:[0:27] Der mir heute ein Buch vorstellen wird. Und zwar handelt es sich um Kinder Minderheit ohne Schutz von Aladin El Mafalani, Sebastian Kurtenbach und Klaus-Peter Strohmeier. Das sind, also Aladin L. Maffalani hatten wir ja schon mal, der ist Professor für Migrations- und Bildungssoziologie in Dortmund. Sebastian Kurtenbach ist Professor für Politikwissenschaften an der FH in Münster. Und Klaus-Peter Strohmeier ist emeritierter Professor für Soziologie mit Schwerpunkt Stadt, Region und Familie an der Ruhr-Universität Bochum. Und das Buch ist bei Keep More and Widget 2025 erschienen. Bevor wir zu dem Buch kommen, ich habe gerade die Reihenfolge ein bisschen abgeändert, ist aber erstmal die Frage, wie geht es dir denn so?
Christoph:[1:26] Mir geht es ganz gut. Ich habe irgendwie ein intensives Wochenende, verlängertes Wochenende inklusive genommen einen Urlaubstag hinter mir, weil meine liebe Großtante, die ist so Ende 80 umgezogen ist und dieser Umzug gestemmt werden musste. Zwar auch in weiten Teilen mit einem Umzugsunternehmen, aber trotzdem mit dann Übersiedlung halt in neue Wohnung und Organisation und wie richtet man das ein und schönen Möbelstücken aus den 70ern, die noch nicht ganz den modernen Ikea-Standards des Aufbaus entsprechen, also deutlich komplizierter sind und so. Also ja, damit habe ich mich jetzt gerade beschäftigt und rumgeärgert gar nicht so viel, ehrlicherweise.
Holger:[2:11] Ja, ich hatte, das war glaube ich letztes oder vorletztes Jahr, so nah am Jahreswechsel, dann verschwimmt das alles ein bisschen, aber wir hatten auch vor nicht zu langer Zeit ist meine Mutter umgezogen und da war dann auch einiges zu tun, obwohl da dann ein Umzugsunternehmen war. Man muss ja trotzdem packen zum Beispiel.
Christoph:[2:33] Ja, ja, absolut, genau.
Holger:[2:35] Und in einer langen Zeit sammelt sich da ja auch so einiges an. Naja, ich kann das gut nachvollziehen.
Christoph:[2:43] Und wie ist es bei dir? Was treibt dich um?
Holger:[2:47] Ja, so das Übliche, ins neue Jahr rein wechseln. Wir haben ein bisschen Handwerker im Haus noch diese Woche, die da streichen. Genau. Und sonst eigentlich nichts Besonderes. Also man wünschte sich, dass man nicht so alles mitkriegt, was im Moment so in der Politik läuft.
Christoph:[3:13] Das ist wahr, ja.
Holger:[3:16] Naja, also für Zuhörer, die zu irgendeinem zufälligen Zeitpunkt zuhören, wir sind jetzt Anfang Februar 2025. Donald Trump ist seit gut zwei, zweieinhalb Wochen im Amt und letzte Woche gab es großes Abstimmungschaos im Bundestag, weil die CDU und wie der Meinung war, ist ja doch nicht so schlimm, wenn die AfD uns zustimmt.
Christoph:[3:42] Ja, einigermaßen unterirdisch, ja.
Holger:[3:47] Ja, das ist natürlich auch ein Thema, womit man sich beschäftigen kann, was aber nicht unbedingt gut für die Laune ist. Aber hoffen wir, dass das Buch heute vielleicht doch ein bisschen besser für die Laune ist, obwohl der Titel, ich habe ihn ja eben schon genannt, Kinderminderheit ohne Schutz, auch nicht so positiv klingt. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Genau. Möchtest du dann vielleicht mit dem, also ich habe ja die ganzen anderen Daten eben schon ein wenig in falscher Reihenfolge erwähnt, möchtest du vielleicht uns noch ein TLDL geben?
Christoph:[4:36] Das mache ich gerne. In Kinder, Minderheit ohne Schutz, Aufwachsen in der alternden Gesellschaft kommen die Autoren zu dem Schluss, dass unsere Gesellschaft den in ihr lebenden Kindern nicht gerecht wird. In allen gesellschaftlichen Subsystemen spielen sie nicht die Rolle, die wir ihnen zugestehen müssten, damit sich die Gesellschaft in Zukunft auf sie als BürgerInnen wird verlassen können. Glücklicherweise kann man die überforderten Bildungsinstitutionen wie Schule oder Kita neu denken, Ressourcen wie die fitten RentnerInnen einbinden und Potenziale in gut funktionierenden Nachbarschaften heben.
Christoph:[5:10] Also ich habe probiert, einen etwas positiven Ausblick zu geben, weil die Autoren das in dem Buch tatsächlich auch machen. Also sie ziehen klare Problemstellungen, aber haben auch durchaus ganz nachvollziehbare Ansätze, finde ich, wie man den ganzen irgendwie Herr werden könnte und auch nicht nur in so einem, langjährige HörerInnen kennen meine Kritik an abgehalfterten Letztkapiteln in Büchern, die dann auf zehn Seiten nochmal schreiben, wie man die große Problemdiagnose der letzten 200 Seiten oder 300 Seiten nochmal umreißen kann. Das finde ich immer nicht so gut und das ist hier, finde ich, anders gelöst und das finde ich ganz gut.
Holger:[5:50] Ja, das klingt ja so, als ob es zumindest nach hinten dann erfreulich werden wird.
Christoph:[5:55] Also offensichtlich geht es in dem Buch um Kinder, das sollte klar geworden sein, Und eben darum, wie es ihnen aktuell in der Gesellschaft geht. Und sie fangen an mit so ein bisschen statistischen Einschlägen. Und ich finde, die kann man ruhig mal rekapitulieren, weil sie doch irgendwie ganz instruktiv sind. Also in Deutschland haben wir seit 1972 mehr Sterbefälle als Geburten, Jahr für Jahr. Und 2024 haben wir doppelt so viele 60. Geburtstage wie Geburten gehabt. Also ja, unser Altersmedian 2023 lag so bei gut 45 Jahren. Also wir sind ziemlich alt, es wird nicht anders und genau, wir feiern mittlerweile doppelt so viele 60. Geburtstage, wie wir Geburten feiern, das heißt, da ist im Verhältnis irgendwas anders, als es früher zumindest einmal war und das hat offensichtlich auch politische und gesellschaftliche Folgen. Also wir haben eine Überrepräsentation Älterer in politischen Institutionen. Ich finde, das ergibt sich natürlich einerseits aus einem Gesellschaftsbild, das altert, andererseits ist das, glaube ich, auch nicht ganz unnormal, also weil einfach in Wahlämter gehoben werden wird, das passiert einem selten in ganz jungen Jahren.
Christoph:[7:09] Aber was natürlich ein Problem wird in der politischen, oder was man als Problem verstehen kann in der politischen Orientierung, in der Großwetterlage, ist, dass die RentnerInnen in Deutschland bald die größte Wählergruppe stellen, also wenn man es nach irgendwie Alterskohorten machen möchte. Das heißt, gegen RentnerInnen wird man auf keinen Fall Politik machen und die Eltern von Minderjährigen sind eine demokratische Minderheit. Das finde ich erstmal ist jede Kleingruppe, die man erhebt, ist eine demokratische Minderheit, weil wie sollte es anders sein? Aber trotzdem gibt es einfach nicht so viele Eltern von minderjährigen Kindern und deswegen haben auch gerade die Kinder einfach rein zahlenmäßig wenig politische Anwaltschaft quasi. Also es gibt nicht so viele Leute, die für sie per Wahl eintreten können. Mit Bildungspolitik gewinnt man im Normalfall übrigens auch keine Wahlen. Das ist so ein empirisches Ergebnis, was wir schon seit Jahrzehnten in Deutschland kennen. Also es ist selten, dass das das Wahlkampfthema ist.
Holger:[8:09] Das ist ja eigentlich irgendwie, ich habe jetzt so den Gedanken, es gibt ja eigentlich nicht nur die Eltern, es ist ja doch, also ich glaube, dass das so ist, aber es ist ja was, wo man auch denken würde, dass zum Beispiel Großeltern, die jetzt zu den Rentnern gehören, ja eigentlich sich ja vielleicht auch Gedanken um ihre Kinder machen, Entschuldigung, um ihre Enkelkinder machen. Aber ja, irgendwie passiert das dann doch nicht immer.
Christoph:[8:37] Und die unmittelbare Betroffenheit ist vielleicht nicht ganz so gegeben. Also man weiß das ja abstrakt und man weiß ja auch, dass seine NachbarInnen irgendwelche Kinder haben und die damit irgendwie umgehen müssen, wenn man selber keine hat. Also jeder ist ja mit Kindern in Kontakt und trotzdem wirkt sich das vielleicht nicht auf die unmittelbare politische Positionierung aus, dass man die immer so stark mitdenkt, wie wenn man damit konfrontiert ist, dass die Schule gar nicht funktioniert und man andauernd Homeschooling machen muss, weil irgendwelche Heizungen ausfallen und deswegen die Lohnarbeit nicht funktioniert oder so. Also, ja,
Christoph:[9:13] Genau. Und wir erleben heute einen durch, ja, ich würde schon sagen primär wirtschaftlich bedingt einfach einen Unterschied oder eine Veränderung im Bildungsalltag von Kindern. Also Kinder sind heute früher und länger in Bildungsinstitutionen, also wir haben ja mittlerweile Rechtsansprüche auf Kita-Plätze, die Ganztagsschule etabliert sich, das heißt immer früher sind Kinder mit Bildungsorganisationen einfach konfrontiert und befinden sich in denen und sie bleiben dann auch Tag für Tag länger da drin, als wir das von früher noch kennen. Das ist so, ja. Und was aber ein bisschen schade ist, trotz Ausbau dieser Kinderbetreuung haben wir keine messbaren positiven Effekte in so PISA- und Iglu-Studien und was es so gibt. Also das ist irgendwie ein bisschen blöd. Ich habe einen Vortrag von Aladin El-Mafalani gehört letztes Jahr und er sagt, bitte nicht falsch verstehen, das richtet sich nicht gegen das Bildungspersonal. Er meint, wenn das Bildungspersonal noch so unterwegs wäre wie in den 90ern und auf dem Ausbildungsstand und mit dem Engagement und sonst wie, dann wäre hier alles längst in Schutt und Asche. Also er meint, daran liegt es nicht, aber bis jetzt gibt es irgendwie, wir haben nicht so richtig gute Erklärungsansätze dazu, warum unser Bildungssystem nicht so gut funktioniert, wie es soll, obwohl wir seit Jahren immer mehr Geld da reinstecken und genau, auch Bildungszeiten verlängern in aller Richtung.
Holger:[10:33] Das ist natürlich nicht so eine einfache Diagnose, wenn gar nicht so klar ist, wo das Problem liegt.
Christoph:[10:41] Ja, ja, ja, voll. Genau. Und daraus leiten sie dann im Prinzip, ach, eine Sache finde ich noch wichtig, genau, weil man dieses Ganze, wir haben, also im Kern sagt das Buch durch die Blume schon auch, wir haben im Prinzip vielleicht ein bisschen … Naja, ich weiß nicht, ob das Buch das sagt, aber man könnte ja sagen, wir haben zu wenig Kinder in Deutschland und dann kann man ja so einen konservativen Politik-Turn nehmen und sagen, das liegt daran, dass irgendwie die Frauen zu wenig Kinder kriegen oder Familien oder das klassische Familienmodell nicht mehr so da ist und bla bla bla. Und das räumen sie am Anfang sehr schnell ab. Also sie sagen, der Durchschnitt an Kindern pro Frau liegt nicht daran, dass wir so viele emanzipierte Frauen haben, die jetzt nur ihre Karriere priorisieren, um das jetzt nochmal sehr polemisch darzustellen, weil der Schnitt an kinderlosen Frauen eigentlich seit Jahrzehnten relativ stabil ist. Der Schnitt ist deswegen nach unten gegangen, weil wir kaum noch kinderreiche Familien von drei oder mehr Kindern haben. Und man kann sich ja in den aktuellen gesellschaftlichen Zuständen auch, finde ich, sehr gut überlegen, wer kann mehr als zwei Kinder oder drei Kinder finanzieren, mit welchen Zeitressourcen, welche Unterstützungsstrukturen brauchst du dafür, damit sowas funktionieren kann und so. Und genau, das räumen sie am Anfang einmal ab und nehmen damit zu diesem ganzen konservativen Geschmäckle den Wind aus den Segeln. Also das ist nicht ihr Ansatzpunkt, das fand ich sehr sympathisch.
Holger:[12:08] Wobei natürlich, also jetzt ein Konservativer wird dann natürlich antworten, Kinderbetreuung wäre ja kein Problem, wenn man noch die klassische Familie mit hat, wo dann eine Person, also klassisch dann die Frau zu Hause bleibt.
Christoph:[12:24] Nicht miterklärt wird dann vermutlich, wie das passen soll in eine moderne Erwerbsgesellschaft, in der ein Gehalt halt auf gar keinen Fall im Normalfall für eine Familienernährung reicht, inklusive man muss eine Rentenlücke schließen und Geld zurücklegen und so, das geht ja einfach nicht mehr auf.
Holger:[12:42] Also ja, das wäre der Einwand, den ich jetzt auch selber direkt gemacht hätte.
Christoph:[12:45] Ja, das weiß ich, das weiß ich.
Holger:[12:46] Nicht klappt, aber sozusagen, also die Inkonsistenz in dem konservativen Denken, die ist halt kreativ. Aus meiner Wahrnehmung eher dabei, dass irgendwie gerne totgeschwiegen wird, dass die gesellschaftlichen Umstände dieses alte Bild faktisch gar nicht möglich machen, auch aufgrund von Politik von konservativen Parteien. Das ist, ja, ist denn, jetzt habe ich so die Frage, da sind natürlich dann Einwanderer schon mitgezählt, dass die auch weniger so kinderstarke Familien haben, oder?
Christoph:[13:25] Ja, das ist schon mitgezählt. Zum Thema Zusammensetzung oder Diversität von Kindern als sozialer Gruppe, da kommen wir noch zu, auf jeden Fall, da sprechen wir noch gleich drüber. Aber genau, das ist schon auch mitgedacht.
Holger:[13:43] Ja, das heißt, das ist eine Sache, die liegt dann nicht an der Herkunft, sondern einfach in unserer Gesellschaft hier für alle Betroffenen ist es einfach so, dass man eher weniger kinderreiche Familien hat.
Christoph:[13:55] Genau, da gibt es bestimmt irgendwie, je nachdem wie du deine Kohorten siehst, irgendwie leichte Unterschiede, aber genau, das wurde jetzt nicht expliziert als Thema, dass nur Familien ohne Migrationsgeschichte irgendwie ein Thema ist.
Holger:[14:14] Genau das ist ja auch ein interessanter Punkt zu sagen da gibt es ja auch jede Menge Klischees wenn man jetzt auf die Statistik guckt das ist halt einfach so genereller Trend unabhängig von irgendwelchen anderen, Faktoren, wo man vielleicht ein Klischee haben könnte.
Christoph:[14:32] Ich probiere es gerade in dem Buch nochmal zu finden ja also doch, scheint mir so zu sein wie wir es jetzt gerade genannt haben ich kann es nicht direkt wiedergeben, aber ich meine so war es Genau, ich glaube, hier kann ich einen Teil überspringen. Da geht es um ein bisschen soziologische Begriffsbildung und Theorien, die es schon gab. Also Franz Xaver-Kofemann ist ein französischer Soziologe, glaube ich, hat schon in den 70ern, glaube ich, den Begriff von Kindern als Außenseiter der Gesellschaft beschrieben. Und das übernehmen die Autoren ein Stück weit, weil sie sagen, Kinder sind einfach aus vielen Bereichen des Erwachsenenlebens ausgeschlossen und ihr Leben findet halt in Sonderumwelten statt, also in Institutionen, die extra für sie hergestellt sind. Und das ist anders als früher und das meint dann früher als vor den 70er Jahren als Kinder, als kleine Erwachsene in Anführungsstrichen mit pädagogisch, ich würde sagen, auch sehr starken Problemen, die damit einhergehen, selbstverständlicher Teil des Alltags waren. Also Kinder laufen nicht mehr im Erwachsenenleben ihrer Eltern einfach mit oder ihrer Familie.
Christoph:[15:41] Ja, genau. Ja, und dann kann man natürlich sagen, politisch gesehen haben sie einfach keine Beteiligungsrechte und ja, mit so einer Individualisierungsthese von Ulrich Beck, also der hat das in der zweiten Hälfte der 80er Jahre aufgemacht, dass unsere Gesellschaft halt immer stärker zu Individualisierungsprozessen strebt und dass so ein Ideal davon ist, wie man sein Leben lebt. Da sind Kinder natürlich, kann man als Hindernis verstehen. Ich würde andererseits sagen, Kinder sind glaube ich auch Teil von Selbstverwirklichungsfantasien erwachsener Personen. Aber wenn…
Holger:[16:23] 100 Jahren, da gab es auch deswegen mehr kinderreiche Familien, zum einen, weil einfach die Kindersterblichkeit höher war und zum anderen, weil Kinder auch so ein bisschen Teil der Altersversorgung waren, dass man dann davon ausgegangen ist, die Kinder kümmern sich um einen. Und das ist natürlich heute auch weniger.
Christoph:[16:41] Ja, das ist auf jeden Fall wahr. Was man beobachten kann, ist, dass in so Zeitbudgetstudien mittlerweile Familienzeit im Alltag eine geringe Rolle in Familien spielt. Das sind so durchschnittlich 1,5 Stunden täglich nur und das heißt, wenn das der Durchschnitt ist, gibt es Familien, in denen es weniger ist und ein paar, in denen es mehr ist. Aber trotzdem ist das, finde ich, schon irgendwie bezeichnend oder doll und daraus, da kommen wir später noch drauf, leitet sich für die Autoren eigentlich immer weiter ab, dass das nicht unbedingt, also sie widmen sich nicht so sehr einer Problematisierung dieser Thesen, sondern zu sagen, naja, das ist erstmal so und das bedeutet, dass Bildungsinstitutionen sich verändern müssen und zum Beispiel Erziehungsaufgaben übernehmen müssen. Ob das das pädagogische Personal jetzt besonders witzig findet oder nicht, ist egal. Wenn es so ist, dass Kinder so viel in den Institutionen, die für sie geschaffen sind, Zeit verbringen und so wenig Zeit in der Familie haben, dann muss auch in den Institutionen erzogen werden. Und dann müssen ehemals familiäre Aufgaben wie, keine Ahnung, gemeinschaftliches Essen oder so, muss dann da stattfinden, weil offensichtlich findet es in der Familie keinen Platz. Gründe dafür mal beiseite gelassen. Das finde ich irgendwie einen spannenden Ansatz, weil ich auch das Gefühl habe, es ist mal ein produktiverer Umgang als so ein Lamento. Es ist so eine angenehme Annahme des Status Quo, um von da aus weiterzudenken.
Holger:[18:09] Wobei ich jetzt gerade den Gedanken habe, also ich wüsste jetzt gar nicht, wie diese Zeit früher war. Ja, also wenn ich jetzt so an meine Kindheit, Jugend denke, da war dann auch, dann war ich, wenn das Wetter draußen gut war, dann bin ich von der Schule nach Hause gekommen, habe vielleicht irgendwie schnell Hausaufgaben gemacht und dann war ich stundenlang irgendwie mit Freunden draußen unterwegs. Ich hatte Glück, dass es da auch so ein bisschen Natur in der Nähe gab.
Christoph:[18:43] Ja, geht mir auch so.
Holger:[18:44] Und sozusagen, wenn ich da jetzt hochrechnen würde, was meine Mutter sozusagen an… An Familienarbeit mit mir hatte, wo ich dann auch anwesend war, weiß ich nicht, ob das dann so viel mehr Stunden waren. Zumindest an Wochentagen.
Christoph:[19:01] Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschlagen. Und du hast für dich sicherlich recht. Aber in dem Buch steht, Zeitbudgetstudien zeigen, dass die Familienzeit für Kinder und Erwachsene im Alltagsleben nur eine geringe Rolle spielt. Seit Jahrzehnten sind das im Durchschnitt etwa anderthalb Stunden täglich oder weniger. Also seit Jahrzehnten. Das ist tatsächlich dann unverändert. Aber ja, erstmal bedeutet das ja trotzdem nicht, dass dann eben viel Zeit für das, was Familie zugeschustert wird, als Verantwortung unbedingt da ist. Aber trotzdem finde ich das spannend, das dagegen zu kontrastieren.
Holger:[19:35] Ja, was ich mich dann frage, es ist ja mehr als Familie. Wo ich dann jetzt den Gedanken hätte, welche anderen Institutionen gibt es denn noch? Also zum einen, je nachdem, wo man lebt, ich habe ja gesagt, ich hatte das Glück, dass da Natur in der Nähe war. Aber wenn ich jetzt irgendwie irgendwo in der Innenstadt aufgewachsen wäre.
Holger:[20:00] Da wäre das vielleicht nicht so gewesen. Und da kann man natürlich auch, aus verschiedenen Gründen ist es dann vielleicht weniger, dass die Eltern auch sich wohl dabei fühlen, wenn die Kinder draußen rumstreuen. Also das ist ein Faktor. Und es gibt dann ja auch Sachen, dann war man halt irgendwie im Sportverein irgendwo mal zu verschiedenen Zeiten im Leben und ist auch die Frage, ob das vielleicht auch weniger geworden ist, beziehungsweise die Sportvereine bestimmte Sachen dann auch weniger beibringen. Also wenn du jetzt irgendwie so einen guten Trainer hast, sag ich mal, hast du ja auch wieder Vorbildfunktionen, wo dann vielleicht bestimmte Dinge man lernt, so ein bisschen auch bestimmtes Verhalten lernt, was einem dann in so einem Schulumfeld wieder hilft. Und wenn sowas natürlich wegfällt, vielleicht auch für viele Familien einfach finanziell nicht mehr machbar ist, dann glaube ich, dass dann auch dadurch manche Sachen vielleicht bei der Schule hängenbleiben könnten, die früher einfach nicht zwingend in der Familie, aber außerhalb der Schule irgendwo den Kindern mitgegeben wurden. Das ist aber jetzt nur ein Bauchgefühl. Das ist jetzt in keinster Weise irgendwie… Wissen, sondern einfach nur so eine Idee, was man vielleicht nochmal nachforschen könnte.
Christoph:[21:23] Ich glaube, über Vereine sprechen sie, also was so die Zeitverteilung angeht in dem Buch, nicht explizit, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Aber natürlich spielt das eine Rolle und sie machen immer wieder den Punkt, dass es für Kinder in Bezug auf ihre Erfolgschancen, auch was die Selbstwahrnehmung angeht, extrem wichtig ist, dass sie mindestens einen Erwachsenen haben, der an sie glaubt. Also mindestens ein. Da sollte man natürlich hoffen, dass das im Normalfall die Eltern sind, aber es ist auch nicht immer so, dass das die Selbstwahrnehmung ist, aber das scheint man empirisch gut feststellen zu können, dass dieses Erwachsene vermitteln, ich glaube an dich und dein Potenzial und ich bin quasi auch, ja, ich nehme dich als vollwertigen Menschen wahr und möchte, dass dein Leben gelingt, für deren Erfolg total wichtig ist, weil sie das Gefühl haben, dass sie halt ja, Menschen haben, auf die sie sich verlassen können, die nicht die eigene Peergroup ist. Also zu denen sie dann auch mit Sorgen, Nöten usw. kommen können. Und natürlich da dann auch Förderung erleben, das muss man ja auch sagen. Ich kann zum Thema Zeitbudget vielleicht noch kurz sagen, also daher kommt dieser Fokus auf Schule. Also Kinder verbringen mittlerweile ungefähr 45 Stunden pro Woche in der Schule, sagen sie. Und Familienzeit sind so ungefähr 18 Stunden.
Christoph:[22:46] Und die Differenz macht halt auf, dass Institutionen gut funktionieren müssen und das tun sie nicht. Ja. Ja.
Holger:[22:54] Noch kurze Frage, einfach weil ich in der Familie Kinder habe, die sind jetzt nicht in der Schule, sondern im Kita-Alter. Also hier ist dann wirklich der Fokus auf Schulalter, das heißt irgendwie ab 16 Jahren.
Christoph:[23:13] Ja, da ist das jetzt genau. Sie sprechen auch über die Notwendigkeit von Kita, aber Schule ist schon, hat nochmal einen größeren Raum. Was an Kindern irgendwie spannend sind, das ist die quantitativ kleinste Altersgruppe, aber ethnisch, sprachlich und religiös ist sie am vielfältigsten. Also es ist einfach die, also es ist die kleinste Gruppe, wenn wir nach Alter gucken, aber es ist die heterogenste und das finde ich ist schon irgendwie total spannend. Sie machen dann eine Kritik am Begriff mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund auf, weil sie meinen, dass ja hinter dem Begriff Migrationshintergrund verbergen sich halt extrem unterschiedliche Realitäten. Also wenn, keine Ahnung, in einer Klasse zehn Sprachen gesprochen werden, ist es irgendwie schwierig, in Deutsch und die anderen Sprachen zu unterteilen oder wenn es sieben Religionen in einer Klasse gibt, ist es ein bisschen merkwürdig, irgendwie von uns christlich, evangelisch, katholisch gelesen oder atheistisch und die anderen zu differenzieren. Also ich meine, damit kann man einfach Vielfalt überhaupt nicht gut erfassen und wird dann halt den Kindern, denen ein Migrationshintergrund zugeschrieben wird, auch, man wird ihnen damit ja in keinster Weise gerechter, weil es überhaupt nichts darüber aussagt, wie deren konkrete Lebensrealität aussieht. Fand ich einen guten Punkt.
Holger:[24:43] Und was ich auch, so ein Gedanke, den ich generell zu dieser Bezeichnung Migrationshintergrund habe, ist ja auch immer, also zum einen, wie lang sieht man den jetzt zurück? Und macht man das jetzt nur an der Sprache fest. Ich bin auch in einem anderen Teil von Deutschland aufgewachsen als meine Eltern. Meine Eltern sind deutsch, aber ich habe nicht den Dialekt meiner Eltern angenommen, weil ich in einer anderen Umbegebung aufgewachsen bin. Ich kenne sozusagen, wo meine Eltern aufgewachsen sind, auch nur von Familienbesuchen, und Und so, das würde jetzt trotzdem niemand als Migrationshintergrund bezeichnen, weil wir da immer dann sagen, das ist halt jemand, der das Land gewechselt hat. Aber zu sagen, wenn man jetzt einfach nur guckt, bin ich denn genauso aufgewachsen und genau in der Kultur, ich sage jetzt auch mal bewusst Kultur aufgewachsen wie meine Eltern, dadurch, dass wir in Deutschland ja schon eine gewisse Varianz auch kulturell haben, vielleicht… Ja, vielleicht ist das auch ein bisschen willkürlich, wo man dann sagt, das ist ein Migrationshintergrund.
Christoph:[25:53] Ja, ich finde, man könnte zumindest berechtigt sagen, wenn man schon auf so Länderkulturen abheben möchte, dass zum Beispiel eine Person, die in Trier groß geworden ist, mehr mit luxemburgischer Kultur zu tun hat als mit sächsischer Kultur oder so. Da kann man ja Argumente für machen oder man sagt, keine Ahnung, wenn man irgendwie in deiner Ecke groß geworden ist, vielleicht ist man in Niederlanden näher als dem schleswig-holsteinischen oder so. Also ja, ja, genau, das ist alles sehr konstruiert auf jeden Fall. Das ist ja an sich alles Mögliche konstruiert, aber trotzdem finde ich es gut, das mal zu durchdenken. Ja, was ist das? Ja, so ein, zwei harte.
Holger:[26:31] Genau, war nur so ein Gedanke.
Christoph:[26:33] Nee, finde ich sehr plausibel und gut. Deutschland ist mittlerweile nach den USA das Land mit den meisten internationalen MigrantInnen. Das fand ich nochmal spannend, weil ich das, glaube ich, sehr abstrakt wusste, aber das nochmal so zu lesen, fand ich irgendwie total spannend.
Holger:[26:47] Das war auch, ich hatte ja schon mal von dem Aladin El Mafalani, ich kriege seinen Namen immer noch nicht richtig hin, das Integrationsparadox vorgestellt und da hat er ja auch schon darauf verwiesen, dass wir Einwanderungsland Nummer zwei weltweit jetzt sind.
Christoph:[27:03] Und das ist insofern beeindruckend, als dass wir ja eine Sprache haben, die keine Weltsprache ist. Also wenn man nach Kanada einwandert, nach Frankreich, nach Spanien, was auch immer, das sind alles Weltsprachen, die da gesprochen werden oder auch in den USA mit Englisch und Spanisch. Und Deutsch ist halt einfach, also ist auch eine Weltsprache, aber halt in keinster Weise so verbreitet wie die anderen. Das ist schon interessant.
Holger:[27:28] Wobei, ich glaube, man unterschätzt da auch den Faktor der geografischen Lage. Also ich glaube, dass Deutschland auch eigentlich schon sehr lange ein Einwanderungsland ist, auch länger als die meisten Menschen denken, weil es sehr zentral in Europa liegt. Plus, dass es halt wirtschaftlich auch schon eine Weile relativ erfolgreich ist und das dann auch, ich sag mal, zum einen einen Bedarf schafft an Arbeitskräften und es auch attraktiv macht, für Leute zum Arbeiten herzukommen. Ja. Und mit, ne, also es gibt nicht ohne Grund, wenn man mal im Ruhrpott guckt, wo die Namen herstammen, dann stellt man fest, dass es sehr viele polnische Namen gibt. Ja. Von Leuten, die aber auch kein Polnisch mehr sprechen und nichts, ne, die dann einfach da in die Fabriken zur Arbeit oder im Kohlebergbau gearbeitet haben, ne, und das ist dann auch schon über 100 Jahre her, dass die hergekommen sind.
Christoph:[28:26] Ja, naja. Ja, Deutschland ist schon ein extrem langes Einwanderungsland. In der Struktur der letzten Jahrzehnte hat sich natürlich ein bisschen was verschoben.
Holger:[28:37] Klar, es sind andere Gruppen.
Christoph:[28:39] Genau, das ist einfach nochmal nicht so sehr Türkei, Italien, Griechenland, also die Gastarbeiter in die sogenannten, muss man ja auch sagen, also mit den Anwerbeabkommen, das hat sich einfach mittlerweile verschoben. Genau, aber nochmal harte Zahlen, habe ich gesagt, genau, etwa 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland ist nicht in Deutschland geboren und bei den Kindern unter fünf Jahren haben über 42 Prozent und dann benutzen sie es eben doch, einen Migrationshintergrund. 95 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund leben in Westdeutschland, inklusive Berlin, das fand ich total krass.
Christoph:[29:16] Und genau, er hat eine Reden, also nee, sie, das ist ja ein Autorenkollektiv, sie haben eine westdeutsche Grundschule, die real existiert, dargestellt, die auch nicht völlig aus dem statistischen Muster fällt, also kein Ausreißers in dem Sinne. Und in einer westdeutschen Grundschule hatten 75 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund mit Wurzeln in über 50 Ländern und 23 gesprochenen Sprachen. Sie benutzen dafür den Begriff Superdiversität, weil sie, der wurde auch nicht von denen entwickelt, der Begriff, den gibt es schon länger, weil sie sagen, also mit landläufigen Diversitätsvorstellungen ist das, was Kinder als Normalität erleben in ihren Bildungs- und Schulkontexten und Lebensalltagen einfach nicht mehr, da versteht man was Falsches drunter. Und ich finde dieses Wurzeln in über 50 Ländern mit 23 gesprochenen Sprachen, das ist einfach total krass und das heißt, dieses binäre und ohne Migrationshintergrund verfehlt völlig und das Bild, was sie eher benutzen, ist ein gesellschaftliches Mosaik, was halt einfach völlige Normalität für Kinder ist und das ist nur die Dimension Migration.
Christoph:[30:29] Auch Familienstrukturen haben sich pluralisiert, also wir haben Patchwork-Familien, wir haben Regenbogenfamilien, Alleinerziehende und ja, so ist es einfach. Ich glaube, der Punkt, den sie machen wollen, ist die gesellschaftliche Wahrnehmung, wie Gesellschaft aufgebaut ist und wie Deutschland aufgebaut ist, ist für die aktuelle junge Generation oder die jungen Menschen einfach, glaube ich, ganz anders als, keine Ahnung, für Menschen, die 40, 50, 60 plus sind. Also da gibt es einfach unterschiedliche Realitätswahrnehmung.
Holger:[31:04] Ja, das glaube ich gerne. Also ich habe jetzt auch gerade zurückgedacht, ich habe ja mal so ein Schulhalbjahr als Ausliffslehrer gearbeitet vor ein paar Jahren. Und da ich so überlege, auch wie viel Sprachen, also Sprachen, die Kinder in meiner in einer Klasse hatten, also in der, die ich vor allem unterrichtet habe. Also ich müsste jetzt wirklich mich konzentrieren und durchzählen, aber das waren schon einige. Also ich weiß auf jeden Fall Italienisch. Dann war jemand, da waren die Eltern aus Pakistan, da weiß ich nicht genau welche Sprache das dann zu Hause gesprochen wurde. Dann war jemand aus Marokko da war Arabisch und Französisch, glaube ich. Also habe ich mal mit der Mutter auf Französisch geredet. Also das ist nur das, was mir jetzt spontan einfällt. Auf jeden Fall auch noch wer aus Polen. Und bei einer Klasse von… Weiß ich nicht, wie viele es waren, 25, 26 Kindern, ist das ja auch schon eigentlich nicht wenig, wenn man darüber nachdenkt. Und mir fällt jetzt gar nicht alles ein, das sind jetzt nur die, die mir spontan eingefallen sind.
Christoph:[32:16] Ich finde ganz amüsante Anekdote dazu. Natürlich ist, ich finde, Deutsch lernen ist einfach eine ganz, also nicht in so einem Integrationsimperativ vermittelt, sondern eher so aus einem emanzipatorischen Verständnis halte ich den Erwerb von deutschen Sprachfähigkeiten, wenn man in dieses Land kommt, für essentiell wichtig, damit man sich hier durchsetzt, also damit man sich hier organisieren kann, damit man ein Verständnis hat, damit man verkehrsfähig ist und so. Also ich halte das einfach wichtig für ein selbstbestimmtes Leben. Und was ganz spannend ist, meine Partnerin arbeitet ja in der Schule mit auch einfach in einer herausfordernden sozialen Lage mit auch enormer Heterogenität. Und die Verkehrssprache zwischen unterschiedlichen Kindern, wenn die nicht die gleiche Herkunftssprache haben, ist häufig notgedrungenerweise Deutsch. Also wenn sich neue Freundschaften finden über quasi ehemalige Ländergrenzen hinweg, sind sie häufig dazu genötigt, Deutsch miteinander zu sprechen, weil sie sonst keine gemeinsame Verkehrssprache haben. Und es ist nicht so sehr irgendein tolles deutsches Sprachbad, wo sie dann dialektfrei von Familien, die schon seit einiger Zeit hier leben, dann das Deutsch lernen, sondern sie müssen sich halt gemeinsam erarbeiten. Aber nur das Deutsche ist das Gemeinsame, womit sie überhaupt Kommunikation herstellen können. Und darüber lernen sie es dann häufig. Und das finde ich irgendwie total interessant. Also es ist irgendwie eine andere Lernstruktur, als das, was man so landläufig, glaube ich, sich vorstellt.
Christoph:[33:44] Genau, also das erstmal so, das waren die Großdiagnosen, aber trotzdem haben wir halt natürlich eine große Diversität auch in den unterschiedlichen Kindheiten. Also man kann sich das vorstellen, also wir haben irgendwie Großwohnsiedlungen mit armutsgefährdeten Menschen, die stark migrantisch geprägt sind, aber wir haben natürlich irgendwie auch reiche Viertel, die seit eh und je in irgendwelchen Luxuswohnungen und Villen zusammengestellt sind. Da sind natürlich die Bevölkerungszusammensetzungen entsprechend dann nicht dem gesamtgesellschaftlichen Durchschnitt, sondern sie sind in sich sehr verschieden. Darauf weisen sie auch immer wieder hin. Und dann hat man natürlich in Deutschland auch weiterhin noch ein starkes Stadt-Land. Also nicht unbedingt, da ist es nicht so sehr ein Gefälle, sondern einfach eine große Unterschiedlichkeit zwischen ländlichen Räumen und städtischen Räumen. Und die ländlichen Räume sind wiederum auch sehr unterschiedlich, je nachdem, ob sie wirtschaftlich noch stark sind oder schon sehr schwach, weil es da irgendwie wenig Wirtschaftsbetriebe gibt.
Holger:[34:47] Kinder und vielleicht auch die jungen Leute dann weggehen.
Christoph:[34:51] Ja, also so und in kleinen Städten gibt es relativ wenig Kontakt zur Diversität und genau so ist es einfach sehr, sehr unterschiedlich. Das finde ich ist nochmal wichtig darauf hinzuweisen, also es ergibt sich nicht ein allgemeiner Durchschnitt, sondern sehr unterschiedliche Lokalwahrnehmung, so kann man es vielleicht sagen oder Lokalstrukturen. Ja, dann geht es so ein bisschen drum, was Kinder brauchen überhaupt und erst einmal muss man sagen, dass Erziehung natürlich eine asymmetrische Interaktion ist, immer. Also Kinder sind irgendwie Erwachsenenvorstellungen ein Stück weit ausgeliefert und wir erleben aber einfach, dass Familien und Schulen mittlerweile zunehmend überfordert sind und auch Schulen sich damit konfrontiert sehen, dass die Vorbereitungsfunktionen von Familien, dass da Grundfähigkeiten vermittelt werden, sowohl Grundfertigkeiten wie, vielleicht kann man den eigenen Namen zumindest schon mal malen, aber auch Grundfähigkeiten in der Erziehung, dass sowas abnimmt und ein Indikator dafür ist, dass in Obhutnahmen seit Jahren steigen, also immer mehr Kinder müssen durch das Jugendamt betreut werden.
Christoph:[36:08] Und genau, also es gibt eine Studie aus Kanada, die heißt auf Deutsch UWE-Studie und ich glaube, da kommt dieser Professor von der FH aus Münster ins Spiel, weil die, die offenbar in Deutschland durchführen, also die UWE-Studie Umwelt, Wohlbefinden und Entwicklung, kommt ursprünglich, wie gesagt, aus Kanada. Und da ist ein bisschen die Idee, dass man Schüler und Schülerinnen zu ihrem Wohlbefinden und zu ihren Ressourcen fragt, weil man sie so als ExpertInnen für ihre eigene Lebenswelt versteht. Also die kriegen irgendwie eine Kamera oder vermutlich ein Smartphone und sollen damit in der Fotosafari Erwachsenen ihre Welt erklären und Dinge und Orte fotografieren, die für sie relevant und wichtig sind.
Christoph:[36:53] Und dann kann man gucken, was für ihr Wohlergehen irgendwie wichtig ist und was irgendwie dabei rauskommt, ist eben, es gibt teilweise Viertel mit total wenig Angeboten für Kinder, das ist ein Problem. Und genau, nicht funktionierende Schulen mit irgendwie Infrastruktur, die kaputt ist, kaputten Toiletten und so, das ist alles sehr, sehr unglücklich und wird von Kindern auch wahrgenommen und problematisiert. Und ein bisschen der Punkt, den die Autoren machen, ist, wir binden Kinder und Jugendliche zu wenig ein in ihren Problembeschreibungen. Also sie haben zu wenig Möglichkeiten, sich selbst Gehör zu verschaffen oder sie werden zu wenig gefragt. Das finde ich, kann man erst mal teilen.
Christoph:[37:43] Immer wieder, und das habe ich ja auch schon gesagt, geht es auch um die Bedeutung von Lehrkräften und Erwachsenen. Also die Haltung der Erwachsenen gegenüber den Kindern ist für das Erleben der Kinder davon, wie Schulqualität ist, total wichtig. Also wenn sie das Gefühl haben, dass sie gesehen werden, dass an sie geglaubt wird, dass ihre Potenziale gesehen werden, dann verschiebt es sehr viel in der Schulqualität. Und was ich krass fand, ist, in einem Drittel der Schulen, und das kommt eben bei dieser UWE-Studie raus, kennt ein Drittel der Kinder keine Erwachsene, die sie wichtig finden. Und das sind natürlich irgendwie katastrophale Zustände, das kann so irgendwie nicht so richtig bleiben. Und da plädieren die Autoren sehr stark für einen Kultur- oder einen Verständniswechsel des pädagogischen Fachpersonals, also dass man da einen Haltungswechsel vor, weg von einem, die Familien geben uns hier Kinder ab, mit denen wir nicht arbeiten können, zu, wie können wir diesen Kindern gerecht werden, auch wenn vielleicht die Fähigkeiten noch nicht so gegeben sind, wie wir uns das wünschen würden.
Holger:[38:49] Ja, wobei ich da jetzt gerne, also ich vermute mal, das kommt auch noch. Ich glaube aber, es ist auch einfach ein Faktor, die so nackten Zahlen des Betreuungsverhältnisses. Ja, ich glaube, es ist halt wahnsinnig schwer, wenn du da eine Gruppe vor dir hast, du hast, selbst wenn du nur eine Klasse hast, da hast du irgendwie, wenn eine kleine Klasse ist, sind der dann schon 25, wenn du Pech hast, sind es irgendwie über 30. Ja, ja. Da wird es natürlich auch ganz realistisch betrachtet als Lehrer extrem schwer, wirklich auf jedes Kind einzugehen, und auch vielleicht zu erkennen, wo ein Kind Bedürfnisse hat. Also da möchte ich auch so ein bisschen die Lehrer dann in Schutz nehmen, dass die auch unter sehr schweren Bedingungen das tun müssen.
Christoph:[39:43] Finde ich einen sehr, sehr validen Punkt, gerade weil sie das Thema Heterogenität so stark machen, fand ich das auch einen relativ plumpen Wunsch, ehrlicherweise. Wir kommen gleich noch zu anderen Maßnahmen, die ich sinnvoller finde, aber diese Idee von, naja, der Haltungswechsel wird schon richten und die Lehrkräfte haben quasi ihre Rolle nur noch nicht neu interpretiert und neu verstanden. Das mag ja in Einzelfällen so sein, aber genau, ich finde das auch eine sehr grobe und irgendwie gefühlt nicht faire Unterstellung, weil ich so denke, naja, ich glaube genau, aktuellen Schulrealitäten in diesem Kontexten gelingenden Unterricht zu machen, der junge Menschen auf Gesellschaft vorbereitet, Inhalte vermittelt und das unter Bedingungen von alles ist marode, den Betreuungsschlüssel hast du schon angesprochen, das geht so einfach nicht auf und natürlich kann man sich das in Teilen wünschen, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, die ist jetzt auch schon dieses Jahr 14 Jahre zu Ende, aber ist vielleicht noch nicht ewig her, denke ich auch, ja, also sicherlich wäre Das Selbstverständnis in dem, wie man Dinge vermittelt, vielleicht ab und zu mal hilfreich gewesen, das zu reflektieren.
Christoph:[41:00] Aber das als breiten Problem, dass es nur daran hängt, finde ich irgendwie auch nicht glücklich und wenig zielführend, weil Lehrkräfte nach allem, was wir wissen, und das sagen sie auch im Buch, auch einfach hoffnungslos überlastet sind. Also genau, aber von daher teile ich deine Kritik an dem Wunsch. Aber ich wollte ihn wiedergeben, weil er halt so im Buch vorkommt. Ja,
Christoph:[41:22] Wie könnte man Kitas und Schulen vielleicht ein bisschen anders denken? Also wir haben es irgendwie mit strukturellen und dauerhaften Problemstellungen zu tun, in denen Bildungsmisserfolge mittlerweile stillschweigend toleriert werden. Dem stimme ich durchaus zu, weil dass wir eine Bildungsungleichheit in Deutschland haben mit einer starken, also einer starken Kopplung von schulischem Erfolg oder Bildungserfolg vom Status deiner Eltern, das ist bekannt und da ist Deutschland ja einfach auch in den reichen Ländern wirklich ganz, ganz weit hinten, das kriegen andere Länder deutlich besser hin, von daher, das kann es irgendwie nicht sein. Und wir haben den ökonomischen Zwang und das finde ich nochmal ganz gut, das ist ja nicht nur eine idealistische Perspektive, die sagt, wir müssen Kindern irgendwie gerecht werden, sondern ökonomisch gezwungen können wir auch kein Kind auslassen und auf dessen Fähigkeiten verzichten, weil wir so wenig Kinder in Deutschland haben und unser Rentensystem irgendwie schon hemmungslos überlastet ist und wir wirtschaftliche Reproduktion brauchen und dafür, wir haben in Deutschland irgendwie keine Rohstoffe, die wir groß ausbeuten können. Deswegen finde ich das einen guten Punkt zu sagen, wir können keine Kinder in ihrem Bildungsprozess zurücklassen. Das geht einfach nicht auf.
Christoph:[42:36] Deswegen, Institutionen sollen sich stärker als familienergänzende Akteure verstehen. In der allgemeinen Fassung finde ich das besser als mit dieser konkreten LehrerInnen-Kritik. Und dafür müssen Institutionen multifunktionaler werden. Das heißt, es muss mehr Kooperationen mit Vereinen geben. Eltern müssen stärker eingebunden werden in ihren Rollen, damit man irgendwie gemeinsam arbeitet.
Christoph:[43:01] Teams müssen multiprofessioneller werden. Das finde ich auch wichtig. Ich glaube, das kommt langsam und die Zeiten, in denen ein Klassenraum bedeutet hat, ich als Lehrkraft habe hier die alleinige Hoheit und was hinter dieser Tür passiert, ist ganz mir überlassen und niemand darf drauf gucken. Ich hoffe, dass sich das langsam verschiebt. Ich meine, Doppelsteckungen werden zunehmend normaler, aber trotzdem muss vielleicht, genau, also Lehrkräfte müssen vielleicht das Wohlergehen von Kindern noch stärker im Blick haben als nur den reinen Bildungserfolg und andererseits muss die Schulsozialarbeit vielleicht sich nicht nur als Anwalt der Kinder verstehen, sondern auch noch den Bildungserfolg im Blick haben. Und da muss eine stärkere innere Verzahnung auch stattfinden und die Multiprofessionalität muss noch größer werden. Das heißt, wir brauchen noch größere Teams, denn es müssen halt nicht alles Lehrkräfte sein. Das finde ich ist schon gut. Also auch so Nachmittagsbetreuung kann halt auch durch anderes pädagogisches Personal geleistet werden, die dann vielleicht auch unterschiedliche Rollenverständnisse mitbringen, um so einem Familienersatz vielleicht auch näher zu kommen. Weil ich finde auch, man muss nicht alles mit seinen Lehrkräften verhandeln, finde aber gut, wenn Schule ein sicherer Hafen, um einen Begriff aus der Pädagogik zu verwenden, für alle ist und dafür brauche ich eine andere Zusammensetzung, das finde ich. Und das scheinen mir auch Vorschläge zu sein, die grundsätzlich umsetzbar sind.
Holger:[44:30] Ja, wobei ich auch sagen würde, allein, also man muss sich halt klar machen, man braucht einfach viel mehr Menschen, die in Schule arbeiten. Ja, absolut. Man kann darüber diskutieren, in welchen Funktionen die da am besten arbeiten. Bin ich jetzt sicher kein Experte, außer dass ich halt einmal so Schule mal beobachtet habe, aus verschiedenen Perspektiven, aber man müsste da eigentlich halt wirklich deutlich mehr investieren und auch deutlich mehr Leute einstellen und es auch attraktiv machen, dort zu arbeiten. Also ich weiß, die Gealschule, wo ich war, die hat dann auch gesucht nach einem, ich weiß nicht mehr genau, welche Funktion es war, nach einem Sozialarbeiter oder Pädagogen. Und du musst halt auch erstmal einen finden.
Christoph:[45:30] Ja, das ist total schwierig, ja.
Holger:[45:33] Dann ist natürlich einmal die Frage, wie viele Leute lernen das, studieren das, machen da eine Ausbildung, aber natürlich auch die Frage, wie attraktiv ist das, dass Leute erstens auf die Idee kommen, das später machen zu wollen und zweitens dann auch unter den Stellen, die ihnen zur Auswahl stehen, dann die an der Schule annehmen. Und wenn man sagt, naja, da ist man schlecht bezahlt und überlastet, weil zu wenig Leute sind und man mit dem Problem alleine gelassen wird, dann kannst du dir wünschen, dass du diese Sachen alle hast, aber kannst die halt praktisch gar nicht umsetzen. Das heißt, man muss da, glaube ich, ganz breit dran gehen und dafür müsste man halt nicht nur in irgendwelchen Wahlkampf reden, darüber reden, wie wichtig Bildung ist, sondern das auch wirklich in praktischer Politik umsetzen. Und da sehe ich leider eine große Lücke.
Christoph:[46:32] Ja, das ist glaube ich auch eine absolut richtige Diagnose. Was sollte ich sagen? Genau, also was Sie noch sagen, das finde ich, ist auch ein guter Punkt, weil mir das auch nicht unrealistisch erscheint grundsätzlich. Also natürlich braucht es mehr Geld und was Sie aber auch sagen ist, dass es mehr Entscheidungskompetenzen und finanzielle Mittel auf Institutionenebene geben muss. Also Schulen als kompetente Organisationen für ihre konkrete Problemlage verstehen und das finde ich ist total richtig, wenn ich immer wieder mitkriege, wie bürokratisch Stellenbesetzungen sind, wie schlecht es funktioniert, wie wenig Eigenmittelschulen haben, um ihren Situationen Herr zu werden, ist das echt ein Problem und da sehe ich auch nicht, warum das so ist. Ich habe nochmal drei, genau, und was Sie einfordern, ist eben auch ein stärkeres Zusammenarbeiten von Kita und Grundschule und dann wiederum mit Grundschulen und weiterführenden Schulen. Sie haben drei Zitate aus Ihren Studien.
Christoph:[47:35] Einmal von einer Kita-Leiterin, die sagt, wir machen einige Förderprogramme für Sprache und Motorik, aber wir sind keine Vorschule. Die Kinder werden noch lange genug in die Schule gehen. Da sagen Sie, das ist ein fehlgeleitetes Verständnis von dem, was Kita heute leisten sollte. Es ist ein Stück weit Vorschularbeit und das ist auch okay, das ist nicht schlimm. Ja, Kinder gehen lange in die Schule, aber es ist notwendig, dass auch die Kita sich als vorbereitende Institution für die Grundschule versteht, damit die Grundschulen nicht mit den enormen heterogenen Leistungsständen konfrontiert sind, wie es aktuell ist. Weil ich glaube, da kommen halt irgendwie, mit sechs kommen Kinder in die Schule, die können lesen und andere sind halt noch dabei, irgendwie deutschflüssig zu lernen und das ist so, also vielleicht, also das ist ja auch nicht das Gleiche, vielleicht können sie ja dann eine andere Sprache schon lesen, aber da sind einfach die Lernstände für das, was in der Grundschule gefordert ist, sehr heterogen, das will ich sagen.
Holger:[48:29] Ja, ja.
Christoph:[48:32] Genau, dann haben wir eine Leiterin einer Grundschule, die sagt, wir kämpfen gegen die Zeit. Wir haben vier Jahre bis zum Übergang zur weiterführenden Schule mit 28, 29 Kindern pro Klasse, jedes mit einem anderen Rucksack an Fähigkeiten und Problemen. Wir können nicht jedem Kind gerecht werden. Und da meinen die Autoren, da hätten sie halt gerne einen Kulturwandel, weil dieses, wir können nicht jedem Kind gerecht werden, da kann man ja hoffen, dass das eine Zustandsdiagnose ist, aber wenn man das als Realität hinnimmt, ist das trotzdem nicht das, was man von der Grundschule sich wünschen sollte. Aber klar, da ist eine Überforderung zu sehen und deswegen eben der Brückenbau zur Grundschule. Und dann haben wir noch einen Schulleiter einer Gesamtschule, der sagt, leider muss man sagen, dass bestimmte Kinder und Jugendliche bei uns nicht zurechtkommen. Und ja, zu viele verlassen uns ohne Abschluss, aber wir können einen Abschluss auch nicht verschenken, dann ist er nichts mehr wert. Und genau da greift dann ihr Punkt von, genau das können wir uns nicht mehr leisten, dass Kinder ohne Abschluss einfach die Schule verlassen und man das hinnimmt. Und ich glaube, die wollen die Abschlüsse auch nicht verschenken, aber trotzdem, genau das ist das Problem, da braucht es dann eben mehr Ressourcen, damit genau das in der Form, in der Breite, in der wir es erleben, nicht mehr vorkommt, weil wir uns das gesellschaftlich einfach in keinster Weise leisten können.
Holger:[49:48] Ja, vielleicht wäre dann da der Sinneswandel auch, dass man nicht mehr sagt so, dass ein Abschluss verschenken heißt halt, ich mache die Anforderungen geringer. Das ist ja das, wie dieser Gesamtschuldirektor das ja wahrscheinlich versteht. Sondern dass man sagt, wir müssen halt einfach mehr investieren, um sicherzustellen, dass die Anforderungen, dass die Kinder diese Ansprüche erfüllen.
Christoph:[50:17] Ja, genau.
Holger:[50:18] Also es gibt ja immer zwei Wege, das zu erreichen. Und dann, da könnte ich mir schon vorstellen, dass viele Lehrer vielleicht auch eine gewisse Resignation haben und das einfach so hinnehmen, dass das so ist. Sicher auch, weil sie überfordert und überlastet sind. Aber das Zielbild wäre dann, kann ich schon verstehen, wenn man sagt, dass das Zielbild sein sollte, dass Lehrer sagen, so, wir müssen halt alle Kinder, Entschuldigung, alle Kinder auf den entsprechenden Stand hochziehen, dass sie das können. Aber natürlich muss man da dann wieder, was ich schon gesagt habe, sagen, da müssen den Schulen eben auch die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Sonst verlangt man von den Lehrern, dass sie sich überarbeiten. Und natürlich freut man sich oder hofft man, dass Lehrer auch irgendwie engagiert sind, aber man muss es natürlich auch irgendwie, man darf das auch nicht alles bei den Lehrern abladen, sondern muss als Gesellschaft denen auch die Mittel dafür geben.
Christoph:[51:17] Ja, den Punkt machen sie auch und auch mehrfach. Also sie wünschen sich dann noch, dass man das Wohlbefinden der Kinder stärker ins Zentrum stellt und das überhaupt mal erfragt und abfragt, um ein Verständnis darüber zu entwickeln, wie es Kindern in den Institutionen geht. Und das heißt, es geht mehr um Analyse und Diagnostik. Dafür müssen dann natürlich auch Mittel bereitstehen. Und sie wünschen sich erstmal, dass Mindeststandards erreicht werden. Das scheint es in anderen Ländern stärker zu geben, dass man stärker auf so Mindeststandards, die am Ende eines Klassenjahres oder am Ende der Grundschule oder so erreicht werden müssen von allen, dass man das stärker im Blick hat. Und sie meinen, da ist einfach unsere Diagnostik auch noch nicht auf Höhe der Vorreiter, die es wohl so gibt.
Holger:[52:07] Ja, und die Frage ist ja auch, was ist dann die Lösung? Dann kann man natürlich sagen, die Lösung ist dann sitzen bleiben. Aber ob das dann zwingend so sein muss? Also ich weiß, in den USA gibt es diese Einrichtungen der Summer School, wo sozusagen man dann in den, also da sind die Sommerferien, muss man dazu auch wissen, drei Monate lang. Aber wo dann sozusagen jemand die Chance hat, nicht zu wiederholen und in die nächste Klasse zu gehen, wenn er halt in den Sommerferien Dinge nachholt.
Christoph:[52:37] Summer School, das kenne ich hier aus Hannover tatsächlich auch, gibt es hier als eine Uni-begleitetes Projekt. Das ist dann irgendwie, glaube ich, zwei oder drei Wochen, jeden Tag, ich glaube, zwei Stunden Förderung oder drei und dann daneben halt so Ferienbespaßung. Also es ist wirklich nicht nur Lernen, sondern es ist ein Teil davon. Und ich glaube, hier wurden ganz gute Erfahrungen damit gemacht.
Christoph:[53:01] Was ich spannend finde, sie sprechen dann nochmal über Sozialraum und Nachbarschaft. Und Nachbarschaft scheint in Deutschland was zu sein, mit dem Menschen relativ zufrieden sind. Also 90 Prozent der Menschen in Deutschland sagen, dass sie positive nachbarschaftliche Beziehungen haben und das positiv erleben. Und 75 Prozent der Menschen beschreiben sich auch als gut vernetzt. Das ist zum Beispiel in der Corona-Pandemie stark zum Tragen gekommen, als sich gerade für ältere NachbarInnen engagiert wurde und man für die eingekauft hat und sonst wie. Also das scheint eine Ressource zu sein und sie meinen, da könnte man eigentlich stärker darauf bauen, weil über Nachbarschaft Kinder Gesellschaft erleben. Also man kriegt über Nachbarschaft vermittelt, was gesellschaftlich okay ist, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und Stadtteile bieten eben die Möglichkeit, Erfahrungen von Gemeinschaft und Gesellschaft zu machen und positive Erfahrungen zu machen. Und da wäre irgendwie wünschenswert, dass das eben nicht nur in manchen Stadtteilen funktioniert und in anderen gar nicht. Und genau, dafür müssen Nachbarschaft, Familie und Vereine, damit das für Kinder relevant wird, in der Schule stattfinden. Also sie haben so Vorstellungen davon, dass sich Schulen zu Community-Zentren entwickeln können, in denen dann eben nicht nur SchülerInnen ein- und ausgehen, sondern der Rest der Nachbarschaft auch, weil es da eine Stadtteil-Mensa gibt, in der man gemeinsam essen könnte, das was in Familien eben immer weniger funktioniert,
Christoph:[54:27] In denen, keine Ahnung, irgendwelche Freizeitangebote stattfinden, sowas. Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken, der mir auch nicht völlig absurd, der mir nicht völlig absurd vorkommt, weil auch dafür muss man nicht 200 Milliarden in die Hand nehmen für solche Umbauten und das kann man eben auch lokal managen und die Hoffnung ist so ein bisschen, dass wenn man so… Schule und Nachbarschaft irgendwie miteinander verknüpfen würde, dass man dann Kinder auch aus ihrer gesellschaftlichen Außenseiterrolle holen würde, weil sie dann in gesellschaftliche Prozesse eingebunden sind. Also, wenn ich im Homeoffice in der Schulmensa essen gehe und da meine Nachbarschaftskinder aus meinem Haus erlebe, dann denke ich sie vielleicht bei nächsten Entscheidungen stärker mit und habe sie zumindest noch stärker auf dem Schirm, als ich es jetzt gerade habe, so exemplarisch gesprochen. Das fand ich irgendwie.
Holger:[55:15] Aber dann wirklich auch zu den Zeiten, wo die Kinder da sind. Ich hatte jetzt Gedanken. Also ich trainiere seit vielen, vielen Jahren in Schulsporthallen, weil ich einfach in einem Verein bin und Vereine da dann abends Hallenzeiten kriegen. Da sehe ich jetzt natürlich nicht die Kinder von der Grundschule, wo wir da trainieren. Das passiert nicht, aber ich bin halt in der Halle dieser Grundschule. Aber das ist dann schon so gemeint, dass es auch auf eine Art gemacht wird, wo sich die Zeiten überschneiden.
Christoph:[55:45] Ja, genau. Also jetzt als Frage. Ja, ja, das ist so, genau. Auch sowas wie ein funktionierendes Vereinsleben, darüber haben wir ja gerade gesprochen, ist total wichtig dafür, dass Kinder Gesellschaft positiv leben können und eingebunden sind. Also starke wirtschaftliche Regionen zeichnen sich häufig auch dadurch aus, dass es sowas wie ein reges Vereinsleben gibt, in dem Kinder auch partizipieren können. Und in strukturschwachen Regionen fehlt das oft und dann fehlt auch der Austausch in der Nachbarschaft und dadurch fehlen auch normalisierende Effekte. Effekte und genau, auch Normalitätsvorstellungen, was in Gesellschaften okay ist und was nicht, fehlen dann für Kinder. So Klassiker, kommt jetzt in dem Buch gar nicht direkt vor, aber es ist die Broken Window Theory.
Holger:[56:28] Wobei die, glaube ich, widerlegt wurde, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwo der Röttger Breckmann mal in irgendeinem seiner Bücher auseinander nimmt. Also ich habe dunkle Erinnerungen.
Christoph:[56:43] Dass ich irgendwo Es gibt auf jeden Fall Kritik.
Holger:[56:46] Zumindest mal Argumente dagegen, sagen wir so.
Christoph:[56:48] Ja, ja, ja. Aber so ein bisschen dieses, wenn ein Stadtteil verwahrlost, dann verwahrlost er immer stärker, weil man das für normal hinnimmt, dass das eben so ist. Und unter der Schwelle von zerbrochenen Fensterscheiben ist es so ein bisschen Müllentsorgung, Mülltrennung. Man sieht, und ich finde, das kann man zumindest, also das ist jetzt anekdotenempirisch, aber das kann man schon erleben, dass das an manchen Orten nicht gut funktioniert und dann offenbar die Bereitschaft auch sinkt, sich dafür noch einzusetzen. Genau, aber ich fand erstmal ganz schön zu denken. Sowas wie Nachbarschaft kann eine Ressource sein, die wir gesellschaftlich heben können, weil es eine Ressource ist, die an sich noch gut zu funktionieren scheint. Das fand ich irgendwie ganz schön, weil ich finde, sonst hört man ja immer wieder von einfach gesellschaftlichen Institutionen, die wir mal hatten und die da niederliegen quasi. Man könnte auch sich sowas überlegen wie Coworking Spaces für Homeoffice Nutzer in Schulen oder dann eben so Community Zentren. Dann würde ich die, dann hat man auch vielleicht, es geht gar nicht darum, dass man pro Tag zwei Stunden mit fremden Kindern spricht, das wäre vielleicht auch ein bisschen merkwürdig, aber dass man sich überhaupt gegenseitig erlebt und nicht nebeneinander herlebt. So, das ist glaube ich der Punkt.
Holger:[58:03] Naja, ja, genau, wenn man zu motiviert ist, mit fremden Kindern zu sprechen, dann wirkt das zumindest seltsam, das ist richtig.
Christoph:[58:10] Eine weitere Ressource sind die Boomer, die jetzt in Rente gehen. Also wir wissen das schon lange, dass die Rente einfach mittlerweile eine lange Lebensphase ist für viele Menschen, weil die Lebenserwartung kontinuierlich gestiegen ist und das Renteneintrittsalter eben nicht im gleichen Maße. Und dass Menschen, die in Rente gehen, auch sehr lange sehr fit sein können. Also die erleben das häufig als nochmal sehr selbstbestimmte Phase des Lebens, in der man nochmal Dinge verwirklichen kann.
Christoph:[58:42] Und wir haben jetzt eben gegen die geburtenstärksten Jahrgänge, die wir jemals hatten in Rente. Und das ist häufig, zum Beispiel fürs Rentensystem wird das ein enormes Problem. Also die Finanzierung davon wird echt ein Drama. Aber das sind Menschen, die fit, motiviert, häufig gut gebildet sind Und sie könnten an vielen Stellen quasi Patenschaft stehen für die Betreuung von Kindern. Genau, wir haben viele auch kinderlose Boomer oder Boomer, deren Kinder weiter weg leben und gerade die könnten dafür einstehen, dass sie sich stärker in der Kinderbetreuung einbringen. Und das finde ich irgendwie nochmal einen sehr guten Gedanken. Ich überlege gerade, ob ich die Zahlen hier irgendwo aufgeschrieben habe. Aber ja, auch wenn man leibliche Oma ist, stört und seinen Kindern vorliest, stört das eigentlich überhaupt nicht, wenn man die Nachbarschaftskinder, die vielleicht unbetreut zu Hause sein müssen, mal mit dazu nimmt und denen auch mit vorliest. Gerade wenn die Nachbarschaftsstrukturen wie gerade eben besprochen intakt sind, könnte man sich sowas ja vorstellen. Also sie plädieren sehr dafür, dass diese gesunden, aktiven SeniorInnen sinnvolle Aufgaben in der Gesellschaft übernehmen und da gibt es sicherlich nicht nur die Rolle, dass man sich um Kinder kümmert, aber das wäre ein großes Feld, in dem man sich einbringen kann. Auch so dieses, irgendwelche Vorlesepatenschaften, Lernbegleitung, man kann sich da alles mögliche ausdenken.
Holger:[1:00:07] Ich habe jetzt irgendwie im Hintergrund, im Hinterkopf, Entschuldigung, dass ich, ich glaube, das waren so Modellprojekte, aber wo man so Dinge getan hat wie ein Altenheim mit einem Kindergarten zu kombinieren oder sowas.
Christoph:[1:00:21] Ja, ja, genau.
Holger:[1:00:22] Also sowas ist ja denkbar, wo beide Seiten auch was gewinnen können.
Christoph:[1:00:27] Ja, absolut. Ach ja, hier habe ich es. Würde sich nur jede zehnte Person aus den geburtenstarken Jahrgängen 1960 bis 69 ehrenamtlich in Kitas oder Grundschulen engagieren, gäbe es mehr Unterstützungspersonen als derzeitige ErzieherInnen und Grundschulkräfte zusammengenommen. Das finde ich, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wenn zehn Prozent der Leute sich denken, ja, also ich würde gern irgendwie was mit sehr jungen Kindern unter zehn machen, dann wäre das eine Verdopplung des Personals, das sich zumindest erstmal irgendwie mit jüngeren Menschen auseinandersetzt. Wenn sich sogar die Hälfte engagieren würde, könnte jedes Kita- oder Grundschulkind einen persönlichen Mentor oder Wegbegleiter im dritten Alter haben. Das ist irre. Also das, finde ich, sind echt heftige Zahlen. Man sieht daran, wie klein die Gruppe an Kindern mittlerweile ist und wie groß sie ursprünglich irgendwann mal war. Aber ja, genau. Faktisch muss man aber sagen, gibt es dieses große Engagement eben nicht. Sie plädieren dafür, dass zum Beispiel die Rentenkasse ja mal sagen könnte, mit dem Rentenbescheid, der eintrudelt, wenn man 67 wird, gibt es nochmal einen Hinweis darauf, wo man sich so einbringen könnte. Und sie plädieren auch dafür, dass man auch materielle Anreize konkret setzt. Ich meine, Altersarmut ist auch ein sehr ernstes Thema und verbreitetes Thema.
Christoph:[1:01:47] Machen sie in dem Buch jetzt gar nicht so explizit, aber daher denke ich schon. Also man könnte über Honorare für Lesepatenschaften oder was auch immer sich das überlegen oder wenn man sich ins Ehrenamt einbringt, dann gibt es Steuergutschriften oder allgemeine Vergünstigungen. Das ist schon total wichtig und natürlich das Selbstverständnis der Organisation Also es braucht ernst gemeinte, kooperative Strukturen, die nicht so ein starkes Nebeneinander her sind. Genau und ja, das finde ich ist nochmal ein sehr schöner Gedanke, weil das so eine andere Betrachtung ist und eben die letzten, gerade die letzten beiden Kapitel, also dann kommt nochmal das Abschnittskapitel, da müssen wir jetzt nicht durch, sie sprechen sich halt dafür aus, dass es Kindern in der Gesellschaft besser gehen soll, weil nochmal so Ressourcen gesehen werden, das finde ich ganz gut.
Holger:[1:02:33] Ja, und ich glaube auch, das ist ja eigentlich vielleicht auch für viele alte Menschen gar nicht so was Schlechtes.
Christoph:[1:02:40] Oh ja, das stimmt auch dazu.
Holger:[1:02:42] Die haben eine zeitliche Beschäftigung, die werden mental ein bisschen gefördert und ich glaube, mit Kindern zu tun zu haben, kann auch ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Jungen halten, aber so ein bisschen ein positiver Impuls sein, Dass man vielleicht nicht in so, ich sag jetzt mal, übertreib jetzt mal etwas, nicht in so ein hinvegetieren kommt. Und ich glaube, das ist schon ein Faktor und man kann das ja auch anpassen. Es muss jetzt ja nicht sein, man muss dann irgendwie jeden Tag dahin kommen und den ganzen Tag, den ganzen Vormittag in der Grundschule bleiben oder sowas. Aber es ist ja auch was, wo man sagen kann, können einmal die Woche für zwei Stunden dazukommen. Und dann macht man einen Stundenplan, dass immer irgendwie jemand da ist. Also so Möglichkeiten gibt es ja auch. Und ich glaube, das ist ja für beide Seiten Gewinn. Man muss das halt nur den, auch ein bisschen als Gewinn bewerben. Nicht so ein, das ist jetzt Arbeit, sondern da habt ihr was von. Auch für die alten Menschen.
Christoph:[1:03:48] Ein Punkt noch, den Sie da im Buch auch zu machen ist, ich meine, es gibt einfach alte Menschen, die eben kinderlos sind und dann entsprechend auch Sorge vor Einsamkeit im Alter haben und ein ernsthaftes Engagement über längere Zeit mit jungen Menschen kann davor natürlich im Zweifel auch schützen. Also wenn man ein Kind im Alter von fünf bis zwölf begleitet hat über sieben Jahre, kann es natürlich sein, dass dieses Kind irgendwann auch denkt, ich gebe was zurück, ich besuche die auch später noch und komme mal vorbei, wenn die vielleicht nicht mehr ganz so leistungsfähig ist. Ich habe ein Beispiel bei mir im persönlichen Umfeld, das war eine Frau, die verstorben ist, die eine Ballettschule hatte und offenbar immer eine sehr enge Beziehung zu ihren Zöglingen dort hatte, selbst kinderlos geblieben ist. Aber ein paar dieser BallettschülerInnen haben sich im hohen Alter, als die Frau über 90 war, um sie gekümmert, sie versorgt wie eigene Enkelkinder im Prinzip und sind auch dann letztlich als Erben eingesetzt. Und genau, also ich glaube, das war eine totale Win-Win-Konstellation. Also ich meine, so Wahlverwandtschaft muss es ja vielleicht nicht gleich sein, kann es aber werden. Und ich glaube auch, es kann total in beide Seiten gewinnbringend sein und damit bin ich am Ende des Buches.
Holger:[1:05:10] Ja, sehr schön. Also, was du am Anfang gesagt hast, dass es da auch Ausblicke gibt, das ist ja schön, weil, ja, dass die Situation nicht immer so schön ist. Ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, der weiß das. Auf jeden Fall sehr interessant, auch einige spannende Ideen, würde ich sagen. Damit du dich im Moment ausruhen kannst, fange ich mal an mit, was mir so eingefallen ist jetzt an, in Anführungszeichen, weiterer Literatur. Mir sind nämlich, glaube ich, vor einem Podcast eingefallen. Erstmal aus unserem eigenen Fundus hätte ich da die, ich mache mal mit absteigenden Zahlen, die Nummer 77, da hatte ich das Integrationsparadox von Aladin L. Maffalani vorgestellt.
Christoph:[1:06:08] Ist, glaube ich, aber die Nummer 76.
Holger:[1:06:10] 76, dann habe ich mich da eben verguckt.
Christoph:[1:06:13] Aber ist ja kein Problem.
Holger:[1:06:15] Ah, du hast recht. Ja, ich habe mich verguckt. Genau, die Nummer 76. Das heißt, du hattest das wahrscheinlich auch auf deiner Liste. Dann hattest du in Folge 65 die Baustellen der Nation vorgestellt. Ich weiß gar nicht mehr, ob da Bildung als Baustelle dabei war, sollte es aber sein.
Christoph:[1:06:33] Ja, auf jeden Fall.
Holger:[1:06:48] Dann habe ich noch die Folge 61, die gespaltene Gesellschaft. Ich weiß gerade gar nicht, wer hat das vorgestellt. Das hast auch du vorgestellt. Und Folge 48, die Altenrepublik, was dann so ein bisschen der Kontrast zu den Kindern ist. Das hast auch du vorgestellt.
Christoph:[1:07:07] Ja, man erkennt ein Thema vielleicht.
Holger:[1:07:10] Genau, ich sehe ein Thema. Dann habe ich letzte Woche einen Podcast gefunden. Ich weiß gar nicht, vom MDR oder NDR, die bei der ARD so für die Menge der Masse der Podcasts zuständig sind. Das heißt Durchgefallen, wie Schule uns als Gesellschaft spaltet. Das ist also ein fünfteiliger Podcast. Der ist auch relativ neu. Wo auch noch mal so ein bisschen durch so die Bildungssituation gegangen wird, Bestände gezeigt werden. Auch am Ende ein Positivbeispiel gezeigt wird, spannenderweise die Rüttlich-Schule, die irgendwann vor zehn Jahren mal so durch die Medien gegangen ist und so ein bisschen, wie die dann auch eine Folge über die hat und wie die so Spielräume, die sie dadurch bekommen haben, dann genutzt haben.
Christoph:[1:08:04] Die kommen auch, die kommen nur einmal vor, aber sie kommen auch in dem Buch vor.
Holger:[1:08:08] Ja. Und dann hatte ich noch Jung und Naiv, die Folge 535. Da war auch Aladin El Maffa Alani und er war in zwei Folgen. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das die Folge, wo er auch ein bisschen über das deutsche Bildungssystem spricht.
Christoph:[1:08:27] Mhm.
Holger:[1:08:29] Genau, das wären jetzt so die Dinge, die mir dazu eingefallen sind.
Christoph:[1:08:33] Sehr gut. Baustellen der Nation ist, glaube ich, Folge 66 gewesen. Und ich würde noch ergänzen, das nomadische Jahrhundert von Gaia Wins. Ich glaube, das hat Nils vorgestellt, meine ich. Genau, das ist Folge 77. Dann habe ich noch Bücher. Und zwar einerseits Globale Migration von Jochen Oltmar. Das ist bei CH Beck erschienen. Das ist eines, glaube ich, von diesen 100 Seiten Formaten, die die haben. Nee, nee, nee. Aber das CH Beck-Wissen, die sind aber auch nicht so lang. Ja, es sind 140 Seiten. Und da geht es ein bisschen drum, wie globale Migration in der Neuzeit sich strukturiert, was die großen Bevölkerungsbewegungen sind, die es im 19. und 20. Jahrhundert gab.
Christoph:[1:09:21] Genau, die aktuellste Ausgabe ist von 2016 mittlerweile und das finde ich ist bei dem Thema dann, wenn man auch die aktuellen Bewegungen mit reinnehmen wollte, ein Stück weit veraltet, aber gut, trotzdem, ich habe das Buch damals gerne gelesen. Und was ich jetzt vor ein paar Wochen gelesen habe, war das Buch Djinns von Fatma Aydimir. Da geht es um eine GastarbeiterInnenfamilie, wenn man sie so nennen möchte, also eine türkischstämmige Familie bzw. Kurdischstämmige Familie in Deutschland. Und genau die Familienperspektiven werden anhand der einzelnen Familienmitglieder in unterschiedlichen Teilen des Buchs vorgestellt. Also es ist ein, finde ich, sehr lesenswerter Roman. Und weil es auch viel um Zeitknappheit und…
Christoph:[1:10:10] Probleme der Familienorganisation in dem Buch geht, dachte ich, die Knappheit der Zeit und die Vordringlichkeit des Befristeten von Christian Geier und Niklas Luhmann könnte noch ein spannendes Buch sein. Ich überlege gerade, wo das erschienen ist. Achso, bei Katmos ist das erschienen. Genau, da geht es eigentlich um Zeitknappheit in großen Organisationen. Warum kommt man eigentlich nie zu dem, was man sich mal vorgenommen hat, sondern muss Meeting an Meeting rein und so. Also, ja, thematisch einen Meter weg auf jeden Fall, aber trotzdem fand ich das irgendwie spannend. Und dann habe ich noch einen Vortrag, der ist leider von der Audioqualität so mäßig, Aber es ist ein Vortrag, den Elmar Falani, glaube ich, an der Ruhr-Universität Bochum gehalten hat, meine ich. Schule in der super diversen Gesellschaft. Ich habe den jetzt ehrlicherweise nicht mir selber angehört, sondern nur so ein paar Sekunden, weil ich glaube, das ist ungefähr der gleiche Vortrag, den ich dann letztes Jahr in Hannover gehört habe. Aber Elmar Falani ist ein hervorragender Redner. Wenn ihr die Chance habt, ihn mal in einem Vortrag live zu sehen, dann nutzt diese Chance, weil es wirklich großartig ist, ihm zuzuhören. Und ich vermute, dass in dem Vortrag einiges, was ich jetzt gerade aus dem Buch erzählt habe, auch vorkommt. Genau, damit, das wären meine weiteren Verlinkungen. Genau, und die Folgen, die du hattest, hatte ich halt auch in beiden Teilen.
Holger:[1:11:31] Ja, sehr schön. Dann, genau, sind wir am Ende der Folge. Wir können nochmal darauf hinweisen, ihr findet uns online. Ich habe immer ein bisschen den Überblick verloren.
Christoph:[1:11:49] Welche Social Media wir haben. Primär ist die Webseite, glaube ich, gerade relevant. zwischenzweideckeln.de. Genau.
Holger:[1:11:56] Ansonsten gibt es uns theoretisch auch noch bei Facebook. Und ich weiß nicht, wie wir, auf welchen Social Media mit dem, was da so passiert.
Christoph:[1:12:06] Auf Facebook heißen wir Zwischenzweideckeln, auf Instagram ist der Handel at deckeln und auf Mastodon sind wir zzde, da komme ich auch immer durcheinander, aber warte.
Holger:[1:12:18] At social am Ende auf jeden Fall.
Christoph:[1:12:21] Wir verlinken es, ne? Wir verlinken es.
Holger:[1:12:23] Ja, ja. Genau. Und ja, je nachdem, wie sich der Meta-Konzern weiter entwickelt, dann ist die Frage, wie wir uns da weiter verhalten wollen. Ja, genau.
Christoph:[1:12:36] Genau. Mastodon ist zzd at podcast.social. Das ist der Link.
Holger:[1:12:43] Gut. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und sagen mal bis zur nächsten Folge. Ja, genau.
Christoph:[1:12:54] Macht’s gut. Tschüss.
Holger:[1:12:55] Tschüss.
Music:[1:12:57] Music
Quellen
Intro und Outro der Episode stammen aus dem Stück Maxixe von Agustin Barrios Mangore, eingespielt von Edson Lopes (CC-BY).
Das Umblättern zwischen den Teilen des Podcasts kommt hingegen von hoerspielbox.de.
Zwischen zwei Deckeln findest du auch im sozialen Medium deiner Wahl: Mastodon und Bluesky.
Der Beitrag 087 – „Kinder – Minderheit ohne Schutz“ erschien zuerst auf Zwischen zwei Deckeln.

Jan 16, 2025 • 1h 3min
086 – „Regeln“ von Lorraine Daston
Regeln durchziehen nicht unsere modernen Gesellschaften, sondern sind schon immer Grundlage menschlichen Zusammenlebens. Doch ihre Bedeutung und Interpretation hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Diesem Wandel geht Lorraine Daston in ihrem Buch Regeln – eine kurze Geschichte nach: Sie beschreibt unterschiedliche Arten von Regeln – dicke und dünne oder lokale und universelle – und spürt besonders einem Verständnis von Regeln nach, das wir heute verloren zu haben scheinen: den Regeln als Modelle, die wir nachahmen und an denen wir uns orientieren.
Shownotes
Lesenotizen Nils zu „Regeln“ von Lorraine Daston
ZZD008: „Objektivität“ von Lorraine Daston und Peter Gallison
ZZD020: „Vereindeutigung der Welt“ von Thomas Bauer
ZZD049: „Collapse of Chaos“ von Ian Stewart und Jack Cohen
ZZD059: “Todesalgorithmus” von Roberto Simanowski
ZZD081: „Die Unterwerfung“ von Phillip Blom (Lesenotizen Nils)
Buch: „The Eye of the Master“ von Matteo Pasquinelli (Lesenotizen Nils)
Buch: „Brauchbare Illegalität“ von Stefan Kühl
Podcast: “Lorraine Daston – Die Regeln unseres Lebens” Sternstunde Philosophie
Buch: “Against Nature” von Lorraine Daston
Artikel: “Rule-Following and Intentionality” (aus der Stanford Encyclopedia of Philosophy zum Regelfolgenparadox von Wittgenstein)
Artikel: “The Tyranny Of Time” von Joe Zadeh im Noema Mag
Buch: “Materialfluss – Eine Geschichte der Logistik an den Orten ihres Stillstands” von Monika Dommann
Blogartikel: “Interesting problems: The Church-Turing-Deutsch Principle” (Blogartikel von Michael Nielsen zum Problem, ob jeder physikalische Prozess von einem universellen Rechner simuliert werden kann)
Quellen und Co
Intro und Outro der Episode stammen aus dem Stück Maxixe von Agustin Barrios Mangore, eingespielt von Edson Lopes (CC-BY).
Das Umblättern zwischen den Teilen des Podcasts kommt hingegen von hoerspielbox.de.
Zwischen zwei Deckeln findest du auch im sozialen Medium deiner Wahl: Mastodon und Bluesky.
Transkript (automatisch erstellt)
Amanda:[0:16] Hallo zusammen, ich begrüße euch zur Folge 86 von Zwischen zwei Deckeln. Einem Podcast, in dem wir euch alle drei Wochen ein Sachbuch vorstellen. Und die, die uns schon kennen, wissen, dass wir das nicht alleine machen oder dass ich das nicht alleine mache, sondern wir sind immer zu zweit. Heute mit mir, Amanda, und mit Nils.
Nils:[0:33] Hallo zusammen.
Amanda:[0:35] Ja, das ist die erste Folge im Jahr 2025. Die letzte Folge war das Weihnachts- oder wie habt ihr es genannt? Neujahrs-Special oder End of the Year. Jahresabschluss-Special, genau. Und jetzt starten wir wieder mit einem Sachbuch. Ich bin schon sehr gespannt, weil es ist tatsächlich ein Buch, was ich schon zweimal angefangen habe zu lesen, einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch, und ich bin nie über das Vorwort oder erste Kapitel hinausgekommen. Deswegen nutze ich sehr gerne die Gelegenheit, dir dabei zuzuhören. Und ich stelle das auch gleich vor, was du uns hier präsentieren wirst heute. Was mich inzwischen beschäftigt oder im Moment beschäftigt, ist etwas etwas Banaleres. Und zwar habe ich letztens von New Adult Romanen gehört, weil das so ein Trend ist auf TikTok.
Nils:[1:23] Oh Gott. Wohl.
Amanda:[1:24] Ich habe weder TikTok noch kenne ich mich da mit diesem Genre aus. Aber ich habe jetzt so eine Ausleihe, so einen E-Book-Ausleihe von der Bibliothek begonnen. Und da gab es die auszuleihen, so ein paar von diesen Trend-Büchern. Und da habe ich mich jetzt ein bisschen reingelesen. Und es ist ziemlich, ich sag mal, seicht, aber passt ganz gut, weil ich habe ein neugeborenes Zuhause und bin da um vier Uhr morgens nur mit irgendwie einem Bruchteil meiner Gehirnzellen dabei und deswegen ist das jetzt Literatur, die ich mir geradezu gemühte für. Im Moment ist das ein Buch von, ich weiß gar nicht, wie man die Autorin ausspricht, Mars ist der Nachname. Sarah J. Mars. Sarah J. Mars, ah, kennst du?
Nils:[2:07] Ja, Autorin, ja, ich habe nichts von ihr gelesen, Aber sie ist gerade so einer der ganz großen Namen in dem Bereich.
Amanda:[2:12] Genau, ja. Und ich kannte das nicht. Und das Buch oder die Reihe heißt Das Reich der sieben Höfe. Und da bin ich jetzt, das ist auch ewig lang. Deswegen, ich habe bisher ein Prozent davon gelesen, gemäß meiner App. Deswegen kann ich noch gar nicht viel darüber sagen. Ist das ein Prozent der ganzen Reihe? Ja, ja. Also in einem E-Book? Ja, das scheint so, ja.
Nils:[2:33] Okay, oh Gott.
Amanda:[2:35] Also da tausende von Seiten, von iPhone-Seiten. Mal schauen, wie sich das entwickelt mit diesem Genre, ob mir das gefällt oder nicht.
Nils:[2:45] Selbst mit nur wenigen Gehirnzellen bleibst du dem Hobby treu. Sehr schön.
Amanda:[2:50] Wie sieht es bei dir aus?
Nils:[2:52] Bei mir geht es tatsächlich gerade, ähnlich wäre gnadenlos übertrieben zu sagen, mein Neugeborener ist schon fünf, aber ich grabe mich gerade noch so ein bisschen aus dem Winterloch, aus den Winterferien irgendwie mental so hervor. Und deswegen gerade noch nicht so konzentriert wieder irgendwas am Tun, am Machen. Ich habe aber vor Weihnachten noch ein Buch zu Ende gelesen, was, glaube ich, auch mein nächstes Buch dann hier im Podcast sein wird. The Eye of the Master von Matteo Pasquinelli. Das ist im Grunde so eine Kulturgeschichte der künstlichen Intelligenz. Ja, weiß ich nicht. Also es ist schwer zusammenzufassen. Es ist irgendwie so eine Automatisierung von Arbeit, Kapitalismus, Technologie, all diese Dinge irgendwie zusammengebracht. Und das habe ich gelesen. Da bin ich jetzt gerade dabei, das ein bisschen für mich aufzubereiten, so in meinem Blog und sowas, um das da reinzuschreiben. Aber wie gesagt, am meisten bin ich jetzt gerade wieder am Arbeiten und irgendwie wieder wach werden nach der Winterpause.
Amanda:[3:48] Okay, das klingt aber spannend für die nächste Folge auf jeden Fall.
Nils:[3:51] Ja, also nicht die nächste Folge, für meine nächste Folge. Das wird noch ein paar Wochen oder Monate dauern.
Amanda:[3:58] Sehr schön. Ja, jetzt zuerst mal das Buch, was du heute vorstellen wirst. Das ist Regeln von Lorraine Destin. Das ist ein Buch, das ist 2023 erschienen. Ich glaube, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch im selben Jahr. Und Destin ist eine amerikanische Historikerin, Wissenschaftshistorikerin, die aktuell aber auch in Berlin arbeitet. Ich glaube, sie leitet das Institut für Wissenschaftsgeschichte.
Nils:[4:26] Und Max-Planck-Institut, genau.
Amanda:[4:28] Genau, das Max-Planck-Institut und hat auch ein paar, also ich finde, ziemlich bekannte Bücher geschrieben. Und das Neueste, oder nicht, vielleicht nicht mal ganz das Neueste, ist eben dieses Regeln. Magst du uns da gleich das TLDL geben?
Nils:[4:44] Ja, sehr gerne doch.
Nils:[4:50] Regeln durchziehen nicht nur unsere modernen Gesellschaften, sondern sind schon immer grundlagemenschlichen Zusammenlebens. Doch ihre Bedeutung und Interpretation hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Diesem Wandel geht Lorraine Destin in ihrem Buch Regeln eine kurze Geschichte nach. Sie beschreibt unterschiedliche Arten von Regeln, dicke und dünne oder lokale und universelle und spürt besonders einem Verständnis von Regeln nach, das wir heute verloren zu haben scheinen, den Regeln als Vorbildern oder Paradigmen, die wir nachahmen und an denen wir uns orientieren.
Amanda:[5:24] Okay, ich bin gespannt. Ich lasse dich einfach mal beginnen.
Nils:[5:30] Ja, dann beginne ich einfach mal. Es ist tatsächlich gar nicht so ein langes Buch. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Also ich kann deinen ersten Impuls so ein bisschen nachvollziehen am Anfang vom Vorwort oder den ersten Seiten so ein bisschen zurückzuprallen quasi. Aber im Endeffekt ist es dann wirklich sehr, sehr ergiebig, auch gerade im Anschluss an das letzte Buch, was ich auch hier im Podcast vorgestellt habe, die Unterwerfung von Philipp Blom. Da fand ich viele so Anschlussmöglichkeiten. Deswegen passt es, glaube ich, jetzt hier auch ganz gut rein. Lorraine Destin fängt an, oder das ganze Buch durchzieht, so eine Unterscheidung von drei verschiedenen historischen Verständnissen von Regeln. Wobei man da jetzt erstmal gucken muss, dass sie auf Englisch schreibt, das heißt, bei ihr sind es Rules und da ist es ein bisschen eindeutiger, warum die drei, warum das drei sind und nicht nur zwei. Das erste, was sie nämlich hat, was dann im Buch aber auch eine untergeordnete Rolle spielt, deswegen ist diese Inkonsistenz nicht ganz so schlimm, ist das Messen.
Nils:[6:33] Also Dinge zu messen, Dinge zu standardisieren in gewisser Maße, also zu sagen, was ist ein Meter, da irgendwie gemeinsame Maßstäbe zu finden und so weiter und so fort. Oder überhaupt erstmal auch auf die Idee zu kommen, im Grunde Dinge auf so eine Weise zu messen. Das ist ein sehr antikes Projekt, tatsächlich. Und das funktioniert eben im Englischen mit Rule, funktioniert das irgendwie intuitiver. Da gibt es ja auch den Ruler, also das Lineal. Im Deutsch mit den Regeln ist das irgendwie nicht so ganz intuitiv, dass das auch ein Verständnis ist. Aber es ist ohnehin das, was auch in ihrem Buch eigentlich, was sie zwar rekonstruiert, irgendwie ein Kapitel, was dann aber eigentlich keine Rolle mehr spielt, deswegen werde ich es hier auch im Podcast halbwegs außen vor lassen. Und dann kommen die zwei anderen Relevanten, die sie so ein bisschen historisch in der Abfolge verortet, nämlich einmal dieses Verständnis, das ist das, was ich gerade schon im TLDL auch hatte, von Regeln als Vorbilder oder Paradigmen.
Nils:[7:38] Und einmal die Idee von Regeln eben tatsächlich als Gesetze. Also als irgendwelche universal gültigen Aussagen, die entweder Universalgültigkeitsanspruch haben oder halt irgendwie, wie jetzt rechtliche Gesetze irgendwie sagen, das gilt jetzt auf einem gewissen Gebiet oder für eine gewisse Zeit oder sowas. Also das sind diese beiden Perspektiven, wir gucken uns die gleich im Detail noch genauer an. Und dann sind für sie auch noch zwei Arten von Welt so ein bisschen relevant im Gegensatz. Das ist einmal eine Welt, also Welt im Sinne von, ja, worin diese Regeln sich bewegen, worin diese Regeln gelten, was diese Regeln versuchen zu kontrollieren. Das ist einmal eine komplexe, vielfältige, dynamische Welt und einmal eine stabile, berechenbare, standardisierte Welt.
Nils:[8:30] Das sind so die zwei Unterscheidungen, die sie aufmacht, wobei die mit den Regeln im Grunde die ist, um die es ihr geht und die andere, die greift sie nur auf, um das so ein bisschen zu vereinfachen. Das wird jetzt gleich in meiner Vorstellung aber auch immer mal wieder auftauchen und miteinander interagieren.
Nils:[8:47] Ich hatte gerade schon noch eine weitere Unterscheidung genannt, die im TLDL zwischen dicken und dünnen Regeln, das ist vielleicht auch die erste, mit der wir mal anfangen, oder beziehungsweise mit den dicken Regeln. Das ist was ähnliches oder anders angefangen. Dicke Regeln bezeichnen sich dadurch aus, dass es nicht nur die Regel selber ist, sondern dass diese Regel sehr, sehr komplex ist, dass sie viele Ausnahmen, viele Erläuterungen, Fallunterscheidungen, Beispiele, Analogien, verbundene Geschichten und so weiter haben. Also man kann sich darunter sowas vorstellen, wie zum Beispiel eine religiöse Lehre. Die jetzt nicht so ihre Gesetze in dem Sinne hat, aus A folgt B, sondern die eben eher in Metaphern, in Bildern, in Vorbildern, in Geschichten, in Analogien und so weiter agieren. Und dann haben wir eben dünne Regeln. Dünne Regeln sind die Regeln, wie wir sie heute zum Beispiel aus Gesetzen kennen oder wie wir sie kennen aus den Naturwissenschaften ganz viel. Das ist halt eine Regel, das ist diese eine Formel oder dieser eine Satz oder dieser eine Zusammenhang und der gibt uns sozusagen an, was passiert, was zu passieren hat oder auch wie wir irgendetwas verstehen oder interpretieren sollen.
Amanda:[10:05] Okay.
Nils:[10:06] Also dicke Regeln sind halt dicke, also ich habe mir das mal so vorgestellt, dicke Regeln sind dicke Bücher und dünne Regeln sind halt so kleine Sätze. Diese Unterscheidung mappt jetzt in dem wie ich das vorstellen möchte relativ stark auf diese beiden Verständnisse von Regeln also die einmal Regeln als Vorbilder und Paradigmen und einmal Regeln als Gesetze ist jetzt vielleicht in der Vorstellung der Unterscheidung schon klar geworden und ich möchte jetzt mal mit dieser Idee von Regeln als Vorbilder und Paradigmen anfangen sie nennt das im Englischen Models und Paradigms Aber Model würde ich jetzt im Deutschen eher nicht als Modell übersetzen, sondern eher als Vorbild. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie das die offizielle deutsche Übersetzung tut, weil ich das englische Buch gelesen habe. Aber ich verwende hier den Griff Vorbilder. Also falls ihr das im englischen, das deutsche Buch gelesen habt und es da Modelle heißt, dann sind das Modelle im Sinne von Vorbildern, von Models, an denen man sich orientiert. Nicht Modelle im Sinne von irgendwelchen abstrakten Modellierungen sozusagen.
Nils:[11:11] Und was diese Paradigmen und Vorbilder auszeichnet, ist, dass diese Art, über Regeln zu denken, oder diese Art von Regeln, sowohl allgemeine als auch konkrete Ebenen abdecken kann. Was heißt das genau? Sie kommt mit einem Beispiel, was ich ganz spannend fand, wo ich jetzt inhaltlich relativ wenig Ahnung habe. Ich gebe das jetzt mal so wieder, wie sie das genannt hat. Sie nennt zum Beispiel den klassischen mittelalterlichen Abt in einem Kloster da als ein sehr gutes Beispiel, weil der im Grunde zwei Rollen hat. Der hat auf der einen Seite die Rolle selber als Vorbild zu agieren also, er, die Weise wie er agiert gerade was Glauben angeht was die Arbeit im Kloster angeht, was sein Verhalten angeht das ist nicht nur halt wie er agiert sondern er hat auch explizit die Rolle dass andere ihn nachahmen, dass andere so handeln wie er handelt dass sie sich von ihm Entscheidungswege Entscheidungskriterien abgucken.
Nils:[12:09] Und so weiter Das ist das eine, das ist dieser Vorbildaspekt. Und dann kommt dieser Paradigmenaspekt, dass er eben auch Entscheider ist, der eben in diesem komplexen religiösen Regelwerk Entscheidungen trifft oder auf Grundlage dieses Regelwerks Entscheidungen trifft. Aber dieses Regelwerk ist halt kein Regelwerk nach dem Prinzip, wenn A, dann B, sondern ist das ein komplexes Geflecht. Ich habe diese Reihe von Dingen gerade schon mehrfach genannt aus Analogien, aus Parabeln, aus Geschichten, aus Beispielen, aus doch vielleicht auch Glaubenssätzen, aus Ausnahmen, aus Illustrationen, aus Bildern, was auch immer. Also es ist so eine ganz komplexe Sammlung an Dingen im Grunde. Vielleicht auch ab und an mal irgendwie so ein Satz, nur du sollst nicht, so was haben wir ja durchaus auch.
Nils:[13:00] Aber all diese Dinge sind halt nicht in sich widerspruchsfrei. Das ist ja auch was, was man Religion gerne vorwirft, gerade zu den religiösen Regeln, dass die irgendwie in sich völlig widersprüchlich werden und nicht miteinander Einklang zu bringen wären. Das ist, so wie Destin das hier vorstellt, eigentlich gar nicht so schlimm oder kein grundlegendes Problem des Systems, weil es eben nicht darum geht, wie wir das heute kennen, für jede Situation eine konkrete Entscheidungsregel vorzugeben. Also wie ein Richter, der sozusagen im Gesetz nach dem Fall sucht und dann sagt, okay, das ist dieser Fall und daraus folgt jetzt diese Entscheidung, diese Strafe oder diese Verhaltensvorschrift, was auch immer, sondern es ist immer die Person, die in einer konkreten Situation eben mehr oder weniger alles über diese Situation weiß, also das Konkrete weiß und einen großen Teil dieses abstrakten, teilweise auch konkreten Regelwerkes im Hintergrund hat. Und im Grunde in der Kombination aus diesen beiden Dingen eine Entscheidung trifft.
Amanda:[14:04] Okay.
Nils:[14:05] So, das heißt, was ein Begriff ist, der da in dem Bereich ganz groß ist, den nennt Lorraine Destin interessanterweise gar nicht, aber das wäre das, was wir heute Ermessen nennen. Wo man sagen würde, das ist eine Ermessensentscheidung, also wo man irgendwie sagen kann, da kann das Amt zum Beispiel so oder so handeln. Das spielt hier eine viel, viel zentralere Rolle. Weil es eben nicht diese Standardregel gibt, sondern der Abt in der konkreten Situation immer in der Lage ist zu entscheiden, okay, welche Regel wiegt jetzt gerade schwerer, mit welcher Situation in der Schrift lässt sich das vergleichen, wie ist diese Situation, wie ist diese Geschichte in den letzten Jahrzehnten irgendwie ausgelegt worden, was ergibt sich daraus? Gibt es hier vielleicht irgendwie eine konkrete Grund davon, auch mal eine Ausnahme zu machen? Beispielsweise aus einer persönlichen Situation, aus einer Konstellation von unglücklichen Umständen oder ähnlichem. Das ist das, was hier auf einmal eine ganz starke Rolle spielt. Das wirkt für uns heute so ein bisschen fremd. findest du?
Amanda:[15:14] Das finde ich nicht es klingt so ein bisschen dialektisch man hat wie zwei man macht die Synthese aus dem Konkreten und nimmt das abstrakte was dazu das man im Hintergrund hat und dann trifft man eine Entscheidung, wieso findest du das fremd?
Nils:[15:30] Ja stimmt das ist ein guter Punkt, ich glaube es ist fremd, wenn man es auf sowas anwendet wie ein Rechtssystem.
Amanda:[15:37] Aha, ja.
Nils:[15:38] Also wenn man sagt, es ist irgendwie eine richterliche Entscheidung zum Beispiel basiert darauf, dann würde man ja jetzt doch schnell dahin kommen zu sagen, das hat viel von Willkür, weil eben diese eine Person entscheiden kann, welche Regel jetzt gilt, so ungefähr, oder ob jetzt vielleicht doch eine Ausnahme möglich ist oder so. Andererseits sind das auch genau die Punkte, wo wir ja mit unserem Rechtssystem immer mal wieder hadern sozusagen, weil es genau diese Dinge nicht erlaubt. Ja, okay. Also ja, stimmt, so für sich selber, für das eigene Leben macht man das vielleicht tatsächlich so, stärker so, aber so als Entscheidung, ja, fühlt sich das für mich fremd. Also Destin unterscheidet da jetzt gar nicht so sehr, Regeln ist dabei sehr allgemein, also sowohl sowas wie Gesetze, als auch wie führe ich mein eigenes Leben oder so, das ist alles irgendwie so zusammengemanscht.
Amanda:[16:28] Okay, ja.
Nils:[16:29] Aber das ist diese Idee eben von Vorbildern und Paradigmen, dass man eben nicht sagt, ich folge einer Regel, wenn A, dann B, sondern ich folge dem, was eine Person tut. Oder ich bewege mich eben in diesem komplexen System aus widersprüchlichen Regeln, Gedanken, Ideen, Überzeugungen und versuche da irgendwie eine möglichst konkrete, passende Entscheidung für die konkrete Situation zu treffen.
Amanda:[16:54] Mhm, okay. Okay.
Nils:[16:57] Das wandert dann bei ihr auch, sie ist eben eine Wissenschaftshistorikerin, auch immer so ein bisschen in die Idee Wissenschaft, also wie sieht Wissenschaft denn dann in dieser Situation aus und was macht Wissenschaft? Oder jetzt in dem Fall auch einfach Handwerk und Kunst. Das ist da auch nochmal ein schönes Beispiel, weil sie eben auch sagt, dass diese Regeln in diesem Modell immer ganz eng mit der konkreten Praxis verbunden sind. Das heißt, die sind nicht universell, in dem Sinne, das ist die eine Regel und die gilt immer, sondern das ist halt die Regel, die gilt in dem Ort. Weil in dem Ort gibt es diese Art von Baustoff und dieser Baustoff ist ein bisschen feuchter als der Baustoff im Nachbarort. Und deswegen gilt im Nachbarort eine andere Regel, weil da ist der Baustoff trockener, mit dem muss man anders umgehen. Und diese Regeln werden eben auch nicht, das fand ich ganz spannend, wenn man eben in frühe Schriften guckt, was auch jetzt Erklärungen angeht in der Kunst und im Handwerk, so eine Art frühe Lehrbücher auch, die haben sich nie an komplette Anfänger gerichtet. Also es war nie das, was wir heute kennen, irgendwie so, du fängst bei nix an und wirst dann so langsam irgendwo hingebracht, sondern die haben immer darauf aufgebaut, dass eine grundlegende Praxis schon da ist. Dass die Leute das Grundlegende schon kennen, auch in diesem Handwerk in Handgriffen geübt sind, bestimmte Begriffe schon kennen und dann quasi darauf aufbauend Orientierung bieten, auf Muster hinweisen und Dinge irgendwie weiter erklären.
Amanda:[18:25] Okay, das ist interessant. Das erinnert mich an, kennst du das Regelfolgenparadox? Hast du davon schon gehört? Das ist ein philosophisches Paradoxon von Wittgenstein, wo er eigentlich auch diese Regelbefolgung untersucht. Und im Endeffekt geht es darum, um die Frage oder um das Problem, wie können wir wissen, ob wir eine Regel überhaupt richtig befolgen.
Nils:[18:52] Okay.
Amanda:[18:53] Weil du kannst das natürlich, es gibt wie ein Regress, oder? Weil eine Regel ist ja auch sprachlich. Also es geht vor allen Dingen in der Sprachphilosophie dann, also bezieht er es natürlich, Wittgenstein, geht es darum, wenn das sprachlich definiert ist, wie können wir dann auch sicherstellen, dass wir das richtig interpretieren, was wir aus der Regel dann folgen. Also es ist wie nur ein Stück weit noch zurück und er sagt dann, oder wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sagt er eben auch, es ist eben nicht, dass Regelfolgen, das kann man gar nicht objektiv sozusagen irgendwas festmachen, also es gibt nicht metaphysisch irgendwie eine Garantie zu sagen, das ist jetzt die korrekt befolgte Regel oder nicht, sondern es folgt immer aus der Praxis, also sozial und aus dem Kontext und so weiter. Also es ist eigentlich das Gleiche und die gleiche Antwort, sage ich mal, für eine noch grundlegendere Frage, wenn es um Regeln geht.
Nils:[19:44] Ja, das ist eine gute Analogie. Ich habe jetzt, als du das erklärt hast, habe ich dann wieder an Habermas und seine nicht kontraktuellen Grundlagen des Vertrages denken müssen. Also dass ein Vertrag immer auch darauf angewiesen ist, dass Leute sich auch an einen Vertrag halten wollen.
Amanda:[19:58] Ja, genau.
Nils:[19:58] Dass der nicht alleine in der Lage ist, sozusagen einen Austausch zu garantieren oder Konformität zu garantieren, sondern dass der immer darauf angewiesen ist, dass es eine grundlegende Übereinstimmung zwischen den Menschen gibt, dass Verträge einzuhalten sind. Genau das geht glaube ich in die ähnliche Richtung und mir ist es hier halt ganz ganz wichtig, in dieser Situation bei dieser Art von Regeln also wie gesagt Regeln auch als Handwerker wie gehe ich vor oder als Künstler wie mache ich bestimmte Dinge, dass da die Person die interpretiert und entscheidet immer gleich mitgedacht ist also diese Regelsysteme funktionieren nicht ohne, Ohne eine kompetente Person, die irgendwie eine gewisse Bildung in diesem Bereich hat, die das Regelsystem auf eine gewisse Weise kennt und sich darin bewegen kann, aber eben gleichzeitig auch immer eine konkrete Person ist, in einer konkreten Situation, mit einem konkreten Gegenüber oder mit einem konkreten Werkstoff vor sich und eben nicht irgendwie so ein abstraktes, abstrakte, berechenbare Ding, die irgendwie für alle immer gleich funktioniert.
Amanda:[21:03] Ja.
Nils:[21:04] Okay, und das ist, glaube ich, hier nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil, das schließt auch ganz schön an, ich hatte in einer ganz frühen Episode, ich glaube, es war Episode 8, hatte ich hier ein anderes Buch von Lorraine Destin vorgestellt, Objektivität, da macht sie das Ganze, macht sie was ähnliches auf, da geht es um die Objektivität von wissenschaftlichen Abbildungen. Und sie schreibt halt da eben auch, früher, also 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, waren das in erster Linie Zeichnungen, die irgendwie als solche Zeichnungen verständlich waren. Also da läuft es ein bisschen andersrum. Während das jetzt im 20. Jahrhundert, im 21. Jahrhundert immer noch stärker, werden wissenschaftliche Abbildungen viel mehr so abstrakte Visualisierungen von irgendwas, wo man ziemlich viel Ausbildung braucht, um die überhaupt zu verstehen. Also wenn ich auf eine Zeichnung irgendwie von einem Tier gucke aus dem 19. Jahrhundert, dann kann ich auch als Laie relativ viel daran erkennen. Wenn ich aber irgendwie auf eine CT-Aufnahme schaue, dann sehe ich da als Laie erstmal relativ wenig.
Nils:[22:13] Oder auf irgendeine Visualisierung von physikalischen Messgrößen in einem kernphysikalischen Experiment oder irgendwas. Da kann ich nichts dann erkennen, als jemand, der nicht wirklich massiv Ahnung hat in dem Bereich. Und so ist es hier im Grunde andersrum, dass ich mich im Grunde in diesem Regelsystem, nicht bewegen kann, wenn ich nicht auch eine Verankerung, eine Verortung in dieser Praxis habe.
Nils:[22:38] Und dann auch stark verkörpert, das ist was, da werden wir gleich auch um was Mathematik angeht, nochmal kurz zu kommen. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt einen Aspekt, wo wir das hier in unserer Welt tatsächlich auch noch haben, diese Art von Regelsystem. Das ist nämlich das angelsächsische Case Law. Also die englische… Was ist das? Also vor allem die englische und amerikanische Art der Rechtsprechung und Rechtsetzung, wo es zwar natürlich auch sowas gibt wie Gesetze, wo aber viel größerer Wert auch gelegt wird auf irgendwelche Interpretationsgrundsätze und aber vor allen Dingen auch auf Präzedenzfälle. Also welcher andere Fall war denn so ähnlich? Und ist jetzt der Fall A die bessere Analogie oder der Fall B die bessere Analogie? Also diese Gedanken und Argumentation, das ist tatsächlich so eine Art, wo sich dieses Denken auch in der heutigen Welt noch viel wiederfindet.
Nils:[23:37] Was diese Art von Regelsystem auch auszeichnet, das fand ich dann besonders spannend, damit ich mich da bewegen kann, brauche ich diese Regeln, diese Beispiele, diese Geschichten, diese Analogien im Grunde sofort abrufbar. Wenn ich darin denke, dann kann ich nicht erst, also ich kann natürlich auch irgendwie ein bisschen gezielt suchen oder so, aber ich brauche einen gewissen Grundstock in meinem Kopf drin, damit ich eine Situation überhaupt erstmal einordnen kann. Damit ich sagen kann, ja, das geht so ein bisschen in die Richtung von der Parabel oder das passt hier zu dem Gleichnis, das passt hier zu der Geschichte, in dem Buch, in der Bibel und so weiter und so fort. Und da habe ich dann für mich, das hat Destin nicht gemacht in ihrem Buch, aber ich habe mir ein bisschen so den Gedanken gehabt, das könnte auch was mit dem auswendig lernen in der Schule zu tun haben. Warum es vielleicht doch auch manchmal sinnvoll sein kann, bestimmte Dinge auswendig zu lernen, damit man sie genau in solchen Denksystemen abrufen kann.
Amanda:[24:34] Ja, das ist, kennst du Vera Birkenbiel?
Nils:[24:39] Ja, dem Namen nach mehr als inhaltlich, aber ja.
Amanda:[24:42] Und sie hat das mal in so einem Gespräch gesagt, sie nennt das das Wissensnetz. Und ich finde das eine super Analogie, weil man halt echt so, genau, also man hat wie ein Netz von Regeln und dann kann da was hängenbleiben. Und wenn man das eben nicht hat, dann hat man auch keine Referenz, wie man die anwenden soll oder kann oder wie man in einer konkreten Situation da agiert. Also ich habe auch genau, jetzt, als du es erzählt hast, ist mir das auswendig in den Sinn gekommen. Macht Sinn.
Nils:[25:13] Ich muss auch immer wieder dran denken, Ich habe gerade ganz oft Religion als Beispiel gebracht. Heutzutage gibt es auch mit dem religiösen Extremismus meistens in dem Sinne Probleme, als dass der dazu neigt, die Schriften sehr wörtlich zu verstehen. Das haben wir im Grunde in allen Bereichen, das haben wir im Christentum mit den Evangelikalen, das haben wir mit bestimmten Schlagrichtungen des Islamismus gibt es das, dass da Regeln sehr wörtlich genommen werden, so wie sie da stehen. Und das macht sie auch nicht explizit, aber das scheint mir auch ein Problem zu sein, dass man eben diese Elemente dieser dicken Regel als eigenständige dünne Regel versteht. Also dass man sagt, irgendwas, im Islam ist das sehr deutlich, weil da einfach sehr viel vorbildhaftes Handeln, da ist dieses Vorbild-Element sehr groß, sehr hochgehängt. Wie hat der Prophet damals gehandelt und wir handeln genauso. Dass das eben das damalige Handeln, das Einmalige als eine absolute Regel, als ein Gesetz verstanden wird und nicht als eine ein Handeln einer konkreten Situation, das vielleicht auf irgendwelchen fundamentalen Grundsätzen basiert und auch einen normativen Charakter ruhig haben soll, aber eben nicht als absolute Regel das steht.
Amanda:[26:30] Gut, das könnte man auch verallgemeinern oder auf alles. Also wenn man anstatt Regeln irgendwie eine Idee nimmt, die ist ja nicht ihrem Entstehungskontext verpflichtet. Also sie entsteht immer wieder neu.
Nils:[26:41] Ja, sie ist ihrem Entstehungskontext verpflichtet.
Amanda:[26:44] Nee, eben nicht, oder? Weil sie halt eben in einem neuen, unterschiedlichen Kontext wieder anders interpretiert wird.
Nils:[26:50] Ach so, okay. Ja, sie ist verpflichtet insofern, dass sie aus einem kommt und dass sie ohne den nicht verstanden werden kann. Aber sie kann natürlich übertragen und anderswo anders angewendet werden.
Amanda:[26:59] Genau, ja.
Nils:[27:00] Gut, da haben wir, glaube ich, einfach nur das verpflichtet anders interpretiert.
Amanda:[27:03] Genau.
Nils:[27:05] Also das ist so ein bisschen die alte Welt, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich nie so ganz monokausal. Oder ganz gerichtet, wie das jetzt in der Vorstellung klingt. Aber das ist so ein bisschen die alte Welt, eben das alte Regelverständnis. Und das ist das Verständnis von Regeln, wo Destin sagt, das ist ein bisschen verloren gegangen. Das wird weniger relevant. Und was viel mehr relevant wird, sind eben die klaren Gesetze. So die klaren Regeln, die sich leicht aufschreiben lassen. Und so weiter. Und da geht sie einen interessanten Weg, der mich erst mal ein bisschen überrascht hat, den ich aber inhaltlich extrem spannend fand. Und sie guckt nochmal, wo kommt denn eigentlich das prototypische Gesetz, die prototypische dünne Regel, die mathematische Formel, wo kommt die eigentlich her? Und da guckt sie eben auch einmal zurück in die Antike, in die frühen Beschreibungen von eben solchen Regeln und mathematischen Algorithmen und beschreibt eben auch da, dass das ganz oft eben nicht, oder meistens nicht eben in irgendwie so eine abstrakte Formelform niedergeschrieben wurde, sondern als Handlungsanweisung.
Nils:[28:21] Also wirklich wie man jetzt einem kleinen Kind vielleicht erklärt, wie rechnest du 3 plus 2 du nimmst drei Finger und dann machst du nochmal zwei dazu und dann zählst du sie nochmal also wirklich als eine physische Handlungsanweisung für mathematische Vorgehensweisen, also heute kennt man das noch so ein bisschen aus der Geometrie, da geht man ja teilweise noch so vor, dann nimmst du einen Zirkel und dann legst du es lineal an und dann drehst du es so und dann kommt am Ende das bei raus, Also wirklich als Mathematik, als Handlungsanweisung und nicht als Formel. Wir nehmen das immer noch so ein bisschen als Brücke, damit die Leute so ein bisschen lernen, um überhaupt mal reinzukommen. Aber da war es halt tatsächlich die Hauptform, wie das dokumentiert und auch entwickelt wurde. Und dann eben auch ganz eng mit den Werkzeugen verbunden, die dafür genutzt wurden. Eigentlich auch eine ganz spannende Beobachtung. Und dann kommt sie im Grunde zu einem Thema, was da so ein bisschen für sie eine Brücke darstellt. Das ist dieser ganze Gedanke der Automatisierung und der Berechnung, also der Computerisierung im Grunde. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so, warum sie diesen Sprung macht. Er weiß sich halt super spannend, aber ich weiß nicht mehr, warum sie ihn macht.
Nils:[29:34] Sie kommt im Grunde von ganz am Anfang mal, Arbeitsteilung als Idee ist jetzt nie hat es immer schon so ein bisschen gegeben aber wurde halt das erste Mal massiv schriftlich festgehalten in der Form von Adam Smith sein klassisches wie wird eine Nadel hergestellt und nicht einer, 20 Leute machen jeweils eine Nadel sondern 20 Leute machen einen Schritt und kriegen dann derselben Zeit irgendwie 100 Nadeln produziert, Und die erste echte Anwendung davon, das ist jetzt das, was mich überrascht hat, war tatsächlich nicht in der Produktion von irgendwas, sondern in der Mathematik.
Nils:[30:12] Nämlich, als um die Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert, also Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert, große Tabellenwerke erstellt werden sollten für astronomische Berechnungen. Das waren vor allem Logarithmen, die damals erstellt werden mussten. Gaspar de Prony war da ein ganz prominenter Name.
Nils:[30:33] Und was der im Grunde gemacht hat, dass er gesagt hat, wir nehmen jetzt diese intellektuelle Arbeit, dieses Berechnen dieser Logarithmen, was durchaus aufwendig ist, und wir machen daraus jetzt im Grunde eine physische Arbeit. Wir teilen diese Arbeit auf. Das heißt nicht, ich muss hier diese 10.000 Logarithmen berechnen, sondern ich erarbeite irgendwie ein System, wie mehrere hundert bei weitem mathematisch nicht so gut ausgebildete MitarbeiterInnen oder Menschen, die waren ja wahrscheinlich noch keine MitarbeiterInnen im heutigen Sinne, wie die das mit einfachen Rechenschritten so formularisch machen können. Indem sie einfach immer nur irgendwelche kleinen Zahlen addieren zum Beispiel. Ohne Logarithmen rechnen zu müssen. Und das wurde dann auch tatsächlich so durchgeführt. Das heißt, da sind dann wirklich mit einem relativ hohen organisatorischen und logistischen Aufwand diese Berechnungen, diese Formulare für diese Berechnungen sozusagen verteilt worden. Und dann haben da, oder diese Prozeduren vermittelt worden und dann haben da wirklich ganz viele Menschen gesessen und kleine, einfache Rechnungen gemacht, um damit diese großen Mengen an Logarithmen, die es zu berechnen, galt für die Tabellenwerke zu berechnen.
Nils:[31:58] Und das ist interessant, was jetzt daraus dann weiter passiert und das ist dann auch wieder ein Name, den kennt man vielleicht mehr als Gaspard de Prony, das ist eine Arbeit, an die hat dann Charles Babbage angeschlossen, den man ja gemeinhin als Erfinder des Computers oder der automatisierten Rechenmaschine sieht.
Nils:[32:16] Der hat nämlich genau das, was Proni da gemacht hat, gesehen und hat versucht, es zu automatisieren. Also nicht nur auf viele Menschen zu verteilen, sondern tatsächlich zu automatisieren. Und dann das eben zusammen mit Ada Loveless dahin weiterentwickelt, dass das eben nicht nur für diesen Algorithmus geht, sondern für grundsätzlich alle oder für mehr. Für viele Algorithmen. Das heißt, was wir da jetzt für einen Nebenstrang haben, ist hier im Grunde das Argument, dass die Arbeitsteilung der Automatisierung vorausgeht. Das heißt, dass nicht irgendwie eine Technik erfunden wird und damit wird dann die Arbeit automatisiert, sondern dass erstmal die Arbeit auf ganz viele Menschen verteilt wird, die nicht sonderlich viel können müssen. Und wenn das dann klappt, dann können diese Menschen, die nicht sonderlich viel können müssen, durch die Maschine ersetzt werden.
Amanda:[33:07] Okay, das ist, das klingt für mich ein bisschen nach, ich habe einen Artikel gelesen, dort wird das Church-Turing-Deutsch-Principel genannt und also die These ist da, dass eigentlich jeder physische Prozess oder physikalische Prozess simuliert werden kann von einer universellen Maschine eigentlich. Und das, also ist das ungefähr das, was gemeint ist?
Nils:[33:31] Ja, es geht ja mehr als ums Simulieren. Okay. Es geht ja wirklich ums Tun, hier an der Stelle. Es geht ja wirklich darum, dass diese Berechnung, also bei Berechnung ist es noch offensichtlich, aber es geht dann ja später auch um die tatsächliche Produktion. Da ist es dann mit dem Simulieren halt nicht mehr getan. Aber es geht, glaube ich, tatsächlich in eine ähnliche Richtung, ja.
Amanda:[33:49] Okay.
Nils:[33:50] Was ich jetzt nur spannend finde, weil dieser Gedanke, dieser Punkt ist genau der Punkt, an dem jetzt das Buch, was ich gerade gelesen habe, das ist von Matteo Pasquinelli, The Eye of the Master, an dem das ansetzt. Das vertieft das im Grunde nochmal massiv. Und er zitiert auch tatsächlich explizit Destin, das fand ich ganz lustig, weil ich die Bücher direkt hintereinander gelesen habe, ohne dass mir das vorher bewusst gewesen wäre.
Amanda:[34:10] Das liebe ich, wenn das passiert.
Nils:[34:15] Das ist aber jetzt eben, diese Entwicklung ist halt ein spannendes Phänomen, weil was das eben dann im Endeffekt macht, gerade dann auch wenn die Automatisierung da war, dass das aus dieser intellektuellen, also der psychischen Arbeit, im Grunde physische Und da gibt es ein schönes Beispiel. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurden in den USA die sogenannten Holleritmaschinen eingesetzt im Bereich des Zensus.
Nils:[34:42] Und da war es irgendwie notwendig, mehrere zehntausend Summen zu erstellen aus irgendwelchen Zahlen, die aus sieben unterschiedlichen Tabellen kommen. So, das war im Grunde die Aufgabe, die da bestand. Und statt dass das eben einige mathematisch gebildete und fähige Menschen tun, ist es eben an diese Hollerit-Maschinen übergeben worden. Und das bedeutete, dass zwölf Millionen Zahlen auf 300.000 Karten eingeprägt, also Punchcards gelocht werden mussten. Und das ist natürlich ein unglaublicher physischer Akt. Und es ist auch eine Art von physischer Arbeit, die so aus der Arbeitswissenschaft weiß man, das extrem belastend ist, weil sie ist auf der einen Seite unglaublich monoton, aber verlangt die absolut volle Aufmerksamkeit. Ja, klar. Weil man sich eben nicht vertun darf. Man macht immer dasselbe, man nimmt immer einen Stanzer und ein Stanzloch in eine Karte, ein Stanzlöcher in Karten. Man darf sich dabei aber nicht vertun. So, und das ist so für die mentale Belastung und auch für physische Belastung eine der schlimmsten Kombinationen, die man sich so vorstellen kann. Abseits jetzt von manifester Ausbeutung und so, davon reden wir jetzt nicht. Und das war wohl auch tatsächlich so, dass diese Belastung der Menschen, die das gemacht haben damals, einer der Gründe war, warum grundsätzlich die Arbeitszeiten verkürzt wurden.
Nils:[36:11] Weil die eben nicht über die ganze Zeit das durchgehalten haben. Was jetzt hier passiert ist, ist aber auch gleichzeitig, das hatte ich gerade schon angedeutet, dass diese intellektuelle Arbeit des Berechnens massiv dequalifiziert wurde. Weil die Berechnung jetzt eben von automatisierten Maschinen oder eben von Menschen, die nur kleine Summen bilden müssen, irgendwie gemacht werden konnte. Also das fand ich einen sehr spannenden Schritt und ich glaube, der Ersten nimmt diesen Schritt auf, weil es halt hier genau darum geht, diesen Schritt im Grunde von der Praxis, von dem Verkörperlichten, von dem sehr eng an den Menschen gebundenen weg zu so einer abstrakten Prozedurierung, wo der Mensch im Grunde nur noch ausführendes Organ im Grunde ist, hinzugehen. Und das dann wiederum so ein bisschen zu diesen dünnen Regeln führt oder zu den Gesetzen, die sie da irgendwie, die sie da aufgreift.
Nils:[37:10] Genau, sie geht dann auch noch so ein bisschen auf Gesetze, jetzt tatsächlich im Sinne von Gesetzen, wie wir sie rechtlich kennen. Also das war jetzt ja eher so ein Zwischending. Jetzt geht es auch noch um rechtliche Gesetze. Da hat sie ein ganz schönes Kapitel, das ich jetzt aber auch nicht im Detail aufdrösel, wo sie mal guckt, also erst mal unterscheidet sie zwischen Gesetzen, Regeln und Regulierung.
Nils:[37:34] Gesetze sind sehr allgemein, sehr knapp, sehr kurz. Kurze Regeln sind dann schon so ein bisschen konkreter irgendwie runtergebrochen und Regulierung ist dann so das, was unten im Amt sozusagen dann tatsächlich vorgibt, wenn hier eins steht, dann macht das, wenn hier zwei steht, das macht das, dann macht das. Was sehr, sehr kleinteilig werden kann und sie überlegt dann an zwei Beispielen, wann sich sowas eigentlich durchsetzen kann, wann sich so eine Regulierung, die von oben geplant ist eigentlich durchsetzen kann und sie hat da drei spannende Beispiele, sie hat einmal das Beispiel der Regulierung von Konsum, Also es gibt zum Beispiel, es gibt wohl eine lange Geschichte, mir war das auch nicht so bewusst, von Regeln, was man eigentlich anziehen darf, was man besitzen darf, wer wie viele Dinge von welcher Qualität kaufen darf, welche Hüte, welche Mäntel, welcher Schmuck an Mänteln sein darf und so weiter. Es gibt es wohl tatsächlich im letzten Jahrhunderten sehr lange immer wieder versucht worden und es hat nie wirklich funktioniert. Es gab dann teilweise sehr, sehr massive Regeln, es darf nur drei Knöpfe aus diesem Holz an einem Mantel geben und nicht vier, aber diese Regel wurde dann halt nicht durchgesetzt, also die Regel war sehr detailliert, aber wurde halt quasi nicht durchgesetzt.
Nils:[38:51] Das eine Beispiel, das andere Beispiel was sie bringt, ist ein sehr anderes, ist die Rechtschreibreform, das hatten wir ja in Deutschland vor, wann hatten wir das, 25 Jahren irgendwas in der Größenordnung, hatten wir darüber ja große Diskussionen wie verändert sich jetzt irgendwie unsere Rechtschreibung, es hat sich jetzt irgendwie halbwegs etabliert und es gibt nicht mehr ganz so viele, die da noch irgendwie hinterher quaken, und dann haben wir eben noch das Thema wie man Städte regulieren kann in dem Sinne, dass eben Müll rausgestellt wird, dass Autos auf einer Straßenseite fahren, und so weiter und so fort. Also das ist so ein bisschen die Beispiele, die sie ein bisschen historisch nachzeichnet. Das ist ganz nett zu lesen. Wichtig ist halt, dass diese Gesetze oder für ihre übergreifende Argumentation ist halt besonders wichtig, dass so eine funktionierende Regulierung, also auch schon auf der kleinteiligen Ebene, dazu führt, dass die Welt deutlich vorhersehbarer und kontrollierbarer wird. Weil man eben viel besser vorauslegen kann, was andere Menschen tun und was auch irgendwie passiert. Klassisches Beispiel, die Regulierung der Krümmung von Gurken. Das ist ja so ein EU-Beispiel, was immer gerne genannt wird. Im Kern gibt es…
Amanda:[40:05] Sind es nicht die Bananen, sind es Gurken?
Nils:[40:07] Ich glaube, es war tatsächlich bei Gurken, dass die nicht zu sehr gekrümmt sein durften. Was einfach damit zu tun hatte, damit eine berechenbare Anzahl von Gurken in die Standardcontainer passt.
Amanda:[40:18] Klar, macht Sinn, ja.
Nils:[40:19] So, klar, auf einmal ist es vorhersehbar und kontrollierbar. Auf einmal weiß ich, okay, ich habe jetzt den Standardcontainer, da sind jeweils 50 Gurken drin, ich habe ja 500 Gurken. So, und das weiß dann auch jeder, der diese zwei, oder der diese eine Information hat, kann das sofort sich ableiten. Da brauche ich keine große Praxis oder viel Erfahrung oder irgendwas. Ich muss nicht eins in die Hand nehmen und das mit der Hand abbiegen oder ein anderes daneben und sagen, hier sind vielleicht zehn drin, hier sind wahrscheinlich nur acht drin. Sondern es ist einfach standardisiert, Punkt. Das macht die Welt vorhersehbar, das macht die Welt kontrollierbar. Natürlich nur, wenn sich diese Norm und diese Regulierung auch tatsächlich etabliert. So, das war der Gedanke von Gesetzen. Sie führt das dann weiter zu einem auch wieder spannenden Punkt, nämlich zum Thema Naturgesetze. Und da haben wir auch wieder ein Übersetzungsproblem, weil Naturgesetze hat im Deutschen zwei Bedeutungen, die sich im Englischen unterscheiden lassen, nämlich einmal Natural Laws und Laws of Nature.
Nils:[41:29] Also Natural Laws sind sowas wie natürliche Gesetze, also das kennt man aus der deutschen Philosophie, kennt man das durchaus auch, diese Idee. Also das sind so Dinge, die halt gelten. Das ist das Natürliche, das ist das Normale, das ist das, was den Mensch zu Menschen macht. So, alles andere ist wieder die Natur so, diese Art von Argumentation da in dieser Logik ist die Natur der ultimative Ausdruck von Vernunft, weil ja so sind wir Menschen halt so, das ist ein Naturgesetz dass wir Menschen so sind.
Nils:[42:09] Und dann haben wir noch einen anderen Blick auf Natur, das ist jetzt nicht der andere Blick auf Gesetz, sondern auf Natur, wo Natur der ultimative Ausdruck von Instinkt ist. So, das ist irrational, das ist unvernünftig, das sind doch nur Emotionen, das sind Triebe, die müssen eingehegt werden und so weiter und so fort. Da ist Natur irgendwie alles andere als vernünftig. So, und das Problem ist gewesen, jetzt hat man diese beiden Blicke auf Natur, so Natur ist irgendwie das, wie wir halt sind, wir sind halt auch irgendwie Teil der Natur und so. Und gleichzeitig ist Natur irgendwie rational. Und das ist so ein bisschen Weg gewesen, das zu überbrücken, das war eben auch einer der Wege, eine Funktion, die Religion übernommen hat. Eben genau das so ein bisschen zu kriegen, weil beides unterliegt Gott. Es gibt also irgendwas, was drüber geordnet ist und dann sind diese Widersprüche zwischen diesen beiden Perspektiven sind zwar irgendwie da, aber sie sind nicht so kritisch, weil im Endeffekt entscheidet eh Gott. So was auch immer das heißt. Das ist jetzt auch ein schöner Punkt, der bei Blom in seinem die Unterwerfungsbuch auch gut auftaucht, so diese Widersprüchlichkeit. Und ein weiterer Weg dahin zu gehen, ist dann eben zu sagen, wir haben jetzt nicht mehr diese natürlichen Gesetze, sondern wir haben die Naturgesetze, also Laws of Nature im Englischen. Das heißt, das sind Gesetze, das sind Regeln, denen die Natur unterliegt.
Nils:[43:33] Die auch, die aus der Natur kommen sozusagen, aber denen sie auch selber unterliegt, wo sie jetzt nicht sich irgendwie von abweichen kann, die irgendwie da drüber geordnet sind, So als grundlegendes Ordnungsprinzip. So, habe ich dich soweit mitgenommen?
Amanda:[43:52] Ja, ich bin noch da.
Nils:[43:54] Bist du leise geworden?
Amanda:[43:56] Ja, nee, also ich muss das noch ein bisschen zusammenbringen, was die Unterscheidung, die sie da macht. Aber ja, erzähl mal weiter.
Nils:[44:05] Also diese Unterscheidung zwischen Naturgesetz und Naturgesetz, das ist im Grunde der Gedanke, einmal dieses, so ist es halt natürlich, also so ein bisschen dieses Moralische. Oder die Menschen sind doch Fleischfresser. Oder der Mensch ist von Natur aus, setze das Adjektiv deiner Wahl ein. Das sind diese Naturgesetze, die irgendwie was rechtfertigen. So was Moralisches. Und dann haben wir eben das, was wir Naturgesetze nennen. Wie hier E gleich mal C-Quadrat im Klischee. Was ja doch eine andere Art von Gesetz irgendwie ist. Das ist etwas Gesetztes. Was aber eben nicht irgendwie wir Menschen gesetzt haben. Sondern wo wir glauben, wir hätten es entdeckt und nicht erfunden. Oder warum man es jetzt…
Amanda:[44:44] Und sie macht das einfach deskriptiv, also um dann ein Argument daraus zu entwickeln. Beschreibt sie diese Unterscheidung?
Nils:[44:53] Weil sie eben zur Universalität von Regeln will. Also das ist eine gute Frage, danke. Sie macht das, weil sie eben von dieser eingebetteten Praxis hin will zur Idee von universellen Regeln. Von Regeln, die irgendwie immer gelten. Die irgendwie so eine universelle Geltung haben. Weil da ist das Naturgesetz eben der Prototyp für. Weil wir da ja eben auch schon gelernt haben, dass selbst die so ihre Grenzen haben. Wenn man so an Newton’sche Mechanik oder sowas denkt, die dann im ganz Kleinen und ganz Großen auch wieder in ihre Grenzen stößt.
Nils:[45:23] Genau, das ist ein bisschen die Idee und dann sind wir auch im Grunde schon am letzten Punkt. Das ist auch, glaube ich, was, was sie, ich weiß gar nicht, ob sie das so explizit macht in dem Buch. Also das war ein interessantes Buch, weil sie macht sehr viel historische Analyse, sehr viel auch historische Details und legt irgendwie so einen analytischen Werkzeugkasten, macht sie auf und stellt ihn vor, aber wendet ihn dann eigentlich nicht mehr an. Das fand ich spannend. Das war in dem Buch von Pasquinelli, das ich nächstes Mal vorstellen werde. Relativ ähnlich, weil dieser Schluss, den ich jetzt ziehe, ich weiß gar nicht, ob sie den so explizit zieht, aber ihre Grundthese ist schon, dass die Regeln, die wir haben, eben immer dünner werden, in ihrem Sinne, dass sie immer deterministischer werden und dass sie das Ermessen im Grunde immer mehr rausnehmen. Also, dass es eben nicht mehr darum geht, dass eine konkrete Person mit Wissen über die konkrete Situation von dem Hintergrund von komplexen Orientierungen und Geschichten und Analogien eine Entscheidung trifft, sondern dass es halt die eine Regel gibt, die angewendet werden muss, egal, was die Umstände eigentlich sagen. Das heißt, und zwar nicht nur im Sinne, dass Personen das nicht mehr dürfen, sondern dass es diese Beispiele, diese Erläuterungen und so weiter auch teilweise gar nicht mehr gibt.
Nils:[46:40] Ich weiß nicht, ich hatte in meinem Studium, es ist jetzt leider auch schon erschreckend lange her, aber mal irgendwie so auch verschiedene Arten, wie Gesetze ausgelegt werden könnten. Einmal gibt es irgendwie so die Interpretation nach dem Wortlaut, also dem, was da steht. Dann gibt es aber auch die Interpretation nach dem, wie der Gesetzgeber es gemeint haben könnte.
Nils:[46:59] Und es gab noch ein drittes, was mir jetzt gerade entfallen ist. Also das ist so ein bisschen der Versuch, das dann wieder reinzubringen, aber eigentlich ist da diese Regel, dieses Gesetz, das sagt, ja, wenn du mehr verdienst als x, dann musst du. Egal, ob das jetzt in der Situation angemessen ist oder nicht. Oder ob das auch dem Ziel, das das Gesetz mal hatte, noch angemessen ist oder nicht. Es gibt halt diese Regel und die steht da. Und es fehlt im Grunde diese Reichhaltigkeit, diese Fülle an an Erläuterungen, an Beispielen und so weiter, um das anzuwenden. Und was jetzt auch noch dazu kommt, das sagt Destin, aber glaube ich nicht selber, das ist jetzt eher meine Interpretation, dass wir immer mehr auch dahin kommen, dass auch die grundlegende praktische Kompetenz derjenigen, die es anwenden, fehlt. Also dass auch bei immer mehr Quereinstiegen in verschiedene Bereiche oder so, auch diese grundlegende praktische Erfahrung, die einem dann vielleicht doch mal noch ermöglicht, so ein bisschen zu drehen oder eine von der Regel abweichende Entscheidung zu treffen, dass die eben auch immer mehr fehlt. Und deswegen wir da auch Schwierigkeiten haben, weil es eben nicht mehr wirklich eine Brücke gibt zwischen dem Abstrakten und dem Konkreten. Es gibt das Abstrakte und das beherrscht im Grunde alles.
Amanda:[48:11] Und sagt sie, weshalb sie das Gefühl hat, dass das zu dieser Entwicklung gekommen ist? Weil für mich klingt das ein bisschen jetzt auch, insbesondere mit dem Hinblick auf KI, eigentlich, dass das Gegenteil passiert. Also, dass dieser Determinismus aufgeweicht wird und eigentlich einer Blackbox Platz macht, wo wir eben gar nicht mehr genau wissen, wie es am Schluss zu diesem Output kommt. Und klar, wenn man einfach den Output nimmt, dann hat man diese dünne Regel. Man hat irgendeine Aussage oder eben was befolgt wird, ohne den Kontext oder ohne zu wissen, was steckt dahinter. Aber für mich ist das ein bisschen ein Widerspruch. Oder nicht ein Widerspruch, aber ich verstehe nicht ganz, oder ich kann nicht nachvollziehen, wie sie das Gefühl hat, warum das dazu gekommen ist.
Nils:[48:54] Einerseits, ich meine, sie ist Ideenhistorikerin, insofern geht sie natürlich primär davon aus, dass Ideen auf Ideen aufsetzen, sozusagen. Das wird sehr viel mit dieser Idee der Naturwissenschaft, Naturwissenschaftlichkeit, der universellen Gesetze und der Regeln, die immer gelten und so weiter zu tun haben. Pasquinelli macht was ähnliches, bei dem ist es halt Kapitalismus. Ähm, sie redet irgendwo davon auch, dass diese Berechenbarkeit, die eben Regulierung bietet, dass die süchtig macht. Diese Berechenbarkeit und Kontrollierbarkeit, die macht süchtig sozusagen, weil das auf einmal, oh, jetzt kann ich das vorhersehen, jetzt kann ich das berechnen. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Das Thema KI, das ist glaube ich hier noch nicht tief drin, das Buch ist 23 erschienen, also es wird irgendwie 2021, 2021 oder was geschrieben sein, vielleicht auch noch 2022, das wird sie noch nicht tief mitgemacht haben. Ich bin aber tatsächlich da auch eher an dem Punkt, so dieses, der Output ist am Ende eine dünne Regel, die ich im Grunde gar nicht mehr verstehe. Also das ist für mich jetzt eher so der Anknüpfungspunkt, wo auch dieser Punkt, es fehlt die praktische Kompetenz, dann irgendwann einzuschätzen. Was ist denn jetzt dieser Output von diesem KI-System? Taugt der jetzt eigentlich was oder nicht? Dafür muss ich ja erst mal gelernt haben, zu entscheiden, was taugt denn jetzt was oder nicht in dem entsprechenden Kontext, in dem ich bin. Also ist der Werbetext, den er produziert hat, jetzt gut oder schlecht? Dafür muss ich selber wissen, wie gute Werbetexte aussehen.
Nils:[50:20] Also da sehe ich jetzt die Schnittschmelze. Bei der Erstellung, da hast du recht, das ist so ein bisschen blackboxig. Aber das ist ja das Entstehen der anderen dünnen Regeln im Grunde auch. Also ich persönlich weiß jetzt nicht, wie irgendwie die Regel entstanden ist, du musst beim Auto die Kupplung drücken, damit du Gas geben kannst. Ich habe natürlich eine grobe Ahnung von der Mechanik dahinter. aber, Irgendwie ist nehme ich halt so hin, das mache ich halt so.
Amanda:[50:47] Ja, aber findest du nicht, es gibt ja auch diese Regeln, also keine Ahnung, nimm mal den irgendwie kategorischen Imperativ, wo ja, ich sage mal, das Qualitätsmerkmal davon ist, dass so ein komplexes Gebilde dahinter steckt und das runtergebrochen wurde auf eine ganz, ganz dünne Regel eigentlich. Genau. Es gibt wie beides, also das Dünn ohne Hintergrund und Dünn mit viel Hinterbau.
Nils:[51:12] Ja, aber die Frage ist, was ist das für ein Hinterbau? Ist das ein Hinterbau, der sozusagen rechtfertigt? Oder ist das ein Hinterbau, der mir beim Agieren mit dieser Regel hilft?
Amanda:[51:24] Okay, ja.
Nils:[51:24] Und also ich würde jetzt aber auch sagen, sowas ist, das gehört noch eher in die Kategorie der dicken Regeln.
Amanda:[51:30] Ja, okay.
Nils:[51:30] Weil es eben eingebettet ist in ganz langen Ideen, historischen Diskurs und so weiter. Das ist natürlich bei sowas mathematischem einfacher, wo du sagen kannst, okay, wenn ich diese Berechnung von Druck anwende, dann erfahre ich, ob die Wand hält oder nicht.
Amanda:[51:44] Punkt.
Nils:[51:46] Und das ist aber dann eben auch relativ berechenbar und absehbar. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo sie dann auch hin will, dass wir diese dünnen Regeln im Grunde nur haben, dass die nur funktionieren in einer sehr stabilen Welt. In einer Welt, die konstant ist, die berechenbar ist, jetzt sind wir genau bei diesen beiden Welten ganz am Anfang, und dann funktionieren die dünnen Regeln. Also wenn ich die Regulierung habe, dass 50 Gurken in jeder Standardkiste sind, dann reicht es, wenn ich die Standardkisten zähle. Und dann reicht es vielleicht sogar, wenn ich irgendwie das Gewicht der Standardkisten beim Beladen, bevor die Gurken drin waren, hernehme und daraus kann ich berechnen, wie viele Gurken habe ich. Weil ich weiß, die Kisten haben beim Beladen, waren das drei Kilo Kisten, ich weiß, jede Kiste wiegt 300 Gramm, okay, das sind also zehn Kisten, jeder Kiste sind 50 Gurken, ich habe also 500 Gurken. So, das spart mir im Endeffekt das Zählen, wie viele Gurken habe ich hier eigentlich. Aber damit das funktioniert, muss das eben so standardisiert sein. Die Kisten müssen immer das gleiche wiegen, die müssen immer mit 50 Gurken befüllt werden.
Nils:[52:50] Und wir haben Leben in einer Welt, und da bin ich jetzt wieder auch relativ stark bei ihr, die sehr stark auf diese dünnen Regeln angewiesen ist, damit sie noch funktionieren kann. Die aber gleichzeitig einen gewaltigen Aufwand betreibt, um die Welt so stabil und berechenbar zu halten, damit diese dünnen Regeln noch funktionieren. Also dann muss auf einmal eine Behörde eingerichtet werden, die kontrolliert, ob auch wirklich immer 50 Gurken in jeder Standardkiste sind. Das selber ist wieder eine leichte Arbeit, die ist jetzt nicht intellektuell aufwendig oder so, aber sie muss halt gemacht werden. Das ist interessant. Bisschen dieser Spannungsverhältnis, also wir haben im Grunde die Komplexität, das macht sie jetzt wieder, glaube ich, gar nicht so explizit, wir haben im Grunde die Komplexität, wir haben jetzt zwei so dünnen, einfachen Regeln, nach denen wir eine ganze Menge machen können. Dafür haben wir ein ziemliches Konstrukt gebaut, damit die Welt so stabil ist, dass die noch halten. Und das ist halt auch so, könnte man als Argument herziehen, warum wir uns mit so einem gesellschaftlichen, globalen Wandel so schwer tun, weil wir dann eben irgendwie immer mehr wieder lernen müssen, mit diesen dicken Regeln zu arbeiten, mit dieser nicht so berechenbaren, nicht so standardisierten Welt irgendwie zurecht zu kommen und das alles deutlich aufwendiger und, komplexer wieder wird, auch für den Einzelnen. So. Das war eigentlich der Ritt durch das Buch.
Amanda:[54:19] Cool, vielen Dank. Soll ich mich gleich anschließen mit meinen weiterführenden Tipps? Ich fand es sehr spannend. Ich habe den Podcast gehört von Lorraine Dustin in der Sternstunde Philosophie. Das war auch irgendwie Umsbuch. Aber ich finde, sie hat da gar nicht wirklich Bezug genommen auf die Themen, wie du sie jetzt vorgestellt hast. Deswegen finde ich das ganz gut, aber natürlich trotzdem interessant, das Interview mit ihr zu hören. Also das wäre meine erste Empfehlung.
Amanda:[54:56] Bezüglich Folgen von unserem Podcast ist mir Folge 59 in den Sinn gekommen. Da habe ich ein Buch von Roberto Simanowski vorgestellt, Todesalgorithmus. Da geht es eben auch um Algorithmen und was halt die Befolgung oder Nichtbefolgung auch für ethische Konsequenzen hat. Hat natürlich im weitesten Sinne auch mit Regeln zu tun. Dann ein Buch, was ich von Dustin gelesen habe, ist Against Nature. Das hat natürlich auch einige Schnittstellen mit dem, was du jetzt vorgestellt hast. Wie kann Natur interpretiert werden? Was für Konnotationen, Denotationen gibt es? Ich fand das sehr interessant. Ich finde das Thema generell sehr spannend. Kann ich auch sehr empfehlen. Und dann noch zwei Dinge, die mir in den Sinn gekommen sind. Das ist einerseits ein Artikel, Von, ich glaube, das war eben Nömer-Mag, kann das sein? Oder New York Times? Nein, ich glaube, spricht man Nömer oder Noema?
Nils:[55:56] Noema, ich würde es mal Noema nennen, aber ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt.
Amanda:[55:59] Auf jeden Fall ein Artikel, der heißt The Tyranny of Time oder so. Und da ging es eben auch darum, wie Zeit und diese gemessene Zeit eigentlich dazu führt, wie unsere Welt strukturiert wird. Und wie dann auch Personen benachteiligt werden, Dadurch, dass diese Zeit erfunden worden ist.
Amanda:[56:20] Und interessant fand ich auch, dass der Autor da gesagt hat, dass die Erfindung eigentlich auch mit den Mönchen oder das ist aufgekommen in den Klostern, weil diese Ritualisierung des Alltags im Kloster auch dann die Zeit ja strukturiert hat in einem Sinne und dass darauf dann eben auch der Kapitalismus basiert und so weiter. Also es hat wie auch viele Anknüpfungspunkte mit dem, was du jetzt erzählt hast. Und das ist in einem Artikel beschrieben. Und das letzte Buch, das ist Materialfluss, heißt das. Da geht es um die Geschichte von Logistik und aber aus der Perspektive des Stillstands. Also der Untertitel ist eine Geschichte der Logistik an den Orten ihres Stillstandes. Und das ist von Monika Doman geschrieben und ich fand das auch, es ist so ein Buch, was ich einfach gesehen habe und dann reingeguckt, komplett aus der Luft, also ich habe da nicht irgendwie eine Ahnung von, aber es ist mir jetzt in den Sinn gekommen, als du das mit den Gurken so erwähnt hast. Also das ist natürlich auch sehr interessant, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Also wie dann Logistik möglich gemacht worden ist durch Regeln eben und durch Standardisierung und so weiter. Also das ist auch ganz, ganz nett.
Nils:[57:33] Und da gab es auch noch irgendein Buch, glaube ich, zur Geschichte des Shipping-Containers, des Standard-Containers.
Amanda:[57:38] Ja, genau.
Nils:[57:38] Das auch in diese Richtung geht.
Amanda:[57:40] Ja, da habe ich auch einen guten Artikel zu. Ich glaube, den habe ich schon mal irgendwo erwähnt. Kann ich sonst auch noch verlinken.
Nils:[57:45] Gerne. Cool, danke dir. Ha, du hast sogar eine Episode noch dran, die ich mir nicht vorher ausgesucht hatte, sehr gut. Ich habe tatsächlich primär alte Episoden von uns jetzt erstmal mitgebracht. Erstmal, weil ich einfach die Bezug schon mehrfach gemacht habe, auf jeden Fall die Unterwerfung von Philipp Blom, meine letzte Episode, das war Nummer 81. Einfach weil da diese Idee erstmal dieser Widersprüchlichkeiten die irgendwie durch Religion vor allen Dingen überdeckt werden aber vor allen Dingen auch, weil ja dieses Kontrollieren der Welt dieses Berechenbarmachen der Welt das setzt ja im Grunde deren Unterwerfung voraus und das macht Philipp Blom eigentlich sehr schön in seinem Buch deutlich und weil es wirklich irgendwie als Trilogie wunderbar funktioniert und gar nicht von mir so geplant war dann eben auch noch The Eye of the Master von Matteo Pasquinelli, das ist glaube ich gerade auch auf Deutsch erschienen. Das Auge des Herren heißt es, glaube ich, tatsächlich da. Das wird vermutlich unsere Episode 91 werden, aber die gibt es halt noch nicht. An Episoden, die es schon gibt, haben wir natürlich dann auch auf jeden Fall die Episode zur Objektivität von Lorraine Destin und Peter Gellison. Auch ein anderes Buch von der Autorin. Ich finde sowieso, also Lorraine Destin ist gerade so eine unserer klarsten Denkerinnen zum Verhältnis Wissenschaft, Gesellschaft.
Nils:[59:03] Was passiert da eigentlich? was ist da eigentlich passiert in den letzten Jahrzehnten. Auf jeden Fall immer empfehlenswert zu lesen und zu hören, wenn sie euch über den Weg läuft. Dann habe ich noch von Ian Stewart und Jack Cohen unsere Episode 49, Collapse of Chaos. Einfach, weil es eben da auch dieses Konstanthalten sozusagen der Welt und der Versuch, Chaos irgendwie zu kontrollieren und zu steuern im Grunde geht.
Nils:[59:32] Dann habe ich noch unsere Episode 20 von Thomas Bauer, die Vereindeutigung der Welt. Da kommt genau dieser Gedanke her, den ich vorhin formuliert habe mit Religionen, die sozusagen diese Elemente der dicken Regelsysteme jetzt heutzutage oft als dünne Regeln missverstehen und dadurch irgendwie in so einen etwas schrägen Blick auf die Welt im Grunde verfallen. Und dann noch ein Buch, was wir noch nicht vorgestellt haben, was ich jetzt aber eigentlich auch mal endlich lesen sollte. Das ist von Stefan Kühl, ein Organisationssoziologe, gebrauchbare Illegalität. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein oder zwei Mal hier empfohlen. Da geht es im Grunde darum, dass Organisationen, also meistens Unternehmen, aber im Grunde auch Behörden oder irgendwelche NGOs oder so, dass die immer auch, dass die sich nie darauf setzen sollten, dass immer alle Leute alle Regeln einhalten. Das Ganze im Grunde nur funktionieren kann, wenn auch mal Leute sich gezielt und an den richtigen Stellen nicht an Regeln halten. Deswegen brauchbare Illegalität, das ist, glaube ich, sehr, sehr anschlussfähig eben an diesen Gedanken der dünnen Regeln, die nicht mehr in der Lage sind, die Welt irgendwie so zu erfassen, wie die Komplexität es eigentlich erfordern würde.
Nils:[1:00:49] Genau, ihr könnt auch ein paar meiner Gedanken zu dem Buch, könnt ihr auch nachlesen auf meiner anderen Webseite, auf weltenkreuzer.de, da habe ich auch ein paar sechs oder sieben Lesenotizen zu dem Buch schon platziert, die stelle ich euch auch mal in den Chat, den Link zumindest zur Übersicht, könnt ihr da auch einmal reingucken. Genau, jetzt überlege ich gerade noch, ob mir noch irgendwas spontan einfällt, aber gerade erst mal nicht.
Amanda:[1:01:18] Sehr schön. Sollte ich den Abschluss machen,
Nils:[1:01:20] Nils? Sehr gerne.
Amanda:[1:01:26] Ich bedanke mich fürs Zuhören. Man findet uns im Internet unter zwischenzweidecken.de. Das ist unsere Hauptwebseite. Wir sind auch auf den sozialen Medien zu finden unter addeckeln, also das letzte Wort mit dem Ad auf x auf Twitter. Und wir sind auch auf mastodon unter social, Moment.
Nils:[1:01:52] Atzzzd.podcasts.social.
Amanda:[1:01:54] Genau, vielen Dank. falls ihr uns hört auf allen wir sind auf allen gängigen Podcasts Plattformen auch zu hören und freuen uns auch natürlich über Bewertungen oder Sternchen, je nachdem wo ihr uns runterlädt oder hört und ja, bedanken wir uns fürs Zuhören und ich bedanke mich fürs Vorstellen, Nils Wir hören uns in den nächsten Folgen Macht
Nils:[1:02:17] Es gut, tschüss.
Music:[1:02:18] Music
Der Beitrag 086 – „Regeln“ von Lorraine Daston erschien zuerst auf Zwischen zwei Deckeln.

Dec 26, 2024 • 1h 41min
085 – Jahresabschluss 2024
Im Rückblick auf das Jahr werden spannende Buchempfehlungen zur kritischen Auseinandersetzung mit Statistiken vorgestellt. Die Gefahren einer möglichen Regierungsbeteiligung der AfD werden analysiert, ebenso wie die Herausforderungen für Künstler in der Ära der Algorithmen. Der Einfluss von Streaming-Diensten auf die Musiklandschaft wird diskutiert, während der Film 'Die Fotografin' die Lebensgeschichte und die Herausforderungen von Frauen im Krieg beleuchtet. Abschließend gibt es interessante Einblicke in die Diskussionskultur und die Bedeutung des Chaos Communications Kongresses.

Dec 5, 2024 • 1h 7min
084 – „Gutes Geld“ von Philippa Sigl-Glöckner
Philippa Sigl-Glöckner fordert eine neue Finanzpolitik für Deutschland und Europa, die über Schuldenquoten hinausblickt. Sie diskutiert die Bedeutung individueller Freiheiten und die Herausforderungen der aktuellen Arbeitsmarktsituation. Die Probleme von Niedriglöhnen und sozialen Ungerechtigkeiten werden thematisiert, ebenso wie die Notwendigkeit von Investitionen in Bildung und Infrastruktur. Zudem wird das Ungleichgewicht zwischen Konsumgütern und essenziellen Dienstleistungen beleuchtet, während die Modern Monetary Theory in den aktuellen wirtschaftlichen Diskurs eingebracht wird.

Nov 14, 2024 • 1h 20min
083 – "Im Grunde gut" von Rutger Bregman
Rutger Bregman zeigt in seinem Buch „Im Grunde gut“, dass Menschen von Natur aus kooperativ und gut sind und plädiert dafür, den weitverbreiteten Pessimismus über das Böse im Menschen zu überdenken. Bregman widerlegt Studien und Geschichten, die angeblich das Gegenteil beweisen und erzählt von Ereignissen, die auf Mitgefühl und Solidarität basieren – auch unter schwierigsten Bedingungen. Dieses positive Menschenbild ist nicht nur realistisch, sondern kann uns auch anleiten, unser Zusammenleben und unsere Institutionen danach auszurichten und so eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen.
Shownotes
„Im Grunde gut“ von Rutger Bregman (Verlagswebseite)
Nocebo (DocCheck)
„Weltbilder und Weltordnung in den Internationalen Beziehungen“ aus der APuZ „Weltbilder“
„Vom wilden Silberfuchs zum zahmen Haustier“ (DLF Nova)
„We met the world’s first domesticated foxes“ (Verge Science auf Youtube)
„Warum sind Hunde so freundlich?“ (nationalgeographic.de)
Williams-Beuren-Syndrom (DocCheck)
bzgl. Interbellum „Zwischenkriegszeit“ (Wikipedia)
„Milgram-Experiment“ (Wikipedia)
Nudging (Gabler Wirtschaftslexikon)
Wyver, Shirley, et al. „Safe outdoor play for young children: Paradoxes and consequences.“ Paper code 2071 (2010).
ZZD020: „Die Vereindeutigung der Welt“ von Thomas Bauer
ZZD039: „Vom Ende des Gemeinwohls“ von Michael Sandel
ZZD053: „Zukunft als Katastrophe“ von Eva Horn
ZZD063: „Epistemische Ungerechtigkeit“ von Miranda Fricker
ZZD075: “Weggesperrt” von Thomas Galli
„Nach der Flut das Feuer“ von James Baldwin (Verlagswebseite)
„Selbstfreundschaft“ von Wilhelm Schmid (Verlagswebseite)
„Die Macht der Menschenbilder“ von Michael Zichy (Verlagswebseite)
„Künstliche Intelligenz und Empathie“ von Catrin Misselhorn (Verlagswebseite)
„Jenseits von Markt und Staat“ von Elinor Ostrom (Verlagswebseite)
„Nudge“ von Richard H. Thaler und Cass R. Sunstein (Verlagswebseite)
„Against Elections“ von David Van Reybrouck (Verlagswebseite)
Rutger Bregman in der Sternstunde Philosophie (srf.ch)
Roland Reichenbach in der Sternstunde Philosophie (srf.ch)
Quellen
Intro und Outro der Episode stammen aus dem Stück Maxixe von Agustin Barrios Mangore, eingespielt von Edson Lopes (CC-BY).
Das Umblättern zwischen den Teilen des Podcasts kommt hingegen von hoerspielbox.de.
Zwischen zwei Deckeln findest du auch im sozialen Medium deiner Wahl: Mastodon und Bluesky.
Transkript (automatisch erstellt)
Music:[0:00] Music
Christoph:[0:15] Eurem Sachbuch-Podcast und wir sind mittlerweile bei Folge 83 angekommen. Mein Name ist Christoph und ich habe heute Amanda mit dabei.
Amanda:[0:24] Hallo.
Christoph:[0:25] Ja, wir haben gerade eine halbe Stunde technische Probleme gehabt, bevor wir jetzt aufnehmen konnten. Von daher freue ich mich sehr darüber, dass es jetzt klappt. Amanda, womit beschäftigst du dich gerade? Was treibt dich um?
Amanda:[0:37] Abgesehen von den technischen Problemen, meinst du? Ja. Nee, ich, ja, büchertechnisch, ich bin gerade umgezogen. Das heißt, ich komme weniger zum Bücherlesen als zum Bücherstapeln. Das ist auch das Einzige, was uns noch fehlt, ist ein Bücherregal. Ich habe vor kurzem mal das Buch Altern von Elke Heidenreich gelesen. Ich weiß nicht, ob du das war, ist bei uns, liegt das überall auf. Und darin sagt sie einen Satz, den ich ganz gut fand. Oder etwas, was sie bereut hat. Sie bereut sonst eigentlich nicht so viel von ihrem Leben. Was ja schön ist, aber etwas, sagte sie, was sie anders machen würde, ist sich schon von zu Beginn oder als junge Frau bereits ein sinnvolles Bücherregal zu kaufen für all ihre Bücher und nicht immer irgendwelche Ikea-Regale mitzuziehen, die dann so halb auseinanderfallen. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und mir deswegen auch ein schönes Bücherregal jetzt gekauft für die neue Wohnung, aber das ist noch nicht da, deswegen stapeln sich die Bücher bei mir einfach neben mir hier. Was auch cool ist, weil man sieht mal wieder Dinge, die man oder Bücher, die man sonst nicht vergessen hatte. Und das heißt, mein Lesestapel kann sich aus bereits vorhandenen Büchern neu zusammenstellen. Ah ja, sehr gut.
Christoph:[1:55] Ja, ich habe vor Jahren schon angefangen, Bücher immer wieder auch rigoros auszusortieren. Deswegen habe ich gar nicht so viele Bücher. Wir haben hier im Arbeitszimmer einmal so ein Raumtrenner-Bücherregal. Und das habe ich ziemlich okkupiert mit vor allen Dingen sozialwissenschaftlicher Literatur, da ist so ein bisschen die Fachabteilung. Und dann gibt es noch so ein repräsentatives Bücherregal, wo sich ein paar Sachen finden, aber sonst ist ja echt, wir haben noch ein drittes dann, aber hier sind einfach gar nicht so viele Bücher in der Wohnung, weil ich immer wieder aussortiere. Zum Beispiel auch für diesen Podcast ich auch nur noch digital lese, weil ich die Notizverwaltung viel, viel angenehmer finde, wenn ich darauf digital zugreifen kann. Deswegen ist das hier gar nicht so viel.
Amanda:[2:39] Ich mache es genau umgekehrt. Ich kaufe mir die Bücher, die ich im Podcast vorstelle.
Christoph:[2:43] Ja, ihr kaufen tue ich sie auch.
Amanda:[2:45] Ja, also in Papierform meine ich.
Christoph:[2:49] Naja, habe ich auch lange so gemacht. Ich habe lange auch alle meine Sachbücher nur gedruckt gelesen, aber bin irgendwie vor ein paar Jahren davon weg und ich glaube, es funktioniert ganz gut für mich. Ich bin gerade am überlegen, ob ich so einen, ich kaufe meine Bücher ja bei kleinen Buchhandlungen, meine digitalen und lese sie dann auf einem Kindle.
Amanda:[3:06] Ah, kannst du das, okay.
Christoph:[3:07] Ja, das geht. Und jetzt bin ich gerade am überlegen, ob ich mir doch nochmal ein Kindescribe kaufe. Also dieses Modell mit dem Stift, weil ich da ein bisschen Lust drauf habe, weil die natürlich auch eine Notizbuchfunktion haben und so. Und genau, es ist so ein bisschen, damit habe ich mich vor ein paar Wochen rumgeärgert oder mich dafür interessiert, mal gucken, aber ich habe es jetzt erstmal wieder weg von mir geschoben. Ja genau, und ansonsten beschäftige ich mich momentan einfach ehrlicherweise relativ viel mit Arbeitsthemen, also viel Transformation in Niedersachsen und also sozial-ökologische und gerechte Transformation hier bei uns im Bundesland, weil das ja so mein Arbeitsfeld ist. Und wir hatten BetriebsrätInnen- und PersonalrätInnenkonferenz in Niedersachsen am Montag. Also wir nehmen jetzt gerade an einem Mittwoch auf, also nee, an einem Freitag. Ich bin völlig verwirrt. Also Anfang der Woche hatten wir das und dann war ich danach auf einer Fortbildung zum Thema, auf der ich selber auch Input gegeben habe. Und genau, mit solchen Dingen beschäftige ich mich gerade.
Christoph:[4:08] Ja, damit können wir, glaube ich, eigentlich schon zum heutigen Buch kommen. Du hast uns mitgebracht, im Grunde gut, von Rüdger Brechmann, glaube ich, so oder so ähnlich wird er ausgesprochen. Das war sicherlich nicht richtig, aber ich finde es sehr witzig. Treue Hörer in dieses Podcasts wissen vermutlich, dass ich die 29er ganz gerne höre und die haben im Grunde gut auch dort besprochen und haben dann das Feedback einer niederländischen Hörerin bekommen oder einer Hörerin, die auch niederländische Wurzeln hat, dass sie es gnadenlos falsch ausgesprochen haben und sie hat es ihnen dann einmal richtig eingesprochen und immer wenn sie Rüdger Brächmann jetzt zitieren oder referenzieren, haben sie so einen Button, bei der die Hörerin einfach einspringt und das einmal ins Mikro sagt quasi. Naja, genau, das hast du uns mitgebracht. Ich bin ganz gespannt auf deine Kurzzusammenfassung. Ach, das Buch ist 2021 erschienen und 2017 auf Englisch im Original.
Amanda:[5:10] Rutger Prägmann plädiert in seinem Buch im Grunde gut für ein neues Menschenbild, welches darauf basiert, dass der Mensch eben grundsätzlich gut ist. In verschiedenen Erzählungen über unterschiedliche Lebensbereiche untermauert er sein Argument und präsentiert so eine alternative Sichtweise auf die Natur des Menschen.
Christoph:[5:32] Und inwiefern ist das eine alternative Sichtweise? Ich habe immer das Gefühl gehabt, also ohne, dass ich jetzt, ich habe keinen philosophischen Background, aber ich dachte immer, es ist so eine der zentralen Debatten, ob der Mensch nun im Grunde gut oder im Grunde böse oder gar nichts von beidem ist. Also inwiefern ist das eine Alternative? Also das unterstellt ja erstmal, dass Menschen, also das vorherrscht, dass der Mensch böse sei oder indifferent oder was auch immer.
Amanda:[5:54] Ja gut, also das Wort Alternative habe ich jetzt natürlich dazu genommen. Ich glaube, er meint schon oder er zeigt schon, dass wir oder viele unserer Grundannahmen, auch wenn es beispielsweise um Institutionen geht, darauf basieren, dass wir eigentlich eben nicht gut sind. Also, dass wir egoistisch sind oder das ganze Wirtschaftssystem mit diesem Homo economicus, das basiert ja eigentlich schon auf einer Annahme, dass der Mensch ihm nicht eigentlich gut ist oder dass man ihn zumindest im Zaum halten muss, auch wenn es zum Recht geht beispielsweise.
Christoph:[6:29] Zumindest auf den eigenen Vorteil bedacht, also das zumindest. Und dann ist die Frage, was die Theorie dahinter ist, ob das dann nicht allen zugute kommt, aber da wäre ich auch eher kritisch.
Amanda:[6:43] Ja, es ist ein Buch, was jetzt theoretisch, ich sag mal nicht wahnsinnig, also es geht jetzt nicht um die Theorie per se, sondern es geht darum, dass er einfach viele Erzählungen präsentiert und mit gewissen Mythen aufräumt und auch ein bisschen investigativen Journalismus betreibt und so eigentlich noch ganz spannende Dinge ans Licht fördert. Also es ist eben, es liest sich sehr, sehr gut. Es sind 18 Kapitel, die ganz unterschiedliche Geschichten oder Erzählungen dann aufgreifen. Und das Buch beginnt. Eigentlich mit dieser Meinung, also es kommt immer mal wieder, kommt Krieg, kommen Kriege natürlich darin vor und der Krieg, mit dem er beginnt, da geht es um die Luftangriffe, ich glaube es war der Zweite Weltkrieg, Luftangriffe da und wie man damit eigentlich versucht hat, die Moral der Bevölkerung zu brechen. Also dass das wie das Mittel der Wahl war und dass das gar nicht funktioniert hat. Also dass man dann eigentlich mit Psychologinnen und anderen Berichten eigentlich dem diametral entgegengesetzt war. Also die Leute haben sich geholfen, also man hat sogar irgendwann darüber gewitzelt, so in Großbritannien, wenn es blitzi war plötzlich.
Amanda:[8:07] Also das Wetter sozusagen, wenn da viele Bomben gefallen sind und dass also diese Massenpanik eigentlich gar nicht so eingetreten ist, wie man sich das erhofft hat von diesen Luftangriffen.
Christoph:[8:20] Also im Sinne von, es bildet sich dann Solidarität zwischen den Menschen aus?
Amanda:[8:24] Genau, genau. Und das kommt auch später noch im Buch, dass es was spannend daran ist, ist, dass eigentlich die Personen an der Macht das nicht wahrhaben wollen. Also das ist wie, eigentlich spricht alles dagegen. Man hätte eigentlich auch Fakten, um das zu zeigen und zu widerlegen. Aber diejenigen, die an der Macht sind, die sind irgendwie immun dafür und haben halt immer gesagt, ja, es braucht eben noch härtere oder noch mehr Luftangriffe und so weiter.
Amanda:[8:59] Und er, dieses, ja diese, ich sag mal diese Massenpanik, ist wohl etwas, was, wovon viele Leute ausgehen. Also es gibt so ein Gedankenexperiment, wo ein Flugzeug eine Notlandung machen muss und in Szenario A, in der Welt A, helfen sich alle einander, sind ruhig, geben einander den Vortritt und so weiter. Und auf der Welt B, in Szenario B, verfallen alle in Panik und jeder versucht schnellstmöglich zum Ausgang zu rennen und übertrampeln sich und so weiter. Und das wurde dann in Umfragen den Menschen oder verschiedenen Personen präsentiert und offenbar glauben 97 Prozent, jetzt in einer von dieser Umfragen, glaubten an Szenario B. Also, dass Menschen wirklich sozusagen das Schlimmste dann zutage fördern, wenn sie in so einer Notsituation sind.
Christoph:[9:56] Ja, das ist sehr interessant. Weil sie dann ja offenbar, also es klingt so, als wäre das nicht das, was eintritt. Aber woher kommt die eigene Annahme? Weil wenn das nicht der Fall ist, dann können sie ja nicht von sich selbst ausgehen. Also sie müssten ja denken, alle anderen werden sich so verhalten, aber ich mich vielleicht nicht.
Amanda:[10:15] Genau. Und das nennt er eigentlich einen Nocebo-Effekt. Also man kennt Placebo, dass etwas nützt weil man daran glaubt also das gibt natürlich noch andere gründen warum es nützt aber das ist eine erklärung und das nocebo ist das das andere also dass man das ist wie ein geschadet weil man daran glaubt obwohl man gar nicht unbedingt weiß warum man daran glaubt.
Amanda:[10:43] Und er sagt dann, ja, woher kommt das überhaupt? Also es ist so ein bisschen, kommt das zustande, dieses Gemeine-Welt-Syndrom? Er sagt das wegen den Nachrichten. Also wir haben wie einen Negativity-Bias. Das heißt, schlechte Dinge sind zwar seltener grundsätzlich, aber stärker. Also sie wiegen stärker auf. und wir haben einen Availability Bias, das heißt etwas, wir haben das Gefühl, dass gewisse Dinge öfter auftreten, als sie tatsächlich auftreten. Und in Kombination mit schlechten Dingen ist das natürlich so ein Verstärker und Nachrichten sind eigentlich das Hauptmedium, was das zutage fördert. Also man hört viele Dinge, man hört prinzipiell eigentlich nur schlechte Dinge in den Nachrichten und diese bleiben dann eher in unseren Köpfen haften und wirken dann eben so als Nocebo, also als, ja, wir haben das Gefühl, alles ist schlecht, obwohl eigentlich das gar nicht der Fall ist.
Christoph:[11:49] Ja, finde ich plausibel zumindest erst einmal. Also ich habe ja schon ein paar Mal hier im Podcast erzählt, dass ich relativ viel politische Psychologie zum Thema Terrorismus, Nationalismus, religiöser Wahn und so weiter hatte und dagegen ging es offensichtlich, waren auch mehrere Seminare zum Thema Terrorismus dabei. Und da war das auch immer wieder Thema, diese ganze Fehlwahrnehmung der faktischen Bedrohung im Vergleich zu der Menge an Prävention und Angst und wie häufig das vorgeschobenes Argument ist, um irgendwelche Dinge politisch durchzusetzen, war da auch viel Thema. Das steht eigentlich in überhaupt keinem Verhältnis, wenn man sich Verkehrstod oder sowas anguckt.
Amanda:[12:35] Ja, ja. Ja, und ich finde noch interessant, weil es ja nicht unbedingt, also man kann das ja auch auslegen als Strategie, also wenn man das nutzt, um absichtlich auch falsch, falsche Informationen zu verbreiten. Aber ja, es ist halt ein Problem, wenn man wirklich glaubt, dass es einfach so ist oder dass Menschen so sind, obwohl eigentlich dafür, also gar nicht so viel dafür spricht. Und was ich dann auch spannend fand ist dass also es ist sehr also es gibt so die die realistische theorie nicht zum beispiel in den politikwissenschaften und ich habe mich ich habe mir da nie groß was dabei überlegt man ja man argumentiert dann halt und dann hat man realismus und neorealismus und was auch immer dass das also warum sollte das eine realistische theorie sein weißt du und er sagt halt auch dieses negative Menschenbild.
Christoph:[13:30] Also so zu denken, mit so einem Menschenbild oder mit so einem Weltverständnis ranzugehen, läuft unter Realismus.
Amanda:[13:35] Genau. Also Realismus kann man ja auf verschiedene Arten und Weisen verstehen und dass dieses negative Menschenbild per se ein realistisches Menschenbild sein muss, macht eigentlich gar keinen Sinn.
Christoph:[13:47] Ja, das stimmt.
Amanda:[13:49] Also der Begriff wird hier auch einfach verwendet, ohne dass das eben unbedingt realistisch ist. Und das ist halt auch, was er dann sagt. Also er spricht sich eben für ein neues realistisches Menschenbild aus, was eben nicht diesem Negativen zugrunde liegt. Er macht dann so die erste Geschichte, wo er auch wirklich investigativ tätig ist. Da geht es um eigentlich die Erzählung, die beginnt mit dem Buch von William Golding, Der Herr der Fliegen. Kennst du das?
Christoph:[14:24] Nur vom Namen, also ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe es nie gelesen.
Amanda:[14:29] Da geht es um, es ist ein Kinderbuch oder ein Buch, wo das von Kindern handelt, welche auf einer einsamen Insel gestrandet sind und dann dort mehrere Monate sind. Und ja, am Ende drei davon sterben und werden irgendwie krank und es herrscht irgendwie Krieg aller gegen alle unter diesen Kindern. Und es ist so ein Beispiel halt, wie Kinder wirklich sind, sage ich mal. Oder wurde dafür genommen. Oder wenn man die auf sich alleine gestellt sind, was sie dann veranstalten. Ich glaube, er hat sogar den Nobelpreis gewonnen für realistische Darstellung von dem menschlichen Verhalten. Oder so mit dieser Begründung. Auf jeden Fall versucht dann Brechmann eigentlich das irgendwie nachzuvollziehen, ob es dafür wirklich Beispiele gibt und stößt dann auf eine Geschichte von sechs Jungen, die in Tonga, das ist im Pazifik.
Amanda:[15:36] Dort auf einer, ich glaube, auf einer Schule waren, eine Art Internat und das war ihnen mega langweilig dort und dann haben die halt beschlossen, dass die sich auf den Weg machen in einem selbst gewasserten Kanu, waren auch total unvorbereitet, hatten kein Wasser dabei und irgendwie nur zwei Kokosnüsse und so weiter und sind dann in einen Sturm gekommen und schließlich.
Amanda:[15:59] Glücklicherweise auf einer unbewohnten Insel gelandet auf Atta und dort gestrandet und waren dann dort mehrere Monate dort. Und irgendwann kam halt eben ein Schiff vorbei, also jemand, der sie dort gefunden hat und konnte seinen Augen gar nicht trauen. Also die hatten dort eine Kommune sozusagen eingerichtet. Die hatten ein Fitnesscenter, die haben sie abgesprochen, dass man immer Wache hält. Die hatten ein Feuer, konnten sie entfachen. Die hatten Hühnerställe. Also die haben sich mega gut organisiert. Und hatten sich auch geschworen oder hatten vereinbart, als sie dort gelandet sind, dass sie sich nicht streiten. Und es gab dann auch wie so Schlichtungsmechanismen. Also wenn jemand irgendwie nicht gut drauf war, dann wurde er auf die andere Seite der Insel. Und dann hat man ihn wieder zurückgeholt und geschaut, wie es jetzt klappt. Also es ist wie eigentlich das komplette Gegenteil von diesem Buch, der Herr der Fliegen. Von diesem Buch und ja, zeigt halt eben, dass, man sich natürlich Geschichten schon ausdenken kann, wie der Mensch wirklich ist, aber das heißt noch lange nicht, dass wenn das eintritt, dass das dann auch wirklich so passiert. Ja.
Amanda:[17:17] Er macht dann im nächsten Kapitel einen Ausflug zum, es geht dann um den Homo Papi, also Papi im Sinne von Welpen, also der Homo Welpe eigentlich. Und wie wir Menschen eigentlich auch, ich sag mal, eine domestizierte Form sind von früher. Also ich sage mal, wenn man jetzt klassischerweise den Neandertaler als Beispiel nimmt, sind wir eigentlich eine domestizierte Form davon. Und es gibt wohl auch ein sehr interessantes Experiment, das wurde in Russland gemacht mit Silberfüchsen. Und Silberfüchse sind ziemlich aggressive Tiere offensichtlich, also nicht einfach so domestizierbar und es gab ein Experiment, das dann darauf abzielte, dass man einfach die freundlichsten Tiere selektiert hat und diese hat man dann weitergezüchtet. Also es ging nicht darum, irgendwie, wie die ausgesehen haben und so weiter, sondern einfach die, die haben, ich sag mal, wenn sie die Hand, die dich am wenigsten gebissen haben, so, die wurden dann selektiert und weiter.
Christoph:[18:29] Es ist ein großes, also ich glaube, ich kenne das Experiment. Du kennst das? Ja, ich glaube, es läuft auch schon seit Jahrzehnten,
Amanda:[18:35] Um ehrlich zu sein. Genau, genau. Ich laufe das immer noch weiter sogar.
Christoph:[18:37] Das weiß ich nicht genau, aber ich habe vor ein paar Jahren ein relativ ausführliches YouTube-Video, ich weiß gar nicht wo, gesehen. Genau, und so wie ich das im Kopf habe, geht es ja auch darum, die Domestifizierung von Wildtieren einfach nochmal nachzuspielen. Also im Sinne von, was haben wir eigentlich mit dem Wolf gemacht? Genau, und ich glaube, für viel Geld, aber ich glaube, man kann die mittlerweile auch als Haustiere kaufen von denen. Also das war natürlich vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs in der jetzigen Form. Aber ja, ich gucke mal, ob ich dazu was finde. Irgendwann war das mal so ein Rabbit Hole, in das ich auf jeden Fall reingestürzt bin. Vielleicht finde ich von damals noch Sachen wieder. Ja, total spannend.
Amanda:[19:16] Ja, also spannend ist dann auch, was damit passiert ist. Also klar, die wurden dann insgesamt natürlich viel freundlicher, weil da wurden die ja auch so selektiert. Aber was interessant war, ist schon nach wenigen Generationen haben die Tiere auch begonnen, anders auszusehen. Also die haben zum Beispiel plötzlich oder andere Verhaltensweisen zu zeigen, die haben plötzlich mit dem Schwanz gewedelt, was Füchse sonst nicht machen. Oder die haben hängende Ohren gekriegt. Also solche Dinge, die wir von Hunden kennen, zum Beispiel jetzt im Vergleich zu den Füchsen und ganz generell ist eigentlich die Theorie, dass dadurch, also dass man nie ein kindlicheres Aussehen annimmt. Und interessant ist natürlich, dass die ja gar nicht dafür selektiert worden sind, sondern ausschließlich der Freundlichkeit wegen und, Das könnte man natürlich auch bei den Menschen dann heranziehen, oder? Also wenn man jetzt zum Beispiel die Gesichtszüge von uns mit denen des Neandertalers vergleicht, dann sind wir auch kindlicher eigentlich vom Gesicht jetzt zum Beispiel. Und dass wir eigentlich uns selber so in einer Art und Weise, ist es domestiziert und domestifiziert haben. Und so eigentlich das Survival of the Friendless hat am Ende gewonnen.
Christoph:[20:37] Ja, dazu noch einen Einwurf, weil ich das beim Thema Domestizierung von Hunden ganz spannend finde. Es gibt eine Studie, also ich bin jetzt gerade bei NationalGeographic.de aus Science Advances, da geht es um die Genstruktur von Hunden. Und genau, es gibt Hunde, die tragen zwei Gene in sich und die, also zwei Gene fehlen, glaube ich, oder haben Varianten. Und bei Menschen verursachen die gleichen Gene, die dann fehlen, das sogenannte Williams-Boyron-Syndrom. Es gibt so elfenhafte Gesichtszüge dann bei Menschen und kognitive Schwierigkeiten und eine Tendenz, jede Person zu lieben und ganz freundlich zu sein zu anderen Menschen. Also da ist ein bisschen die Frage, ob wir mit Hunden auch so gut klarkommen, weil wir denen quasi eine genetische Macke reingezüchtet haben eigentlich.
Amanda:[21:33] Spannend, okay.
Christoph:[21:35] Aber genau, findet ihr in den Shownotes dann natürlich.
Amanda:[21:39] Ja, das ist Survival of the Friendlist, was auch noch interessant ist, dass die dann auch, die haben dann Intelligenztests auch mit den Füchsen gemacht und die Freundlichen sind auch intelligenter.
Christoph:[21:53] Oh, das finde ich spannend.
Amanda:[21:55] Also diese, was alles damit eine hergeht mit dieser Lektion, wenn man sich nur auf Freundlichkeit bezieht, ist eigentlich ganz spannend. Also das Aussehen, aber eben auch Intelligenz kann durchaus hier mit betroffen sein in diesen Genen. Ja, das ist so, dass sein Ausflug zu diesem wie wir vielleicht dazu geworden sind oder so aussehen, wie wir aussehen und trotzdem, ich sag mal, gegen den Neandertaler gewonnen haben, evolutionstechnisch.
Amanda:[22:29] Und weiter geht es dann wieder mit Kriegsgeschichten und er zitiert dann, Einen Colonel, Colonel Marshall, der eigentlich herausgefunden hat, also es ging dann auch um, ich glaube es war wieder der Zweite Weltkrieg, ich habe mir das nicht notiert, gesehen hat, dass seine Soldaten einfach nicht schießen. Also es ist wie so, man hatte da Niederlagen und so weiter und das wurde früher wohl immer irgendwie analysiert und er ist dann irgendwann dazu übergetreten, die Personen einfach zu interviewen und jeder konnte einfach sagen, was das Problem ist und dann hat sich wirklich herausgestellt, dass die meisten einfach nicht schießen wollen. Und das ist offenbar gar nicht so selten. Man hat auch in anderen Kriegen gesehen, dass zum Beispiel Gewehre zum Teil zwei- oder dreifach geladen wurden. Einfach, weil was macht man, wenn man nicht schießen will? Ja, dann lädt man das Gewehr halt eben nochmal. So, das ist wie, eigentlich hat der Mensch eine sehr große Aversion auf andere Menschen zu schießen.
Christoph:[23:40] Also es ist jetzt so ein bisschen Halbwissen, dass ich einen streue, aber ich meine, es ist auch so, dass quasi man immer wieder feststellt, dass quasi zu viel Munition für die erzielten Treffer genutzt werden, also auch wenn man Fehlschüsse und so einrechnet, im Sinne von Leute schießen absichtlich daneben. Das habe ich zumindest auch mal gehört. Mal gucken, ob ich dafür eine Quelle finde, das wird spannend.
Amanda:[24:02] Ja, er zitiert das auch irgendwo, dass sie gesagt haben oder dass Soldaten gesagt haben, ja, wenn ihr uns befiehlt oder wenn wir den Befehl erhalten, dann schießen wir einfach daneben oder wir schießen hoch.
Christoph:[24:14] Ja, guck, das ist dann ja das.
Amanda:[24:17] Also eben, das ist eigentlich überhaupt nicht, ja, das ist überhaupt nicht das, was Menschen eigentlich machen wollen. Das ist ja auch sehr beruhigend zu wissen, dass man das nicht unbedingt gut findet. Er sagt dann auch ganz generell, es gibt eigentlich sehr wenig archäologische Beweise für Krieg generell. Also klar, wir haben jetzt in den letzten Jahrhunderten natürlich Geschichte, Geschichtsschreibung, die uns die Kriege schon auch darlegen. Und er sagt hier, auch hier, also wenn er von den Nachrichten spricht, welche so die negativen Informationen verbreitet, dann ist es bei Büchern genauso oder es ist wie so die Geschichte von einer friedlichen Zeit wird Interbellum genannt oder also die Zeit zwischen den Kriegen. Und das macht natürlich auch den Eindruck, dass man eigentlich, dass es überall die ganze Zeit nur Krieg gab. Was durchaus auch stimmt, insbesondere wenn man es mit heute vergleicht. Also wir haben heute nicht sehr viel weniger Krieg, auch wenn uns das überhaupt nicht so vorkommt. Und natürlich auch, ja. Und wir natürlich auch einen ganz anderen Fokus auf gewisse Weltregionen heute haben oder in unserem Breitenkran haben.
Amanda:[25:27] Deswegen ist es eigentlich interessant, dass er sagt, ganz früher, ja, es gibt eigentlich nicht viele Beweise, dass man sich bekriegt hat. Auch wenn man wirklich ganz zurückgeht, die Höhlenmalerei, also da werden meistens, werden da Jagdszenen abgebildet oder so. Also selten irgendwie Gewalt zwischen den Menschen oder gar nicht.
Christoph:[25:47] Ja, auch ein spannender Hinweis. Ich finde auch die Erzählung von, naja, Krieg war eigentlich Dauerzustand, ist sehr omnipräsent. Ich meine, wir haben das ja auch, also gerade hier in Europa, die Ukraine und den Krimkrieg und alles, was dazu gehört, ausgeklammert. Und auch die Balkankriege werden dabei ausgeklammert, aber trotzdem gibt es ja zumindest hier in der Europäischen Union immer die Erzählung von, naja, dank der haben wir halt 70 Jahre Frieden in Europa und das ist historisch neu, ohne dass ich das jetzt so in Abrede stellen möchte. Es ist ja immer spannend, mal so ein Gegenrede zu hören, als naja, aber es war auch nicht immer alles nur Krieg.
Amanda:[26:27] Ja, ja, ja, absolut. Gut, der Krieg ist auch etwas, was so ein bisschen mit Zivilisation einhergeht, gemäß ihm. Er sagt auch, es ist so die Ursünde, ist eigentlich die Erfindung des Privateigentums, was wir auch aus anderen Erzählungen kennen.
Amanda:[26:52] Und das eigentlich er nennt das immer Jäger und Sammler ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, den man vielleicht heute anders benennen würde aber, dass die eigentlich ein ganz gutes Leben gehabt haben, im Sinne von, die Natur hat eigentlich den Menschen alles gegeben, was sie gebraucht haben und mit der Sesshaftigkeit ist das eigentlich hat das aufgehört, also Sesshaftigkeit hat ihren Preis, Bauern müssen plötzlich mehr, müssen härter arbeiten für das gleiche Leben und gleichzeitig hat sich damit dann auch eine gewisse Zivilisation oder ein Bevölkerungswachstum zumindest ausgebildet und dann haben auch die Katastrophen begonnen es kam zu Hungersnöten, es kam zu Krankheiten, und er sagt halt auch viele Meilensteine der Zivilisation, die wir so benennen, also sei es zum Beispiel Geld oder Schrift oder das Recht waren eigentlich Meilensteine der Unterdrückung, also Geld oder die Schrift wurde erfunden, um halt Schulden festzuhalten. Oder Geld wurde dazu genutzt, um Personen zu unterdrücken oder um ihnen was von ihrem Eigentum abzunehmen sozusagen. Oder auch das Recht, also das war wie dieser alte Kodex Hammurabi zum Beispiel. Das ging ja einfach darum, wie man Menschen auch bestraft zum Beispiel.
Amanda:[28:17] Und seine Schlussvollkommung ist auch so ein bisschen, ja, heißt das, dass Zivilisation eine schlechte, eine gute Idee ist, es ist einfach noch zu früh, das zu sagen.
Christoph:[28:28] Schön, ja, okay.
Amanda:[28:30] Also es hat durchaus natürlich seine Vorteile und man kann die negativen Aspekte auch überwinden, aber im Großen und Ganzen, ob das dann besser oder schlechter ist, wird sich zeigen.
Christoph:[28:45] Das finde ich sehr witzig, muss ich sagen. Okay, ja. Hast du eine Meinung dazu? Jetzt nach dem Buch?
Amanda:[28:55] Also ich finde, es kommt natürlich auch sehr auf den Standpunkt drauf an. Also ich kann ja nicht mich von meiner Sozialisation lossagen und deswegen finde ich Zivilisation schon sehr schön. Ob das jetzt für den Menschen als, ich weiß nicht, als Spezies die sinnvolle Organisationsstruktur ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob jemand von uns das sagen kann. Also wenn wir uns einfach biologisch denken, dann sind wir jetzt und dann sind wir irgendwann mal nicht mehr.
Christoph:[29:27] Man kann es immer mit Luhmann halten und sagen, in der Moderne wird gleichzeitig alles immer besser und gleichzeitig alles immer schlechter. Das finde ich ganz schön. Wobei ich neige, glaube ich, auf jeden Fall der These zu, dass es langfristig, mittelfristig ist. Ich hoffe, es wird schon besser. Ich glaube, das ist schon eine gute Idee.
Amanda:[29:48] Ja, dann bist du im gleichen Spirit wie Prigman.
Christoph:[29:55] Ja, sehr gut, sehr gut.
Amanda:[29:58] Eine weitere Geschichte, die er so investigativ aufdeckt oder eigentlich andere Personen und er schreibt das dann auf, da geht es um die Osterinsel. Die Osterinsel ist eine kleine Insel im Pazifik, westlich von Südamerika, ungefähr zweieinhalbtausend Kilometer von dort. Und die haben diese berühmten Steinstatuen, die Moaich, die hast du bestimmt schon mal gesehen. So lange Steingesichter sind das.
Christoph:[30:25] Ja, ich glaube schon, ja. Ja.
Amanda:[30:27] Und die übliche Erzählung dieser Osterinsel ist eigentlich und auch Personen, die dort leben, überliefern das so ein bisschen so, ist, dass die ja vor irgendwie so und so vielen Jahren kam es zu Hunger und dann zu Krieg und Kannibalismus und dieses Volk hat sich ja nicht selbst ausgerottet so. Und da hat man natürlich verschiedene Vorstellungen davon gehabt, was dazu geführt hat und eine davon ist, dass eben diese Steinstatuen, von denen gab es ja viele und die herzustellen, dafür brauchte man viele Bäume und irgendwann gab es keine Bäume mehr und es kamen zu Hungersnöten und die Menschen waren ausgelaugt und haben sich dann eben selbst gegenseitig aufgegessen und es kam zu Krieg. und Leid und so weiter. Und das war wie so, ja, wurde auch als Beispiel für, ich sag mal, eine Gesellschaft, die kollabiert ist, angeführt.
Amanda:[31:31] Offenbar auch in dem Buch, zum Beispiel von Jared Diamond, der, ich glaube, in Kollaps war das, der diese Erzählung nimmt und die wurde auch immer wieder so rezipiert und, Und man deckt dann eigentlich auf, dass es alles eigentlich Schwachsinn ist, es ist alles erfunden und falsch. Und das ist schon interessant, weil das halt einfach, man hat dann so wie ein Mythos und man statuiert daran ein Exempel und offenbar sind einfach sehr viele Quellen und Zitate verdreht worden. Das stimmt einfach nicht. Also wenn man dann diese Berichte von Seefahrern gelesen hat, die dann tatsächlich da angekommen sind, also das war ein sehr friedfertiges Volk, die waren topfit, die hatten alle genug zu essen. Es ist einfach wirklich so, ja, alles falsch.
Amanda:[32:23] Und was dann aber passiert ist, ist Ende im 19. Jahrhundert wurde ein Drittel der Bevölkerung wurde auf Sklavenschiffen nach Peru gebracht und dann dort nach internationalem Druck hin dann wieder zurückgebracht und auf der Fahrt ist irgendwie die Hälfte gestorben und dann haben sie noch die Pocken dort eingeschleppt und dann war es wirklich vorbei. Also es ist wie so, eigentlich hat dann sozusagen die, ja von extern dieser Einfluss hat dann dazu geführt, dass die Personen wirklich krank geworden sind und gestorben sind und sich von den Klippen gestürzt haben, weil sie halt einfach so nicht mehr leben konnten dort. Ja und einfach interessant eben wieder so eine Geschichte, die bei uns in den Köpfen oder die so einfach dargestellt wird, ohne sie kritisch zu hinterfragen eigentlich. Und so in diesem Ton geht es auch ein bisschen weiter. Es geht dann um diese berühmten sozialpsychologischen Experimente, zum Beispiel das Stanford Prison Experiment oder das Stanley Milgram Schockmaschinen Experiment.
Amanda:[33:30] Wo er eigentlich auch kein gutes Haar dran lässt, ob die tatsächlich so stattgefunden haben und ob die Schlussfolgerungen aus diesen Experimenten so zu ziehen sind, wie man die eben zieht. Ganz grundsätzlich ist die Sozialpsychologie so in den 50er und 60er Jahren, hatte die eine Hochzeit mitunter auch natürlich nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Man wollte halt wie auch erklären und wissen, wie Menschen zu Monstern werden können, so ganz plakativ ausgedrückt. Und so sind dann auch diese Experimente entstanden. Und interessant ist eben, dass die sich auf einen klaren Zeitraum auch ein bisschen beschränken. Also viele dieser sozialpsychologischen Experimente, die auch diese Schlussfolgerung dann ziehen.
Amanda:[34:27] Die sind in diesen Jahren dann auch durchgeführt worden. Und das Stanford Prison Experiment, das ist ein Experiment, wo es darum ging, dass Studierende, Ja, Studenten der Universität dort wurden im Keller dort eingesperrt und es gab eben Gefangene und es gab Wärter und das ist total eskaliert. Also es ist irgendwie dann, ja, also alle haben sich gegenseitig dann irgendwie dort die Köpfe eingeschlagen und es roch nach Exkrementen und das ist eigentlich, also es war ein totales Chaos am Ende dieses Experiment. Und die Schlussfolgerung ist eben, dass man, wenn man Personen eine Uniform gibt und ihnen sagt, ja, alles ist erlaubt sozusagen als Wärter, dann kommt auch das Schlimmste zutage. Und das ist offenbar auch nicht ganz so geschehen. Das stellt sich nämlich heraus, dass dieses Experiment ziemlich klar manipuliert wurde, im Sinne von, dass man den Wärtern ganz konkrete Anweisungen gegeben hat, was sie zu tun haben. Es ist nicht einfach, man gibt denen eine Uniform und schaut, was passiert, sondern die wurden schon auch so instruiert, dass die Gefangenen erniedrigt werden sollten.
Amanda:[35:55] Dann gibt es auch ein ganz berühmtes Zitat von einem Gefangenen, also Student, der dort als Gefangener war, wo man irgendwie eine Tonaufnehmer, wo er schreit, ich muss hier raus, ich werde verrückt und so. Die ging natürlich dann rum und wurde oft zitiert. Und der Student hat aber gesagt, das war ein Fake. Also er hat sich da eingeschrieben für das Experiment, weil er dachte, kann dann dort im Gefängnis für seine Prüfungen lernen. Und der erste Tag war noch ganz witzig, weil er sich halt irgendwie doof aufführen konnte und rumschreien konnte und so weiter. Und am zweiten Tag war ihm das irgendwie zu blöd und er wollte gehen, aber der Studienleiter hat ihn nicht gehen lassen. Und nur halt, wenn er sozusagen körperliche oder mentale Probleme zeigen würde und dann hat er das halt gefakt, vorgetäuscht und ist dann aber damit eigentlich in diesen Bericht auch eingegangen. Und er hat das dann auch widerlegt, zum Beispiel in einer Doku über das Experiment und das wurde einfach nicht gezeigt, das wurde wie rausgeschnitten, sein Geständnis.
Christoph:[37:07] Prima, ja.
Amanda:[37:08] Genau, also wirklich so viele Dinge, die er da einfach nicht… Ja, die man wie nicht hört. Man kennt das Experiment, den Namen davon, was da passiert ist. Aber eigentlich ist das nicht ein Experiment, das nach heutigen Standards, abgesehen von den ethischen, so durchgeführt werden könnte eigentlich. Ja, es gibt auch das Gleiche zum Beispiel mit Kindern, das Rob’s Cave Experiment, wo auch zwei Gruppen von Jungen in einem Camp sind. Und alles ist erlaubt so. und das Ziel war zu zeigen, dass sie sich dann eben halt gegenseitig irgendwann die Köpfe einschlagen und dazu kam es halt einfach wie nie. Ja und enttäuschend, wirklich enttäuschend. Ja, es musste dann auch abgebrochen werden, weil die zu freundlich miteinander waren.
Christoph:[37:58] Ärgerlich, so ärgerlich.
Amanda:[38:00] Ja und das gleiche auch mit einer BBC Sendung, das hieß The Experiment, wo man so ein bisschen dieses Stanford Prison Experiment nachgestellt hat. Ja, und da ist eigentlich auch nichts passiert.
Christoph:[38:14] Es spannend, total interessant.
Amanda:[38:15] Wir folgen und irgendwann haben die Wärter dann, die haben da zusammen gegessen am gleichen Tisch. Und irgendwie, also die, ja, war total langweilig. Schlussfolgerung, wenn man durchschnittliche Menschen in Ruhe lässt, dann passiert eigentlich nichts. Ja. Und es, also finde ich noch interessant, weil das natürlich ein sehr einflussreiches Experiment der Sozialpsychologie ist.
Christoph:[38:39] Ja, genau. Also wenn man irgendwie lose in nur einem der Randfächer studiert hat, würde ich sagen, hat man davon ja gehört und kennt das, ja.
Amanda:[38:50] Ja und das zweite ist dieses Stanley Milgram Schockmaschinen-Experiment, wo es darum geht, ja wie weit ist man bereit zu gehen oder eine fremde Person zu bestrafen auf Gehorsam und das war eben erschreckend, wie viele Menschen dann wirklich auch sehr weit gegangen sind. Und die schlussfolgerung davon ist offenbar auch gewesen dass es eben ja wenn wenn es um gehorsam geht dann folgen wir dem teilweise blind und hier sagt er jetzt nicht unbedingt dass das das experiment ganz falsch war aber auch hier ist die schlussfolgerung ja so vielleicht nicht ganz zutreffend auch weil er sagt dass.
Amanda:[39:34] Die Menschen haben halt auch, oder wenn man die später interviewt hat, haben halt auch viele gedacht, ja, man hilft, indem man dieses Experiment macht. Also man hilft der Wissenschaft. Und die wurden ja auch dann immer aufgefordert. Also wenn man die genauen Berichte und liest, wie für jede Testperson, wie das abgelaufen ist, dann haben die da eigentlich immer zuerst versucht, mit den Opfern zu sprechen und dann versucht, es nicht zu tun und dann mit dieser Person, die eben die Anweisung gegeben hat, zu diskutieren. Und es hat eigentlich immer den gleichen Ablauf gehabt. Und der Grund, warum das aber trotzdem dazu gekommen ist, dass viele Personen dann weitergemacht haben, ist einerseits dem auch geschuldet, dass offensichtlich nur ungefähr die Hälfte geglaubt hat, dass die Elektroschocks auch wirklich wahr waren oder also appliziert wurden. Also ganz viele haben da gar nicht unbedingt daran geglaubt.
Christoph:[40:37] Ja, spannend.
Amanda:[40:39] Ja, was natürlich schon auch relevant ist. Und als sie dann oder diejenigen, die dann zu zweifeln begangen, haben dann das Experiment zu dem Zeitpunkt dann auch abgebrochen, also wo sie dann nicht mehr sicher waren. Und ich fand die Schlussfolgerung, die er dann zieht oder die er zitiert, ist, dass es eigentlich einfach darum geht oder der Unterschied zwischen den Personen, die dann eben früher oder später abgebrochen haben, ist eine erlernbare Kompetenz im Umgang mit Befehlen einer zweifelhaften Autorität. Es ist nicht blindergehorsam so in dieser Form, wie man diesen Begriff versteht, sondern halt eben, ja, was oder auch, was mache ich, wenn ich glaube, dass das, was ich tue, gut ist? Oder also es ist, man macht ja viele Dinge in, ja, die negative Konsequenzen haben, aber man Und glaubt ihm, dass sie etwas helfen. So.
Amanda:[41:30] Ja, das ist so, geht dann nebenbei weiter. Ja, warum machen Menschen überhaupt schlimme Dinge? Und auch da ist eigentlich, ja, der Grund ist eigentlich, dass wir andere Menschen sehr gerne mögen. Das Problem ist aber, dass wir natürlich unterscheiden zwischen Menschen, die uns ähnlich sind oder nicht. Und ein Beispiel, das er da anführt, ist auch wieder aus dem Zweiten Weltkrieg. Also zum Beispiel bei den Nazis, wenn man die interviewt hat. Also was hat dazu geführt, dass die immer weiter gekämpft haben? Ist das irgendwie Ideologie? War das Gehirnwäsche? Hatten die das Gefühl, dass sie noch einen Erfolg oder einen Siegeserfolg in Aussicht hatten? Und eigentlich kann man das alles verneinen, sondern es war einfach die Kameradschaft. Also man tut Dinge, weil man die anderen nicht im Stich lassen möchte. Und es gibt auch hierzu Experimente, die man beispielsweise mit Babys gemacht hat und da kann man auch zeigen, also dass Babys, wenn man denen Figuren oder ein Figurenspiel vorführt, die präferieren immer die hilfsbereite Person. Das finde ich jetzt ist ja noch einleuchtend.
Christoph:[42:45] Ja, sehr, finde ich auch. Noch nicht so überraschend, ja.
Amanda:[42:48] Was aber interessant ist, ist, wenn man den zum Beispiel dann fragt, also Babys oder Kleinkinder, was sind ihre Lieblingsfrühstücksflocken und dann hat man Figuren und die einen mögen eben die Frühstücksflocken und die anderen mögen die anderen, dann präferieren die Kinder die mit dem gleichen Geschmack, wie sie selbst haben. Egal, ob die Figuren dann gemein sind oder frech oder nicht. Also das ist schon noch… Wir haben offensichtlich eine sehr starke Tendenz dazu, Menschen, die uns ähneln, eher zu mögen.
Christoph:[43:28] Ja, das ergibt Sinn. Ich meine, ihr kennt das ja auch aus Gruppenexperimenten. Ich meine, eigentlich ähneln uns die Leute dann gar nicht so sehr, aber Gruppenteilungen funktionieren extrem gut. Also man kann Menschen, die in einem Raum sind, beliebig in A und B einteilen. Und du wirst gruppendynamische Prozesse finden, dass sie sich gegeneinander abgrenzen und die eigene Gruppe stark präferieren. Obwohl es völlig arbiträer ist, wie sie zusammengewürfelt wurden. Also ja, das ist… Das ist schon wichtig. Ich würde natürlich auch, also das eine ist ja wie, also das ist ja jetzt eine sehr psychologische Herangehensweise an die Welt. Also man geht ja von viel Handlungsmacht von individuellen Personen offenbar aus, wenn man so denkt. Und die Frage ist ja, bei welchen systemischen Zwängen wir auch sind und welche gesellschaftlichen Systeme wir mit welchen Eigendynamiken haben. Und ob dabei dann immer Gutes bei rauskommt, ist vielleicht die zweite Frage. Also das wäre ja noch sowas. Also so guckt man ja sehr auf quasi Verhaltensmöglichkeiten, aber die Verhältnisse an sich sind vielleicht ein bisschen nachgelagert.
Amanda:[44:37] Ja, das ist ein guter Punkt. Den nimmt er so auch nicht auf.
Christoph:[44:44] Was ich auch okay finde, wenn man, also es scheint nicht der Scope des Buches zu sein, von daher ist das glaube ich völlig in Ordnung.
Amanda:[44:52] Ja, ja, total, aber das ist ein guter Punkt. Noch zu dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem Einteilen von Menschen. Auch das gibt es Experimente dazu. Das hat man auch mit Kindern gemacht, dass man denen zum Beispiel ein rotes und blaues Shirt angezogen hat. Und nach da hat sich gezeigt, diese Unterschiede, die sind nur dann relevant geworden, als auch die externen Personen, also zum Beispiel die Lehrpersonen oder so, diesen Unterschied deutlich gemacht haben. Also die Die Kinder selber haben das gar nicht beachtet. Erst als man dann gesagt hat, die Blauen sind ja immer besser deswegen. Oder man die explizit immer mit Rot und Blau angesprochen hat. Also erst als dieser Unterschied künstlich eingeführt wurde, hat das dann auch Konsequenzen gezeigt im Verhalten.
Amanda:[45:43] Das ist auch so in einem Kapitel ein bisschen später angekommen. Man zitiert auch diesen Pygmalion-Effekt, also dass man, eigentlich ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung, wo es auch darum geht, dass man dieses Experiment mit Kindern gemacht hat, beziehungsweise mit Lehrpersonen, wo man den Lehrpersonen gesagt hat, eine berühmte oder eine renommierte Person hat einen Test entwickelt und die Kinder haben die und die Chancen auf eine bessere Ausbildung oder was auch immer. Und das hat sich dann auch tatsächlich so bewahrheitet. Also die Personen sind wirklich oder die Kinder, die dann in diese arbiträre Testgruppe gefallen sind, waren dann am Ende des Schuljahres auch wirklich signifikant besser als die anderen, obwohl die wurden ausgelost. Also da stand nichts dahinter. Und das hatte man auch mit Ratten gemacht. Also auch, wenn man irgendwie Ratten durch ein Labyrinth gelaufen lassen hat und die Personen, die da die Aufsicht gemacht haben, denen gesagt hat, ja, das ist eine ganz speziell intelligente Rattenrasse, dann waren die am Schluss auch besser als die anderen. Also es ist wie, obwohl die genau die gleiche Rasse waren. Das ist spannend.
Christoph:[47:00] Das ist wirklich interessant. Ich kenne das ganze Thema, was will man über seine SchülerInnen wissen, hier aus meinem Haushalt, weil meine Partnerin ja Lehrerin ist. Und dann ist immer die Frage, möchte man bei einem Schulwechsel, also wenn die Kinder von einer anderen Schule zu einem wechseln, die Akten dazu haben oder nicht? Also möchte man das Kind quasi möglichst unvoreingenommen betrachten, damit man nicht geprimed ist durch was auch immer in der Schulakte drinsteht. Oder es ist vielleicht in manchen Fällen doch sehr, sehr sinnvoll, die Schulakte zu kennen, damit man weiß, auf welches Kind man sich einlässt, damit man proaktiv damit umgehen kann. Und das ist so ein bisschen, ja, mal so, mal so. Also ich glaube, es gibt Argumente dafür und Argumente dagegen. Auf jeden Fall kann man sagen, dass Schulakten in Deutschland nicht immer gewissenhaft und gut geführt werden. Das habe ich jetzt gelernt dadurch, egal, ob man sie haben will oder nicht.
Amanda:[47:48] Ja, das ist ja in der Medizin das Gleiche. Also man kann, das müsste man dort eigentlich auch… Ja, hat, wie du gesagt hast, hat sein Für und der Wider. Ja, ich fand auch, es gibt so einen Trend im Moment, oder den gibt es wahrscheinlich schon lange, aber ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen damit auseinandergesetzt, das Manifestieren. Oh ja, es hat nicht geklappt.
Christoph:[48:13] Die falsche Person ist amerikanischer Präsident geworden.
Amanda:[48:17] Ja, dann hast du deine Kraft-Channels nicht richtig geöffnet.
Christoph:[48:22] Das war einfach nicht genug vermutlich, aber egal, erzähl erstmal.
Amanda:[48:25] Nee, aber das ist mir dann auch so in den Sinn gekommen. Also das Manifestieren, das ist so, klar, in gewisser Hinsicht ist das, ja, belächle ich das so ein bisschen. Ich finde es auch teilweise gefährlich, insbesondere wenn es dann um negative Dinge geht. Also wenn man Personen irgendwie selbst die Schuld gibt, weil sie negative Gedanken haben, dass sie dann irgendwas nicht geschafft haben oder was auch immer. Also das finde ich einfach überheblich, das zu behaupten. Aber eben, irgendwo durch muss es ja schon auch einen Effekt haben. Also wie man sich zu etwas verhält, jetzt in Bezug auf diese SchülerInnen oder die Ratten, dass es dann einfach Effekte hat, die wir einfach nicht quantifizieren können und auch nicht müssen. Aber es ist nicht läugtbar, dass das doch irgendwas macht.
Christoph:[49:13] Ja, genau. Ja, ich glaube, ich meine, es ist, finde ich, ein bisschen geht es ja in eine andere Form, also es ist, wenn PsychologInnen hier zuhören, die werden mich vermutlich hauen, aber ich finde rein so von der Verortung her ist es nicht so weit weg vom Konzept des Nudging, also dass wir gewisse Dinge einfach so auslegen und so gestalten, dass man dazu angehalten ist, zum Beispiel das ökologisch Sinnvollere zu tun. Also so der Klassiker ist, keine Ahnung, man drückt auf drücken und doppelseitig bedrucken ist vorausgewählt, damit man weniger Papier verbraucht und so. Und ich glaube, das geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Man primet sich ja auf gewisse Verhaltensweisen, die dann irgendwas umsetzen sollen und dass das natürlich auf so einer unbewussten Ebene durchaus Effekte hat, ist glaube ich sehr klar, aber man muss das vermutlich richtig einordnen. Und genau, ich sehe auch, dass das absolut gefährlich sein kann, ja.
Amanda:[50:15] Ja, das geht auch in die Richtung von einem anderen Kapitel, wo es darum geht, wie Macht korrumpiert. Er nennt das auch acquired sociopathy, also erworbene Soziopathie, wo es, also er beschreibt zum Beispiel ein Experiment, wo fünf Personen in Gruppen eingeteilt werden und eine Person wird als Anführerin ausgelost. Und dann bekommen die Kekse. Und wenn es keine Anführerin gibt, dann bleibt in der Regel ein Keks übrig. Also sie bekommen sechs Kekse und ein Keks bleibt dann übrig. Aber wenn eine Anführerin ausgelost wird, dann verschwindet der sechste Keks im Mund der Anführerin. Also dass man wie sich eigentlich, wenn man plötzlich in der Machtposition ist, sich dann auch Dinge rausnimmt, die man sonst nicht tun würde. Und das kann auch auf ganz banale Dinge gezeigt werden. Also beispielsweise, wenn man ein Auto fährt und da fährt man irgendwie einen, keine Ahnung, einen Fiat und dann hält man halt an beim Fußgänger und wenn man aber in einem Mercedes sitzt oder in einem BMW, dann plötzlich nicht mehr, also die gleichen Menschen, weil man wie.
Amanda:[51:41] Ja, Macht ist vielleicht das falsche Wort, aber das wie irgendeinen Stimulus setzt, der einem suggeriert, dass man sich anders verhalten darf oder kann.
Amanda:[51:53] Und eben das sind auch so ein bisschen, geht ja auch ein bisschen in die Richtung von Nudging, also das ist wie man plötzlich in Situationen ist, wo man sich eigentlich wieder der Art und Weise überhält, die man sonst tun würde. Und das ist wohl auch, was sehr unbestritten ist. Es gibt ja viele Theorien, die Prägman in seinem Buch eigentlich widerlegt aus der Psychologie, aber eben das macht, korrumpiert. Das ist wohl eine Tatsache, die bisher sich so hält. Ja, da gehe ich mit.
Christoph:[52:29] Glaube ich.
Amanda:[52:30] Du hast vorhin noch die Präsidentschaftswahlen in den USA angesprochen. Also er sagt dann auch, was in früheren Gesellschaften wahrscheinlich ein wichtiger Punkt war, um das ein bisschen in Balance zu halten, das war eigentlich die Scham. Also man konnte sich nicht unbegrenzt schamhaft verhalten, weil das wurde sanktioniert. Also du konntest… Auch früher eigentlich nur Anführer oder Anführerin werden, wenn du, ich sage mal, gewisse, ich sage mal Tugenden, was man so darunter verstehen kann, an den Tag legt. Und ja, mittlerweile funktioniert die Scham irgendwie nicht mehr so als Eingrenzung. Und ja, das zeigt sich ja irgendwie auch wieder.
Christoph:[53:11] Das begeistert mich als Argument. Ich argumentiere immer wieder damit, dass ich das Gefühl habe, dass es vielen Menschen an Anstand einfach fehlt. Also das ist, wenn man richtig hinguckt, dann fehlt es einfach an Anstand und das finde ich ist so eine banale Diagnose, aber ich finde, da findet sich so viel drin wieder, das geht ja genau in die gleiche Richtung. Mir ist Höflichkeit halt auch wichtig. Und wenn man höflich ist und anständig, dann lässt man manche Dinge einfach politisch nicht zu und dann sind sie einfach keine Optionen.
Amanda:[53:47] Das stimmt, ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Da würde Rutger Prägmann unterschreiben. Ich glaube, es ist auch ein Teil oder eine seiner zehn Lebensregeln, die er am Ende vom Buch dann aufstellt.
Christoph:[54:01] Oh, zehn Lebensregeln kriegen wir am Ende. Also er ist zum Berg gegangen und hat neue Gebote empfangen.
Amanda:[54:09] Sozusagen, genau. Ja, der letzte Teil des Buches geht dann auch noch so um gewisse institutionelle Beispiele, wie man es eben auch anders machen kann. Also zum Beispiel das Beispiel, das sind jetzt viele, vielmal Beispiele von eines Niederländers, Joost de Bloch, der ein Pflegesystem oder eine Pflegeorganisation gegründet hat, die eigentlich ja sich sehr los sagt von diesem ganzen Managementorganisation und eigentlich auch nur ein Produkt anbietet. Also es ist nicht, ich weiß nicht, ob du das kennst. Also in der Pflege muss man sehr viel abrechnen und jede Leistung separat ausweisen und so weiter. Und das macht, auch hier in der Schweiz, es ist ein Riesenproblem, weil das natürlich den ganzen Apparat extrem aufbläst, künstlich, weil das einfach finanzierungsrelevant ist.
Amanda:[55:06] Und dieser Juste Block mit seiner Einrichtung hat einfach ein Produkt, das nennt sich Pflege. Und das wurde dann tatsächlich so auch in dem nationalen Pflegekatalog so übernommen. Also das ist jetzt einfach, für seine eigene Organisation gibt es nur einen Abrechnungscode und der nennt sich Pflege und nicht irgendwie Langzeitpflege oder Telemedizin oder irgendwie da noch jemandem was abgewischt so. Ja und zeigt sich auch, dass das, es ist zwar wohl nicht jetzt massiv viel günstiger als die anderen Pflegeinstitutionen, aber überdurchschnittliche Qualität und das ist ja nicht schon das beste Argument, finde ich. Voll ähm.
Amanda:[55:50] Ja, andere Beispiele sind dann, da geht es um diese Schrottspielplätze, wo man eben eigentlich den Spieltrieb von Kindern viel besser, wo sich eigentlich einfach gezeigt hat, dass es denen viel, viel besser geht, wenn man denen einfach einen Schrotthaufen hinstellt und die machen dürfen, was sie wollen. Als wenn man diese durchdesignten Spielplätze hat.
Amanda:[56:21] Und auch so mit der Konsequenz, dass einfach Spielen ist was, was uns inhärent ist. Dass wir dort auch lernen zu kooperieren. Und das ist ja auch das, was Bergmann dann eigentlich sagt. Menschen sind dazu gemacht zu kooperieren und auch zu lernen, wie wir mit anderen umgehen können. Und dass halt viele Dinge, wie wir sie im Moment haben, dann nicht unbedingt hilfreich sind. Schule ist auch so ein Punkt. Also es gibt auch Beispiele von diesen neuen Schulsystemen, wo es keine Klassenräume mehr gibt, wo der Tag halt auch nicht in Stunden aufgeteilt ist und so weiter. Und Scheitern tut das dann immer an den Abschlussprüfungen oder weil irgendwelche, Politik oder Eltern auch zum Teil dann halt irgendwie einen Leistungsnachweis erwarten. Und da heißt das dann, da konfligieren diese neuen Ansätze dann meistens mit den alten.
Christoph:[57:18] Man kann sich, finde ich, sehr gut fragen, ob man bei dem jetzigen System Schule rauskommen würde, wenn man es quasi neu auf dem Reißbrett planen würde. Dann käme vermutlich nicht das System raus, was wir gerade haben.
Amanda:[57:33] Ach, meinst du? Okay.
Christoph:[57:35] Ich glaube nicht, dass man bei 45 Minuten Fachstrukturen rauskommen würde. Ich glaube, man käme bei einem anderen Lernsystem raus in irgendeiner Form. Bin ich mir relativ sicher. Was wollte ich noch sagen? Ach zum Thema moderne Spielplätze, weil es auch so ein Lieblingsthema von mir ist. Soweit ich weiß, zeigt die Forschung auch, dass moderne Spielplätze zwar enorm abgesichert sind, aber überhaupt keinen Risikoumgang mehr erlernen lassen. Also das Einschätzen der eigenen Fähigkeiten halt völlig an den Rand tritt und alte Spielplätze oder Spielplätze früher halt, die durchaus objektiv Gefahren beinhaltet haben, deutlich ungefährlicher sind, weil Kinder halt beim Spielen konkret darüber nachdenken müssen, was sie gerade tun. Also du kannst quasi nicht geistesabwesend mit den Spielgeräten umgehen, sondern musst konzentriert bei der Sache sein und dadurch sind sie eigentlich sicherer auch. Und man lernt halt viel mehr, wenn man sich tatsächlich selbst einschätzen muss und nicht alles von vornherein komplett abgesichert ist. Ich will gucken, ob ich dazu auch noch eine Quelle finde.
Amanda:[58:42] Ja, eine Mäzenin dieser Schrottspielplätze hat dann den Satz gesagt, lieber ein gebrochener Knochen als ein gebrochener Geist. Und eben, wie du gesagt hast, die sind wohl offen, die sind gar nicht gefährlicher genau. Also da sind auch nicht mehr Unfälle passiert und der ursprüngliche dänische Architekt, der damit begonnen hat mit diesen Spielplätzen, hat gesagt, es ist zwar das Hässlichste, was ich meine ganze Zeit entworfen habe, aber trotzdem das Beste. Sehr gut genau es ist, ein weiteres Beispiel ich mache dann irgendwann auch Schluss mit den Beispielen die gefallen mir.
Christoph:[59:21] Aber es macht Spaß die zu hören
Amanda:[59:24] Da geht es um Gefängnisse und auch da er ist ja aus den Niederlanden und er hat schon auch einen gewissen Fokus, ich sage mal auf die skandinavischen Ländern, was ich persönlich ganz interessant finde weil ich ja sonst eher so, ich sag mal, englisch zentrierte Literatur lese. Deswegen fand ich das auch interessant, dass da viele Anekdoten auch aus dieser Region kommen. Und mit den Gefängnissen ist es das Gleiche. Da zitiert er.
Amanda:[59:54] Oder da spricht er von norwegischen Gefängnissen, wo halt eben Personen, zwar sei es auf einer Insel oder in einem abgelegenen Gebiet sind, aber die wohnen auch wie in einer Kommune zusammen. Also die müssen, die arbeiten halt für ihr eigenes, für ihr eigenes Essen, sag ich mal, oder für ihren eigenen Unterhalt des Hauses und so weiter und haben eigentlich ein sehr gutes und friedliches Zusammenleben, auch wenn die für wirklich Schwerstverbrechen eigentlich dort inhaftiert sind und so. Auch da, finde ich, gibt es einen Satz, der stammt wohl von einem Justizbeamten oder so aus diesem Gefängnis, der sagt ja, wir lassen jedes Jahr Nachbarn frei. Also es ist nicht so, also es macht gar keinen Sinn, die Person einzusperren und die irgendwie ein komplett lebensfremdes Milieu dort zu bieten. Weil irgendwann, also die meisten Personen kommen ja wieder aus dem Gefängnis frei, egal was sie gemacht haben. Und dann sind sie irgendjemandes Nachbarn.
Amanda:[1:00:59] Und dann macht das einfach, und das stimmt auch, wenn ich mir dasselbe überlege, da habe ich mehr davon, wenn ich weiß, diese Person hat zwar mal was Schlimmes gemacht, aber die hat die letzten 20 Jahre, ich sage mal friedlich, irgendwie in der Kommune gelebt, als dass die sich irgendwie, weiß ich, wie sozialisiert hat in einem Gefängnis. Wie das in den USA zum Beispiel sehr, sehr großes Thema ist.
Christoph:[1:01:21] Er fordert natürlich sehr viel Reflexionsvermögen der Gesellschaft, die das als Format des Gefängnisaufenthalts akzeptiert. Also wenn ich mir vorstelle, dass man das in der jetzigen politischen Konstellation in Deutschland vorschlagen würde, also bei den jetzigen Resozialisationskonzepten, Habe ich das Gefühl, weiß ich nicht. Also da bin ich froh, dass wir keine direkte Demokratie haben, weil ich glaube, wenn das direkt entschieden würde, würde da auch viel abgeschafft und geändert werden, wenn es zur Abstimmung stände. Also es ist gut, dass das vermittelt nur ist. Also ja, ganz heikles Thema, glaube ich, politisch, wobei, glaube ich, empirisch relativ klar ist, wie der Umgang sein sollte. Also ja. Und halt auch ethisch-moralisch. Also das kommt ja auch noch dazu.
Amanda:[1:02:10] Ja, und das ist wohl auch immer mal wieder so passiert. Es gibt dieses berühmte Bretton, das war ein Police Officer in New York in den 90er Jahren, der dann eben so ein System aufgebaut hat, wo man wirklich hart durchgreift. Also jede Kleinigkeit wurde dann geahndet und wegen dieser Broken-Windows-Theorie, also wenn es irgendwo ein kaputtes Fenster gibt, dann folgen halt die weiteren kaputten Fenster auch, weil dann die Hemmung sozusagen sinkt. Und das, ja, das ist halt auch die Philosophie des strenger, strenger, irgendwer am strengsten so. Und dass das aber halt eben nicht unbedingt, also das wurde dann mit Zahlen belegt, aber auch diese Zahlen kann man natürlich kritisch hinterfragen und es zeigt sich auch, dass in ganz vielen anderen Gebieten, wo das nicht so gehandhabt wurde, auch die Kriminalität gesunken ist, aber halt eben aus anderen Gründen.
Christoph:[1:03:08] Spannend, ja okay.
Amanda:[1:03:09] Ja, deswegen ist es halt auch dieses System und trotzdem ist das halt immer noch sehr weit verbreitet auch ich denke auch insbesondere in den USA, dass man sich da immer noch dran orientiert.
Christoph:[1:03:19] Ich meine, da sind die Gefängnisse ja auch gewinnorientiert, ne? Also es sind halt Privatunternehmen und also das ist in meinen Augen ja völlig abstrus, also was soll dabei, also wie soll sich so ein System rechnen, also da kann nichts besonders tolles bei rauskommen, glaube ich.
Amanda:[1:03:36] Ja, da hast du recht. Ich schließe mit dem letzten Beispiel, was er bringt. Da geht es um Kolumbien und die FARC. Das ist eine Guerrilla-Gruppierung in Kolumbien. Und ja, es gab einen Konflikt, der hat viele Jahre gedauert und dauert teilweise, ich denke, immer noch an. Auf jeden Fall hat es viele Guerillakämpfer, die dann dort in Kolumbien sehr lange Zeit auch von ihren Familien abgeschnitten waren. Und es wurde dann eine interessante Initiative ergriffen und zwar wurden PR-Menschen angestellt in diesem Jahr zur Beratung, was man da dagegen machen kann und wie man dieses Problem angehen kann. Und die haben dann eine ganz spannende Strategie rausgefunden oder gefahren, dass sie in einem Jahr zum Beispiel haben die aus Flugzeugen über dem Urwald und dem Dschungel, wo auch die viele dieser Kämpfer und KämpferInnen versteckt sind, haben die Lichter abgeworfen und eigentlich so Weihnachtsbäume da aus dem Dschungel gemacht. Und dann auch mit der Message ja also wenn Weihnachten zu dir kommen kann oder in den Dschungel kommen kann dann kannst du auch nach Hause kommen so.
Amanda:[1:05:02] Und das hat wohl sehr viel Wirkung gezeigt, sodass sie das dann auch solche Aktionen weitergemacht haben. Eine andere war, dass man Fotos, als die noch Kinder waren, genommen hat und dann hat man hinten eine Botschaft draufgeschrieben von der Mutter, die dann gesagt hat, ja, diese Weihnachten warte ich auf dich zu Hause. Und dann hat man die einfach so in so Kugeln, in durchsichtigen Kugeln auf dem Fluss losgelassen, auch mit Lichtern. Und auch das hat dann irgendwie dazu geführt, dass hunderte von Personen tatsächlich zurückgekehrt sind.
Christoph:[1:05:41] Spannend, also so ein proaktives Zugehen ohne Vorleistung.
Amanda:[1:05:45] Ganz genau.
Christoph:[1:05:46] Ah ja, okay, schön.
Amanda:[1:05:48] Und man hat dann auch gemerkt, dass irgendwie ein Problem ist, dass sie nicht gewusst haben, wie sie nach Hause kommen, Also weil die halt auch ein bisschen verloren waren in diesen Dschungels. Und dann hat man halt einfach so Licht, eine Art von Feuerwerk gemacht, dass die auch wussten, wo sie dann hin mussten. Also einfach so Dinge.
Christoph:[1:06:07] In Kombination dann auch mit so einem Amnestie, so heißt das, mit so einem Amnestieangebot oder wie, weil man kann ja nicht sagen, komm nach Hause, wir kommen im Gefängnis vermutlich.
Amanda:[1:06:18] Genau, genau. Also Amnestie weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall irgendwie Reintegration oder Resozialisierung, das auf jeden Fall in Kombination damit. Und das, ja, es ist auch hier wieder so die Quintessenz eigentlich, dass man auch Terroristinnen oder TerroristInnen, wenn man sie ja als Menschen behandelt, dann hat man vielleicht mehr Erfolg, als wenn man sie halt als Menschen behandelt. Als Monster behandelt.
Christoph:[1:06:48] Meine Frage wäre immer, wie man das eben gegen die eigene Bevölkerung durchsetzt. Weil ob die, wenn sie mit TerroristInnen konfrontiert waren, ist ja die Frage, ob die von Anfang an Juhu geschrien haben, als man gesagt hat, ja, also jetzt zu Weihnachten wollen wir denen ein paar Geschenke machen. Und dann, wenn sie wiederkommen, dann gibt es mindestens Strafmilderung oder Straferlass. Oder wir haben ein umfangreiches Programm aufgelegt zur Resozialisierung. Weil ich schätze, in Kolumbien gibt es noch mehr Umverteilungskämpfe und man hat sicherlich auch andere Ideen, was man mit dem Geld noch anstellen könnte. Schulen bauen, wen auch immer finanzieren, was auch immer. Also das wäre immer so meine Anschlussfrage, wie setzt man das gegen die eigene Bevölkerung durch? Weil ich mir wiederum, aber vielleicht ist da mein Verständnis, auch so wie du es Anfang beschrieben hast, falsch, dass ich unterstelle, dass Menschen das nicht mittragen wollen würden. Aber vielleicht sind Menschen ja auch viel besser und haben viel mehr Verständnis dafür, als ich jetzt unterstelle. Das kann ja auch sein.
Amanda:[1:07:43] Ja, stimmt. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Es ist auch, viele Beispiele sind natürlich so ein bisschen schön gefärbt und er sagt dann schon auch immer wieder, klar, es ist nicht alles jetzt deswegen perfekt und so weiter, aber es sind halt Beispiele, die zeigen, dass nicht alles auch schlecht sein muss oder dass gewisse Dinge durchaus funktionieren, auch wenn man sich das eben nicht vorstellen kann. Also das Gleiche, was du jetzt auch gesagt hast. Wer weiß, ob das funktionieren würde. Ja, das wäre es gewesen. Ich kann die zehn Regeln noch schnell sagen.
Christoph:[1:08:18] Ja, doch, die interessiere mich doch ein bisschen. Die würde ich gerne hören, ja.
Amanda:[1:08:21] Ich sage einfach, ohne darauf einzugehen, was die Überschriften sind. Die erste ist, geh im Zweifelsfall vom Guten aus. Die zweite ist, denke in Win-Win-Szenarien. Die dritte ist, verbessere die Welt, stelle eine Frage. Die vierte ist, zügle deine Empathie, trainiere dein Mitgefühl. Das ist, ich glaube, vielleicht irreführend, wenn man das nur den Titel hört. Da meint er, dass man eben, also nicht unbedingt, ich sage mal, keine Ahnung, wenn du dich stößt, dann hast du nicht so viel davon, wenn ich den Schmerz mit dir mitfühle. Also das nennt er dann Empathie aber Mitgefühl schon also im Sinne von ich kann dir dabei helfen das zu überwinden das wäre dann bei ihm Mitgefühl das Unterschied zwischen Empathie ich finde es nicht ganz von den Wörtern her vielleicht ist.
Christoph:[1:09:16] Da auch was in der Übersetzung verloren gegangen das kann ja auch sein
Amanda:[1:09:20] Dann Nummer 5 versuche den anderen zu verstehen auch wenn du kein Verständnis aufbringen kannst auch hier gemeint dass man durchaus Menschen zuhören kann und darf, auch wenn man nicht gut heißt, was die machen oder was sie denken, also plädiert für Zuhören und Verstehen und dann liebe deine Nächsten, so wie auch andere ihre Nächsten lieben. Also im Sinne von, es ist nicht schlimm, wenn wir unsere In-Group-Lieber mögen oder unsere Familie und so weiter, müssen wir uns einfach bewusst sein, dass andere Personen das auch tun und auch ihre eigene Familie haben und das wir dann auch respektieren. Nummer sieben, meide die Nachrichten. Sehr guter Punkt.
Christoph:[1:10:07] Oh ja, ja, ja.
Amanda:[1:10:09] Mache ich auch konsequent. Nummer acht, prügle dich nicht mit Nazis oder strecke deinem größten Feind die Hand hin. Da auch eine witzige Anekdote, wo an einem Ort, wo offensichtlich immer sehr viele Nazis hinpilgern, dann die Bewohner eine Initiative gestartet haben und daraus einen Spendenlauf gemacht haben. Die haben dann einfach eine Start- und eine Stopplinie da eingezeichnet. Und immer wenn ein Nazi-Sympathisant da durchgelaufen ist, um an diese Städte zu pilgern, haben die gespendet. Und dann wurde das einer Organisation gut gesprochen, die eben eigentlich gegen Nationalsozialismus oder Menschen helfen soll, die da aussteigen möchten. Nummer neun, oute dich, schäme dich nicht für das Gute, also man darf durchaus, man muss das nicht runterspielen, wenn man etwas Gutes macht, dass das auch anderen, also man darf auch das anderen zeigen, damit die vielleicht auch davon inspiriert werden, man muss sich da jetzt auch nicht damit brüsten, das meint er nicht, aber eben auch nicht schämen und das Letzte, sei realistisch.
Christoph:[1:11:23] Wenn ich es richtig verstanden habe, bist du damit am Ende der Vorstellung angekommen. Dafür vielen, vielen Dank. Ich habe ehrlicherweise, das hat mich total gewundert, ich habe im Vorhinein überlegt, welche Bücher passen dazu, welche Folgen und mir ist so wenig eingefallen, was ich total interessant finde, weil das Buch ja eigentlich total allgemein ist und die Annahme hatte, es müsste total anschlussfähig in alle möglichen Richtungen sein, aber irgendwie hatte ich nicht so viel. Naja, was ich aber habe, ist Nach der Flut das Feuer von James Baldwin, das ist, wenn ich mich richtig entsinne, so eine Essay-Sammlung, die James Baldwin, glaube ich, geschrieben hat, da war er so um die 30 Jahre alt, ich weiß gar nicht, wann das im Original erschienen ist, ist aber schon lange her,
Christoph:[1:12:09] Irgendwie 50er, 60er, irgendwie sowas, noch alter, keine Ahnung, ja doch, 50er müsste es gewesen sein. Und nach der Flut des Feuers, es ist jetzt schon lange her, dass ich es gelesen habe, geht es aber, was ich mir so im Kopf gemerkt habe, es geht ganz viel um Wut von schwarzen Personen auf die weiße Mehrheit und den Rassismus, den es in den USA gab und auch heute ja immer noch gibt. Aber auch die Notwendigkeit einer Befreiung der Weißen vom Rassismus, also so eine Idee des Brückenbauens und dass quasi weiße und schwarze Personen unter dem System Rassismus leiden. Ich habe es auf jeden Fall damals gerne gelesen und irgendwie war es so eine intuitive Verknüpfung, die ich jetzt gar nicht so schlecht finde, weil es viel, glaube ich, auch um Brückenbauen geht, aber
Christoph:[1:13:00] Und wenn wir heute so eine psychologische und individuelle Herangehensweise hatten, finde ich es auch gar nicht so verkehrt. Ich habe vorher überlegt, was gut passen könnte und es gibt von Wilhelm Schmid ein sehr kleines Büchlein, er ist Philosoph, Selbstfreundschaft heißt das und es gibt ja viel die Idee der Selbstliebe und nur wenn du dich selbst lieben kannst, bist du irgendwie auch für andere Menschen zugänglich und tralala, damit kann ich überhaupt nichts anfangen als Konzept, weil ich das enorm voraussetzungsreich finde und ich finde, man muss sich auch nicht selbst lieben. Aber Wilhelm Schmid vertritt die These, dass man mit sich selbst umgehen sollte wie mit einem Freund. Einen Freund verzeiht man Dinge, man ist nicht zu streng mit sich. Man geht aber auch kritisch mit ihm um, wenn man Dinge hat, die man wirklich loswerden muss. Und ich finde die Idee, dass man mit sich selbst befreundet sein kann oder sollte und dass das einem viel bringen kann, total schön irgendwie. Das habe ich entweder nach meinem Bachelor oder nach meinem Master auf der Wiese im Park gelesen auf so einem schönen Sommertag. Und irgendwie verbinde ich das sehr mit so einem guten Zugang zur Welt und einem sinnvollen Konzept.
Christoph:[1:14:03] Genau, das sind die beiden Büchlein. Die sind beide jetzt nicht so sonderlich dick, die ich mitgebracht habe. Und Folgen, an die ich denken musste, sind einmal Epistemische Ungerechtigkeit von Miranda Fricker. Das hast du vorgestellt. Bisschen anderes Weltverständnis, das da dargestellt wird, ist Zukunft als Katastrophe von Eva Horn. Das habe ich vorgestellt. Da geht es darum, wie seit Ewigkeiten eigentlich die Zukunft immer wieder schwarz gemalt wird und in dunkelsten Farben gezeichnet ist. Dann, weil es ja um Weltverständnis und so auch geht und jetzt auch die Frage ist, ob Rüdger Brechmann das nicht vielleicht alles auch sehr positiv zeichnet. Nils und ich haben in Folge 20 die Vereindeutigung der Welt von Thomas Bauer vorgestellt.
Christoph:[1:14:52] Und da geht es darum, dass Thomas Bauer stark dafür plädiert, dass wir Ambiguitätstoleranz entwickeln müssen, um die modernen Zustände der Welt auszuhalten, die eben nicht nur toll sind oder nicht nur ganz schlimm, sondern man muss eben die Dinge dazwischen und dass beides gleichzeitig existieren kann, aushalten. Und das finde ich eine ganz wichtige Kompetenz. Ja, und mit den drei Folgen, dabei belasse ich es, glaube ich, und würde dich jetzt noch fragen, du kennst das Buch besser und hast deswegen vielleicht noch einen besseren Überblick, was noch so passen könnte.
Amanda:[1:15:26] Ja, bei mir ging es genauso, wie du am Anfang gesagt hast. Ich habe dann in unsere Folgenliste geguckt und irgendwie passt alles irgendwie ein bisschen dazu. Ich glaube, an Folgen würde ich das Buch Weggesperrt empfehlen. Das habe ich vorgestellt, da ging es ihm auch um Gefängnis, einfach um diesen Aspekt, warum man die durchaus anders organisieren könnte und was auch das Problem daran ist. Das Buch ist auch dann deutschlandspezifisch. Ein Buch, das auch Prägmann erwähnt, ist das von Michael Sandel, Meritokratie, darüber haben wir auch eine Folge gemacht. Und sonst, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich finde, viele unserer Folgen sind irgendwie anschlussfähig. Ich finde, du hast da eine gute Auswahl schon getroffen. An sonst Literatur schließe ich mich gleich an. Du hast die Vereindeutung der Welt angesprochen, das ist von dieser kleinen Reklamserie, was bedeutet das alles? Davon hätte ich gleich drei Empfehlungen zum Buch. einerseits ist das Die Macht der Menschenbilder von Michael Zichi. Da geht es eben halt darum, was Menschenbilder für eine Macht ausüben. Das ist natürlich zentrales Thema auch vom Buch, das ich vorgestellt habe. Dann ein Buch von Catherine Misselhorn Künstliche Intelligenz und Empathie.
Christoph:[1:16:51] Das hat ein bisschen einen anderen Fokus.
Amanda:[1:16:54] Ich fand einfach interessant, wie sie sagt, ja, Empathie ist ein bisschen wie ein Muskel, das kann man auch lernen. Das finde ich ganz interessant an diesem Buch und dann gibt es auch eines von Eleanor Ostrom, Jenseits von Markt und Staat, auch das ist, eine Wirtschaftswissenschaftlerin, die Prägman zitiert, wo es eben sie hat sich eigentlich so ein bisschen gegen dieses Tragedy of the Commons, also die Tragödie der Almende, Tragik der Almende, so dagegen geforscht und ja, spricht dann in dem Buch, der Untertitel ist auch über das Potenzial gemeinsamen Handelns. Und zwei weitere Bücher, die wir noch in den Sinn gekommen sind, das ist einerseits Nudge von Richard Thaler und Sunstein, einfach weil du das auch angesprochen hast, dieses Konzept, ich fand das schon auch noch interessant, wo es eben darum geht, wie kann man gewisse Dinge anstoßen, mit kleinen Nudges halt, mit kleinen Veränderungen.
Amanda:[1:18:03] Ein anderes Buch von auch einem Niederländer glaube ich oder Belgier bin ich sicher, von Raybrook ist Against Elections also gegen Wahlen, wo es auch mal ein ganz anderes, klingt heikel erstmal ja, aber ich finde es sehr cool und ich glaube, er prägt man auch dieses Buch, zitiert er ja, einfach als, was ist möglich, um eben nicht diese, ich sag mal, gewählte, Aristokratie in diesen Modus zu landen, wie wir ihn eben jetzt manchmal haben und jetzt zum Beispiel in den USA insbesondere, der auch immer wieder zu Tage tritt.
Amanda:[1:18:43] Ja, dann noch zuletzt zwei Folgen. Es gibt wohl eine Sternstunde-Philosophie-Folge mit, Brechmann. Ich habe die selber nicht gehört oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber eine, die jetzt kürzlich rausgekommen ist, wo es auch noch um Erziehung und Bildung geht, mit Roland Reichenbach, die fand ich sehr hörenswert, die habe ich schon zweimal gehört, wo es auch eben um dieses Schulmodell geht, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was kann man von Noten halten oder eben nicht und ich fand das irgendwie noch inspirierend, dieses Gespräch.
Christoph:[1:19:17] Sternstunde Philosophie ist natürlich auch wirklich immer toll. Ja, das klang so, als wäre das deine Empfehlung gewesen, ist das richtig?
Amanda:[1:19:26] Ja.
Christoph:[1:19:26] Sehr schön. dann folgt uns gerne in dem Podcatcher eurer Wahl oder auch auf Spotify und wenn ihr mit uns in den Austausch treten wollt dann besucht uns auf zwischenzweideckeln.de und wenn ihr ganz viel Lust habt, lasst uns irgendwo auch gerne fünf oder mehr Sterne da, was auch immer die beste Bewertung ist und wir hören uns in drei Wochen wieder, bis dahin macht’s gut, tschüss
Music:[1:19:51] Music
Der Beitrag 083 – „Im Grunde gut“ von Rutger Bregman erschien zuerst auf Zwischen zwei Deckeln.


