
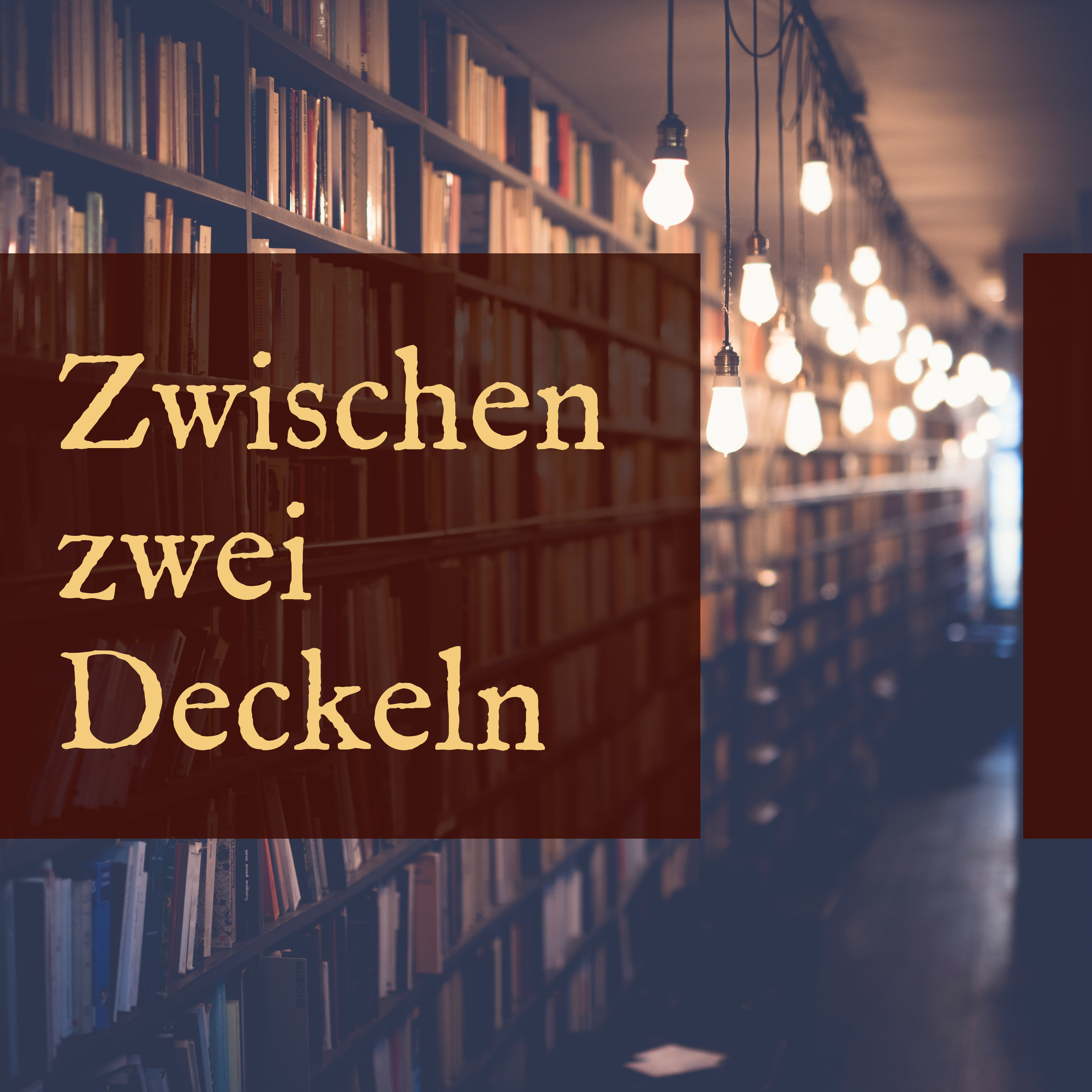
Zwischen Zwei Deckeln
Zwischen zwei Deckeln
Sachbücher zu Wissenschaft, Gesellschaft und dem guten Leben
Episodes
Mentioned books

Apr 4, 2024 • 1h 14min
072 – "Die Faltung der Welt" von Anders Levermann
Auch letztes Mal ging es um Bewältigungsstrategien für globale Probleme wie die Klimakrise. Nach dem marxistischen Ansatz folgt nun ein technischerer Denkansatz.
In “Die Faltung der Welt” schlägt Anders Levermann vor zur Lösung unserer Probleme neue Blickwinkel zu entwickeln. Ausgehend von der mathematischen Idee der Faltung als Grenzsetzung, die innerhalb der Grenzen große Freiheiten erlaubt, sieht er die Möglichkeiten viele aktuelle und akute Probleme durch (teilweise) neue Ansätze gewinnbringend zu lösen.
Shownotes
„Das Rad der Zeit“ von Robert Jordan
Kipppunkte im Klimasystem – Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
Ordoliberalismus – Lexikon der Wirtschaft der Bundeszentrale für politische Bildung
Das Märchen von der Jugend ohne Auto – Süddeutsche Zeitung
ZZD004: „Ökologische Kommunikation“ von Niklas Luhmann
ZZD025: „Narrative Wirtschaft“ von Robert J. Shiller
ZZD037: „Im Wald vor lauter Bäumen“ von Dirk Brockmann
ZZD049: „The Collapse Of Chaos“ von Ian Stewart und Jack Cohen
ZZD057: „Energierevolution Jetzt!“ von Cornelia Quaschning und Volker Quaschning
ZZD058: „Merchants of Doubt” von Naomi Oreskes und Erik M. Conway
ZZD062: „Shape“ von Jordan Ellenberg
ZZD065: „Baustellen der Nation“ von Philip Banse und Ulf Buermeyer
ZZD071: „Systemsturz“ von Kohei Saito
„Short Cuts 5“ von Heinz von Foerster
„Regieren“ von Helmut Willke
Positive Kipppunkte bei der University of Exeter
X-Change Electricity: On track for net zero vom Rocky Mountain Institute
MOOC: Climate.now
„Raus aus dem Ego-Kapitalismus“ von Patrick Kaczmarczyk
„Mission Economy“ von Mariana Mazzzucato
„The Big Myth“ von Naomi Oreskes und Erik M. Conway
„Cannibal Capitalism“ von Nancy Fraser
„The Righteous Mind“ von Jonathan Haidt
„Hyperobjects“ von Timothy Morton
Transkript
[0:00] Music.
[0:14] Herzlich willkommen zur 72. Folge von Zwischen zwei Deckeln, eurem Sachbuch-Podcast.Mein Name ist Christoph und ich habe heute Holger mit dabei. Hallo.
[0:24] Ja, ich freue mich sehr auf die Folge. Ihr wisst natürlich alle schon, was wir heute besprechen, weil ihr ja einfach in den Titel gucken könnt, weil das Buch sowieso auf meiner Leseliste ist.Und jetzt muss ich es eigentlich gar nicht mehr lesen, weil Holger mir das heute vorstellen wird.Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als du geschrieben hast, dass du das vorstellen willst. Aber bevor wir da gleich hinkommen, erst noch die Frage, abseits von dieser Podcast-Vorbereitung, die ja doch meist etwas Zeit braucht, was beschäftigt dich gerade in deinem Leben?Ja, es sind natürlich immer viele Sachen, die einen beschäftigen.Eine Sache, die mir jetzt gerade präsent ist, ist eher eine Sache, die mich nicht mehr beschäftigt.Es werden sich, also Langzeithörer des Podcasts werden sich vielleicht daran erinnern, dass ich früher immer mal erwähnt habe, dass ich dabei bin, The Wheel of Time, also auf Deutsch das Rad der Zeit, zu lesen.Und ich bin jetzt fertig damit.Es war ein größeres Projekt, was auch etwas länger gedauert hat, als ich vorher dachte.Sehr viele Seiten an Geschichte.Eine sehr gut geschriebene Geschichte, die aber zwischendurch auch mal ihre Längen hat.Das ist das, was es dann auch so ein bisschen hingezogen hat.Aber jetzt kann ich sagen, ich habe es also fertig. Und lohnt es sich?Würdest du anderen dieses Monsterprojekt auch empfehlen?
[1:49] Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, was für ein Charakter man ist.Also es gibt durchaus zwischendurch mal so Stellen, wo es sich ein bisschen zieht, wo ich dann auch relativ lange für gebraucht habe.Am Anfang ging es sehr schnell, dann hat es sich zwischendurch gezogen und am Ende ging es auch wieder sehr schnell.Weißt du ungefähr, wie viele Seiten das jetzt insgesamt waren?
[2:14] Ich weiß es nicht also ich meine es sind 14 bücher in der hauptreihe die alle so zwischen 600 und 900 seiten haben okay also klein gedruckt im deutschen wird das dann irgendwie noch aufgeteilt ich glaube auch größer gedruckt da sind das über zwei sie Ich glaube an die 30 Bände, in die sie es aufgeteilt haben. Wahnsinn.Also man kann auf der Wikipedia-Seite nachgucken, wie viele Seiten es sind.Aus dem Kopf weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht.Okay, aber einfach sehr, sehr, sehr viele. Ja, okay.Ja, krass. Dann herzlichen Glückwunsch dazu.Danke. Auf zu neuen Horizonten quasi. Genau.Ich bin jetzt gerade auch noch so ein bisschen in dieser Phase, wo ich überlege, was ich denn als nächstes an Fiktion lesen werde.Da gibt es natürlich auch immer vieles zur Auswahl, auch vieles, was ich hier schon liegen habe.
[3:13] Aber genau, ich bin im Moment noch nicht so ganz entschieden.Habe zwischendurch mal ein Hörbuch von Brandon Sanderson von seinen Secret Projects gehört und überlege jetzt, was ich so richtig da als nächstes lesen werde.
[3:29] Ich wünsche viel Erfolg bei der Auswahl. Danke sehr.Ja, bei mir ist gerade, also jetzt einfach die letzte Woche war einmal Dienstreise von Montag bis Mittwoch und ab Freitag bis Sonntag war ich FreundInnen besuchen, also irgendwie einfach sehr soziallastig, ich bin irgendwie so ein bisschen durch die Republik gefahren, das war aber irgendwie total schön.Hat mir gut gefallen, aber jetzt freue ich mich auch mal wieder zu Hause zu sein, weil irgendwie war ich fast jeden Tag in Zügen.Und das andere ist, ich war in den letzten Wochen erstaunlich viel im Kino.Also ich mag das Kino, also ich mag im Kino Filme sehen sowieso sehr gerne.Und unser lokales Großkino hier hat ab und zu so Filmklassiker am Wochenende quasi.Und die haben zum einen der Pate 1 gezeigt und dann mit ein paar Wochen Abstand auch der Pate 2.Zwei, dann habe ich die jetzt beide mal im Kino gesehen und ja, dann war ich noch in Dune und dann war ich auch letzte Woche, als ich quer durch die Republik gefahren bin, war ich in Berlin, war ich in Zone of Interest zusammen mit einem guten Freund und ja, so ist irgendwie gerade alles sehr kinolastig.Also vier Filme in ein paar Wochen ist für mich sehr viel, muss ich sagen.Ja, damit habe ich mich so rumgetrieben in letzter Zeit. Ja.
[4:47] Ja, also von diesen Filmen habe ich jetzt New Dune auch gesehen. Ja, okay.
[4:53] Die Pate-Filme sind an manchen Stellen nicht so gut gealtert, offensichtlich, aber es sind weiterhin sehr gute Filme, würde ich sagen.Frauen spielen halt faktisch keine Rolle, das ist schon extrem.Also ich glaube, den Best-Day-Test überleben die nicht.
[5:13] Ja, ich meine, ohne die Filme jetzt gesehen zu haben, es gibt Filme, wo ich dann auch nicht weiß, ob dieser Test so zwingend nötig ist.Weiß ich nicht, wenn man jetzt einen Film hat wie 300, der natürlich auf gewisse Art auch sehr, wo man sehr viel drüber streiten kann, wenn da jetzt irgendwie keine große Frauenrolle drin ist, dann ist es so, naja gut, ergibt in dem Film auch gar nicht so viel Sinn.Ja, also ich muss sagen, in dem Pate-Kontext hätte man das glaube ich sicherlich auf jeden Fall hinkriegen können. Naja, aber so, ja.Sollen wir zum Buch von heute kommen? Untertitelung des ZDF, 2020.
[6:01] Ja, du hast uns mitgebracht die Faltung der Welt von Anders Levermann.Herr Levermann leitet die Abteilung für Komplexitätsforschung am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung und ist selbst Physiker und in dieser Rolle auch Professor an der Uni Potsdam und zwar am Institut, glaube ich, für Physik und Astronomie.Oder, ja, also wir haben die Beschreibung seiner Professur nicht gefunden, aber das ist ja auch nicht so schlimm.Ja, und wie eingangs schon gesagt, ich freue mich da tatsächlich sehr drauf.Ich habe, und das muss ich nochmal rausfinden, ich habe irgendwann ein längeres Interview mit ihm gehört vor ein paar Monaten und seitdem habe ich eben dieses Buch auf der Leseliste.Und ja, das ist bei Ullstein 2023 erschienen und ich bin gespannt, was du uns dazu erzählen kannst.
[6:53] Ja, also dann fange ich einmal mit einer kurzen Zusammenfassung an.In die Faltung der Welt schlägt Anders Levermann vor, zur Lösung unserer Probleme neue Blickwinkel zu entwickeln.Ausgehend von der mathematischen Idee der Faltung als Grenzsetzung, die innerhalb der Grenzen große Freiheiten erlaubt, sieht er die Möglichkeiten, viele aktuelle und akute Probleme durch teilweise neue Ansätze gewinnbringend zu lösen.
[7:22] Mhm. So wie ich das damals verstanden habe, geht es ja für ihn darum, quasi neue oder Wachstumsmöglichkeiten mit begrenzten Ressourcen zu entwickeln oder so ähnlich.So habe ich das zumindest damals verstanden und bin gespannt, wie er da die Gesetze der Physik austricksen möchte.Also falls ich überhaupt recht habe mit der Beschreibung, aber für mich klang das nach Ideen von Entkopplung und da bin ich gespannt, ob das stimmt.Ja, im Grunde, das ist schon auch zumindest eine seiner Ideen, ja.Aber das Interessante ist…Ist, glaube ich, auch so ein bisschen wie der Ansatz ist. Also ich muss gestehen, als ich so sozusagen beim ersten Mal durchs Buch habe ich an vielen Stellen gedacht, naja, das ist jetzt nicht so wirklich neu und revolutionär.Ein paar sind schon auch viele spannende Ideen dabei, wo er aber auch selber sagt, es sind eher Vorschläge und auf andere Leute verweist, die diese Ideen schon hatten.Und ich glaube auch sozusagen mit etwas mehr Reflexion, dass das auch gar nicht seine Intention ist, sondern ich glaube, ihm geht es darum, neues Framing zu geben, um diese schon bekannten Ideen irgendwie besser.
[8:43] Nutzen zu können und vielleicht auch Leute besser davon überzeugen zu können.Aber dazu dann vielleicht noch etwas mehr im Verlauf. Ja, gerne, gerne. Gerne. Ich lasse dich einfach rein starten.Genau. Also wie das bei solchen Büchern häufig so ist, fängt er erst mal ein bisschen an, so ein paar Grundprinzipien zu erläutern, auf die er eingehen möchte.
[9:12] Dann zum einen sind das einfach Prozesse, ich sag mal, aus dem Denken der Wissenschaft, der Komplexitätsforschung, wo dann auch so ein bisschen der Physiker rauskommt natürlich wieder.Das sind Dinge, die hat man wahrscheinlich schon häufiger mal gehört.Das sind Dinge wie eine Selbstverstärkung.Das wird im Sinne der Klimakrise kommt das ja auch immer wieder vor, dass ein Prozess, wenn er einmal über einen bestimmten, dass ein Prozess, der einmal gestartet ist, sich sozusagen selber am Laufen hält, wenn man nicht aufpasst.Er weist auch noch mal darauf hin, das fand ich ganz spannend, weil das nicht so oft, glaube ich, in solchen Büchern gemacht wird, so explizit, dass man immer auch überlegen muss, in welchen Größenordnungen denken wir?Also was ist die Skala, auf der wir denken?
[10:11] Er hat dann dieses schöne Beispiel, das ist mir sehr im Kopf geblieben, wo er dann gesagt hat, eine Entfernung von vier Kilometern kann ich mir recht gut vorstellen, aber eigentlich nur als Weg.Wenn ich mir vorstelle, dass es vier Kilometer in die Höhe geht, das kann ich mir nicht vorstellen, obwohl das, wenn man sich jetzt mit der arktischen Eisdecke beschäftigt, eine Größenordnung ist, die da vorkommt.Aber was das genau heißt, ist etwas, was selbst ihm, der sich seit…Sehr langer Zeit damit beschäftigt, irgendwie immer noch nicht so richtig vorstellbar ist. Ja, spannend.Und das ist natürlich auch was, was, wenn man jetzt die ganze Klimasituation betrachtet, natürlich auch Teil des Problems ist, dass wir einfach auf Zeitskalen sind, die für uns sehr schwer vorstellbar sind.
[11:07] Also ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ich glaube, wer da wirklich alle Details haben will, der kann das auch in diesem Buch oder auch in anderen Büchern nochmal nachlesen, geht er nochmal so ein bisschen dann aufs Klima ein, weil das natürlich, würde ich schon sagen, es ist nicht das einzige Problem, mit dem er sich beschäftigt, aber ich würde sagen, es ist das akuteste oder das extremste Problem. Ja, okay. Okay, ja.
[12:07] Abgestrahlt wird und ein Teil dann zurück zur Erde geht. Und wenn wir mehr davon haben, heißt es eigentlich, dass mehr Wärme auf die Erde zurückgestrahlt wird und nicht in den Weltraum entkommt.Weist auch hier nochmal auf Kipppunkte hin, die dann abrupte Übergänge in neue Zustände sind.Also als Beispiel, als extremes Beispiel wäre da jetzt wieder sowas wie, ich glaube im Buch ist er an der Stelle, redet er über Grönland, aber dasselbe gilt natürlich auch für die Antarktis.Wenn da die Eisdecke abschmilzt aufgrund des Treibhauseffekts, dann ist das erst mal was, was noch kein Kipppunkt ist, solange noch genug da ist, dass wenn es wieder kühler werden würde, dass die dann einfach wieder sich langsam aufbaut.Irgendwann gibt es aber den Punkt, wenn einfach kein Eis mehr da ist.Und wenn kein Eis mehr da ist, dann ist der Kipppunkt. Dann wird das auch nicht ohne weiteres wieder wachsen, selbst wenn es abkühlt, sondern da muss halt schon viel mehr passieren, dass man da vielleicht wieder irgendwie so eine Eisschicht aufbauen würde.Es ist nebenbei auch ein ganz gutes Beispiel für solche.
[13:28] Rückkopplungseffekte, also solche selbstverstärkenden Effekte, weil je weiter dieser Eisschirm abschmilzt, desto, Und stärker kann er weiter abschmelzen, was einfach daran liegt, dass, also je höher man in die Atmosphäre kommt, desto kälter wird es. Ja.Und das heißt, die oberste Schicht, auch die ist, die normalerweise abschmilzt, die hat halt mehr, sozusagen ist in der kälteren Umgebung, also wird sie weniger schmelzen.Und wenn es dann tiefer geht, dann ist die Umgebung schon wärmer, das heißt, allein dadurch wird im Zweifelsfall schon mehr schmelzen. Ja, okay.Also das kann man im Grunde, kann man daran auch direkt so ein bisschen die Problematik sehen, vor der wir stehen mit der Klimakrise.
[14:22] Er weist auch nochmal drauf hin, das fand ich ganz spannend, das wird so selten gemacht, dass es allerdings auch nicht so ist, dass sozusagen, wenn wir irgendwie eine bestimmte Grenze der Erwärmung überschritten haben, dass es dann einfach zu spät ist und sich immer weiter, weiter erwärmt bis irgendwie ins Unendliche.Sondern die Erde hat schon einen Regulierungsmechanismus über die Abstrahlung, Wärmeabstrahlung, die sie macht, aber der braucht halt Zeit, um sich einzubalancieren und würde sich dann natürlich bei einer höheren Temperatur balancieren, aber es ist sozusagen, es wird an irgendeinem Punkt aufhören.
[15:03] Ja, okay. Das Problem ist nur, solange wir CO2 weiter in die Atmosphäre blasen, führt das halt weiter zu einer Erwärmung und dieser Balanceakt oder diese Balance wird erst dann beginnen, sich wieder einzustellen.Und auch das ist ein Prozess, der Zeit braucht.Und Zeit, sagen wir mal optimistisch, reden wir da wahrscheinlich von Jahrzehnten, wenn nicht mehr Zeit.Und dieser Prozess wird erst dann einsetzen, wenn nicht mehr CO2 in die Atmosphäre kommt. Okay, ja.
[16:06] Selber auf.CO2 in die Atmosphäre zu blasen oder wir hören halt auf, wenn keins mehr da ist, was wir hochblasen können.Aber dann enden wir halt auch mit sehr viel höheren Temperaturen als…
[16:21] Das klingt nach einem recht theoretischen Ansatz, um ehrlich zu sein.Das klingt sehr nach, naja, also ich glaube, wir sollten tunlichst vermeiden, einfach alles zu verbrennen, was wir noch haben.Nein, also das sagt er ja auch nicht, aber das ist… Genau, genau.Also das ist erstmal so ein bisschen zur Rahmensetzung. Wo er dann vielleicht auch so ein paar, vielleicht sehr trockene Naturwissenschaftler an ein paar Punkten ist und sagt, naja, sozusagen versucht etwas sachlicher ranzugehen, ohne Panikmache, aber doch schon sagt, das ist ernsthaft.Und er kommt dann auch zu dem Schluss, also eigentlich ist das Einzige Sinnvolle zu sagen, null Emission.Das muss unser Ziel sein und das möglichst schnell.Aber er sagt eben auch realistischerweise, wenn man sich einfach anguckt, wie die Welt aussieht, ist das jetzt etwas, was eine gewisse Zeit braucht, um das zu erreichen.Ja, ja. Also das ist das, was er sagt.Und ich denke, das ist was, wo die meisten Menschen mitgehen können.Also wir werden es nicht schaffen, dieses Jahr auf Null Emissionen weltweit zu kommen.Also ich wüsste jetzt auch nicht, ob irgendein Land es schaffen kann, dieses Jahr auf Null Emissionen zu kommen, außer eins vielleicht, das sowieso nicht viele Emissionen hat oder in dem das halt irgendwie verlagert wird.
[17:44] Also ich weiß nicht, jetzt ein kleines Land wie Lichtenstein könnte vielleicht alle Stromerzeugung einfach in die Nachbarländer auslagern und dann theoretisch selber auf Null Emission sein, aber das hilft ja nichts.Also das wäre dann ja irgendwie auch Schönfärberei letzten Endes.
[18:02] Aber es ist schon relativ klar, er sagt relativ klar, nachdem er so ein bisschen erläutert hat, wie es ist und wie das Klimasystem funktioniert, was da eine Rolle spielt, sagt er eben auch, selbst wenn manche Sachen, die gesagt werden, Panikmache sind, aber es ist das einzig Sinnvolle, ist zu sagen, wir müssen auf Null Emission, Punkt.Mhm, ich meine, das wird ja in manchen Industriezweigen nicht gehen, also gerade so Zementherstellung ist ja meines Wissens einfach noch nicht CO2-neutral möglich und dann brauchen wir halt manchmal für so den letzten Rest an Emissionen brauchen wir Carbon Capture and Storage oder Usage, aber insgesamt Netto-Null müssen wir erreichen, ja klar.Ja, wobei ich glaube, wenn ich ihn richtig verstehe, wäre es ihm am liebsten, wenn man einfach auch aus aller Technologie das rausnimmt, weil er eben auch sagt, Carbon Capture schafft nur sehr wenig.Ja, ich wollte nur das formale Argument machen, dass wir für die letzten paar Prozent die Technologie brauchen.Nein, aber wir sollten sonst erstmal alles andere nutzen, das ist völlig klar.Ja, aber das geht so ein bisschen in die Richtung, wo er dann hin will, weil es geht ihm auch darum, die Technik in die richtige Richtung zu lenken.
[19:24] Ja, er sagt dann auch nochmal, dass er im Prinzip, also er ist kein Wachstumsfeind, sondern er sagt schon, dass das Wirtschaftswachstum, wirtschaftlicher Fortschritt hat der Menschheit viel gebracht.Ja, da kann man jetzt sicherlich, weiß ich nicht, ob jetzt in jeder seiner Aussagen Historiker da genau mit übereinstimmen würde, aber es ist schon so, der sagt, wir haben, wir beobachten mit wirtschaftlichem Wachstum geht es den Menschen besser, Dinge wie Frauenrechte, ja, zum gewissen Grad auch Entwicklung von Ideen wie Menschenrechten, das ist alles daran gekoppelt, dass man wirtschaftliches Wachstum hat.Ja, ich glaube, ich würde da im Schnitt mitgehen.Aber, ne, das…Ist vielleicht auch eine etwas persönliche Präferenz.
[20:50] Also auf jeden Fall sagt er relativ klar, er möchte eigentlich die Kraft des kapitalistischen Wirtschaftssystems erhalten.Es ist aber auch so, er sieht auch Probleme, die es gibt.Das kommt dann in späteren Kapiteln, wo er auch nochmal da Vorschläge macht, wie man das so ein bisschen einschränken kann.Bevor wir da hinkommen, kommt er aber erst mal zu der Idee, also dieser mathematischen Idee der Faltung.Also schon im Vorwort sagt er, also er benutzt keine Formeln, sondern benutzt Mathematik einfach als ein in sich geschlossenes logisches Denksystem. Ja.Was sehr nützlich ist, wo er dann auch sagt, im Grunde kann man Mathematik benutzen, um in sich schlüssige Gedanken zu entwickeln.Wenn man Dinge in Mathematik und aus der Mathematik zurück übersetzen kann und sozusagen die Fehlerquelle ist immer diese Übersetzung.Okay, ja. Genau. Und er nimmt dann diese Idee der Faltung.
[21:57] Kleine Anmerkung, ich glaube, er nimmt das konkrete Verständnis aus der Mathematik der komplexen Systeme.Das wird aber auch, also diese reine mathematische Operation wird auch in anderen Zusammenhängen benutzt und wird da vielleicht anders interpretiert.Aber diese Idee, die er nimmt aus der Mathematik der komplexen Systeme, ist im Grunde eine Begrenzung des Raumes.Ja, jetzt muss ich nämlich aufpassen. Jetzt muss ich gucken, wie ich gedanklich mitkomme. Also eine Begrenzung des Raumes der Möglichkeiten.Um das klarzumachen, das ist eigentlich was, das ist bei ihm im Vorwort, aber ich glaube, das ist an dieser Stelle gut, um darzustellen, was er meint.Also er beschreibt das schon im Vorwort, wenn ich mir hypothetisch vorstelle, ein irgendwas, was gerade fliegt, kleinen Ball oder so, der gerade durch den Weltraum fliegt.
[23:05] Der hat dann sozusagen alle Möglichkeiten, gerade zu gehen.Und er sagt, unterstellen wir mal, dass für diesen Ball irgendwie die beste Idee ist, ich bewege mich immer weiter vorwärts.Ja, ich bin glücklich, wenn ich mich gerade vorwärts bewegen kann.Das heißt aber auch, wenn er durch irgendwas abgelenkt wird, also wenn er in der Nähe einer Sonne kommt oder so und sein Weg abgelenkt wird oder er in einen Stern reinfällt oder so, dann ist er unglücklich.Und natürlich, wenn er einmal abgelenkt ist und sich woanders hin bewegt, dann wird er nie mehr glücklich sein können, weil er sich nicht mehr in die richtige Richtung bewegt.
[23:41] Wenn ich jetzt die Idee der Faltung reinbringe, dann heißt das letzten Endes, dass ich die Möglichkeit für diesen Ball, sich zu bewegen, in irgendeiner Form einschränke.Aber es kann auch heißen, dass der Ball, wenn er jetzt intelligent ist, auch in der Lage ist, seine Meinung zu ändern.Dass er vielleicht nicht mehr denkt, es muss immer dieselbe Richtung sein, Sondern solange ich mich irgendwie vorwärts bewege, bin ich glücklich, auch wenn ich dabei vielleicht eine Kurve mache.Okay, ja. Und als Extrembeispiel sagt er dann, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ball habe oder ein Molekül oder sowas, was sich in der Erdatmosphäre bewegt und an die Erdatmosphäre gebunden ist und es glücklich ist, solange es sich bewegen kann.
[24:32] Dann hat es eine enorme Möglichkeit, wo es sich überall hinbewegen kann, nämlich überall, wo Erdatmosphäre ist.Aber es ist trotzdem frei und nicht eingeschränkt.Das ist so ein bisschen gemeint mit dieser Idee, den Raum einzuschränken.Es geht nicht darum, zu sagen, ich sperre jetzt irgendwen in eine Zelle.Das wäre jetzt irgendwie eine nicht so schöne Einschränkung.Aber faktisch ist es ja so, dass wir alle sind faktisch ja eingeschränkt darin, wo wir uns bewegen können.Weil wenn wir jetzt nicht gerade irgendwie ein verrückter Milliardär sind, haben wir als normaler Mensch keine Möglichkeit, um weit weg von der Erdoberfläche zu kommen zum Beispiel.Oder uns jeden Tag einfach ganz beliebig um die Welt fliegen zu lassen.Selbst das ist ja… Ja, aber genau, also selbst wenn du faktisch irgendwie auf so einem Bewegungsradius von, sagen wir mal, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Auto etc., so im faktischen Leben, die meiste Zeit sind wir auf so einem Radius von, sagen wir mal, 50 Kilometer irgendwie eingeschränkt.Aber ich würde sagen, die meisten von uns fühlen sich trotzdem nicht unfrei.Ja, ja, okay, ich glaube, jetzt habe ich den Twist quasi verstanden. Genau.Und die Faltung ist sozusagen einfach so eine Einschränkung dieses Möglichkeitenraums.
[26:01] Und eben das, was ihm dann wichtig ist, damit das in der Art, wie er das jetzt denkt, gesellschaftlich, damit das funktioniert, müssen wir da aber auch, wir müssen bereit sein, solche Grenzen anzuerkennen und müssen uns auf Grenzen einigen, wo er auch sagt, wir müssen uns als Gesellschaft auf bestimmte Grenzen einigen.Oh, Gesellschaft, mein liebstes Kollektiv-Singular. Die Gesellschaft muss sich einigen, dass du es… Ja gut, aber…So ist es ja nicht falsch, aber… Also wir Physiker vereinfachen ja auch gerne Dinge.
[26:40] Also da, wo wir denken, dass es möglich ist. Und wenn wir von was keine Ahnung haben, dann gehen wir da idealerweise nicht zu sehr ins Detail.Also es ist wichtig, dass wir solche Grenzen haben, dass wir die setzen und dass wir das aber auch in unserem Wertesystem mit reinnehmen.Und dass wir diese Grenzen auch dann als etwas Positives sehen.Um wieder zu der Null-Emission zurückzugehen, würde das dann heißen, die Null-Emission kann man jetzt natürlich sehen als, oh nein, wir werden eingeschränkt, wir können ja nicht mehr wie bisher und wie wirtschaften.Das ist, glaube ich, relativ klar, dass das Wirtschaftssystem, wie es im Moment ist, ist halt mit Energieverbrauch gekoppelt und unsere Energie kommt immer noch zu einem großen Teil aus Prozessen, bei denen wir CO2 in die Luft jagen. Ja, ja.
[28:03] Aber auch in Deutschland ist unser Endenergieverbrauch insgesamt noch massiv fossil dominiert.Das als Mini-Einschub. Ich finde, das geht häufig in der öffentlichen Debatte kreuz und quer.Dann wird auf den Stromverbrauch geguckt oder die Stromerzeugung und wie der aussieht.Und man vergisst ganz, dass es noch viele andere Energieträger gibt, die viel wichtiger sind quasi.Ja. Aber er würde dann sagen, man kann diese Grenze der Nullemission, kann man auch als Chance sehen, um innovativ zu werden.Das heißt, nicht mehr zu sagen, oh mein Gott, wir müssen uns so einschränken, sondern sozusagen, ah, guck mal, wir haben eine Grenze, die wir zu einem bestimmten Zeitpunkt einhalten müssen.Er hat da mal das Beispiel, sagen wir, 2040.Und wenn ich jetzt weiß oder wenn ich als Industrie weiß, bis 2040 muss ich das schaffen, dann bin ich halt auch motiviert, nach Wegen zu suchen. Ja, ja.
[29:30] Also nicht ein, na, vielleicht können wir das irgendwie noch wegverhandeln und dann ist es doch nicht mehr 2040, sondern diese Grenze, die muss halt sicher stehen, da muss sich jeder drauf verlassen und dann können die Leute sich dem anpassen.Ja, okay. Und er sieht das so ein bisschen einfach, seine Logik ist, dass dadurch mehr Möglichkeiten durchprobiert werden.Er hat dann den Vergleich, wenn ein Hund wartet auf sein Herrchen, Herrchen kommt nach Hause und der Hund läuft zum Herrchen.Das heißt, der läuft genau einen Weg.Der probiert nichts sonst aus, sondern er will zu seinem Herrchen.Und das ist in seinem Bild so ein bisschen, wer das die Planwirtschaft.Und er sagt auf der anderen Seite, wenn ich mir so ein Ameisenvolk angucke, alle Ameisen laufen los, die laufen kreuz und quer, interagieren irgendwie, wenn sie was finden und können dadurch einen viel größeren Bereich viel kompletter absuchen.Ja, und sein Bild ist so ein bisschen, wenn wir diese Grenzen setzen und, ich sag mal, die Wirtschaft ihr Ding machen lassen, angetrieben dadurch, dass sie wissen, diese Grenze kommt und wir müssen das irgendwie lösen, dass dadurch mehr Möglichkeiten ausprobiert werden und die Wahrscheinlichkeit, sozusagen, gute Lösungen zu finden, dafür einfach besser ist.
[30:51] Ja, ja. Ja, also ich habe mich da sehr an die Idee des Autoliberalismus erinnert gefühlt und ich glaube letzten Endes ist es diese Idee auch, nur mit einer etwas anderen Begründung und vielleicht noch mit einer größeren Betonung, dass man halt das mit einer Vision verbinden muss und nicht einfach nur so eine Ordnung setzt.Ja, spannend.
[31:17] Also ich muss dabei auch stark an die FDP denken, ehrlicherweise.Und die Idee, also die ich nicht schlecht finde, oder nicht per se völlig schlecht, dass man eben sehr viel Steuerung darüber erreichen könnte, wenn man einen scharfen CO2-Preis hat.Also da gibt es ja auch die Idee davon, naja, wir besteuern halt oder wir haben einen CO2-Preis, der vermutlich dann auch einschneidend sein muss, darauf muss man sich dann schon einigen und dann wird schon alles in die richtigen Bahnen kommen.Also ich habe immer die Sorge, dass man dann natürlich soziale Härten schnell vergessen kann, wenn man das so regelt, aber ich glaube, rein zum Lenken von wirtschaftlichen Prozessen ist es, glaube ich, nicht das Schlechteste, weil Märkte da, wo sie funktionieren, ja im Schnitt sehr gut funktionieren.Also wenn das Problem passt und dann Märkte auf etwas drauf lässt, dann sind sie ja einfach hochfunktional, nur man darf halt nicht alles Märkten überlassen, aber wenn es auf die passenden Probleme angelegt wird, dann ist es ein sehr gutes Instrument.
[32:23] Ja, also im Grunde würdest du dich mit ihm, glaube ich, sehr gut vertragen, weil das ist mehr oder weniger auch, was er dann als Beispiel bringt, wo er dann sagt, also ein Problem, was wir lösen müssen, ist die Klimakatastrophe.Kohlenstoff ist ja auch ein umstrittener Begriff, aber ein Problem, das wir lösen müssen, ist, wir müssen unser Klima stabilisieren, indem wir, wie er es ja vorher auch schon gesagt hat, indem wir auf Null Emissionen runter müssen und das heißt, wir verbrennen keinen Kohlenstoff mehr.Ja, weil da, egal was irgendwelche Leute behaupten, es ist einfach physikalischer Fakt, wenn ich Kohlenstoff verbrenne, landen davon zwei Drittel in der Atmosphäre und tragen zum Treibhauseffekt bei.Ja, egal was irgendwer sonst irgendwie behauptet, das ist eigentlich relativ klar.Kleine Randnotiz, auch wenn er das jetzt nicht gesagt hat, aber meines Wissens ist das eigentlich auch schon seit mehr als 100 Jahren bekannt.Man hat halt nur nicht lange Zeit nicht gedacht, dass das ein Problem wird.Ja, die ersten Zeitungsartikel dazu sind ewig alt.Ist ein bisschen wie bei den Tabakstudien damals auch.Also lange war Rauchen ja auch ganz gesund, weil die, weil entsprechend motivierte Unternehmen das entsprechend beforscht haben.Und genau, doch, nee, nee, Klimaerwärmung ist auch schon lange bekannt, aber wurde halt lange verschleiert.
[33:52] Ja, beziehungsweise von den Forschern am Anfang auch dann gesagt, ja, so viel blasen wir ja gar nicht in die Atmosphäre, dass das einen Effekt hat.Und dann an dem Punkt, wo es dann langsam klar wurde, da gab es dann auch wieder, wie sagt man das, Lobbying und Marketing, um davon abzulenken.Genau, dazu haben wir ja auch schon mal was in mindestens einer Folge gehabt. Habt.
[34:19] Genau, aber genau, also er macht dann auch wirklich mehr oder weniger in dem Vorschlag, wie jetzt gerade.Er betrachtet dann nochmal Zertifikatehandel und also er vergleicht Besteuerung, CO2-Besteuerung und Zertifikatehandel und spricht sich für den Zertifikatehandel aus, weil er denkt, der ist direkt da und steuernder, weil er sagt, naja, wenn ich jetzt einfach das besteuere.
[34:47] Mein eigentliches Ziel ist ja Null Emissionen und das kann ich konkreter ansteuern, wenn ich einen vernünftigen Zertifikatehandel habe, wo einfach jedes Jahr die Zertifikate weniger werden.Und dann ist halt klar, zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt es keine mehr und dann darfst du halt auch nichts mehr ausstoßen.Ja, okay, das ist irgendwie eingängig, finde ich.Und dann ist sozusagen die Idee, dass wenn die Industrie weiß, das ist wirklich eine harte Grenze und das wird durchgezogen und er spricht da auch positiv über den Zertifikatehandel in der EU, wo er sagt am Anfang, also durchaus anerkennt, dass das am Anfang nicht so gut geklappt hat, auch deswegen, weil man die Zertifikate relativ freigiebig verschenkt hat.Ich wollte gerade sagen, es waren einfach sehr viele Zertifikate, die nicht sonderlich viel Druck ausgeübt haben, oder? Genau.Am Anfang wurden die komplett verschenkt, was man, wenn man jetzt böse ist, dann auch sagen könnte, das war dann letzten Endes eine Industrie-Subvention, weil die Firmen das schon eingepreist haben, aber nichts dafür bezahlen mussten.Also das war eher zum Schaden des Verbrauchers.
[36:01] Inzwischen, dann gab es halt zwischendurch einfach nach der Finanzkrise gab es insgesamt weniger Verbrauch, dann hat es auch nicht so richtig funktioniert, aber inzwischen pendelt es sich wohl da ein, dass es irgendwie auch zu einem nützlichen Instrument jetzt wird. Ja, sehr gut.Für die Firmen, wenn ich das richtig verstehe, ist so ein Zertifikatehandel manchmal insofern schwierig, als dass der EU-Zertifikatehandel nicht so direkt, dadurch dass es halt gehandelt wird, die Preise vorher nicht so ganz klar sind.Also man weiß nicht ganz, was man eben für eine Tonne CO2 bezahlen muss.Das macht es manchmal wohl etwas diffizil in der Planung.Da ist sicherlich für Firmen manchmal einfach für die Kalkulation eine Steuer, ja, einfach rechnerisch einfacher.Aber ich verstehe sein Argument, dass so ein Zertifikatehandel natürlich deutlich direkter wirkt und du kannst dich dann natürlich irgendwann auch nicht mehr freikaufen, wenn es halt einfach keine Zertifikate gibt, ne? Also ich meine ….
[37:23] Ja, so. Er diskutiert das jetzt nicht, aber ich vermute mal, er würde das eigentlich sogar als ein Plus sehen.Ja, ich bin ja beruflich mit Transformation und Dekarbonisierung der Wirtschaft befasst und merke da, wie diese großen Industrietanker quasi, die ihre Produktion umstellen wollen und ich unterstelle denen tatsächlich auch sehr ernsthafte Absichten.Und ich glaube, mittlerweile auch teilweise stehen da auch manifeste ideologische Überzeugungen hinter, also nicht nur Wirtschaftsmodelle.Also da würde ich in Anschluss an Stefan Kühl sagen, dass das reine Gewinnstreben nicht unbedingt das ist, wohinter sich moderne betriebswirtschaftliche Organisationen versammeln, sondern dass es durchaus multiple Zwecke geben kann.Und da merke ich, dass für die, also da ist meine Perspektive dann insofern eben schon ein Stück weit diese Planungsperspektive, weil die sagen, naja, wir brauchen schon Sachen, mit denen wir irgendwie konkret planen können, wenn das alles sehr unsicher ist, dann macht es das für uns extrem schwierig und zerstört im Zweifel das Geschäftsmodell und dann kriegen wir diese Transformation einfach nicht auf die Kette.Also muss man da sicherlich irgendwie, das muss man, denke ich, einfach nur mitdenken und im Blick behalten, wobei ich seine Argumentationslinie da durchaus stringent finde, also es ergibt schon Sinn, ja.
[38:47] Ja, es ist auch, er erwähnt auch die Idee des Klimageldes, dass man das auch nutzen kann, um die Bevölkerung mitzunehmen, dass bei denen nicht alles landet, diskutiert das jetzt aber nicht weiter im Detail.Ich fand es halt nur ganz spannend, dass er diese Idee auch reinbringt, die ja, ich meine, theoretisch auch Ziel unserer aktuellen Regierung ist, die dann aber mit irgendwelchen seltsamen Argumenten dann irgendwie doch nicht durchgesetzt wird.Ja, es ist mehr als skurril, das muss man ehrlich sagen.
[39:25] Er hat aber noch einen zweiten Punkt im Sinne Nachhaltigkeit und das ist, dass er sagt, dass wir eigentlich auch in unserem Denken dahin müssen, mehr in einer Kreislaufwirtschaft zu denken.Wo er sagt, er setzt zum Beispiel, dass es ja vielleicht auch eine Änderung im Wertesystem sein könnte, wenn man zum Beispiel sagt, naja, vielleicht wird es als erstrebenswert angesehen, ein Auto möglichst lange zu fahren.
[39:53] Und nicht irgendwie viele neue Autos zu kaufen.Oder er sagt auch, dass man ja schon beobachten kann, dass so jetzt in der jungen Generation, dass es dann nicht mehr so sehr um das Statussymbol Auto geht, sondern um einfach die Idee der Mobilität, die natürlich auch anders umgesetzt werden kann.Gut, aber es werden gerade in der jungen Generation in den letzten Studien sagen, es wurden nie so viele Autos verkauft wie jetzt.Und da muss ich sagen, also wenn er einerseits diese Idee von einer sehr, also ich finde das klingt ja sehr marktliberal im Prinzip, was er aufmacht, dann irritiert mich, wenn man andererseits, also ich begrüße die Idee einer Kreislaufwirtschaft sicherlich, verbunden aber mit dem Ideal, dass man, also das ist natürlich ideell schön, wenn man Dinge lange nutzen möchte, passt aber sicherlich nicht ganz zu dem, zu der Notwendigkeit, des Gewinnstrebens von Unternehmen.Wie bringt er das zusammen? Also welches Interesse sollte VW daran haben, dass ich meinen Neuwagen 20 Jahre fahre?Das ergibt überhaupt keinen Sinn für VW oder Mercedes oder BMW oder BYD oder wen auch immer.Ja, ich denke, er hat eher das Bild, dass man eine Recyclingwirtschaft aufbaut. Ah ja, okay. Ja gut.
[41:12] Und dass das dass teilweise sich mit dem Denken ein Umdenken passiert und dass wir letzten Endes dahin kommen müssen, dass wir sagen, Ressourcenabbau ist kostspielig, die Ressourcen sind beschränkt.Und das heißt, wir müssen letzten Endes versuchen, die Sachen möglichst oft wiederzuverwenden im Sinne von so einer Recyclingwirtschaft, Wirtschaft, die natürlich auch Energiekosten haben wird, das ist auch wieder Physik, die, Sachen wieder nutzbar zu machen, musst du halt Energie reinstecken, aber einfach, also ist jetzt auch nicht so ein Punkt, den er extrem ausführlich bespricht, aber es ist einfach, dass er neben dem Klima sieht er eben auch dieses Rohstoffproblem, wo er sagt.
[42:07] Wir müssen mehr dazu hinkommen, die Sachen zu recyceln und letzten Endes Richtung einer Kreislaufwirtschaft zu gehen. Ja, das kann ja in Teilen auch günstiger sein mit den passenden Technologien.Also ich meine, ich bin jetzt gerade gedanklich, weil ich ja beim Auto und da kann man ja bleiben, wenn wir da Batterien, diese großen Batterieblocker haben und nicht mehr nur das Lithium aus der Erde holen, sondern eben alte Batterien wieder auffrischen.Da sind ja dann teilweise auch nur einzelne Batterieblöcke kaputt.Die entladen ja nicht über die Fläche gleichmäßig, sondern einzelne Zellen fallen quasi aus.Dann kann das ja durchaus auch für den Hersteller günstiger sein, sowas wieder aufzufrischen, anstatt dass man irgendwie in den Bergbau da investiert.Also ich glaube, das kann dann natürlich funktionieren.Ja, also er macht auch den Vorschlag, dass man zum Beispiel einfach Plastik verbieten könnte. könnte, um so das ganze Mikroplastik-Problem anzugehen und dann sagen, ja, da müssen die Firmen halt andere Lösungen finden.Wobei die Sache, wo ich ihn etwas schwammig finde, ist, wie man das dann am Ende wirklich durchsetzt.Das ist so ein bisschen schwammig, finde ich, was er da vorschlägt. Ja.
[43:22] Boah, und also, ja, ein Leben ohne Kunststoff, das wäre spannend.Ja, aber wie gesagt, das ist halt diese Idee, zu sagen, wir sehen diese Faltung als, wir sehen das als eine Vision und wir einigen uns darauf, was wollen wir ändern und dann setzen wir eine Grenze, geben halt eine bestimmte Zeit, um das zu lösen und haben dann, ich sag mal, den Optimismus, dass dann auch eine Lösung gefunden wird, wenn die Zeitskala vernünftig ist.Ich muss sagen, auf so einer global-galaktischen Ebene finde ich das sehr eingängig, weil man da eben mit sehr großen Komplexitätszusammenhängen und Systemen zu tun hat.Also wenn man sagt, wir müssen netto null CO2-Emissionen haben, finde ich das eine sehr eingängige Variante, um da hinzukommen.Aber bei einem engeren Problemzuschnitt, wie zum Beispiel, wir könnten Plastik einfach verbieten, bin ich mir tatsächlich gar nicht mehr so sicher, wie gelungen ich das finde.Weil ich mich da frage, das ganze Thema der unbeabsichtigten Nebenfolgen in einem System, was quasi unbegrenzt oder extrem groß ist, wie bei CO2.
[44:30] Dass man da bespielen möchte.Das Problem ist sehr, sehr groß und dadurch ist die Lösung, die Regel, die man vorgibt, auch sehr abstrakt.Würde ich sagen, die unbeabsichtigten Nebenfolgen sind nicht so groß.Aber bei sowas wie Kunststoffverbot frage ich mich, wie viele Nebenfolgen handelst du dir ein, die du vorher nicht so ganz absehen kannst?Also keine Ahnung, haben wir dann auf einmal einen enormen Energieverbrauch, weil wir alles Mögliche aus irgendwelchen Metallen herstellen müssen.Wenn ich mir vorstelle, ich gucke hier gerade raus und hier stehen gerade heute die Altpapier- und Leichtverpackungstonnen draußen, wenn die alle durch was anderes ersetzt werden müssen, ist da der Ressourcenverbrauch irgendwo anders dann ja enorm groß.Also das sind so Sachen, mir scheint, ich weiß nicht, ob ich die Lösung für kleinteiligere Probleme besonders gut finde. Gibt das Sinn?
[45:20] Ja, wobei ich anmerken muss, es geht ja nicht um ein Kunststoffverbot allgemein, sondern um ein Plastikverbot. Achso, okay, ja gut.Also du könntest das natürlich ersetzen durch, ich sag mal, biologisch besser abbaubare Kunststoffe, weil das Kompliment für ein Plastikverbot ist, dass dieser Plastik sich überall irgendwo dann einschleicht und wir nicht genau abschätzen können, was für Folgen das denn, ich sag mal, im ganzen Biosystem zum Beispiel dann hat.Und dann würde man sagen, vielleicht sollten wir von diesem Plastik weg und ich glaube, der Grund ist vor allem, dass das halt nicht biologisch abbaubar ist.Aber wenn du jetzt einen Kunststoff, der dann ja auch kohlenstoffbasiert sein kann, entwickelst, wo du halt einfach weißt, okay, wenn ich den irgendwo in der Pampa liegen lasse, dann baut der sich halt biologisch ab, dann hätte er jetzt wahrscheinlich kein Problem mit.
[46:13] Aber auch da würde er wahrscheinlich sagen, Er sagt auch, er macht Vorschläge.Er sagt jetzt nicht, das ist jetzt das, was wir machen müssen, sondern er will einfach Vorschläge geben.Ich glaube auch einfach, um so ein bisschen Denkhorizonte zu öffnen.Das ist ja auch spannend.
[46:33] Wobei ich sagen muss, was ich spannender finde, ist, er macht sich auch Gedanken über eher wirtschaftliche Probleme.Und beschreibt dann auch das Problem der Too-Big-To-Fail-Unternehmen, wo man gesagt hat, wir können die nicht untergehen lassen, der Staat muss die retten, weil sonst das System zusammenbricht.Wo dann auch sagt, nach der Wirtschaftskrise wurde dann, hat Obama wohl gesagt, wir müssen verhindern, dass es solche Unternehmen weiter gibt, aber da ist halt nichts passiert.Wahrscheinlich würde man heute sagen, es ist eher schlimmer. Ja, wir waren.Man kann sich ja mal überlegen, was passiert, wenn irgendwie eine der großen Tech, eins der großen Tech-Unternehmen untergeht.
[47:18] Also rein von der Börsenspekulation waren wir, ich habe neulich ein Buch aus 2014 gelesen, das werde ich am Ende auch empfehlen.Und genau zu dem Zeitpunkt 2014 war die Spekulation auf dem gleichen Niveau wie quasi vor der Finanzkrise wieder.Also rein von den Gates, um die da bewegt wurden und so. Also da war offenbar begrenzt die Lerneffekt. Also schauen wir mal.Ja, aber er hat eigentlich einen ganz spannenden Vorschlag, wie man da rangehen könnte.Also da verweist er auch darauf, dass der nicht von ihm erdacht wurde.Ich fand ihn aber spannend.Also mir war ja auch neu, dass man halt die Unternehmenssteuer so gestaltet, dass die ab einer bestimmten Unternehmensgröße halt so hoch ist, dass es sich nicht lohnt, ein so großes Unternehmen zu haben.Ja, spannend.
[48:36] Dann durch, dass er sagt, es ist eigentlich, das Problem ist, dass die Kartellbehörden, die ja eigentlich dafür da sind, um zu verhindern, dass es solche Riesenunternehmen gibt, dass die einfach durch die Art, auch wie sie gebildet sind, dass sie einfach zu langsam agieren können, weil sie, sie müssen sich immer Einzelfälle angucken und das kostet natürlich Zeit, Aufwand etc. Etc.Und unter Umständen, sie sehen es dann erst, wenn es schon ein Problem ist.Und das ist halt ein Vorschlag von ihm, das ganze, das System schon in sich so zu gestalten, dass es einfach aus System inherent ist, dass Unternehmen gar nicht größer werden wollen als bestimmte Größen. Ja, spannende Idee.Ich muss gerade nochmal drüber nachdenken, wie ich zu so riesigen …, Ja, doch, ja, sehr große Unternehmen können natürlich, ich weiß immer nicht, wie das so im B2B-Bereich ist, im B2C-Bereich sind die Probleme, glaube ich, einfach sehr offensichtlich, das haben wir hier auch im Podcast schon mehrfach besprochen, gerade was so, wenn man das an Dekarbonisierung zurückkoppelt, finde ich natürlich, sind sehr große Unternehmen insofern, was das angeht, attraktiv ist, dass, wenn man sie erstmal auf einen gewissen Pfad gebracht hat, also ich kriege es halt beruflich in der Stahlindustrie mit.
[50:00] Dann bewegt man halt sehr, sehr viel auf einmal.Also da, man muss dann halt nur ein Unternehmen steuern oder vielleicht auch finanziell unterstützen als Staat auf dem Transformationspfad.Deswegen muss ich da gerade über, ich denke noch drüber nach.Aber erstmal ist es total spannend, diese Grenze einzuziehen und kann natürlich Monopolbildung vermutlich gut, also könnte ich mir vorstellen, dass es die gut verhindert. Ja, spannend. Spannend.
[50:25] Es ist halt die Frage, wie global müsste man sowas angehen. Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem.Also viele der Vorschläge, aber das ist ja auch das Problem bei dem Netto-Null.Ja, klar. Wenn jetzt, sagen wir, die EU bringt sich auf Netto Null, aber wenn sie das dadurch tut, dass sie halt einfach alle Industrie, die viel CO2 ausstößt, dann einfach in andere Länder auslagert, die das nicht so streng sehen, dann hast du natürlich global gesehen auch nichts gewonnen. Ja, das stimmt.
[51:25] Muss, ist, nirgends kriegt man Energie, also dann sind die Konvertierungsprobleme da, aber erstmal als Strom kriegst du Energie ja nicht günstiger erzeugt als beispielsweise mit Windkraft oder dann in anderen Regionen der Welt mit PV.Also ich glaube, da bewegt sich einfach auch sehr viel und es kann einfach auch, ich glaube, es wird absehbar sehr ökonomisch sein, Grün zu produzieren, nicht aus irgendwelchen ideellen Gründen, sondern weil Energie einfach, einfach da günstiger zu kriegen wird, als auf anderen Wegen, das muss man einfach, glaube ich, mittlerweile so sehen und das ist ja eine sehr schöne Entwicklung.Ja, noch so als letzten Punkt, er geht auch ein bisschen auf, ich sage jetzt mal, die Spaltung der Gesellschaft oder die wirtschaftliche Spaltung der Gesellschaft ein.Ohne da jetzt das zu ausführlich zu besprechen, hat er da auch zwei Vorschläge, die in gewisser Weise für viele Menschen wahrscheinlich sogar revolutionär erscheinen.Und er sagt, diese Spaltung der Gesellschaft in die Superreichen und die Armen, das ist ein Problem.Philosophiert dann auch noch mal ein bisschen über die Aussagekraft von Genie-Indexen und sowas aus mathematischer Sicht.
[52:51] Aber die Vorschläge, wo er hinkommt, das sind im Wesentlichen zwei.Er sagt zum einen, ein Problem ist die Vererbung von riesigen Vermögen und das schlägt davor zu lösen, indem man halt einfach einen Maximalbetrag, den man einer Person vererben darf, festlegt.Also er sagt dann zum Beispiel, er nimmt als Zahl zwei Millionen, also wenn jemand zwei Millionen vererben kann, dann darf er halt immer nur zwei Millionen an eine Person vererben.Also das heißt, er könnte auch, wenn er 100 Millionen hat, könnte er an 50 Menschen jeweils 2 Millionen vererben.Das wäre erlaubt, weil der Sinn des Ganzen ist nicht, es unmöglich zu machen, das Geld weiter zu vererben, sondern dass das, was geerbt wird, breiter gestreut wird.
[53:46] Und er sagt dann, wenn man jetzt so eine Grenze zieht, wird sich für die meisten Menschen erstmal gar nichts ändern.Man könnte sogar überlegen, ob man bei denen nicht die Erbschaftssteuer ganz abschafft oder runtersetzt.Und das würde halt eh nur die betreffen, die wirklich viel haben und würde halt verhindern, dass sich das Vermögen zu sehr ballt durch diese Erbschaften.Warum schlägt er so ein Modell vor und nicht einfach eine sehr stark progressive Erbschaftssteuer zum Beispiel? Also äußert er sich dazu?Man könnte ja auch mit Prozentsätzen arbeiten, die halt bei gewissen Summen dann einfach, also es kann ja exponentiell sein. Also sagt er dazu was?
[54:30] Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Also es kann sein, dass er das dann auch über solche Steuersätze regeln möchte.Das müsste ich nochmal nachschlagen. Also es kann sein, dass er das dann so regeln möchte, dass sozusagen über diesen zwei Millionen der Steuersatz einfach so hoch wird, dass es sich nicht mehr richtig lohnt.Aber es geht ihm ja auch mehr darum, das Vermögen zu verteilen und er findet es dann auch vollkommen okay, wenn jemand fünf Kinder hat, dass jedes Kind dann zwei Millionen bekommt sozusagen.Also das ist vielleicht wieder ein bisschen das Argument, man muss halt überlegen, was ist das Ziel, was ich haben möchte und wenn mein Ziel erstmal ist, ich möchte verhindern, dass sich Vermögen bei einzelnen Personen ballt, dann kann ich das so sozusagen ein bisschen auflösen.
[55:20] Aber natürlich gibt es da sicher auch gute Gegenargumente.Also grundsätzlich bin ich natürlich sehr dafür, Erbschaften viel stärker zu besteuern. Das ist ein leistungslos erworbenes Einkommen, was in gerade höheren Gesellschaftssphären viel zu sehr weitergereicht wird.Und ja, ich bin sehr dafür. Genau, deswegen hat mich nur der Weg interessiert.Ja, also auch da würde er, denke ich, dann sagen, jetzt der Betrag, den hat er willkürlich ausgewählt, den müsstest du halt dann wieder gesellschaftlich in einem gesellschaftlichen Prozess aushandeln, wie genau du das gestaltest.Ich fand es halt nur spannend, weil es eben mal eine etwas andere Idee ist, als einfach zu sagen, wir müssen das alles weg besteuern, zu sagen, ja wir wollen ja eigentlich, dass es sich nicht ballt, das heißt, wenn jemand das halt einfach an verschiedene Leute verteilt ist es auch okay, also das ist sozusagen für mich dann so die neue Idee Ja, genau, deswegen habe ich ja nachgefragt, verstehe ich gut, Und er schließt er schlägt dann auch noch vor, dass man Wenn man Einkommen begrenzt und einfach sagt, das Maximaleinkommen wird halt begrenzt als das x-fache des sozusagen des niedrigsten Einkommens, das kann man ja dann über den Mindestlohn jetzt, glaube ich, relativ gut bestimmen.
[56:45] Und dann kann man halt auch darüber diskutieren, wie viel darf es denn sein.
[56:52] Also wo er dann irgendwie die Zahlen, wo er dann glaube ich auch drauf kommt, dass man je nachdem wie man die Zahlen wählt, könnte es auch sein, dass man es noch okay findet, wenn jemand ein Jahreseinkommen von zwei Millionen hat, wo die unteren nur 20.000 haben.Wenn die Gesellschaft sagt, das ist okay, okay, dann kann man das akzeptieren, aber wichtig ist halt, dass man das auch nicht grenzenlos werden lässt.
[57:19] Ähm, wobei ich gerade nicht, ich glaube, dass er das für Unternehmer nicht so richtig darstellt.Na, das ist, das müsste ich auch nochmal nachgucken. Das bezog sich jetzt, glaube ich, mehr auf so ausgezahltes Einkommen von arbeitender Bevölkerung.Und, äh, ich glaube, zu Unternehmern, ne, sagt er da nichts, wie viel die denn verdienen dürfen mit ihrem Unternehmen. Ja, gut, aber das kann man sich dann ja auch überlegen.Also, das scheint mir eine nicht so schwierige Denkübung dann zu sein. Ja, genau.Aber das ist noch sozusagen die letzte Idee, die er hat, außer dass er noch so einen kleinen Einschub macht, dass man hier dieses automatisierte Trading, diese Ultra-Fast-Trading-Geschichten, dass es vielleicht Sinn ergibt, das einzuschränken, wo er dann zwei Vorschläge hat. Also das eine ist, dass man das auch besteuert.Und die andere Idee, die ich persönlich noch charmanter finde, ist, dass man sagt, naja, Trading ist ja was, was eigentlich Menschen machen und das System ist darauf abgestellt, wie Menschen das machen, dieses Ultra-Fast-System.
[58:26] Dann bricht das System ein bisschen, weil es zu schnell ist und man könnte natürlich auch einfach ein Limit setzen und sagen, naja, so ein Algorithmus darf halt nicht mehr traden, als ein Mensch kann.Und wenn man jetzt sagt, ein guter Broker schafft einen Trade pro Sekunde und einfach sagt, so ein System darf halt maximal einen Trade pro Sekunde machen, fand ich auch eine ganz spannende Idee.Ja, man kommt so ein bisschen ins Denken, wie man so Probleme lösen kann.Das klingt ganz attraktiv, muss ich sagen. Genau.Und wie gesagt, an sich ist diese Idee, die er hat, für mich halt, würde ich sagen, ist halt eine Variante des Ordoliberalismus.Aber das, was halt dann spannend ist, ist, dass er nochmal so ein bisschen einen anderen Blick drauf hat, wie man denn ordnet. Nämlich indem man das viel mehr darüber macht, dass man Grenzen setzt.Er sagt auch an einer Stelle im Buch, lieber einfache, klare Regeln als sehr komplizierte Regeln.Wo er auch so ein bisschen sagt, dass die Politik dazu neigt, jedes kleine Detail regeln zu wollen und die Gesetze wahnsinnig kompliziert werden und keiner sie mehr versteht. Und er hat eine ganz klare Präferenz dafür.
[59:40] Eine einfache Regel, idealerweise eine, die so ziemlich jeder versteht.Und die ziehen wir aber knallhart durch, wenn wir uns einmal auf die geeinigt haben und setzen dann auf die Steuerungskräfte dadurch, dass wir diese Regel durchsetzen.Mhm.Ja gut, aber das scheint mir ja nicht unmöglich zu sein.Genau. Und das ist jetzt, glaube ich, ein ganz guter Überblick über das Buch gewesen.Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt auch schon, ich habe jetzt auch eine Weile geredet. Insofern würde ich dann mit der Vorstellung jetzt zum Ende kommen.
[1:00:46] Super, vielen Dank dir. Ja, ich würde ein bisschen Shownotes hinterherwerfen als erstes und du kannst dann ja danach noch deine machen und ich glaube dann, wenn ich hier in unser Pad reingucke, gibt es dann genug, wo ihr Hörer in euch reinstürzen könnt und Dinge hören, lesen und so weiter könnt.Also zum einen probiere ich dieses Interview, was ich mit Anders Lebermann gehört habe, nochmal wieder zu finden.Also es gibt verschiedenste, aber ich fand das recht gut und mal gucken, vielleicht, also ich werde irgendwas verlinken und ich hoffe, das, was ich gehört habe.Von alten Folgen habe ich jetzt gar nicht so viele rausgeschrieben, aber ich habe in Folge 4 die ökologische Kommunikation von Niklas Luhmann, vorgestellt, wo es im Prinzip um die Frage geht, ob die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Bedrohungslagen einstellen kann.Es ist in den 80ern geschrieben und Luhmann war da sehr pessimistisch.Ich würde jetzt aus meiner Praxis und Alltagserfahrung sagen, ich glaube, so pessimistisch, wie er damals war, muss man nicht sein, aber trotzdem ist es spannend.Dann, weil ich finde, es knüpft ein bisschen daran an, in Folge 25 haben wir narrative Wirtschaft von Robert J.Schiller besprochen, also so ein bisschen die Frage, wie Wirtschaft eigentlich erzählt wird und das finde ich, hat man hier auch ein bisschen, also neue Wirtschaftserzählungen, ich kriege es eben wie gesagt beruflich mit, wie sich alte fossile, Großfirmen neu erfinden wollen und jetzt grün sind und so und da neue Erzählungen anstreben und sich eben, glaube ich, auch ganz ernsthaft in Teilen transformieren.
[1:02:14] Dann, weil wir ja so ein bisschen über Steuerungsideen hier auch sprechen, Dann habe ich Shortcuts 5 von Heinz von Förster mir nochmal rausgesucht, also Kybernetik im Prinzip, viel Beobachtung zweiter Ordnung.Ich glaube, das ist hier auch ganz gut anschlussfähig und da sind eben so mehrere kleine Texte in dieser Shortcuts-Reihe von ihm versammelt, gibt es zu verschiedenen Autoren, ich glaube, es sind nur Männer.Dann habe ich gelesen, und ich finde das schließt tatsächlich sehr gut an, Regieren von Helmut Wilke.
[1:02:47] Helmut Wilke ist auch ein Sozialwissenschaftler gewesen, der ist Anfang dieses Jahres verstorben, ich glaube im Januar, und er beschäftigt sich in diesem recht kurzen Buch eigentlich mit moderner Regierungsfähigkeit und sagt, das wird eben immer schwieriger, Weil die Instanz, die wir haben, die regieren kann, ist der Nationalstaat.Wir sind aber immer weiter global verflochten eben in Systemen, er nennt es laterale Weltsysteme, die keine demokratische direkte Legitimation zum einen haben und zum anderen keine Höchstinstanz haben, die über sie entscheidet.Also, keine Ahnung, Welthandelsorganisation, Weltgesundheitsorganisation, all sowas.Und man bewegt sich aber als Nationalstaat eben in diesen Organisationen und muss in einem Weltsystem quasi agieren, aber ist eben nur in engen Grenzen irgendwie fähig, alles durchzuregieren.Und was für ihn ein Punkt ist, er meint, Politik neigt dazu, in einem sehr alten Verständnis sich in ihrer Steuerungsfantasie zu überschätzen.Also sie reagiert quasi zu kleinteilig, eigentlich genau das, was Herr Lewermann auch sagt und hat aber ja durch Binnenlogiken und die hohe Komplexität von gesellschaftlichen Teilsystemen eigentlich keinen richtigen Überblick darüber.
[1:04:11] Was sie mit Gesetzen eigentlich lostritt und anrichtet, wenn sie probiert in Systeme rein zu regieren.Und deswegen plädiert Helmut Wilke dafür, eigentlich, ja, Zukunftsvisionen politisch zu entwickeln und die aber auch nur, ja.
[1:04:29] In einem sehr modernen Regierungsverständnis quasi die an die Systeme so weiterzugeben, damit die sich selbst darauf einstellen können, was sie erreichen sollen.Und ich habe das Gefühl, das ist hier sehr, sehr anschlussfähig und geht eigentlich sehr in eine ähnliche Richtung, nur ohne Physikbegründung dahinter oder mathematisches Modell.
[1:04:47] Genau, das verlinke ich mal. Also es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja, genau.Es sind erschreckend viele Rechtschreibfehler in diesem Buch.Das hat mich wirklich erschrocken.Also, es hätte nochmal ein Lektorat gebraucht. Das war wirklich irritierend, aber ich habe es trotzdem gerne gelesen.Genau. Und einfach, damit es ein bisschen Positives auch gibt.Ich habe vor ein paar Monaten, das ist eine Studie von der University of, verdammt, ich habe es doch hier gerade offen, ich glaube Exeter rausgekommen.
[1:05:16] Ja, University of Exeter. Da geht es um positive Kipppunkte in der Klimakrise und ganz viel um, naja, wenn der Zubau von erneuerbaren Energien in dem gleichen exponentiellen Tempo sich weiterentwickelt, wie wir das jetzt haben, dann könnte es sogar sein, dass wir 1,5 Grad noch erreichen.Und da, genau, gibt es noch eine andere Studie von, wie heißen die, RMI.
[1:05:44] Das ist das Rocky Mountain Institute, die beschäftigen sich auch mit den globalen Elektrizitätssystemen.Die Studie heißt Exchange Electricity on Track for Net Zero.Zero, die sind auch nicht völlig negativ eingestellt, was das 1,5 Grad Ziel angeht, also da gibt es so ein bisschen, ja auch nachdem das mal festgelegt wurde und als Ziel ausgerufen wurde und wenn Energie jetzt günstig ist und bleibt, erneuerbar, dann könnte es vielleicht noch klappen, das vielleicht als Sachen, die Hoffnung machen, die aber auch nie an irgendeiner Stelle sagen, wir können uns jetzt zurücklehnen, sondern nur wenn wir in dem Tempo weiter durchziehen, könnte das noch halbwegs hinhauen.Und falls ihr euch selber weiterbilden wollt, gibt es einen Massive Open Online Kurs, den man zeitunabhängig machen kann.Der heißt Climate Now und ist, glaube ich, von der Helsinki University aufgelegt.Genau, der ist auf Englisch und beschäftigt einfach so alles Mögliche zum Thema Climate Change, wie heißt das auf Deutsch? Klimawandel.
[1:06:49] Also hat, glaube ich, acht Kapitel. Was ist das eigentlich?Wie geht es weiter? Wie können wir uns darauf einstellen?
[1:06:55] Was muss passieren? Was sind die großen Themen?Also, ja, wenn ihr Bock auf Selbstlernen habt, dann wäre das noch eine Möglichkeit.Ja, und das sind die Sachen, die ich euch mit auf den Weg geben möchte.Was möchtest du noch ergänzen?Ja, ich habe, glaube ich, eine etwas längere Liste. Also ich habe auch noch einige alte Folgen.Die sind jetzt chronologisch rückwärts. Zum einen direkt unsere Vorgängerfolge Systemsturz, wo es ja auch ein bisschen darum geht, einen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen.Da allerdings eher, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus so einer, wie sagt man, marxistischen Denkrichtung.
[1:07:38] Dann eine Folge, die auch wir beide zusammen aufgenommen haben, glaube ich, die Baustellen der Nation, wo es ja auch so ein bisschen um verschiedene aktuelle Probleme und Lösungsvorschläge geht.Dann nochmal zum, wie man mit Mathematik Dinge beschreiben kann, habe ich in der Folge 62 in Shape vorgestellt.Wir hatten in dieser Folge ja auch einmal angesprochen, wie da die Tabakindustrie und dann auch die CO2-produzierende Industrie, die so das Narrativ, sage ich mal, beeinflusst hat.Und dazu haben wir in Folge 58 Merchants of Doubt besprochen.Auch zum Thema, was kann man tun gegen den Klimawandel, gab es in Folge 57 Energierevolution jetzt. Ja, das habe ich gemacht, stimmt.
[1:09:04] Ich habe auch noch ein paar Lesetipps. Dann habe ich einmal Raus aus dem Egokapitalismus von Patrick Kaczmarczyk.Das ist ein polnischer Nachname, deswegen hoffe ich, ich habe es jetzt halbwegs richtig ausgesprochen.Das ist eine Betrachtungsweise aus der katholischen Soziallehre heraus und bietet halt auch nochmal eine andere Idee davon, wie man in dem Fall Wirtschaft denn gestalten kann.In eine ähnliche Richtung finde ich Mission Economy von Mariana Mazzucato.Ich glaube, eins der wenigen Bücher von ihr, was wir noch nicht vorgestellt haben. Stimmt, ja, das wollen wir noch nicht.Witzig, die habe ich letzte Woche auf einem Vortrag gehört, kurz.Ah, schön. Live? Ja, ja, war live. Also nur zugeschaltet, aber live, ja.
[1:09:58] Genau, und das ist auch nochmal, wie man einfach anders an Wirtschaft rangehen kann und auch ein bisschen mehr Zug auf Missionen hindenkt.Das heißt, mehr mit positiven Ideen das steuert.Dann nochmal zu dem, so ein bisschen als Kontrapunkt zu der Idee, dass die Märkte ja alles am besten lösen.The Big Myth von Naomi Oreskes und Eric M. Conway.Die haben auch Merchants of Doubt geschrieben und in dem Buch hinterfragen oder stellen sie so ein bisschen dar, wie im Grunde Lobbyisten diese Idee, dass die Wirtschaft alles am besten löst, so in die Welt gebracht haben.Zu dem Thema der großen Tech-Firmen gibt es Cannibal Capitalism von Nancy Fraser, nicht zu verwechseln das ist eine amerikanische Philosophin die sollte man nicht mit der deutschen Politikerin verwechseln als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, dachte ich auch hä, sie hat jetzt, unsere Ministerin hat jetzt ein Buch geschrieben und dann hat es irgendwann geklickt, ja, ach ne, doch nicht.
[1:11:08] Weil so ein bisschen die Idee von Levermann ja auch ist, dass man sozusagen auch die Wertung ändern soll, schmeiße ich nochmal The Righteous Mind von Jonathan Haidt rein, wo es darum geht, wie wir denn unsere Werte so bilden und was für unterschiedliche Werte Menschen haben und wie es sein kann, dass moralische Menschen trotzdem zu extrem unterschiedlichen Meinungen gelangen.Und als Abschluss nochmal, das passt immer, wenn man über Dinge wie Klimawandel redet und Dinge, die einfach viel zu groß sind, als dass man sie so einfach verstehen kann.Ein philosophisches Buch, Hyperobjects von Timothy Morton, wo es genau um solche Objekte geht, die jenseits unserer Vorstellung sind, aber trotzdem unser Leben sehr stark beeinflussen können.Und genau, das sind eine Menge Tipps, aber mir ist viel eingefallen.
[1:12:17] Ja, ist doch prima. Könnt ihr euch überlegen, was ihr davon als nächstes angeht.Zum Abschluss bleibt mir nur, euch auf unsere Webseite zu verweisen.Wenn ihr uns Kommentare hinterlassen wollt, ist das, glaube ich, der sinnvollste Weg. Das ist zwischenzweideckeln.de.Auf Social Media könnt ihr uns folgen. Auf Facebook, da heißen wir zwischenzweideckeln.Auf Instagram heißen wir addeckeln.Auf Mastodon heißen wir, da ist es immer am schwierigsten, addzzd.Und jetzt seit einiger Zeit schon, aber ich weiß gar nicht, ob wir das hier so breit getreten haben, laden wir unsere Folgen auch auf YouTube hoch.Also vielleicht ist das ja ein Weg, um bekannte FreundInnen oder Familienmitglieder von euch auf unseren Podcast aufmerksam zu machen.Genau, da heißen wir, glaube ich, einfach nur Zwischenzweideckeln.Oder wenn ihr eure Podcasts generell sehr gerne bei YouTube hört, dann ist das vielleicht auch ein Weg.Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr einen richtigen Podcatcher benutzt, damit das für immer ein schön offenes Format bleibt und Podcasts nicht monopolisiert werden oder oligolipolisiert, ja und das ist es dann für heute auch schon gewesen und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr uns wieder zuhört, macht’s gut, liebe Grüße und tschüss.
[1:13:33] Music.
Intro und Outro der Episode stammen aus dem Stück Maxixe von Agustin Barrios Mangore, eingespielt von Edson Lopes (CC-BY).
Das Umblättern zwischen den Teilen des Podcasts kommt hingegen von hoerspielbox.de.
Zwischen zwei Deckeln findest du auch im sozialen Medium deiner Wahl: Mastodon und Bluesky.
Der Beitrag 072 – „Die Faltung der Welt“ von Anders Levermann erschien zuerst auf Zwischen zwei Deckeln.

Mar 14, 2024 • 1h 10min
071 – „Systemsturz“ von Kohei Saito
Wenn wir gerade schon dabei sind, die Grundlagen unseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems zu hinterfragen, können wir auch gleich weitermachen. Amanda stellt uns dazu ein Buch vor, das in den letzten Monaten für einiges an Aufsehen gesorgt hat: Eine Neu-Interpretation von Marx auf der Spiegel-Bestsellerliste?
„Systemsturz“ von Kohei Saito versucht, die Degrowth-Bewegung vom Kapitalismus loszulösen, da Wirtschaftswachstum und Technologieentwicklung nicht ausreichen, um die Klimakrise zu bewältigen. Saito entwickelt ein kommunistisches Alternativmodell basierend auf einer neuen Lesart von Marx‘ „Kapital“ und seinen späteren Notizen. Dieser Degrowth-Kommunismus basiert auf einer Wiederherstellung der Commons, also gemeinschaftlich verwalteter Produktionsmitteln, und betont die Wichtigkeit der demokratischen Verwaltung dieser Ressourcen als auch einer Entschleunigung des Produktionsprozesses. Saito sieht darin der einzige Weg, dass die globale Gesellschaft in Zukunft nachhaltig und würdevoll arbeiten und leben kann.
Shownotes
Buch: „Intuitive Biostatistics“ von Harvey Motulsky
Artikel: „Warum kann man Land besitzen? Es war doch schon immer da.“ von Reto U. Schneider, NZZ Folio, 29.10.2021
Buch: „Das Ende des Kapitalismus“ von Ulrike Herrmann
Buch: „Kapital und Ideologie“ von Thomas Piketty
Film: „The Driven Ones“, Dokumentation über 5 Studierende der Universität St. Gallen und ihren Struggle in der Corporate World.
ZZD045: „Bullshit Jobs“ von David Graeber
ZZD066: “Mythos Geldknappheit” von Maurice Höfgen
ZZD001: „Resonanz“ von Hartmut Rosa
ZZD026: “Die Rettung der Arbeit” von Lisa Herzog
ZZD032: “Schulden” von David Graeber
ZZD042: „Arch+ 239 – Europa: Infrastrukturen der Externalisierung“
ZZD044: “The Entrepreneurial State” von Mariana Mazzucato
ZZD056: „Die grosse Consulting-Show“ von Mariana Mazzucato und Rosie H. Collington
Alle Episoden zum Thema Wirtschaft
Quellen und Co
Intro und Outro der Episode stammen aus dem Stück Maxixe von Agustin Barrios Mangore, eingespielt von Edson Lopes (CC-BY).
Das Umblättern zwischen den Teilen des Podcasts kommt hingegen von hoerspielbox.de.
Zwischen zwei Deckeln findest du auch im sozialen Medium deiner Wahl: Mastodon und Bluesky.
Transkript (automatisch erstellt)
[0:00] Music.[0:16] Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen zwei Deckeln Episode 71 eurem Sachbuch-Podcast.Mein Name ist Nils und ich habe heute Amanda mit dabei. Hallo.Genau und Amanda wird uns heute ein äußerst spannendes Buch vorstellen.Vorher macht so ein bisschen der Blick auf das, was uns aktuell beschäftigt.Bei mir ist es tatsächlich das Buch, das ich euch wahrscheinlich in der übernächsten Episode vorstellen möchte.Das wird auch so ein paar Themen aus meinen letzten beiden Folgen aufgreifen.Lasst euch da also gerne überraschen und sonst schraube ich aktuell noch an einem etwas längeren Artikel zu einem menschengerechten Internet herum, der vielleicht auch dann irgendwie online geht, so ungefähr, wenn diese Folge online geht.Auch da packe ich euch den Link natürlich im Zweifel gerne in die Shownotes.Amanda, was treibt dich gerade um?Jetzt gerade dein Thema, menschengerechtes Internet, das klingt sehr spannend.[1:10] Ja, ich treibe mich auch ein bisschen mit Technik rum und zwar vorwiegend Fachartikel, Informatik und Sprachmodelle und so weiter und Statistik.Und ich lese ein exzellentes Biostatistikbuch, das heißt Intuitive Biostatistics von Harvey Motulski.Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich habe jetzt da die neueste Version, Ausgabe gekauft und das ist echt, also es ist echt hervorragend, das Buch.Ich kann das sehr empfehlen, wenn man, ist natürlich Biostatistik, also schon auch so viel ein bisschen auf Medizin gemünzt, aber die Konzepte werden richtig gut erklärt.Also man kann da bestimmt auch von profitieren, wenn man, ja, wenn man jetzt nicht spezifisch Medizinstatistik sich beschäftigen möchte.Ich hatte dich gerade erst akustisch missverstanden und es klang so, als hättest du gesagt, du würdest ein Buch über Bier-Statistik lesen.Das hätte mich dann auch interessiert, also mehr zumindest als Bier-Statistik.[2:12] Nee, Bierwandern, dieses Buch gibt es für die Schweiz, klassisches Schweiz-Souvenir, Bierwanderbuch.Okay, ich habe ja lange Zeit, ein paar Jahre in Bamberg gelebt und studiert, da gab es ja auch mal den Bierführerschein.Nee, was ist das denn? Wo man dann die sieben Brauereien oder acht Brauereien der Stadt sozusagen abwandern musste.Ach nee, nicht Bierführerschein, Bierdiplom hieß das genau. Genau.Und dann eben in jeder der Brauereien irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein halber Liter, ein Seidler oder eine Maß war, an Bier vertilgen musste sozusagen, um dann sein Diplom gestempelt zu bekommen.Aber irgendwann konnten die Studierenden sich nicht mehr benehmen und dann haben die Brauereien es abgeschafft. Oh nein. Ja. Genau.Und die Noten sind gestiegen. Oder gesunken in Deutschland.[3:02] Ja, man würde trotzdem sagen gestiegen, auch wenn die Zahlen kleiner werden. Stimmt.Ja, du hast uns heute ein Buch mitgebracht, ein spannendes Buch, das tatsächlich bei mir auch auf der Leseliste stand, wo ich auch schon überlegt hatte, das vielleicht demnächst mal in den Podcast mitzubringen, aber ich habe es noch nicht gelesen.Du hast uns mitgebracht von Kohesato Systemsturz Ist ja auch ein Buch, was so in den letzten Monaten so ein bisschen nicht etwas kleinere und größere Wellen geschlagen hat So als äh, Genau, und da möchte ich dich jetzt mal bitten, wenn du magst, mit dem TLDL anzufangen.[3:44] Kohe Saitos Systemsturz richtet den Blick auf die Klimakrise und rüttelt an
Tl;dl
[3:48] vielen bekannten Konzepten.Saito lässt kein gutes Haar am Kapitalismus, aber auch nicht am Staat und unserem heutigen Politiksystem.Auch der Kommunismus wird, basierend auf der neueren Marx-Forschung, auf neue Füße gestellt.Der Autor entwickelt dazu das Konzept des Degrowth-Kommunismus, welches seiner Ansicht nach der einzige Ausweg aus unserer aktuellen Klimasituation darstellt. Er betont hier insbesondere die Wiederherstellung der Kommens, also gemeinschaftlich verwalteter Produktionsmittel.Seitens Spielart des Kommunismus soll eine global gerechtere, nachhaltigere und würdevollere Gesellschaft ohne starken Staat ermöglichen.
Buchvorstellung
[4:27] Okay, die kleinen Themen, kaum relevante Fragen, auf die völlig konventionelle Weise beantwortet. Habe ich das richtig interpretiert? Genau so ist es.[4:39] Ja, also ich muss vorwegnehmen, ich habe gar keine Rezensionen gelesen, deswegen die Wellen, also ich habe natürlich mitgekriegt, dass das Buch irgendwie relevant ist und ein Bestseller ist, deswegen stelle ich es ja auch vor, aber ich kann jetzt da nicht irgendwie einsteigen auf irgendwelche kontroversen Diskussionen, die sich um dieses Buch gebildet haben, also du darfst da gerne ergänzen, wenn du was dazu weißt.Mhm.Ja, ja, ja, total. Ja, es ist auch ein Buch, das sich sehr gut lesen lässt, ich sag mal ohne viel Vorwissen, deswegen nehme ich an, konnte es auch zu einem Bestseller überhaupt werden, aber ja, also vielleicht als kleine Kritik vorneweg, er lässt natürlich dann auch viel aus, also es ist auch, aus oder auslassen ist falsch, aber vieles wird für mich ein bisschen zu wenig ausgeführt, wo ich es mir ein bisschen wünschen würde.Naja, aber Beginn tut das Buch eigentlich so mit einer Auslegeordnung ein bisschen vom aktuellen Problem und wie gesagt, er bezieht sich sehr auf die Klimakrise, also modelliert das so als das Hauptproblem unserer heutigen Zeit.[6:07] Stichwort auch Anthropozän, also diesen Begriff, den man jetzt auch überall kennt.Und er sagt dann, ja, wir sind eine Gesellschaft oder wir, die Gesellschaft des globalen Nordens, sichert sich den Wohlstand, insbesondere indem wir Peripherien ständig schaffen.Also wir leisten Kompensationszahlungen in die Ferne und wälzen unsere Kosten eigentlich dahin ab. Das wurde auch geprägt durch den Begriff Externalisierungsgesellschaft von Stefan Lessenig.Ja genau, also dieses, wir machen was, wir haben unseren Wohlstand, aber wir machen die Folgen eigentlich unsichtbar, indem wir sie in die Peripherie verschieben. bin.[6:53] Das Ganze geht dann auch anhehe so mit einer Kritik an, ich sag mal, Eco-Bags und biologische T-Shirts, das ist so ein bisschen Ablasshandel.Das hilft nicht wirklich, sondern das beruhigt ein bisschen unser Gewissen und wie gesagt, macht eigentlich unsichtbar, was das Problem dahinter ist.Und das führt natürlich dazu, dass wir jetzt auch ein bisschen in dieser Krise stecken.Also diese planetaren Grenzen, er nimmt dann dieses Konzept, Ja.[7:27] Das heißt, die Erde oder die Resilienz der Erde reicht eigentlich nicht mehr aus für unser wirtschaftliches Tun, für den Ressourcenverbrauch, den wir haben.[7:40] Das ist so sein, ich sage mal so, das Grundthema, was sich so durchzieht.Und er kommt dann sehr schnell auch dazu, was das eigentlich mit dem Wirtschaftswachstum zu tun hat.Also er sagt, gut, Wirtschaftswachstum ganz generell ist mit einer erhöhten Umweltbelastung verbunden.Okay. Jetzt gibt es dieses Konzept der Entkopplung, also dass man sagt, ja gut, oder ich sage mal, dieses mehr Wirtschaftswachstum, mehr Umweltbelastung, das wird jetzt nicht in Frage gestellt, das ist so.Und viele Theorien beziehen sich ja auch darauf und möchten das irgendwie auseinandernehmen.Und Entkopplung ist so ein Wirtschaftsbegriff, der das eigentlich meint, also eigentlich, dass man Wirtschaftswachstum entkoppelt von dieser Umweltbelastung.Das bedeutet, man spricht dann entweder von relativer oder von absoluter Entkopplung und relativ wäre, also wir haben Wirtschaftswachstum, aber die CO2-Emissionen beispielsweise steigen nicht im gleichen Maße wie die Effektivitätssteigerung.Also man hat, beides steigt so ein bisschen, aber Wirtschaftswachstum ist größer, deswegen nur eine relative Entkoppelung.[8:57] Und absolute Entkoppelung wäre dann, wir haben Wirtschaftswachstum und gleichzeitig eine Reduktion, jetzt beispielsweise der CO2-Emissionen. Ja, okay.[9:37] Okay, ja, einfach so diese Wirtschaftstheorien, die sagen ja gut, Investitionen in nachhaltige Technologien und so weiter, die führen dann zu dieser Entkopplung.Das ist ja eigentlich die dominante politische Strategie derer, die überhaupt versuchen, ernsthaft was daran zu tun, habe ich so das Gefühl. Genau, ja genau.Also es ist auch so der, genau, das ist der Mainstream, sag ich mal, dazu und den kritisiert er halt.Und zwar sagt er einerseits, fragt er sich halt, ja, ist diese absolute Entkopplung überhaupt realistisch?Wir wissen nicht, ob wir das ausreichend hinkriegen und auch in der Zeit, in der wir das hinkriegen müssten.Also einfach die Machbarkeit davon. davon.Und das zweite ist, dass er generell die in Frage stellt, ob das, Jetzt nicht im zeitlichen Horizont möglich ist, sondern ob das vom Konzept her möglich ist.Also ob Wirtschaftswachstum, sagt er, ja, das ist immer mehr Konsum, das ist immer mehr Verbrauch und deswegen auch immer mehr Emissionen.Es geht gar nicht ohne. Ja.Also egal, ob das jetzt grüne Technologie ist oder nicht, du kannst das nicht entkoppeln.Und er nimmt, also als Beispiel sagt er dann ja, zum Beispiel in den Niederlanden, es gibt so auch den Begriff Netherlands Fallacy.[10:59] Wo aussagt, dass in Industrienationen kann man diese Entkoppelung tatsächlich messen.Also man hat Wirtschaftswachstum, aber ohne größere Umweltbelastung.Aber man verschiebt die halt einfach in den globalen Süden.Also man macht die, wie gesagt, unsichtbar. Und deswegen in den Zahlen hat man dann grüne Zahlen.Aber das ist nicht wirklich global gesehen nützlich. Nur lokal halt die geringeren Zahlen. Genau. Genau.[11:27] Und das Gleiche ist ein bisschen, er sagt dann ja Effizienzsteigerung.Man erhofft sich dann beim Green New Deal auch ein bisschen ja dadurch wird alles halt effizienter. Man muss weniger Ressourcen aufwenden, um was zu produzieren und so weiter.Aber er sagt, das ist eigentlich nicht der Fall, weil je billiger was wird, desto mehr Personen werden das kaufen.Also je effizienter, desto billiger, desto mehr Personen kaufen das.Und aus diesem Grund nimmt der Energieverbrauch auch nicht ab.Wir ersetzen den einfach. Auch jetzt sehen wir das ein bisschen mit den alternativen Energien.Also die ersetzen nicht die fossilen Brennstoffe, sondern sie ergänzen sie einfach in dem Maße, als wir halt mehr Verbrauch auch wieder haben.So, es ist nicht so ein, ja, nicht ein Ersatz oder nicht ein Austausch, sondern einfach ein Zusatz.Ja, wobei das jetzt zumindest, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern aussieht, in Deutschland merkt man es schon, dass sowas wie Kohleverstromung und so weiter auch in absoluten Zahlen tatsächlich runtergeht. Und auch ersetzt wird durch erneuerbare Energien.Aber klar, das kann natürlich vielleicht das Wachstum bremsen und den Ausstieg der Emissionen reduzieren, aber es fährt ihn halt nicht auf Null oder sogar ins Negative runter. Ja.[12:46] Ja, also das sind so seine, einfach seine Überlegungen, weshalb absolute Entkoppelung ist für ihn einfach nicht realistisch. Und das ist so eine seiner Grundthesen.Und dazu, ja, versucht er halt eben so eine alternative Theorie darzustellen.[13:05] Er sagt auch, also grundsätzlich sagt er eben, diese Investitionen in grüne Technologien, die sind definitiv notwendig, aber sie reichen ihm nicht aus, um das Klimaziel zu erreichen.Und insbesondere geht es nicht, wenn wir das zusammen mit Wirtschaftswachstum denken. Das ist die Hauptaussage.Und was er dann macht, ist, er zeichnet vier Zukunftsalternativen. Okay.[13:32] Ich stelle dir jetzt kurz vor, ich habe da meine Kritik dazu, du möglicherweise auch. Vermutlich.Ja, ich sage mal, wie er das sich denkt. Ja.Und zwar macht er das so in einer Vierfelder-Matrix. Also man kann das sich so in einem Koordinatensystem vorstellen, vier Quadranten.Und dann haben wir auf der horizontalen Achse haben wir Gleichheit ganz links und dann Gleichheit rechts.Und oben starke Autorität und unten schwache Autorität. Okay.Und das bedeutet, wenn wir jetzt oben links wären, dann wären wir bei Gleichheit und starker Autorität.Und das nennt er die eine Zukunftsalternative Klimamaoismus.Das würde bedeuten, Klimaschutzmaßnahmen würden von oben herab diktiert.Freier Markt, Demokratie und so aufgehoben, zentralistische Diktatur. So, das wäre das.Wenn wir dann nach rechts gehen, dann wären wir bei starker Autorität und Ungleichheit.Das nennt er dann den Klimafaschismus.Also hier, der Staat schützt dann eigentlich die Interessen einer privilegierten Schicht.[14:36] Superreiche machen Geschäfte mit den Katastrophen, also mit den Naturkatastrophen, die dann da stattfinden und Klimageflüchtete haben dann keinen Platz und so weiter.Also das ist sein Klimafaschismuskonzept. Ähm, nochmal kurz eine Verständnisfrage.Diese vier Welten sind aber Welten, ähm, wenn wir es schaffen, die Klima, mit der Klimakatastrophe irgendwie umzugehen?Nee. Das sind, oder sind das Welten, die passieren, wenn wir es nicht tun? Genau. Okay.Mhm. Ähm, dann.Oder ja, ich komme gleich zu meiner Kritik, da können wir darüber diskutieren.Wenn wir jetzt nach unten gehen, jetzt wären wir rechts unten, da sind wir bei Ungleichheit und schwache Autorität und das nennt er die Barbarei.Also Hunger, Armutsaufstände, irgendwie die Armen erheben sich gegen dieses eine privilegierte Prozent der Bevölkerung und es kommt zur Rebellion der Massen, zum Zusammenbruch der Staatsgewalt, Krieg alle gegen alle, Hopscher, Naturzustand und so weiter und so fort.Und dann nach rechts, dann sind wir bei Gleichheit und schwache Autorität und das ist so sein, ich sag mal seine Vision, da wollen wir hin.Er nennt das dann X im Buch am Anfang und führt das dann weiter aus.Ich habe ein bisschen mein Problem damit, erstens, ich verstehe die Begriffe nicht. Ich verstehe nicht, warum man die nimmt.[16:04] Klimamaoismus, ich verstehe nicht, warum Maoismus. Für mich hat das eine andere Konnotation, als einfach jetzt eine, also als das zu nehmen für eine zentralistische Diktatur und ohne freien Markt und Demokratie. Also ich verstehe schon, was Salmi sagen möchte.Für mich, ich hätte jetzt nicht unbedingt den Begriff genommen.Ja, wahrscheinlich so in Anlehnung an den großen Sprung vorwärts.Zentral geplante Dings, wie heißt es, Industrie, Wirtschaft, Veränderung, Planwirtschaft, genau in einem hohen Maße und das gleich eben auf so einem gleichen Fundament im Gegensatz jetzt zu dem, was der Faschismus nennt.Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mir selber den Begriff ausgesucht hätte, aber ich finde jetzt zumindest auf dem, was du erzählt hast, plausibel, aber vielleicht habe ich auch irgendwas nicht mitgekriegt.Also das kann gut sein, weil ich tue mich auch schwer mit Faschismus.Ich finde das auch so als irgendwie ein Schutz von einer privilegierten Schicht.Das verbinde ich auch jetzt nicht per se mit Faschismus.Für mich haben diese Begriffe andere Bedeutungen im Kopf. Kopf.Deswegen, ich tue mich da ein bisschen schwer damit, aber ist okay.Wie gesagt, man kann das ja so nennen, es ist ja auch ein bisschen ein Gedankenexperiment.Was ich wirklich gar nicht so mitgehe, ist das mit der Barbarei.[17:24] Das ist dann so, das wird so hingesagt und irgendwie für mich überhaupt nicht ausgeführt und das würde ich schon erwarten.Also es ist dann überhaupt nicht klar, warum warum das zwangsläufig da hinführen soll.[17:40] Diese Naturzustand-Argumentation, da bin ich generell immer sehr skeptisch.Ich mag nicht, wenn man einfach mit irgendeinem Naturzustand kommt und damit dann argumentiert.Und er macht das auch und am Anfang erwähnt er das einfach, aber er benutzt es später dann auch wirklich so als Argument.So, wenn wir das und das nicht tun, dann fallen wir in die Barbarei.Und das finde ich, das kann man nicht einfach unkommentiert so schreiben. Bisschen einfach.Ja, verstehe ich. Also das wäre so ein bisschen meine Kritik an diesen Zukunftsalternativen, die er hier so zeichnet.Ja, ich meine, wenn man es jetzt aus einer marxistischen Perspektive so ein bisschen denkt, wenn man halt sozusagen sagt, du hast eine Situation, in der es keine starken Machtpole gibt, aber eine große Ungleichheit, dann ist es ja im Grunde der marxistischen Logik entsprechend, dass sich dann irgendwann die, die in der Ungleichheit unten gelandet sind, dass die sich irgendwie mobilisieren und dafür sorgen werden, irgendwie diese Gleichheit herzustellen.Und dass das dann nicht zivilisiert abläuft, wenn es irgendwie nicht eine moderierende Autorität gibt sozusagen, die da irgendwie in der Lage ist einzugreifen, kann ich das Argument schon irgendwie nachvollziehen.Aber das ist tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, wie begründet er es macht in dem Buch, aber das würde ich für sehr begründungsbedürftig halten.Ja, genau. Wie du sagst, ich kann das auch nachvollziehen, dass er das so nimmt.Ich hätte mir einfach gewünscht, dass das ein bisschen weiter ausgeführt wird.[19:09] Das gleiche gilt auch für die Gleichheit. Das ist auch ein Begriff, den er nimmt.Und die Theorie basiert auch viel auf diesem Gleichheitsgedanken, den ich total nachvollziehen kann.Auch nur schon aus ethisch-normativen Gründen, dass man das hinnimmt.Und trotzdem finde ich, führt er das nicht gut aus, warum das für ihn so zentral ist.Weil es ist ja schon wichtig, wenn du dann mit Kommunismus kommst, dann musst du das irgendwie begründen können.Und das macht er meines Erachtens zu wenig. Okay.[19:40] So, das sind so seine Alternativen und er sagt eben, zu seiner Vision passt eigentlich, also dieses X, das er da nennt, also schwache Autorität und Gleichheit, das ist eben dieser Degrowth-Kommunismus. Okay.Bedeutet, ja, Fokus auf gegenseitiger Hilfe, aktive Demokratie und auch keinen übermäßig starken Staat.Ich komme gleich noch dazu, was das noch mehr beinhaltet.[20:10] Ähm, ja, also das ist sozusagen seine Idee dieses neuen Wirtschaftssystems. Ja.Und dann kommt eigentlich die Begründung, wie er darauf kommt.Und da bezieht er sich wirklich explizit auf Marx.Also Saito ist auch Mitherausgeber dieser Mega, Mager, nein, Marx, Engels Gesamtausgabe.Mega dann wahrscheinlich, ja. Mega, ja. Ja, und die beinhaltet mitunter neue Forschungsnotizen des späten Marx, die früher wohl nicht so einfach zugänglich waren.Und er bezieht sich auch sehr stark darauf. Also er zeichnet dann so ein bisschen nach, wie man Marx eigentlich neu lesen kann und wie man ihn über seine Publikationsphase, aber dann eben auch mit diesen unveröffentlichten Notizen interpretieren kann.Und er bezieht sich dann sehr stark auf diesen, ich nenne es einfach späten Marx.Also er legt nicht nur seine Theorie da, sondern im Grunde auch noch gleich eine neue, also Satus-Theorie, sondern er legt auch gleichzeitig noch eine neue Marx-Auslegung sozusagen vor.Genau, er basiert das auch tatsächlich auf Marx. Marx. Ja.Was ich auch so ein bisschen interess… Also ich fand das ein bisschen speziell.Aber eigentlich, also sehr interessant, aber auch speziell, dass man sich dann so wie auf eine Person, also klar, Marx ist nicht irgendeine Person, aber dass man sich so auf eine.[21:34] Person konzentriert und auf diese Schrift und dann das wieder wie so eine Exegese nimmt und dann daraus die Theorie ableitet.Aber wie auch immer, es ist auf jeden Fall interessant.[21:44] Wenn man sich eben diese Marx.[21:49] Oder ich sag mal, die die bekannten Ansichten von Marx anschaut, dann würde er sagen, ja, am Anfang, dass das bekannt ist, das Kommunistische Manifest.Und da haben wir Wirtschaftswachstum drin. Also das ist das Klassische, das, was man unter Produktivismus kennt.[22:08] Das steckt da drin. Also der Kapitalismus führt zur Steigerung der Produktivkräfte.Das führt zu mehr Innovation und das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung für den Wohlstand.Und es mag es, und Engels, die sagen ja schon auch, ja, also in diesem progressiven Geschichtsbild, das sie haben, würde das Ausmaß oder die Größe der Produktivkräfte ist ja schon auch Indikator dafür, auf welcher Stufe der historischen Entwicklung eine Nation oder eine Gesellschaft steht. Okay, okay.[22:43] Das heißt, Wirtschaftswachstum ist da durchaus, wird bejaht ganz zu Beginn und auf Nachhaltigkeit wird eigentlich gar nicht geschaut.Und das wird nicht erwähnt. Und dann kommt das Kapital raus, das ist 20 Jahre später und dort sagt Saito, der Tenor ist immer noch gleich mit Wirtschaftswachstum und das, was man halt, ich sage mal, klassischen Marxismus auch kennt mit den Begrifflichkeiten, aber jetzt auch zunehmend mit Fokus auf Nachhaltigkeit.Also dann nennt man das den Ökosozialismus im Kapital.Und was Marx dann macht, also das Kapital wird veröffentlicht und also Band 1 und Band 2 und 3, die werden ja nicht mehr von Marx selbst eigentlich veröffentlicht.Ich glaube, das hat dann Engels im Nachhinein gemacht. macht.Aber was man wohl jetzt rausgefunden hat, ist, dass Marx sich sehr, sehr stark mit der Theorie dieser Kreislaufwirtschaft befasst hat. Okay.Das heißt, er wurde sehr stark beeinflusst von beispielsweise Justus Liebig, Justus von Liebig, ja, Justus Liebig, Karl Fraas.[23:52] Personen, die eben diese Wechselwirkung von Natur und Mensch sehr gut untersucht haben, nachgesagt haben, ja, es ist wichtig, wir können nicht einfach einfach den Acker ausbeuten, die Früchte des Ackers nehmen und dann in die Stadt verschieben.Weil das passt dann nicht mehr.Du hast dann den Dünger nicht mehr, den du eigentlich auf dem Acker brauchst und so weiter.Also dieser ganze Agrarstoffkreislauf hat wohl den Marx sehr beschäftigt und hat dann auch dieses Konzept des Risses aufgestellt, dass es eben der Kapitalismus macht Oder verursacht diesen Riss in diesem Kreislauf. Okay, ja.Eine zweite Sache, mit der sich Marx sehr stark beschäftigt hat, sind die Commons.Also Commons …[24:46] Commons sind eigentlich die in England, also diese, wie sagt man das auf Deutsch?Gemeingüter. Gemeingüter, ja, genau. Genau, also der Begriff wird für unterschiedliche Dinge ein bisschen verwendet, also im Buch wird es dann auch wirklich als Gemeingut irgendwann so verwendet, als Überbegriff, aber die Commons sind halt diese Agrarflächen, sag ich mal, die gemeinschaftlich genutzt wurden, also früher, so der frühere Begriff. Genau, genau, im historischen Sinn.[25:16] Und die wurden eben gemeinschaftlich genutzt, die Güter, die da produziert wurden, sind allen zugute gekommen und so hat man eigentlich ein gesellschaftlich und gemeinschaftlich geteilter und verwalteter Reichtum. Ja.Und ein, das ist so ein Schlüsselkonzept, das dann auch, Max sagt ja, eigentlich durch diese Einzäunung, also dadurch, dass diese Commons privat, zu privatem Land wurden, hat man dann plötzlich eigentlich diesen Mangel geschafft.Also das ist, das war so, ich sag mal die Ursünde, wenn man das so nennen möchte, also diese Einzäunung eigentlich. dich.Spannend, ich denke jetzt gerade an mein eigenes Seminar zu politischer Theorie zurück, wo es, um Hobbes, Locke und Rousseau ging, wo Locke ja im Grunde genau diesen Teil, du kannst dir dieses Land, das Land gehört dir, das du selber bearbeiten kannst. Ja, genau.Das ist gerade genau der Gegenpol dazu. War das nicht Locke? Ich meine schon.Okay, ja, ja, ja. Aber vielleicht war es auch noch wer. War das nicht Smith?Land? Ja, nee, Nee, kann gut sein. Auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst, ja.Also man muss das Land mischen mit seiner Arbeit und dann macht man es sich zu eigen.[26:36] Ja, genau. Also das ist so, da gibt es ja verschiedene Theorien, wie kommt man zu Eigentum und so weiter.Ich habe auch, es gibt einen Artikel aus der NZZ, aus dem Folio, der heißt auch irgendwie Land, warum kann man Land besitzen?Das war doch schon immer da oder so. Da wird das auch so ein bisschen nachgezeichnet.Auf die heutigen Verhältnisse gemünzt. Das ist ganz interessant, den kann ich verlinken.Genau, also diese Commons, das ist ein Schlüsselkonzept, wenn man Marx neu interpretiert, was er sich dazu gedacht hat.Und wichtig ist hier zu bedenken, dass es geht hier nicht um Verstaatlichung.Wenn man das übertragen möchte auf heute, das geht nicht darum zu sagen, ja, wir verstaatlichen das, sondern es ist wirklich gemeinschaftlich.Also es ist, ich sage mal, basisdemokratisch verwaltetes Gemeingut.[27:32] Ähm, ja, ganz, wir haben jetzt gerade letztens in der Schweiz auch eine, also in Zürich, Kanton, eine Abstimmung über einen Seeuferweg, der ist grandios gescheitert, diese Abstimmung, wo es darum ging, dass man ums Seebecken rum, also nee, am Ufer, also einen durchgehenden Spazierweg bauen würde für die Bevölkerung.Und das wurde, ja, das kam nicht durch, weil dann das gegnerische politische Lager das Wort Enteignung in den Mund genommen hat und dann war es vorbei mit den Sympathien. Na super.[28:36] Machen würde wollen, dann geht das irgendwie nicht.Und das ist auch interessant, weil das in unterschiedlichen Ländern so unterschiedlich gehandhabt wird. In Texas ist ja so privat, Land ist ja schränkstens verboten, dass du da das betreten darfst.Und ich glaube, in einem nordischen Land ist das wie selbstverständlich.Auch wenn du Land besitzt, dürfen da fremde Leute drauf sein, aber sie müssen einen adäquaten Abstand zu Wohnhäusern halten.Das ist irgendwie noch interessant. dass es da so unterschiedliche Auffassungen gibt.Ich glaube, in England, Schottland ist das ja zum Teil auch irgendwie mit dem Right of Way und so, dass du zumindest queren darfst irgendwie immer.Ja, da gab es da nicht gegen Madonna irgendwie so ein, ja.[29:23] Auf jeden Fall ist das unterschiedlich. Ich finde das spannend, weil Eigentum, ja, es klingt immer so absolut und so klar, was das ist, aber ist es irgendwie eigentlich nicht. Ja.[29:33] Auf jeden Fall betont dann, oder das Buch erwähnt dann auch Graeber, du als Experte, da schlägt dein Herz bestimmt höher.[29:43] Und zwar Graeber sagt, dass auch viele wohlfahrtsstaatliche Leistungen früher eigentlich durch Assoziationen geleistet wurden. Also Assoziationen, da sind gemeint Gewerkschaften, Vereine, Kooperativen, sowas.Und diese Leistungen wurden dann im Wohlfahrtsstaat durch den Kapitalismus eigentlich institutionalisiert.Also sie wurden so dem Staat als Institution übertragen und zusammen mit dann der ganzen neoliberalen Ideologie, die ja in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts so einen Aufschwung erhalten hat, wurden dadurch diese Commons also immer weiter geschwächt oder diese Assoziationen.Ja, gehe ich da jetzt so mit? Also wenn ich jetzt nach Deutschland gucke zum Beispiel, da hast du ja ganz oft auch noch so Elemente der Selbstverwaltung.Da hast du auch ganz oft so ein Versicherungsprinzip, was ja erstmal auch ein solidarisches Prinzip ist, was jetzt auch nicht unbedingt staatlich umgesetzt wird.Versicherungen dürfen ja in Deutschland, es gibt fast nicht mehr, aber Versicherungen dürfen in Deutschland noch als sogenannter Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit organisiert sein.Das ist eine spezifische Rechtsform, die nur Versicherungen offen steht.Ich glaube, es ist in Deutschland aber nur noch die HUC zum Teil, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe.[31:06] Also diese Elemente gibt es noch irgendwie, aber sie sind natürlich viel regulierter, viel verstaatlichter, teilweise ja auch sozusagen in Treuhand, also dass der Staat die Aufgabe an private, jetzt sind es halt meistens Unternehmen, Versicherungsunternehmen und sowas überträgt.Ja, aber ob das jetzt ein Schwächen der Genossen, naja, weiß ich nicht.Da stecke ich jetzt nicht tief genug drin.Ja, also ich weiß, was du meinst, aber zum Beispiel so, wenn du an Thatcher denkst, also dieses Zerstören der Gewerkschaften, das ist schon so, also ich gehe davon aus, Graeber nimmt auch das ein bisschen in den Blick.Ja, definitiv, das ist richtig.Oder auch Regonomics in den USA. Genau, ja.Ja, also das ist so ein bisschen die, ich sag mal, die Darstellung von Saito, wie es zu diesem Grundübel überhaupt kommt.Und eine zentrale Stelle dann in den Marx-Dokumenten ist der Brief an Sassulitsch.Und Zasulitsch ist eine russische Revolutionärin, die Marx wohl gefragt hat, ob es denn jetzt nun tatsächlich notwendig sei, dass Russland zuerst den Kapitalismus durchleben muss, bevor es zum Sozialismus kommen kann. Okay, ja.[32:22] Und deswegen halt, also wenn es jetzt der Kapitalismus notwendig wäre, dann würde eben diese MIA, also diese russische Dorfgemeinschaft zerstört werden müssen und so weiter.Und dann sagt Marx, antwortet dann in diesem Brief und es gibt wohl mehrere Versionen, der letzte oder den, den er abgeschickt hat, ist dann sehr, sehr kurz gefasst.Aber er scheint sich sehr damit beschäftigt zu haben, weil das so viele Versionen davon gibt.Und er sagt dann, nee, ist nicht notwendig. notwendig.Also Russland kann sonst auch den Übergang zum Kommunismus schaffen, ohne den Kapitalismus, ohne die Stufe des Kapitalismus zu durchlaufen.[33:00] Und damit gibt er so ein bisschen auch sein progressives Geschichtsbild auf.Also er sagt jetzt nicht mehr so dieses Stufenmodell, das man kennt, irgendwie keine Sklaverei, Feudalismus und so weiter, sondern er sagt, man kann das eben ein bisschen überspringen und er gibt auch den Eurozentrismus auf.Also Also jetzt ist es ja wie schwierig, man kann da nicht mehr sagen, ja gut, wenn jetzt die Produktivkräfte ausschlaggebend sind, wie weit du in deinem Geschichtsbild vorangeschritten bist als Gesellschaft, dann, ja, das löst sich dann so ein bisschen auf.Diese klassischen marxistischen Begriffe, die man auch noch aus dem Kapital kennt.Und deswegen ist das so zentral jetzt auch für die, ich sag mal, für den Sinneswandel, den hier Marx unterstellt wird. Ja, klar.[34:15] Haben, zurückgeben. Also es ist nicht jetzt irgendwie, man geht zurück in eine primitive Form des Agrar oder des Wirtschaftens, sondern man soll durchaus das, was man geschafft hat, da auch mitnehmen und davon profitieren.Wie das genau aussehen soll, ist nicht ganz klar, aber das ist nicht einfach nicht, dass man sich denkt, ja gut, das ist jetzt irgendwie so, keine Ahnung, Nostalgie und gehen wir alle zurück und wir haben uns alle lieb.Also das nicht, sondern schon basierend auf was wir jetzt haben, aber halt anders organisierte.[34:45] Und insbesondere anders organisiert im Sinne von statisch. Also nicht mehr dieses Wirtschaftswachstum.Ja. So.Was ist damit das Problem? Er sagt dann auch, er benutzt dann so dieses Beispiel von Wert und Gebrauchswert.Ich glaube, bei Marx heißt es Tauschwert und Gebrauchswert.Könnte sein, ja. Er nennt das einfach Wert.Und der Gebrauchswert ist halt dieses, naja, der Wert, den ein Ding hat, um die Bedürfnisse des Menschen zu erfüllen.Also, ja, keine Ahnung, Wasser hat halt die Eigenschaft, dass es meine Durst sättigt oder meine Wäsche wäscht, was auch immer.Und Luft, auch das ist einfach essentiell für unser Leben.Und das ist jetzt so und das war vor 500 Jahren für eine Person genau gleich.Ähnlich, ja. Ja, also, ja, ähnlich.[35:40] Und der Wert eines, ich glaube, bei Marx war das Tauschwert oder Zeitor sagt einfach Wert dazu, das ist eigentlich das, was wir etwas auf dem Markt geben.Also dieses künstliche, der künstliche Verkaufswert, was auch immer.Und er sagt dann ja, das Problem ist hier eigentlich, dass Kapitalismus braucht Knappheit, um zu überleben.Und Wert wird generiert, indem man Dinge verknappt.Also ein Markenprodukt hat einen, oder ich sage mal ein Markenschuh hat genau den gleichen Gebrauchswert wie ein Nicht-Markenschuh, Tonschuh beispielsweise.Beispielsweise, wenn man jetzt mal nicht längere Haltbarkeit und ähnliches unterstellt.Ja, es gibt ja genug Schuhe, die in den gleichen Fabriken produziert werden.Bei einem hast du einen Stempel drauf für eine Marke und bei den anderen nicht.Und das ist halt, also die Marke in diesem Sinne ist diese künstliche Verknappung.[36:44] Das finde ich einen spannenden Punkt, weil es auch was darüber aussagt, also mein Gedanke führt jetzt ein bisschen davon weg, aber weil es auch was darüber aussagt, was man Gebrauchswert nennt, weil jetzt zum Beispiel es stillt meinen Hunger, es wärmt meine Füße und so, das ist unumstritten, aber sowas wie, es gibt mir sozialen Status, ist das Gebrauchswert?Weil das wäre ja jetzt bei der Marke zum Beispiel tatsächlich der Fall.Also die Marke hat ja sozusagen den Nutzwert, dass sie mir in irgendeiner Form Status bringt, was ja auch wieder fortgesetzt wird, dass irgendwie ich vielleicht irgendwie sicherer bin oder bessere Beziehungen aufbauen kann, um dann irgendwie besseren Job zu kriegen.Da können ja im Grunde auch existenzielle Verkettungen sozusagen draus werden oder Zusammenhänge draus werden.Das finde ich jetzt spannend, gerade das Beispiel zu nehmen.Ja, das stimmt natürlich.[37:43] Woran ich dann denken musste, als ich das gelesen habe, ist, in Südamerika hat mir ein Freund letztens gesagt, gibt es den Begriff Patagucci und damit sind gemeint all diese Outdoor-Kleider von Patagonia und so weiter und die TouristInnen, die da mit rumlaufen und super teure Outdoor-Bekleidung haben.Und da dachte ich mir auch, das ist auch so interessant, weil jetzt mal angenommen, das geht hier wirklich nicht um die Marke, sondern um den Gebrauchswert, wird das ja auch zu was stilisiert, was mir persönlich komplett fern ist.Also, dass ich jetzt da zu jedem Zeitpunkt eine Lüftung unter meinem Arm brauche und irgendwie mein Hosenbein abschrauben kann, damit ich dort ein bisschen besser belüftet bin, finde ich auch so witzig.Es ist auch da wieder so eine Maximierung eigentlich.[38:33] Obwohl, ja, also ich glaube, man kann da in verschiedene Richtungen dann argumentieren mit diesem Gebrauchswert. Spannend.Aber was, ich glaube, sein Punkt ist, ist, dass in Bezugnahme auf die Commons, die haben immer den gleichen Gebrauchswert.Also jetzt insbesondere Wasser, Luft, Boden, das ist für uns Menschen ganz grundsätzlich einfach, also das sage ich jetzt, weil wir so physisch beschaffen sind, wie wir es halt sind, oder physikalisch, können wir nicht unendlich viel Wasser, Luft, Boden in Anspruch nehmen für unser Dasein, für unsere Existenz.Und deswegen haben die eigentlich immer den gleichen Gebrauchswert, wurden aber künstlich verknappt.Weder dieses, ich sag mal nochmal diese Ursünde, die ich jetzt so nenne, diese ursprüngliche Akkumulation wird das genannt, also die Einhegung jetzt beispielsweise des Bodens. So.[39:53] Das musste man zumindest bis zum Lebensende dann unterhalten.Sondern heute ist wirklich, also wenn du keine Arbeit mehr hast, dann verhungerst du.Plakativ gesagt. Und das ist so dieses Konzept der absoluten Armut.Kapitalismus schafft das.Oder er schafft das so. Du kannst im Grunde, du kannst gar nicht mehr in Subsistenzwirtschaft leben, selbst wenn du es wollen würdest. Ja. Ja, mhm.Was eben die Lösung da ein bisschen zu ist, ist eben dieses Zurückholen eigentlich dieser Commons.Also Produktionsmittel sollen wieder von den Menschen zusammen in flachen Hierarchien verwaltet werden, gemeinsam durch Arbeiter, Kooperativen, durch Genossenschaften und so weiter.Das ist so eigentlich die Idee dieses Degrowth, basierend auf Marx und gemäß Zeitungstheorie.Und auch eben hier, dann sagt er wieder, ja, warum ist jetzt das wichtig?Ja, weil sonst fallen wir eben in diese Barbarei. Ja, okay, ja. Ja, wie auch immer.Ich gehe mit, mit der Argumentation, warum, oder ich kann das sehr gut nachvollziehen, warum das wichtig ist, aber jetzt, weshalb man die Alternative dann das wäre, das weiß ich nicht so genau. Genau.[41:12] Und dann macht er noch etwas, eine Argumentationslinie auf, die ich auch nicht, vielleicht nicht so ganz verstanden habe, aber interessant finde.Und zwar ist er eigentlich sehr staatskritisch. Und er sagt auch, diese ganzen, dieser ganze gesellschaftliche Wandel können wir eigentlich nicht mit unseren parlamentarischen Instrumenten herbeiführen.Weil die Politik ist mit dem Kapitalismus so verbandelt, dass das gar nicht möglich ist.Also wir können uns, ich sag mal, nicht aus uns selbst reformieren.So ein bisschen aus dem Sumpf ziehen, am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen.Das geht irgendwie nicht. Und deswegen ist er auch gegen jegliche, diese Top-Down-Ansätze, wo wir darauf angewiesen werden, dass wir jemanden wählen oder eine Repräsentationsfigur haben, die das dann für uns verwirklicht.Weil das geht eben nicht, weil die ist ja angewiesen, dass wir sie wieder wählen. Ja.Das ist seine Kritik ein bisschen an diesem Politizismus.Ja, generell an jeder Form von Repräsentation. Jede repräsentative Struktur hat das ja im Endeffekt. Ja.Und ich hätte mir jetzt hier, es kann auch sein, dass ich das ein bisschen verpasst oder überlesen habe, ich hätte mir irgendwie gewünscht, ja, also was sind denn jetzt hier konkrete Alternativen?[42:31] Er nennt zwar schon dann auch Beispiele von Städten, wie die jetzt irgendwie anders organisiert sind und trotzdem, wir leben halt in diesem Politiksystem.Du kannst nicht Kapitalismus und das Politiksystem gleichzeitig abschaffen, also dann sind wir wirklich in dieser Barbarei, die er nennt.Zumindest nicht friedlich und geordnet. Genau.Und deswegen, ich frage mich hier so ein bisschen die Machbarkeit oder wo da der Weg entlang gehen soll.Naja, auf jeden Fall nennt er dann eben auch einige Gegenbeispiele oder argumentierte dann dagegen an, zum Beispiel zu diesem Akzelerationismus von Aaron Bastani.Das ist so, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein Autor, der so ein bisschen das Jetzt-Erst-Recht, diese Einstellung fördert oder proklamiert.Also nutzen wir jetzt die Erde so gut, wie es geht aus, damit wir möglichst viel technologischen Fortschritt haben und irgendwann ist dann alles so günstig und eigentlich gratis, dass wir in einem kommunistischen Schlaraffenland leben.Wir rennen quasi vor dem Klimawandel her und hoffen, dass wir technologisch schneller sind als er.Ja. Okay. Ja, ja, so ungefähr. Und unter ein Kehrer herbeigeführt wird das eben durch Wahlen.Ich sehe gerade so ein Comic-Figur, so ein Comic-Tom, der irgendwie vor Jerry wegläuft oder was andersrum.[43:53] Andersrum, glaube ich, ne? Jerry war die Maus. Comic-Jerry, die dann so über den Abhang läuft und so schnell läuft mit den Füßen, Füßen immer stehen bleibt, stehen bleibt und dann irgendwann doch runterfällt.Das ist so gerade die Vorstellung, die ich bei dieser Idee im Kopf habe.Wäre natürlich cool, cool, auch wenn wir jetzt ganz, ganz, ganz, ganz gut vorwärts machen mit Fortschritt, dann hätten wir vielleicht ein Wurmloch oder so.Ja, okay. Und wir können auf den Mars fliegen, weil ja der Mars zu terraformen einfacher ist als die Erde.Auch wieder wahr. So zu behalten, wie wir sie hatten, ja. Naja, also das ist so ein Beispiel, das er nennt. Das zweite ist Piketty.Also ganz grundsätzlich geht er da, glaube ich, schon auch sehr mit, mit der Idee von Piketty.[44:37] Dass das eben, dass eigentlich die Überwindung des derzeitigen kapitalistischen Systems und dass es dazu eben diese Vergesellschaftung braucht.Aber seine Kritik ist hier eigentlich, dass Piketty dafür die Umsetzung, für die Umsetzung eigentlich staatlicher Hilfe bedarf.Also zum Beispiel via Steuern, Umverteilung oder via Steuern.Und Saito sagt eben, nee, also wir brauchen eigentlich keinen starken Staat dafür.Deswegen, da widerspricht er Piketty ein bisschen.Und ganz generell ist seine Kritik an all diesen neuen Degrowth-Bewegungen eben, dass sie sich zu stark an Politik, Staat, Konsumismus orientieren und auch so ein bisschen die Arbeitsfrage aus dem Blick lassen. Ja.Und dazu nennt er dann seine fünf Säulen des Degrowth-Kommunismus, wo er sich dann insbesondere eben auch auf die Arbeit und auf die Produktionsweisen bezieht.Das ist so dann, ich sag mal, das Kernstück des Buchs, wo er so diese fünf Säulen präsentiert.Und zwar ist das zuerst der Wandel zur Gebrauchswirtschaft.Also es soll im Kapitalismus nicht produziert werden, was sich verkauft, sondern das, was benötigt wird. Okay. Das ist eigentlich das Ziel.[46:02] Er sagt dann ja, wenn die Gesellschaft irgendwie nur Luxusartikel als wichtig erachtet und den Gebrauchswert ignoriert, was du ja vorhin schon gesagt hast, ja, wie definiert man den denn?Aber dann verliere sie an Resilienz.Und ich gehe da schon ein Stück weit mit. Ja, ja, klar. Ja, klar.Aber eben, ich finde jetzt auch nicht, ja, ich finde jetzt, seine Beispiele sind dann auch sehr plakativ.Also, ja, wenn wir, ja, magst du was dazu sagen?Ja, also ich verstehe das natürlich auf der einen Ebene, verstehe ich das gut, aber dann ist halt auch wieder die Frage, das ist ja gerade die Kernidee des Marktes in seiner theoretischen Form, ist ja gerade im Grunde, dass das, was gebraucht wird, weiß niemand besser als die Person, die es braucht.Ja. So, oder? Und da ist der Grundgedanke im Markt, ist ja, die Person wird ihre Ressourcen schon für die Sachen einsetzen, die sie am meisten braucht.Ja. So, und dann, weil die Alternative ist halt eine zentrale Planung, das ist schwierig. Die Alternative ist eine….[47:10] Massive Endkomplexisierung der Produktionsketten, weil, weil, dass irgendjemand jetzt eine Genossenschaft sich dafür entscheidet, irgendwelche Metallringe zu produzieren, ja, die braucht sie selber nicht.Wird jetzt selber kein Gebrauchswert, aber aus den Metallringen werden dann vielleicht irgendwann Schuhe und da ist dann der Gebrauchswert wieder, aber also da ist, ja, ich mag die Idee, das ist ja im Grunde das Klassische, jeder, was er kann, jedem, was er braucht.Aber was ist der Steuerungsmechanismus, der das irgendwie steuert?Also ich bin da auch kein Fan des Marktes, wie wir ihn haben.Oder sage, dass der Markt das unbedingt kann.Aber da sehe ich halt auch keine Lösung drin. Ja.Ja, ich sehe das gleich. Irgendwer müsste ja dann entscheiden oder wir hätten eine Expertokratie oder dann eben doch einfach eine Diktatur ein Stück weit.Ja, was Erbauismus nennt.[48:36] Und BIP, was tatsächlich ein sehr schlechter Indikator ist, je länger, je mehr eigentlich, dass man auch sieht, also der Wohlstand nimmt ab einer gewissen Schwelle ja gar nicht mehr zu, also der Gesamtwohlstand der Nation.Aber der Gedanke, nicht nur auf das BIP zu gucken, ist halt auch alles andere als neu. Den haben wir auch schon seit 20, 30, 40 Jahren irgendwie in der Diskussion.Aber ja, klar, inhaltlich würde ich ihm nicht widersprechen.[49:03] Ja, seine zweite Säule ist die Verkürzung der Arbeitszeit.Also, ja, wenn wir nicht mehr unnütze Dinge produzieren, dann brauchen wir halt auch weniger Dinge.Das heißt, wir können auch weniger arbeiten, so ungefähr.Und was er aber zum Beispiel unter etwas Unnützem versteht, ist ein 24-Stunden-Restaurant oder Laden.Oder die Lieferung am nächsten Tag. Ja, okay. Und auch da, ja, ich verstehe den Punkt.Und trotzdem finde ich, ja, ich finde es auch, also es gibt auch Personen, die arbeiten gerne in der Nacht.Also es ist nicht so, ich finde auch, wenn das in irgendeiner Form dann ausbeutete Züge annimmt und es muss auch nicht jeder, jedes Geschäft 24 Stunden offen haben, natürlich nicht.Und trotzdem gibt es, ja, es gibt auch Berufe, da kannst du halt nicht zu normalen Zeiten einkaufen gehen, da bist du darauf angewiesen, was länger offen hat.So, ich finde das einfach so ein bisschen nicht gut oder einfach so ein bisschen hingeworfen, diese Beispiele.Wobei du da natürlich auch wieder denkst, diese Berufe würde es ja dann auch weniger geben.[50:17] Nee, das glaube ich eben nicht. Ja, gut, da kenne ich jetzt das Beispiel, was er Versato nennt, aber wenn du natürlich generell Arbeitszeiten verkürzt, dann wird ja auch zum Beispiel, wenn ich jetzt in so Berufe denke, die ja oft als Beispiel genannt werden, wie zum Beispiel medizinische Versorgung oder Pflege, was ja eher so mein Bereich ist gerade, da wird ja dann vermutlich auch insofern Kapazität frei, als dass natürlich auch da in anderen Bereichen irgendwie weniger Arbeiter, Arbeitnehmer benötigt werden, die dann eben auch in die Bereiche gehen können, sodass man da dann natürlich auch in den Schichtsystemen irgendwie eine Ausdünnung sozusagen hinkriegt, dass dann da eben auch freie Tage und ähnliches halt mehr da sind, dass dann eben man auch wieder zwischen 9 und 18 Uhr einkaufen gehen kann.So, um es jetzt mal ins Klassische zu ziehen. Ja, okay.So, aber das ist halt auch wieder ein komplexes Argument, was er wahrscheinlich nicht so ausführt, wie man es ausführen sollte.Naja, ich meine, seine fünfte Säule ist dieser, ist Fokus auf systemrelevante Arbeit und dann spezifisch auch Emotionsarbeit.Ja, so subsummiert natürlich diese ganze Care-Arbeit, die wir viel diskutieren.Und da sagt er eben, ja, hier kann natürlich die Produktivität nicht einfach erhöht werden, auch nichts Neues, wissen wir jetzt wirklich zur Genüge, pflegige Kommunikation, das braucht alle seine Zeit, kann nicht einfach schneller gemacht werden.[51:39] Und deswegen, ja, frage ich mich so ein bisschen, ja, ob er das jetzt zusammendenken würde, zusammen mit der Verkürzung der Arbeitszeit.Aber ja, ich verstehe den Punkt. Wobei tatsächlich, also auch wenn das auf der einen Ebene stimmt, du kannst natürlich nicht schneller pflegen.Das ist völlig richtig, was aber nicht heißt, dass es nicht in der heutigen Ausprägung der Systeme massive Ineffizienzen gibt.Also das ist ja tatsächlich jetzt einer der Kerne meiner Erwerbsarbeit sozusagen, dabei zu unterstützen, eben genau diese Ineffizienzen auch zu gucken und dann zu überlegen, wie kriegt man da irgendwie bessere Ausnutzung von Ressourcen bei, ohne die Arbeit für alle zu verdichten.Du kannst natürlich immer sagen, ja, du musst halt schneller machen.Das ist natürlich nicht Sinn der Sache.Aber man kann halt gucken, wo sind Dinge, die passieren, die eigentlich keinen Sinn ergeben, die man vielleicht weglassen könnte.Oder die man irgendwie beschleunigen könnte. Irgendwie Dokumentationsaufwand reduzieren, all solche Dinge.[52:36] Und in der vernünftigen Welt führt das dann halt nicht dazu, dass einfach nur der Betreuungsschlüssel hochgesetzt wird.Und gesagt wird, ja, jetzt kannst du ja 20 Leute betreuen und nicht mehr nur 17, weil du musst ja weniger dokumentieren.Das ist natürlich dann immer der Kampf, den man im Kapitalismus dann zu schlagen hat.Ja, das ist auch ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, weil in der Medizin ist natürlich das Gleiche.Jetzt AI hat dieses Versprechen und die Gefahr ist natürlich schon so, dass man dann diese gesamte gewonnene Zeit, die man davon hat, eben dann nicht unbedingt frei hat oder zur Erholung nutzen kann, sondern dann einfach weiterarbeiten muss. Das ist ja auch die historische Erfahrung.Genau. Und es ist ja nicht nur so, als wäre das irgendwie eine unbegründete Angst, sondern es ist ja genau das, was mit Industrialisierung und Digitalisierung in den letzten 30 Jahren passiert ist.Absolut. Ja, und schon davor. Also war es nicht Keynes, der gesagt hat, ja, irgendwie in den 60er Jahren werden wir dann eine 30-Stunden-Woche haben oder so.Das ist ja nicht eingetreten. Ich glaube, er bezog sich auf in 100 Jahren, müssen wir nur noch 20 Stunden in der Woche arbeiten.Aber diese 100 Jahre wären ungefähr jetzt. Also, sieht leider nicht so aus.[53:45] Genau, ja. Ich fand ein spannender Gedanke noch, wenn wir jetzt gleich hier beim Thema sind, Maschinen ersetzen Menschen, wie er sagt, ja, wenn was passiert, dann wird eigentlich menschliche Arbeitskraft einfach durch fossile Brennstoffe ersetzt. Das fand ich irgendwie noch ein guter Gedanke.Ich habe mir das nie so überlegt. Ja, klar, also es ist ja nicht.Ja gut, bis man die fossilen durch erneuerbare Energien ersetzt.Also das faktisch hat er natürlich jetzt für die nächsten zehn Jahre vermutlich recht oder hat auch historisch über die letzten 50 Jahre sicherlich recht gehabt oder auch 200 Jahre.Aber das ist natürlich, wenn man jetzt in die Zukunft guckt, gerade der Schritt, wo ja genau im Grunde die Hoffnung liegt, auch dieses Green New Deals, wogegen er sich ja auch so ein bisschen stellt.Das ist ja im Grunde genau die Hoffnung, dass man eben menschliche Arbeit nicht mehr durch fossile Energien ersetzen muss, sondern eben durch erneuerbare Energien ersetzen kann und dadurch natürlich dann tatsächlich eventuell auch der Ressourcenverbrauch massiv nach oben geht.Wie weit das funktioniert, kann man gut skeptisch sein.Ja, und trotzdem finde ich dann, für mich ist dann der Sprung sehr klein, wenn man sich dann der Mensch und dann ich sag mal einen Effizienzfaktor des Menschen vorschildert.Also wie viel Energie brauche ich, um was zu erledigen und wie viel braucht eine Maschine.Ich finde das schon, kann auch problematisch werden. Wenn man sich rein energetisch anguckt, sicherlich, ja.[55:10] Seine dritte Säule ist die Aufhebung uniformer Arbeitsteilung, also dass man Arbeit eben nicht nur in sehr spezifischen Formen ausüben soll, sondern dass man wieder so ein bisschen das Gesamtheitliche in den Blick kriegt.Für mich auch sehr eine sehr marxistische Idee, sondern ja, man soll es halt attraktiv machen. Und.[55:36] Diese Aufhebung der Arbeitsteilung, also das soll erreicht werden, finde ich auch per se einen sehr guten Gedanke.Aber auch da frage ich mich, wie kann man das ausweiten auf alle Bereiche?Also es gibt, wie du vorhin das Beispiel mit der Metallschraube, die du genannt hast.Es ist halt einfach dieses Gesamthafte, Ich glaube, da sind wir einfach als global nicht mehr.Also man kann das nicht. Man kann das in gewissen Arbeitsbereichen bestimmt und bestimmt auch verbessern.Aber ich glaube, viele Berufe sind einfach unattraktiv. Und entweder wir machen die attraktiv, indem wir die anders, indem wir sie sehr viel kürzer machen oder sehr viel besser entlöhnen.Aber ja, sonst finde ich das so ein bisschen idealistisch. Ja, es gibt ja auch diese Tendenzen.Also wenn man sich jetzt zum Beispiel, gerade Autoproduktion ist ja so im Grunde ein perfektes Beispiel, wo du ja wirklich mittlerweile auch weg bist von dem, du drehst immer nur die gleiche Schraube mit derselben Bewegung für eine halbe Stunde, wo du ja tatsächlich mittlerweile selbstorganisierte Inseln hast von Produktionsarbeitenden, die halt irgendwie ihren eigenen Produktionsschnitt im Team selbst organisieren, teilweise Schichtpläne selbst organisieren und da eben das auch hin und her wechseln.Und gleichzeitig hast du aber auch eben Bereiche, die einfach unglaublich spezialisiertes Wissen erfordern. Nehmen wir mal das Beispiel Medizin.[56:55] Klar kann man sich irgendwie hochspezialisiertes Diabetologie-Wissen irgendwie draufpacken und gleichzeitig auch noch die Hälfte seiner Zeit irgendwie auf dem Acker arbeiten, aber die Frage ist, wie sinnvoll ist das dann tatsächlich für alle Beteiligten.Jaja, total.[57:18] Entschuldigung, ich will jetzt das auf dem Acker arbeiten, will ich nicht desbekehrlich bezeichnen.Das ist eben auch hochspezialisiertes Fachwissen und jahrzehntelange Erfahrung, die eben da einem dabei helfen, da gute, bessere Arbeit zu machen.Genau, ja, ja. Und ich finde das ganz ein wichtiger Punkt. Ich persönlich bin auch sehr für die Professionalisierung der Arbeit.Insbesondere, es ist immer ein zweischneidiges Schwert, aber ich glaube halt schon, und in der Schweiz haben wir diesbezüglich auch ein sehr gutes System mit dieser Ausbildung, also Lehrberufe, die sind auch sehr hoch angesehen bei uns.Also es ist jetzt nicht so, dass man, man kann damit auch sehr gut ein sehr gutes Leben führen.Man muss nicht an die Uni gegangen sein und das finde ich sehr, ja finde ich eigentlich einen guten Weg.Aber er sagt auch, seine vierte Säule wäre dann die Demokratisierung des Produktionsprozesses, was du gerade angesprochen hast.Also dieses in einem Unternehmen, dass man demokratisch eine Entscheidung findet, Wissen und Information auch als common behandelt. Also nicht Patente, nicht Monopole, sondern das ist auch ein Allgemeingut.So und das sind so seine fünf Säulen seines Degrowth-Kommunismus.[58:28] Ist es jetzt nicht neu, finde ich? Nee, im Kern nicht.Deswegen, ich bin zu wenig drin, um sagen zu können, ja, das ist jetzt ökonomisch wirklich was ganz Neues.Und ich kann das gut nachvollziehen, wenn man jetzt Marx nur interpretiert und so liest, dass das ein entspannendes Element drin hat.Aber die Schlussfolgerung ist jetzt für mich nicht so ganz, ja.Nee. Nee, also da war jetzt kein Punkt bei, wo ich so denken würde, von dem habe ich ja noch nie gehört.[59:03] Ich glaube tatsächlich, er kommt ja auch aus ein bisschen, was du ja auch sagtest, aus der Marx-Exegese sozusagen, aus der Auseinandersetzung mit der Person Marx. Marx.Insofern ist es natürlich nicht überraschend, dass für ihn gerade diese Neuinterpretation, diese Entdeckung der Notizen des späten Marx, die halt diese Argumente auch nochmal stützen.Ja, stimmt. Sicherlich spannend, aber es ist halt nicht, dass sich diese Argumente irgendwie neu ergeben.Sie kommen, jetzt kann man halt auch noch Marx als Unterstützer zitieren. Genau, ja.Und den auch ein bisschen reinwaschen, von der Kritik, dass er halt nicht nachhaltig ist. Ja, genau.[59:38] Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall endet das Buch dann auch mit ein paar Beispielen von Fearless Cities zum Beispiel, also Barcelona, die sich eben so als Municipalismus ein bisschen organisiert hat.Auch eine südafrikanische Kampagne für Ernährungssicherheit erwähnt er, die sich dann eben auflehnt gegen die Firmen und dann so kollektiv kleinbauen und sich organisieren.Also ein paar Beispiele gibt es, nennt er dann, wie das stattfinden kann und er sagt zum Schluss, zitiert er eine Politologin, die sagt, dem, es braucht eigentlich nur 3,5 Prozent, damit es zu einer gesellschaftlichen, damit große gesellschaftliche Umwälzungen stattfinden können.Das ist so der Aufruf. Der Aufruf zur Rebellion schon fast ein bisschen. Ja.Das wär’s gewesen von Systemsturz.[1:00:34] Okay, danke dir. Ja, spannendes Buch. Ich muss gestehen, nach all all dem Aufruhr,
Mehr Literatur
[1:00:42] den ich darüber gelesen habe oder so, dass das irgendwie auch Spiegel-Bestseller wurde und so, hatte ich jetzt so ein bisschen mehr Punch erwartet.Argumentativ so eine starke neue Idee.[1:00:55] Aber vielleicht ist es tatsächlich diese Max-Interpretation sozusagen, die da irgendwie die eigentliche Innovation darstellt und das Ganze dann halt so ein bisschen in die aktuellen Debatten, einbindet. Schätzt du das ähnlich ein? Ich schätze das auch so ein, so ist es mir auch gegangen am Ende.Wie gesagt, ich bin keine Ökonomin, ich habe da wirklich keine Expertise, deswegen kann ich das schwer einordnen.Ich kann keine Aussage dazu treffen. Aber wie gesagt, diese Argumente hat man alle schon irgendwann mal gehört.Ich verstehe auch seine Kritik am Degrowth, wie wir das kennen, wenn man seine Kapitalismuskritik ranzieht.Aber ja, Ja, konkret was Neues habe ich jetzt da auch nicht rausgezogen.Spannend. Also ist es vielleicht tatsächlich auch für die eine interessante Lektüre, die diese ganzen Diskussionen noch nicht so verfolgen.Ja, vielleicht. Wenn man jetzt wieder so zielgruppenweise denkt, die Feuilleton-LeserInnen sind vielleicht bisher nicht so die, die sich im Kern mit den Degrowth-Theorien beschäftigt haben.Aber wenn man sie ihnen irgendwie mit Marx versehen serviert, dann sind sie vielleicht ein bisschen bekömmlicher oder so.Von denen, die sich aus den 60er und 70er Jahren immer noch für links halten.[1:02:13] Vielleicht kann man sie über den Weg sozusagen ein bisschen schmackhaft machen und verkaufen. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt.Keine Ahnung. Weil ich glaube nicht, dass das jetzt so die Greta Thunberg-Generation irgendwie anmacht, diese Argumentationsform.Zumindest werden diese Argumente nicht für neu halten. Ja.[1:02:37] Spannend. Danke dir für die Vorstellung von Kohai Satos Buch Systemsturz.Ich habe natürlich nebenbei so ein bisschen darüber nachgedacht, was man so parallel oder ergänzender zu lesen könnte.Ich glaube, einmal sind es im Kern alle Bücher, die wir gerade so haben zum Thema, wie können wir die Wirtschaft klimagerecht gestalten, die dann auch das eine oder das andere Argument von Sato vermutlich ähnlich entwickeln werden, vielleicht hinter einem anderen theoretischen Hintergrund, vielleicht mit ein bisschen mehr Vertrauen in den Staat oder ein bisschen mehr Vertrauen in den Markt als Mechanismen, die wir so haben.Aber ich glaube, das ist eine produktive Debatte, wo man sehr produktiv sich irgendwie gucken kann, welche Rolle muss der Staat eigentlich spielen.[1:03:20] Was sind die Barrieren, die wir in der repräsentativen Demokratie irgendwie haben, da diese Transformation hinzukriegen.Also das finde ich eine ganz produktive Debatte. Warte, ich habe jetzt drei Folgen von uns oder vier Folgen im Kopf.Tatsächlich alles sogar Folgen von mir, die sich jetzt für mich da direkt dran anschließen, die man gut lesen könnte.Einmal natürlich, wenn man so ein bisschen in den späten Nachwirkungen von Marx irgendwie rumdenken will und auch gerade so dieses Thema Beschleunigung ein bisschen im Kopf hat, ist natürlich die Arbeit von Hartmut Rosa irgendwie durchaus anschlussfähig.Auch so dieses Entfremdung klang ja bei Sato auch so ein bisschen durch man muss eine Produktion so aus dieser spezialisierten Produktion wieder raus, ein bisschen ins Ganzheitliche rein das sind ja auch so Resonanz-Argumente von Hartmut Rosa, also da unsere Folge zur Resonanz von Rosa ist da sicherlich, wenn man in die Richtung gucken will dann die beiden David Graeber-Folgen, Schulden und Anfänge wobei ich glaube tatsächlich, dass Schulden hier die.[1:04:21] Die einschlägigere Folge wäre Und weil du diesen Extraktivismus am Anfang angesprochen hast und diese Externalisierung, da habe ich einmal eine Folge gemacht zu dieser Zeitschrift Archplus.Das ist eigentlich eine Architekturzeitschrift. Europa als Externalisierungsgesellschaft.Das war tatsächlich, was das Thema angeht, ist das wirklich ein extrem gutes Heft und ich glaube auch eine ganz gute Folge geworden. geworden.Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob ich noch andere Dinge gelesen habe, die in eine ähnliche Richtung gehen.Ihr könnt euch im Grunde jede unserer Wirtschaftsfolgen dann auch nochmal raus, rauspicken, wenn ihr irgendwie sagt, ja, der Staat spielt doch eine wichtige Rolle, dann guckt auch mal bei Mariana Mazzucato vorbei, da gibt es eine Folge von Christoph, glaube ich, zu.Christoph hat auch mal eine Folge gemacht zu den Neuerfindungen der Arbeit, oder die Rettung der Arbeit heißt es, glaube ich.Da geht es auch um das Thema Ersetzen durch Roboter und durch Maschinen, Was ist da eigentlich zu erwarten oder was könnte da passieren?Also auch da gibt es, glaube ich, in unseren Episoden eine ganze Menge.Guckt einfach mal auf das Themenfeld Wirtschaft.Da haben wir ja einiges gemacht. Genau, das waren so die Sachen, die mir jetzt spontan dazu einfallen.Was hast du noch an Tipps?[1:05:39] Mich hat das Buch dann sehr stark an Ulrike Herrmann auch erinnert.Das Ende des Kapitalismus. Ich glaube, das ist 2021 erschienen. Kann das sein?[1:05:48] Ich weiß, es ist sehr ähnlich. Die Argumentation ist ähnlich.Ich weiß nicht mehr genau, wo sich diese Bücher jetzt unterscheiden würden.Also klar, sie bezieht sich jetzt nicht in dieser Form auf Marx.Aber ganz grundsätzlich glaube ich, Bücher von Ulrike Herrmann schlagen in eine ähnliche Kerbe und sind auch sehr gut lesbar zu diesem Thema. mal.Das ist ein Buch, was auch ich habe es selbst nicht gelesen.Es liegt seit längerem auf meiner Leseliste, aber wurde eben von Seido auch erwähnt, ist Piketty Kapital und Ideologie.Nicht das Kapital im 21.Jahrhundert, sondern eben das, wo er sich dann spezifisch auch auf diese Überwindung des Systems beruft.Das ist bestimmt auch interessant dazu.Dann hätte ich noch einen Film, den ich kürzlich gesehen habe.Aber das ist The Driven Ones.Das ist eine Dokumentation über fünf Studierende der Universität St. Gallen.Diese Uni ist so die Wirtschaftsuniversität der Schweiz, also auch international sehr renommiert.Und das beschreibt so ein bisschen den Struggle, den sie in dieser Corporate World haben.Und das ist, ich finde es halt, es hat jetzt nicht direkt was damit zu tun, aber schon auch wieder das Thema Entschleunigung, Beschleunigung.Was macht man für Arbeit? Bullshit Jobs.So, und ich fand das sehr interessant, diese fünf Studienabgänger da, wurden da begleitet über eine gewisse Zeit. Haben wir zu Bullshitjobs nicht auch eine Folge?Doch, doch, das wäre auch noch meine Ergänzung.[1:07:18] Bullshitjobs und ich glaube sonst hast du bereits alles erwähnt.Mythos Geldknappheit, das ist ja auch Modern Monetary Theory. Das war Folge 66.Das würde auch noch dazu passen. Das wäre es von mir. Ja, viel zu lesen, viel zu tun.Wie gesagt, großes Thema, kontrovers angegangen sozusagen.Und dass man Marx jetzt auch als Vertreter einer Kreislaufwirtschaft verstehen kann, das nehme ich jetzt mit sozusagen aus dem Buch.Das ist natürlich auch ein schöner kleiner Twist, zumindest für die Theoretiker interessant.[1:08:06] Ja, das war es dann mit unserer Episode 71.
Ausstieg
[1:08:11] Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, habt Ideen, Inspirationen für euer weiteres Lesen, für euer weiteres Denken bekommen. kommen.Mir bleibt dann nur, euch auf unsere diversen Social-Media-Kanäle zu verweisen.Bei Instagram und bei Facebook findet ihr uns bei Instagram at Deckeln und bei Facebook auch.Ich glaube, wir haben sogar noch irgendwie unseren Xitta-Account, aber ich weiß auch nicht, wie lange es den noch gibt.Da kündigen wir zumindest noch neue Episoden an und dann haben wir noch unseren Mastodon-Account, das ist at ZZD.Also zwischen zwei Deckeln ZZD at podcasts.social da findet ihr auch immer die neuen Episoden von uns und auch zwischendurch mal Zitate aus den Büchern, die wir euch hier vorstellen wenn wir daran denken sie zu posten.[1:09:03] So viel dazu ihr könnt uns natürlich auch neue Episoden im Podcastprogramm eurer Wahl abonnieren wir sind auch, wenn es denn sein muss und weil so viele uns da hören auf Spotify, aber natürlich haben wir auch ein RSS-Feed über die Webseite und in den diversen offenen Podcast-Verzeichnissen werdet ihr uns auch finden, wenn ihr uns sucht.Wenn ihr uns Kommentare hinterlassen wollt, macht das gerne einfach über Social Media oder eben direkt auf unserer Webseite.Da haben wir auch eine ganz altmodische Kommentarfunktion.Da bleibt der Kommentar dann auch auf Dauer im Kontext dieser Episode bestehen.Und wir können darunter vielleicht ein bisschen diskutieren, wenn ihr mögt.Sonst, wie gesagt, hören wir uns oder in anderer Konstellation in der nächsten Episode wieder. Bis dahin und viel Spaß beim Lesen.[1:09:49] Music.
Der Beitrag 071 – „Systemsturz“ von Kohei Saito erschien zuerst auf Zwischen zwei Deckeln.

Feb 22, 2024 • 1h 14min
070 – Alle_Zeit von Teresa Bücker
In der letzten Folge waren Gefühle Thema und auch dieses Mal geht es emotionalisiert weiter, denn, wer wie Zugriff auf die eigene Lebenszeit und ihre Strukturierung hat, ist in der neuen Folge Thema. Dass es dabei auch im Verteilungsfragen geht, wird vermutlich schnell klar.
In „Alle_Zeit: Eine Frage von Macht und Freiheit“ von Teresa Bücker zeichnet die Autorin das Bild einer Gesellschaft, die mit ihrem eigenem Zeitumgang in Überforderungsstrukturen läuft. Einerseits sind Menschen auf persönlicher Ebene der Autorin folgend durch ihre starke Fokussierung auf Erwerbsarbeit nicht in der Lage sich frei zu entfalten. Andererseits kommen durch diese Struktur insbesondere Frauen zu kurz und an Grenzen der Belastbarkeit, weil Care-Arbeit immer noch primär in ihre Verantwortung gelegt wird. In Kombination mit dem Verblassen des Alleinernährermodells bekommen Kinder nicht die Zeitaufwendungen, die ihnen zustehen und ihr Aufwachsen in Familien wird zunehmend prekär. Zusammengenommen leidet darunter auch die Zivilgesellschaft, die nicht verlässlich darauf bauen kann, dass Menschen ihre Ressourcen in Form von Zeit und Kraft ausreichend einbringen können. Durch all diese Probleme ziehen sich nur Geschlechterungleichheiten, sondern auch ökonomische Verteilungsfragen: Nur, wer ökonomisch wohlhabend ist, kann sich auch Zeitstrukturen der Teilhabe ermöglichen.
Shownotes
„Alle_Zeit“ (Verlagswebseite) von Teresa Bücker
„Grease“ (Wikipedia)
„Der Pate“ (Wikipedia)
Teresa Bücker (Autorinnenwebseite)
„Konsum“ von Carl Tillessen [hat Christoph vergessen in der Folge zu erwähnen]
Dritte Orte (Wikipedia)
„Die 4-in-1-Perspektive“ (einseitiges PDF) nach Frigga Haug
„Wahnsinn! So viel müssten Mütter eigentlich verdienen“ (instyle.de)
4. Kinderstudie (2018, World Vision)
„Die zentralen Ideen und Ziele des Optionszeitenmodells“ (Deutsches Jugendinstitut)
ZZD065: „Baustellen der Nation“ von Philip Banse und Ulf Buermeyer
weitere Folgen, Literatur und Hinweise
ZZD001: „Resonanz“ von Hartmut Rosa
„Beschleunigung und Entfremdung“ von Hartmut Rosa
„Unverfügbarkeit“ von Hartmut Rosa
ZZD047: „Die Erschöpfung der Frauen“ von Franziska Schutzbach
„Zeit“ von Rüdiger Safranski
„Eine kurze Geschichte der Zeit“ von Stephen Hawking
„Das Care-Chain-Konzept auf dem Prüfstand : eine Fallstudie der transnationalen Care-Arrangements polnischer und ukrainischer Migrantinnen“ von Helma Lutz und Ewa Palenga-Möllenbeck
„Prekarisierung“ von Mona Motakef
„Die Metamorphosen der sozialen Frage“ von Robert Castel
„Eigenzeit: Entstehung und Strukturierung eines Zeitgefühls“ von Helga Nowotny
„Über die Zeit“ von Norbert Elias
„Die Zeit, die Zeit“ von Martin Suter
ZZD019: „Die Bedeutung von Klasse“ von bell hooks
ZZD026: „Die Rettung der Arbeit“ von Lisa Herzog
ZZD029: „Nichts tun“ von Jenny Odell
ZZD039: „Vom Ende des Gemeinwohls“ von Michael J. Sandel
ZZD066: „Mythos Geldknappheit“ von Maurice Höfgen
Transkript
Einstieg
[0:00] Music.
[0:16] Ich begrüße euch zur 70 Episode von zwischen zweiter kennen ich bin Amanda und darf heute dem Christoph zu hören hallo zusammen.
[0:25] Hallo Christoph.
[0:27] Ich habe eine Frage an dich ja bitte machst du hast du so ein Ritual was du jedes Mal machst bevor wir Podcast aufnehmen.
[0:35] Stressig durch die Notizen gehen ist das ein Ritual ich weiß nicht das gehört das gehört dazu das ist nicht.Wie bei fast allen Dingen die ich tue ist Teil des Rituals dass ich mir ein Tee vorher koche aber das.Also mein Leben besteht in großen Teilen aus Tee kochen glaube ich du von daher ich glaube.Nicht so richtig ich muss sagen was schon irgendwie ritualisiert ist ist irgendwie Handy also die oder Handys Arbeits und privat Handy in Flugmodus packen Leuten sagen ich bin ich bin jetzt im Podcast wenn was ist dann könnt ihr mich so und so noch erreichen aber eigentlich halt nicht.Also das ist schon irgendwie ritualisiert aber es nicht so als würde ich immer meine grünen gepunkteten Socken anziehen weil die mir einmal sobald eine Podcast Aufnahme so gut gefallen haben und die Episode so gut geworden ist wie ist das bei dir Stimme Übungen machst du auch nicht nee ich habe zwar mal Radio Beiträge gemacht das heißt ich könnte sowas sogar und ich habe ja auch mal im Chor gesungen da macht man sowas auch gute Idee habe ich noch nie drüber nachgedacht.Also vielleicht kann ich noch ganz viel toller klingen vielleicht sollte ich das mal machen ja könnte man auch im Vorgeplänkel reinschneiden wir wir gegenseitig und Stimme Übung Formen ich weiß nicht wer sich darüber freuen wird ich glaube dass das aufnehmen würde Spaß machen das glaube ich auch du machst Stimme Übungen okay ja vorbildlich.
[2:00] Nee also ich wenn wir halt beispielsweise mal am Morgen aufnehmen dann dann habe ich ja vorher vorhin noch mit niemandem gesprochen und dann gleich Aufnahme finde ich schon so ein bisschen hart und ich es gibt auch ich habe eben letztens mit einer Freundin mit einer Sängerin drüber gesprochen.Ich dachte mit mir zuerst ich bilde mir das ein aber das ist wohl gar nicht so selten jetzt zum Beispiel trinke ich keine Milch davor oder ich esse keine Nüsse ja und ja ergibt Sinn finde ich ja findest du auch okay.
[2:30] Naja also so viel zum Vorgeplänkel was beschäftigt dich denn so intellektuelle Moment.
[2:39] Also das Buch jetzt in letzter Zeit offensichtlich was ich heute vorstelle das hat mich noch mal so ein bisschen ins denken gebracht weil ich das ganze Thema.Zeit.Jetzt eigentlich eher gesellschaftstheoretisch schon länger ins es mit dem ich mich immer mal wieder herumgeschlagen habe deswegen war das irgendwie viel Erinnerungen an Studienzeiten das war ganz schön.Und noch nicht also ist jetzt nicht so mega intellektuell aber Anfang des Jahres geht es jetzt langsam wieder los mit meiner Ferienfreizeit dass die organisiert werden muss das ist jetzt noch nicht intensiv aber man muss sich über eine überlegen welche Kinder vielleicht auch schon zu alt sind und so und muss da an die ersten austausche gehen die ersten Sachen planen und so also das ist einfach so ein bisschen was was nebenbei läuft um ja genau und ansonsten habe ich mich wahnsinnig gefreut wir haben einen neuen Fernseher gekauft aber wir hatten vorher ein recht klein Fernseher jetzt haben wir einen großen Fernseher und ich habe ein bisschen die Hoffnung dass mir der Lust darauf macht mal irgendwelche Klassiker und so zu gucken weil sonst weiß ich nicht also ich gucke eigentlich alleine gar kein Fernsehen und jetzt sieht das für mich fühlt sich das noch an als hätten wir im Kino auf einmal zu Hause und jetzt, habe ich die Hoffnung dass ich da ein paar Sachen mal nacharbeiten kann die ich eigentlich schon länger auf der Liste habe mal gucken ob das was wird.
[3:52] Sehr schön ja das ist das finde ich ein sehr guten Plan ich habe gestern grease geschaut zum ersten Mal oh das habe ich ihm besagten Chor Mal gesungen in einem Medley okay.Ja also ich fand es ich fand es ehrlich gesagt schwierig auszuhalten nicht wegen der Musik die kennt man ja dann so irgendwie das ist ja noch cool aber so dass der Rest drumrum.Ich habe es nicht ich bin froh dass ich es gesehen habe aber es ist nicht also es ist schon es ist eine andere Generation das ist nicht gut geeilt hat ja ich habe es glaube ich nie geguckt muss ich sagen.
[4:22] Ist halt auch so lustige sollen in der Highschool spielen und die die Schauspielerinnen die sind alle über 30 ja man sieht es auch sehr deutlich ne ja ja also aber ja es macht auf jeden Fall Spaß und so alte Filme ich habe es gibt auch das stummfilmfestival in Zürich.Das hat jetzt stattgefunden und da habe ich mir auch einen Film angeschaut und das ist schon das ist ziemlich cool und das wird auch jetzt hier nicht nur so ganz klassisch mit Klavier begleitet sondern es gibt auch solche die halt modernen oder mit mit Synthesizer oder oder elektronisch begleitet sind und das macht echt Spaß und dann sieht man halt auch so Klassiker mal wie ganz anders mehr als wenn ich ich gucke mir das ja nicht zu Hause irgendwie an ja das ging aber gut sehr sehr gut ja.Ich habe vor Jahren mal der Pate geguckt und das läuft jetzt hier in einem der größeren Kinos die machen einmal im Monat so Klassiker.Zeigen die und das läuft jetzt im Februar und da bin ich nächstes Wochenende drin und gucke den an und mal schauen wie gut der gealtert ist da bin ich auch sehr gespannt.
[5:26] Genau Mafia interessiert mich ja so aus.Soziologischer Sicht auch sehr muss das auch noch mal übereinander legen wie die Darstellung da ist zu dem was hier im wissenschaftlicher Literatur kenne also.Okay aber das heißt du bist das ist auch deine intellektuell also intellektuelle Beschäftigung war Stummfilm stummfilmfestival in letzter Zeit.
[5:48] Ja also intellektuell vielleicht nicht aber auf jeden Fall hat das sehr Spaß gemacht und ich bin so ich bin eine ganz ganz schreckliche Filmschau in also wenn man das Meer zu Hause weil ich bin dann so alle 2 Minuten das kann nicht sein oder das ist jetzt unlogisch oder und was ist was ist die jetzt genau und und dann dann lese ich parallel so Wikipedia den Plot nach wenn ich nicht also ich bin wirklich das macht keinen Spaß mit den Filmen zu schauen deswegen war das ganz gut vielleicht Kino ist besser da muss ich mich ein bisschen zusammenreißen das finde ich am Keynote tatsächlich auch gut weil er so modernes Streaming erlaubt ja andauernd zu pausieren und, das geht im Kino halt nicht.Das finde ich daran sehr gut man ist einfach für die Zeit relativ stark gefesselt und auch so zweiter Bildschirm und so parallel ist ja da immer noch irgendwie tabuisiert und deswegen ich bin großer Kinofan geworden über die letzten Weise nicht zwei Jahre oder so ich finde das richtig toll.
[6:42] Ja das passt auch so ein bisschen zu Buch dass du vorstellen willst ne die Zeit sich die Zeit für was nehmen und ich parallel irgendwas anderes gleichzeitig machen.Du stellst uns nämlich heute also vielleicht passt es ich weiß es ja noch nicht genug gar nicht genau kannst du dann noch richtig stellen das Buch dass du vorstellst heißt alle Zeit eine Frage von Macht und Freiheit und wurde geschrieben von Theresa Bük.
[7:13] Das ist eine Journalistin und Autorin die für die Süddeutsche Zeitung also das Magazin schreibt und auch bis vor einigen Jahren Chefredakteurin von Edition f gewesen ist die zum IV ist ich glaube es ist nur unten Online-Magazin also nur im Sinne von es scheint ausschließlich online und insbesondere beschäftigt ist beschäftigt es sich mit gleichstellungs und berechtigungs fragen.Und das Buch das ist vor zwei Jahren 2022 erschienen bei Ullstein und hat auch ein Buch Preis gewonnen denn NDR, hochpreis letzten Jahres genau war für den deutschen sachbuchpreis glaube ich nominiert und ich weiß gar nicht ob man das als Schweizerin weiß der Ende er ist der Norddeutsche Rundfunk also ist eine der Landesrundfunkanstalten die wir haben.Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei uns so ist es quasi nach nach Ländern meistens irgendwie sortiert ich glaube manchmal sind auch ein paar Bundesländer zusammengefasst naja und NDR ist zumindest der der das dritte Programm mit dem ich groß geworden bin quasi hier oben ne.
[8:16] Wir kennen das also ich finde die auch zum Teil sehr gut die Beiträge im SWR MDR dass das Schaum schaut man sich schon in der Schweiz auch an dafür höre ich oder ja doch höre ich gerne den den SRF.Kultur Sternstunde Philosophie ist glaube ich auch von denen und so ne also ja da bin ich da höre ich gerne rein.
[8:40] So magst du uns das tll geben ja total gerne.
Tl;dl Kurzzusammenfassung
[8:49] In alle Zeit eine Frage von Macht und Freiheit von Teresa Bücker zeichnet die Autorin das Bild einer Gesellschaft die mit ihrem eigenen Zeitumstellung in Überforderung Strukturen läuft einerseits sind Menschen auf persönlicher Ebene der Autoren Folgen durch ihre starke Fokus Fokussierung auf Erwerbsarbeit nicht in der Lage sich frei zu ent.Andererseits kommen durch diese Strukturen insbesondere Frauen zu kurz und an Grenzen ihrer Belastbarkeit bei care-arbeit immer noch primär in Ihrer Verantwortung liegt.Zusammen mit dem Verblassen des allein in ihrer Modells bekommen Kinder nicht die Zeitaufwendungen die ihn zustehen und ihr aufwachsenden Familien wird zunehmend preg zusammengenommen leidet darunter auch die Zivilgesellschaft die nicht verlässlich darauf bauen kann dass Menschen ihre Ressourcen in Form von Zeit und Kraft ausreichend einbringen können.Durch all diese Probleme ziehen sich nicht nur geschlechterungleichheiten sondern auch ökonomische Verteilungsfragen nur wer ökonomisch wohlhabend ist kann sich auch Zeitstrukturen der Teilhabe ermöglichen.
Buchvorstellung
[9:47] Dank das klingt spannend mich hat jetzt gerade der die Stelle mit dass die Kinder zu wenig Zeit bekommen oder wenn ich zeit Zuwendung finde ich interessant habe ich mir noch nie so überlegt ich bin gespannt ja magst du gleich beginnen ja mache ich sehr gerne also Frau Bücker startet in dem Buch mit quasi so einer ja gefühlt Momentaufnahme möchte ich sagen also der.Oder der Wiedergabe des Gefühls des Menschen.Glauben oder wahrnehmen dass ihre Zeit niemals reicht dass es so dass wie wie sie startet also das setzt sie erstmal und das ist insofern ein bisschen also man könnte sagen dass.Gar nicht so viel Sinn oder lässt sich objektiv nicht so richtig nachvollziehen weil wir eigentlich wissen dass die Menge an freier Zeit oder dem was als Freizeit gelabert wird seit Jahrzehnten ansteigt also wir arbeiten ja heute viel weniger also Lohnarbeit als vor keine Ahnung 100 Jahren also die 40 Stunden Woche als Errungenschaft wurde ja gegen 60 70 Arbeitsstunden irgendwie durchgesetzt zum Beispiel und wir haben ja immer mehr Annehmlichkeiten im Haushalt durch keine Ahnung Waschmaschine Spülmaschine mittlerweile vielleicht auch Staubsaugerroboter die einem so grundsätzliche Tätigkeiten im Haushalt ja durchaus erleichtert.
[11:11] Aber trotzdem haben Menschen das Gefühl naja irgendwie so richtig viel also.So richtig viel freie Zeit in der ich einfach tun kann was ich möchte habe ich gar nicht unbedingt und sie kontrastiert das so ein bisschen mit dem Zeitgefühl einer ihrer Meinung nach erfüllten Kindheit wo es einfach Phasen gibt in der man Zeit als endlos empfindet die einfach ja in einem großen Mengen zur Verfügung ist und die man füllen kann mit was auch immer man gerne möchte und ja sie sagten das heißt aber dieses Gefühl lässt halt dann nach und.Der Umgang mit Zeit die irgendwie auch stark geplant ist und nicht einfach dass man so in den Tag hinein lebt sondern.Sondern sehr in Zeit Blöcken denkt das ist halt irgendwie eine erlerntes Verhalten was halt so ich würde sagen das ist halt notwendig um Gesellschaft miteinander zu koordinieren und zu synchronisieren.
[12:04] Und ja zum.Gefühl der Zeitknappheit sagt sie naja dass die meiste Zeit die wir irgendwie dazu bekommen kommt halt im Rentenalter dazu und noch dazu kommt sie nicht allen Menschen in gleichem Maße zu das heißt wenn man in prekären Jobs arbeitet dann führt das dazu dass man irgendwie vielfach hackstück der Zeit hat die man nicht in Gänze und in Stücken nutzen kann und ja so ist das gar nicht unbedingt gleich verteilt und sie nimmt dann ich habe den Forscher vergessen den aber genau es gibt den Begriff des Zeit Wohlstandes und da wird das Ganze definiert als ja genug Zeit für die eigenen Bedürfnisse also sehr sehr weit gehalten erst einmal.Und.
[12:51] Ja dass der sozioökonomische Status die Arbeitszeit und die Freizeitgestaltung beeinflusst ist natürlich irgendwie klar habe ich gerade schon gesagt.
[13:02] Und ja ein Problem dass sie noch aufmacht ist das gerade sozialer Status heute sehr vielfältige Fertigkeiten.Einfordert gewissermaßen also nur weil man freie Zeit hat bedeutet das nicht dass da keiner Anforderungen sich an ein selbst stellen weil von einem selbst eingefordert ist dass man beispielsweise sich sportlich ertüchtigt dass man irgendwie sich im Bereich der Kultur auskennt weiterbildet wie auch immer dass man da up-to-date ist gleichzeitig soll man natürlich beruflich erfolgreich sein und zum Beispiel auch kulinarisch gebildet also es ist so um um einen hohen sozialen Status inne zu haben reicht es nicht nur eine dieser eins dieser Felder zu bespielen sondern eigentlich muss man in allen irgendwie ganz gut sein und Zeit aufbringen.Und dann sagt sie natürlich auch naja wir leben in einer Wien 10 overwork Kultur also dass man die eigene Zeit die über die normale Lohnarbeit Zeit hinausgeht opfert kann immer ein Wettbewerbsvorteil.Gegenüber anderen sein also wer mehr arbeitet oder sich privat noch weiterbildet kann kann.Ja kriegt dafür gesellschaftliche Anerkennung um das mal ganz weit zu fassen.
[14:17] Und natürlich leben wir in einer Kultur in der hart arbeiten häufig mit lange arbeiten gleichgesetzt wird und Überstunden quasi manchmal auch zum guten Ton gehören.
[14:30] Ja genau und und was sie sagt am Ende na ja das ist heute gerade noch in männlichen Erwerbsstruktur völlig normales dass man am Ende der Karriere dann mal sagt naja dass man ja ganz dankbar ist für die Familienmitglieder die ihre eigenen Bedürfnisse hinten angestellt haben damit man die eigene Karriere durchbringen konnte aber das wird halt so gesetzt und das ist immer noch stark normalisiert so ja so so startet sie in das Buch also mit dem primären.Kontrast zwischen naja eigentlich wissen wir statistisch dass Leute gar nicht unbedingt viel weniger Zeit neben der Lohnarbeit haben und trotzdem nehmen sie es aber gar nicht so wahr als hätten sie viel mehr Zeit um sich zu ent.
[15:08] Ja ich.Das in Teilen nicht ganz schlüssig weil ich glaube die Grenze die sie zieht zwischen naja man muss sich kulturell weiterbilden sportlicher tüchtigen und so weiter und das ist.Ja das liegt in irgendeinem zu einer Zwischenwelt zwischen Verwendung also das ist dann Mittel zum Zweck.Um irgendwie vorne mit dabei zu sein aber andererseits kann das ja natürlich trotzdem selbst Verwirklichung sein also ich finde da beißt sich das manchmal ein bisschen was sie schreibt.
[15:41] Dann macht sie weiter damit dass sie sagt naja die identitäts Definition die wir heute gerade am Ende Mittel und Oberschicht auch haben wobei ich sagen würde dass es eigentlich für weite Teile der Gesellschaft so dass das durch Beruf dass die durch Beruf und Bildung einfach massiv definiert ist also wer man ist hängt da dran was man beruflich tut und was man gelernt hat und ja also sie sagt nein das ist in Mittel und Oberschicht ganz stark verbreitet aber ich würde sagen das zieht auch weitere Kreise also ich glaube ja Erwerbsarbeit ist in meinen Augen einfach die Vergesellschaftung Instanz in unserer Gesellschaft.Wer Teilhabe möchte der wird das primär also der wird primär über Lohnarbeit integriert und sie sieht dann Defizit und sagt naja wir bräuchten alternative Lebenslauf Modelle.Weil.Das zweite was sie als ganz zentral, geht da glaube ich mit ich habe das Gefühl Konsum ist für viele Menschen mittlerweile eine Freizeitbeschäftigung und das ist eben nur möglich wenn man ausreichende Menge an Geld verdient und dass das geht damit so Hand in Hand das heißt wer nicht viel Erwerbs arbeitet oder nicht ausreichend der kann der darüber eine.Wenn Problem sich eine Identität zu basteln.
[17:07] Und gleichzeitig ist das zweite dass man über Konsum Dinge erwirbt auch nicht so richtig möglich und und inwiefern.Hat Konsum mit Identität zu tun ja ich glaube wer man ist und was man macht ist schon.
[17:25] Stark dadurch gekennzeichnet was für Kleidung man trägt.Ob man an kulturellen Veranstaltungen auch teilhaben kann ich finde das geht immer mal wieder unter dass die ja auch alle Geld kosten also da sind wir ja gerade im Oberschicht Bereich da so einfach viele Dinge nicht gut finanzierbar im Alltag auch wären welches Restaurant und wer in welchem tollen Café einen Kaffee trinkt und.Da eben zum Beispiel ein Kulinarik teilnimmt das ist ja alles sehr Konsumgesellschaft so ein bisschen naja also, es gibt ja so ein bisschen das Konzept der dritten Orte ich weiß nicht ob du das schon mal gehört hast also ein also Orte zwischen neben Wohnung und Arbeit im Prinzip das macht sie jetzt nicht auf aber Ort an dem man irgendwie sein kann.Ohne dass man etwas bezahlt oder oder Orte an die man erstmal ist ohne dass es mit dem dem eigenen vier Wänden oder der Arbeit zu tun hat und da ist auf jeden Fall einfach auffällig dass wir da immer weniger Plätze haben an dem man gehen kann ohne dass man etwas bezahlen muss also öffentlicher Raum ist da auch stark.
[18:33] Konsumiert quasi oder Komode infiziert und das gleiche würde ich sagen für ja für alles was gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht also Vereine politisches Engagement das ist ja alles auf dem Rückzug also alles eigentlich zumindest finanziell relativ niedrigschwellige.Möglichkeiten sich einzubringen und darüber eben auch eigene Sinnstiftung zu erfahren ich würde sagen das wird alles.Tendenziell zurückgedrängt und auch Massenorganisationen verlieren ja an Zulauf ob das jetzt Kirche Parteien Gewerkschaften wer auch immer sind.
[19:11] Aber das wird dann das war jetzt das was ich gesagt habe das steht bei ihr nicht so drin.Genau und sie sagt das ist glaube ich ihre feministische Perspektive also Teresa bückers dezidierte feminist.Das ist in deiner Vorstellung schon klar geworden aber ich wollte es nur mal sagen sie sagt naja Arbeitspolitik fokussiert auch viel zu stark auf.Ein Begriff von Emanzipation der meint dass auch Frauen in der Erwerbsarbeit kommen.Also wenn wir über Emanzipation sprechen dann sprechen wir ganz häufig darüber dass auch das Erwerbspersonenpotenzial von Frauen gehoben werden soll und.
[19:46] Ich habe an einer weiteren Stelle in meinen Notizen irgendwo stehen na ja das hat der Kapitalismus auch wieder ganz gut hingekriegt er hat Kritik da dran dass weiblich gelesene Personen als Hausfrauen zu Hause sind geschickt integriert und jetzt arbeiten beide.Kriegen und damit ist alles alleine an ihrer Modell gestorben und wir haben eine Überforderung in den Familien Strukturen immer wieder aber naja das ist dann halt immer Zitation wenn beide arbeiten und das Geld trotzdem nur für eine Familie erreicht was es vorher auch getan hat es gibt ja dieses schöne Bild der Simpsons zum Beispiel auch wo Leute irritierter von sind das eigentlich nur Homer arbeiten geht und sind komplett das Haus haben und was ist von heute aus eigentlich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann aber das war halt mal gesellschaftliche Realität dann kommt sie auf den Acht-Stunden-Tag und ruft im Prinzip zu einer Neugestaltung dieser Zeitordnung auf also genau in den 1980er Jahren haben Gewerkschaften noch für eine 30 Stunden Woche gekämpft das ist dann irgendwie blast und ja wir haben jetzt.
[20:49] Jetzt den Punkt dass wir halt diese Dreiteilung haben also man sagt eigentlich so 8 Stunden Arbeit pro Tag und dann in Anführungsstrichen 8 Stunden Freizeit und 8 Stunden Schlaf wobei aber völlig klar wird sobald man darüber nachdenkt dass wir alle keine acht Stunden Freizeit haben weil ja noch also die acht Stunden Arbeit sind gesetzt und die 8 Stunden Schlaf daran wird geknackst das ist völlig klar obwohl das vielleicht gar nicht unbedingt so gesund ist.Und die 8 Stunden Freizeit beinhalten natürlich Tätigkeiten wie die sich das persönliche kümmern um die eigenen Belange also es muss eingekauft werden die Wohnung muss instand gehalten werden wir müssen zur Arbeit hin und zurückkommen im Zweifel das kann nimmt ja auch.Also die Pendel Strecken werden länger und fressen mehr Zeit und das heißt acht Stunden für sich selbst hat niemand eigentlich und da kann man natürlich dann an für eine gut aber dafür ist das Wochenende dann ja da aber auch da sind wir eben häufig dominiert von ja Instandhaltungsarbeiten würde ich es mal nennen und sie problematisiert ist stark ich weiß nicht ob ich da persönlich so mitgehen würde ehrlicherweise aber ja das ist vielleicht auch ein bisschen.Einstellungs Frage wie viel konkrete Eigenzeit man haben möchte ich glaube sie selbst das auch alleinerziehende Mutter.Und das ist natürlich eine Perspektive die ich erst mal so nicht inne habe ich glaube wenn man sich um Kinder kümmert dann.
[22:16] Ja dann ist das ganze Zeit erleben noch mal ein anderes ich glaube da kann man sehr schnell sehr wenig für ein selbst übrig bleiben und das wäre eine Kritik von mir an dem Buch das wird immer wieder sehr stark gemacht wie herausgefordert von mir sind was ich.Grundsätzlich Teile zum einen kann ich bin ich selbst nicht betroffen und kann deswegen mein eigenes Erleben nicht dagegen stellen aber zum anderen ist es sehr viel lamong oder drüber und.Also wird ein bisschen ignoriert auch wenn es mal erwähnt wird dass.
[22:42] Dass man schon auch weiß finde ich was es bedeutet eine Familie zu gründen und welchen Zeitaufwand das mit sich bringt und dass das durchaus eine eigene Entscheidung ist wird ja es wird eben erwähnt aber nicht.Nicht ernst genommen würde ich sagen also genau das wäre meine zentrale Kritik an dem Buch zwischendurch verfällt das immer wieder.Ja ein gewisses lamento einfach was ich finde ich nicht sonderlich angenehm lesen lässt.Was ist denn ihre Kritik konkret also sie sagt dass man dass die acht Stunden.
[23:14] Auf der Arbeit zu lange sind also dass man die kürzen müsste oder was was genau ist ja letztlich trittst du dafür ein dass wir weniger arbeiten sie verbindet das in Teilen dann auch.Mit einer Wachstumskritik also ohne das jetzt lange zu.Auszuführen aber das ist schon schon ein Teil davon also sie sagt wir müssen mehr Raum für andere schaffen und naja im Schlaf kann man irgendwie nicht sparen und wenn wir der.Zeitwahrnehmung der Menschen folgen dann können wir eigentlich auch nicht.Noch mehr Freizeit irgendwo weg weg weg her kriegen oder Eigenzeit und sie bezieht sich dann zum einen auf fregger hau.Die hat eine sogenannte also ist eine Forscherin die hat eine Vier in einem Perspektive entwickelt und da sind dann drin also.Man bewegt sich also der Wunsch ist sich von dieser Dreiteilung einfach weg zu bewegen die man halt mal die die wurde auch erkämpft die wurde hart erkämpft aber da die eben weiterzuentwickeln und quasi wieder ein bisschen.Ja ins ins träumen möchte ich sagen zu kommen damit man irgendwie wieder Ansatzpunkt hat und fräger Hauck schlägt vor acht Stunden Schlaf vier Stunden Lohnarbeit vier Stunden care Arbeit für andere und sich selbst.Vier Stunden kulturelle Arbeit.
[24:24] Und vier Stunden politische Arbeit jetzt muss ich mal kurz rechnen ob das aufgeht 8 Stunden Schlaf 4 lohnarbeits und 12 4k Arbeit.Sind 16 vier kulturelle Arbeit ja inklusive weiterbildungs und 20 und 4 Stimmen politische Arbeit und ich glaube die Idee ist so ein bisschen dass man solche Forderungen überhaupt mal entwickelt um in andere Denkmuster zu kommen und das nicht so als so.Wahnsinnig gesetzt zu sehen das haben wir immer schon so gemacht und deswegen muss das für immer so bleiben und ja sie ja.
[24:58] Ich habe da ein bisschen Mühe damit ich finde also ich verstehe natürlich den Ansatz und und die Idee dahinter und was mich so ein bisschen stört ist dass man.
[25:08] Diese acht Stunden Woche da geht man meines Erachtens von irgendeinem ich sag mal Beamten Job aus.Oder einer Person die die irgendwie in einem Büro arbeitet und.
[25:21] Das blendet für mich so viele Berufe aus die vielleicht nicht in dieses Schema gequetscht werden können sei es weil sie übermäßig anstrengender sind.Also wo ich finde acht Stunden ja da sind oder wie vier Stunden sind schon zu viel und auch ganz viele Berufe wo auch diese.Beliebig verkürzen weil weil dann die Schnittstelle zur nächsten Schicht sich dann also dass das geht halt einfach nicht und.
[25:57] Ich finde das immer man hört das so diese acht Stunden und diese Kritik daran und mich stört es ein bisschen wenn das nicht aufgedröselt wird oder ein bisschen genauer betrachtet wird was das dann genau für unterschiedliche Berufsgruppen auch bedeuten könnte macht sie das nee macht sie macht sie nicht also ich weiß nicht ob Frege Hauck das selber macht also die Person lese ich jetzt zitiert das kann ich dir nicht sagen aber das macht sie nicht eine Kritik die Teresa Bücker tatsächlich sehr stark macht ist.Die Ungleichverteilung quasi in den Vollzeiterwerbstätigkeit.Laut Befragung wenn sie 50 Stunden die Woche arbeiten und finden das am tollsten.Das Setzen Sie für sich als Standard und das ist dann irgendwie gesetzt und eine Arbeitszeitreduzierung wird nicht thematisiert oder nicht möglich gemacht weil die Annahme ist das lässt sich finanziell nicht tragen, beziehungsweise Teresa Bücker sagt dass das die Annahme ist dass sich das finanziell nicht tragen lässt ich würde sagen naja das kann durchaus auch einfach stimmen also und das führt dann dazu dass eben Frauen einfach überdurchschnittlich häufig Teilzeitstellen.In Anspruch nehmen also 50 Prozent der Frauen die sich für eine Teilzeitstelle entscheiden.
[27:09] Machen das weil der Rest für Pflege von Angehörigen oder von Kindern benötigt wird also das ist die die Kritik die sie daran anbringt aber trotzdem bin ich bei dir ich weiß nicht genau wie starr diese vielen einem Perspektive tatsächlich ist man könnte ja auch über also gerade so Thema Schichtwechsel finde ich total wichtig dass man zu denken weil man nicht jeden Beruf beliebig zerhackt Stücken kann quasi man kann nicht.Alles besonders klein machen aber vielleicht kann man es dann ja an auf weniger Tage verteilen das wäre ja vielleicht ein Gedanke also ja ich weiß nicht ob man jeden Tag diese Aufteilung die sie vorschlägt vornehmen muss oder ob man das auch über eine Woche Mitteln kann keiner also das wäre mein mein Ansatz dann vielleicht ja ich finde die Idee absolut plausibel und natürlich wichtig dass man das darüber sprechen ich ertappe mich dann aber oft auch selbst wenn ich im Büro und dann muss ich ein Meeting aufsetzen und dann geht das nicht weil die fünf Personen die da mitmachen müssen alle zunehmen anderen Tag dann arbeiten oder nicht arbeiten und ich sehe da schon auch eben dieses Problem dass es halt.
[28:14] Es gibt einfach gewisse Dinge oder Berufe wo auch viel.Organisatorisch stattfinden muss wo auch die eben wie du gesagt hast diese Zerstückelung extrem schwierig ist und dass man da einen guten Mittelweg findet und eben nicht alles pauschal über einen Kamm schert, auch ich sag mal vom Arbeitsgesetz her Weg das ja da da haben wir wahrscheinlich noch sehr viel zu tun das glaube ich auch ja.
[28:44] Teresa Beckers ist die.
[28:48] Gesellschaftliche Synchronisierung von von Zeitstrukturen auch wichtig dass er mir in sehr einer anderen Stelle da sagt sie naja wenn uns allen irgendwie der Feierabend erodiert weil wir alle work-life-blending betreiben und irgendwie das Wochenende als Institutionen so ein bisschen wegfällt weil man da auch arbeiten kann und alles flexibilisiert wird dann ist das problematisch weil wir uns halt irgendwie gesellschaftlich nicht mehr so gut abstimmen können und.
[29:14] Andererseits finde ich kann man eben genau das Argument an was Du gerade gemacht hast auch auf die Arbeitswelt übertragen also.Dir einfach nicht funktioniert wenn wenn es keine Kernarbeitszeiten gibt wo Menschen miteinander quasi arbeiten können also ja also dass die Argumente die sie auf der einen Seite anbringen bringt sie manchmal auf der anderen nicht an möchte ich sagen.Was ich an dem, an dem Modell von Frau Hauck erstmal gut finde ist das care und Politik so zu einem Belang für alle wird also.Man kann sich quasi nicht mehr dahinter dann so gut verstecken zu sagen naja ich arbeite halt so viel ich kann mich nicht gesellschaftlich engagieren oder keine Ahnung mich um andere kümmern gerade ersteres ist was was mich persönlich häufig nervt weil ich gerade das also ich erlebe es häufig dass Menschen mit eigentlich sehr vielen intellektuellen Kapazitäten und Ressourcen auf gesellschaftliches Engagement verzichten weil sie so viel Lohnarbeiten und das halte ich einfach für ein Demokratie also nee das kann die Demokratie theoretisches Problem sondern demokratisches Problem und da hätte ich, fand ich ganz cool wenn wir eine andere Anspruchshaltung einfach entwickeln und Erwerbsarbeit nicht über allem steht quasi.
[30:32] Ja dann hat sie noch ein zwei Statistiken also Frauen leisten heute immer noch im Schnitt 87 Minuten mehr care Arbeit am Tag als Männer also ich vermute das gilt primär für Familien und.
[30:51] Na ja genau nee das ist die eine Statistik die hier relevant ist und ja genau dann im nächsten Kapitel geht sie dann über zu also zu überschrieben mit Zeit für Kern.Sie im startet mit dem was ich gerade gesagt habe also das Fürsorge für Kinder oft als freiwillige Entscheidung betrachtet wird und Erwerbsarbeit als existenzielle Notwendigkeit geht und das findet sie nicht.Korrekt was sie macht den Punkt auch explizit also sie meint naja man wenn man das anders fremd und sagt naja Kinder als schreiben wir brauchen Kinder schon auch als zukunfts-werkstatt.
[31:29] Kommt man schnell in eine sehr Rechte Rhetorik rein und das möchte sie auf keinen Fall also so irgendwelche Frauen sind dann nur noch irgendwie die gebär für die Gesellschaft die dafür zuständig sind Reproduktion zu leisten und das kann es irgendwie nicht sein das sagt sie auch aber ich wäre eben schon heute stark auf dem Standpunkt des Kindern eine freiwillige Entscheidung sind.Und man sich.Sehr klar machen sollte auch im Vorhinein was das bedeutet und wie viel Arbeit das bedeutet und sie spricht natürlich auch viel über Alleinerziehende und das wäre mein Appell.Wenn man sich dafür entscheidet Kinder zu kriegen sollte man sich immer auch überlegen ob man sich vorstellen könnte dieses Kind alleine großzuziehen weil man nie genau weiß was mit der Partner ihnen passiert und man sich trennt die Person verunfallt verfrüht stirbt das kann alles passieren also dass das wäre meiner Pell an der Stelle das kommt mir da ein bisschen kurz was ich aber relevant finde ist also sie sagt es gibt es gibt einen schönen Artikel aus der InStyle glaube ich oder so weil sie nicht aber da wurde mal durchgerechnet was so familiäre Vollzeit fürsorgearbeit, wie teuer das im Monat wäre wenn man es mit den durchschnittlichen Stundenlöhnen die man da so hat also Chauffeuren zum Sportevent Kinderkrankenschwester Managerin weil man sich.Um ganz viel.
[32:43] Ja weil man Dinge koordinieren muss wie Wasser zu kosten würde und da ist rausgekommen naja so um irgendwas über 7000 Euro im Monat würde das ungefähr kosten wenn man diese unbezahlte Arbeit ja durchschnittlich vergüten würde ist jetzt vermutlich keine Zahl die in Stein gemeißelt ist aber einfach nur damit man sie mal gehört hat fand ich schon interessant also wie viel Arbeit da passiert die eben ja einfach unbezahlt geleistet wird und welchen quasi materiellen Gegenwert die hätte wenn man sie komplett outsourcen würde so.
[33:14] Ja ihr Punkt ist dann das Mütter mit kleinen Kindern im Durchschnitt so um die alle 14 Stunden am Tag arbeiten was natürlich kaum Raum für Selbstfürsorge lässt also.Ja und diese Zeit für care wird oft unterschätzt und kriegt gesellschaftlich immer noch nicht die Anerkennung die sie bräuchte da bin ich ganz.Ganz bei ihr und natürlich ist es auch eine emotionale Bindung also nicht nur zeitliche Bindung und.Sie muss auch sehr flexibel geleistet werden also das heißt sie ist nicht gut planbar also die Bedürfnisse von Angehörigen oder Kindern gehen halt von denen aus man kann nicht sagen.Ich stelle Dich wenn mir danach ist sondern ich muss dich halt stehen wenn du das brauchst ich Spiele mit dir wenn du das baust wir können schlecht sagen ich spiele nur dann wenn wir das vorher besprochen haben also funktionieren kleine Menschen eben nicht die traditionelle Rollenverteilung.Ist auch immer noch in keinster Weise gebrochen also ich schätze die Zahl bezieht sich auf Deutschland aber sie zitiert hier dass 60% der Väter keinen einzigen Monat Elterngeld beantragen und das heißt sowas wie wie Elternzeit ist halt immer noch völlig ungleich verteilt.
[34:23] Und ich glaube da gibt es Lösungsansätze die ich eigentlich ganz gut finde also sowas wie naja Eltern also Elternzeit gibt es nur wenn sie mindestens mal gleicher verteilt ist also gibt es nur wenn beide Elternteile sehen Anspruch nehmen so was könnte man ja denken so ist das zumindest in Deutschland nicht geregelt und sie hat da den starken Wunsch dass Männer dazu beitragen care Arbeit aufzuwerten was ich gut finde und auch gleichberechtigter zu verteilen das Problem ist dass sie an anderen Stelle eben sagt naja Männer fühlen sich halt sehr wohl damit besagte 50 Stunden auf der Erwerbsarbeit zu verbringen und da fehlt mir ein bisschen der Ansatzpunkt wie sie, das hinkriegen möchte also klar kann man ethisch moralisch darauf verweisen naja ihr solltet aber.
[35:08] Was der wirkliche Hebel sein soll Männer.Anders einzubinden ist mir nicht ganz klar also sie hat einfach den Wunsch na ja die die Männer müssten mal weil ihr verhaltet euch halt falsch Objektiv aber was ihr Hebel ist es wird für mich nicht deutlich ich hätte ich hätte wahrscheinlich ja ich hätte ich hätte den gleichen Kritikpunkt angeführt was sie zitiert ist eine Studie von World Vision von 2019 glaube ich und das finde ich jetzt einfach also beide Zahlen finde ich total hart aber da sagen 36 Prozent der 6 bis 11 jährigen dass sie ihre Zeit diese mit ihren Vätern verbringen für ausreichend halten.Also ein gutes Drittel also zwei Drittel hätten gerne.Mehr Zeit und selbst mit den Müttern sind es nur 66 Prozent also auch also das heißt auch da gibt es ein Drittel von Kindern das sagt ich habe nicht genug Zeit mit meiner Mutter.
[35:58] Was irgendwie schon frappierend viele sind finde ich also da könnte man sich andere Zustände wünschen, genau wir haben die Emanzipation Kritik habe ich schon ausgeführt dass der Kapitalismus das finde ich geschickt integriert hat und naja das erodierende alleiner in ihrer Modell dass ich beschrieben habe also nicht mehr eine Person oder halt meistens der Mann geht arbeiten und das reicht für eine ganze Familie das belastet Familiensystem einfach sehr stark ne also wenn beide Elternteile.Wenn ich Vollzeit dann eine Person Vollzeit und eine Teilzeit arbeitet dann ist völlig klar dass.
[36:33] Und keine Zeit im Haushalt für Familie Haushaltsarbeit an sich und so da ist und ja.Teresa Bücker sagt ganz klar na ja mehr Zeit in Haushalten entsteht halt erst wenn beide Erwachsene weniger arbeiten das reicht nicht wenn nur die Frau in der Teilzeitstelle hat.Was ich so spannend finde ist es nicht jetzt direkt auf den Punkt aber eher auf das was du vorhin gesagt hast auch das mit der Elternzeit also ich finde ja auch oder ich finde ich finde den Gedanken denn ausgeführt hast mit man müsste dass wir ich sag mal obligatorisch was machen für beide.Aber es ist schon auch so ein bisschen verkürzt dass die Elternzeit was ist was man.
[37:15] Also ein Kind das macht ja nicht nur Arbeit wenn es gerade neugeboren wurde ja das stimmt dass du hast ja die Kinder einen ganzen anderen Anspruch ich sag mal dass das wird dann ich sag mal die ersten Monate können wenn du Glück hast und das Kind ich sag mal pflegeleicht ist können ganz entspannt sein und dann irgendwann kommt dann das Alter wo das Kind sich eigentlich permanent in Lebensgefahr begibt und nichts checkt und du eigentlich die ganze Zeit hinterherrennen muss das ist so ein alter was extrem aufwendig ist und das ist trotzdem nicht ich sag mal.Du kannst trotzdem nichts unternehmen aber du musst die ganze Zeit aufpassen und dann kommt es vielleicht in ein alter Wurst wo es halt auch mal was.Was machen möchte irgendwas unternehmen und oder du musst es in Sport fahren oder was auch immer und, ich finde man könnte das ja auch da ein bisschen aufteilen also es ist ich verstehe schon auch den ich sag mal aus biologischer Perspektive denn den Ansatz dass eine Frau wenn ein wenn sie geboren hat nur schon wegen der körperlichen, Veränderung die es dies auch bei der Frau auslöst da mehr Zeit benötigt als ein Mann und inwiefern dann ein Mann in dieser Zeit auch Hilfe leisten kann.
[38:31] Ist nicht immer gleich gegeben also das kann schon.Kann sein dass das sehr hilfreich ist aber manchmal vielleicht auch nicht weil als Frau stillst du halt das Baby und vielleicht ne also muss nicht sein und all diese Dinge finde ich so.Ja ich.Also ich verstehe den Punkt ich will in keiner Weise absetzen aber es gibt halt man könnte das schon auch noch weiter ausdenken ja das ist auch eine Kritik die ich an dem Buch habe ich aber nur Notiz geschrieben dass das Buch ein.Ein Haufen von Forderungen ist quasi aber wenig Argumentationsketten beinhaltet das und das finde ich manchmal ein bisschen schade also ich finde es ist generell was was man in der Breite manchmal erleben kann das häufig.Wenig argumentiert wird also es wird sich also jetzt nicht auf das Buch bezogen sondern einfach gesellschaftlich ohne Kulturpessimismus gemacht werden ohne einfach nur wünsch dir was zu spielen in unserer Gesellschaftskritik weil das teilweise einfach zu wenig ist zu dem Thema Elternzeit hätte ich noch zwei Punkte zum einen.Kann man sich ja überlegen dass Elternzeit auch so strukturiert sein könnte dass sie nicht in den keine Ahnung ersten zwei Jahren stattfinden muss also dass man das auch einfach auf.
[39:46] Längere Zeiten des also in ein ältere.Ältere Kindheits verwendet das kann man ja machen oder ist zumindest denkbar und das zweite wäre.Und die Frage des naja wie soll denn die Emanzipation von Männern ausgehen wenn sie sich sowohl fühlen in der Struktur in der sie gerade leben also wenn man das SE.Und da wäre meine Hoffnung dass wenn man ihn andere Zeitstrukturen vorsetzt und sagt ihr müsst es ja zu machen dass sie dann den Wert darin erkennen und.Dann eine Lebensstiländerung einsetzt also dass man durch solche Maßnahmen wie naja es gibt nur Geld für Elternzeit wenn ihr das beide macht dass man darüber erreicht dass dann.Auch Männer vielleicht merken ah ja dass er eigentlich ganz cool auch Zeit mit den eigenen Kindern zu verbringen vielleicht will ich das ja auch in meinem Berufsleben weiter umsetzen.
[40:36] Ja oder es führt zu noch mehr Ungleichheit weil sich dann die Personen die ein sehr gutes Gehalt haben leisten können und keine.Zu beziehen apropos Ungleichheit.Worauf sie dann noch zu sprechen kommt sind die globalen Sorge Ketten oder carshare chains also in dem ArbeitsmigrantInnen im Carre Aufgaben übernehmen.Die von Familie nicht übernommen werden können oder wollen also so wird es also hier in Deutschland das zum Beispiel sehr verbreitet dass MigrantInnen polnischer Herkunft so 24 Stunden Pflege für Angehörige betreiben also betagte Angehörige.
[41:18] Weil das eben finanzierbar ist und das genau bei die dann eben zu einem entsprechend geringen Gehalt arbeiten und ja jemanden dann eben.Menschen bei anderen Personen Leben führt das natürlich dazu dass wenn Sie zum Beispiel direkt aus Polen kommen das ist so das klassische Beispiel dass dann zumindest vor dem Krieg in der Ukraine dann ukrainische Frauen häufig in polnischen Familien ausgeholfen haben wenn da quasi die Mutter gefehlt hat und in der Ukraine waren es dann häufig belarussische Frauen.Dann darüber gekommen sind und dann in der Peripherie quasi Europas irgendwann löst sich das auf oder das wird gestemmt durch dann Großeltern Strukturen oder so ich verlinke in den Shownotes in den Artikel der das ganz gut an einem Fallbeispiel beschreibt und genau das ist eben ja reiche Menschen hier können sich das leisten und das zieht quasi globale Ungleichheit Ketten nach sich also die care Probleme die dann hier auftreten und gelöst werden werden ausgelagert und finden dann einfach in anderen Familien.
[42:21] Quasi analog statt ja und da kann man berechtigterweise sehr viel Kritik dran dran äußern und das tut Teresa Bücker auch das gleiche tut sie zum Beispiel für Reinigungskräfte sie sagt naja wenn man wenn man eine Reinigungskraft engagiert dann wäre es doch eigentlich mal ganz interessant wenn man die mit eigenem Lohn bezahlen würde weil offensichtlich ist es man ist einem die eigene Zeit ja nicht wer hat die Wohnung so zu putzen wie die Reinigungskraft das kann ich finde es zum einen nachvollziehbar fragt mich aber also Teresa Bücker machte den Punkt nicht bei der Kleidung die wir tragen nicht bei der Nahrung die wir essen und ich frage mich inwiefern dass da unterschiedlich ist also klar so was wie Reinigung Wohnungsreinigung kann nicht so gut skaliert werden wie die Tätigkeiten die ich jetzt gerade genannt habe also Narr Produktion ist enorm skaliert das ist mir klar bei Kleidung vielleicht gar nicht so unbedingt und da habe ich mich gefragt naja also.
[43:20] So nachvollziehbar ich das finde und ich habe das Freundinnen auch schon gesagt die Reinigungskräfte engagiert haben dass ich gesagt habe naja bei achtet auf jeden Fall drauf wie viele denn bezahlt weil offenbar ist eure eigene Zeit euch entsprechend viel wert also ich habe das Argument wirklich so konkret schon an Leute so Leute gebracht habe ich mich gefragt na ja wir können uns ja nicht in jedem Lebensbereich den Marktlogik entziehen also ohne ohne irgendwie ohne manche pathologisch daher kommen zu wollen weiß ich nicht ob das eben auch ja einfach Opfer formalen Marktlogik sind und da darf ich mich ein bisschen schwer getan ja ich bin da ganz bin ein bisschen gespalten was ich quasi Menschen an Komfort zugestehen möchte und dich frag mich ob jede Bezahlung von Tätigkeiten immer gleich also natürlich ist die Ausbeutung im magischen Sinne quasi aber inwiefern das Ausnutzen ist das habe ich mich so ein bisschen gefragt aber nicht irgendwie noch nicht ganz.Er hat nicht zu einem abschließenden Urteil gekommen ja.
[44:25] Dass ich finde das auch ein bisschen oder ein besonders schwieriges Problem in diese ganzen Diskussionen also was worauf überträgt man diese Marktlogik also wenn man sagt Frauen machen so und so viel mehr Kehrarbeiten sonst müsste bezahlt werden dann klar bin ich dafür und gleichzeitig ich finde schon auch eben nimmt auch so ein bisschen das menschliche das klingt jetzt doof aber so dass eine care arbeite ist eben nicht nur Erwerbsarbeit es gibt einem auch ganz viel zurück ohne das jetzt noch.
[45:03] Ich finde das schon auch ich finde das ganz ein schwierigen Spagat zu machen was in welche Schublade will man das Packen also ich finde man kann auch man könnte auch argumentieren und sagen ja naja okay in als kleines Kind oder als Kind generell braucht man care man braucht man muss für einen gesorgt muss für einen gesorgt sein und als ganz alte Person möglicherweise auch und gleichzeitig gibt es ganz viele Personen die lassen die sind pensioniert.Und die sind topfit und die könnten ja auch care-arbeit übernehmen also die könnten auch in Kitas arbeiten und ich finde das ist so ein bisschen ich frage mich dann ja wie wie kann man das in der Argumentationsweise bringen die.Sich ein bisschen auch loslösen kann von diesem kapitalistischen Argument aber das trotzdem dann irgendwie zusammenpasst also ich finde das ganz ganz schwierig kann ich kann ich gut verstehen.Ein Modell dass sie noch vorstellen da habe ich mir leider nicht dran geschrieben von wem es kommt dass das sogenannte Option Zeitmodell was irgendwie unter dem Begriff atmende Lebensläufe auch diskutiert wird und da ist der Ansatz dass man über den Lebenslauf 9 Jahre Zeit zur verfliegt zur Verfügung gestellt bekommt die für gesellschaftlich relevante Tätigkeiten zur Verfügung stehen.
[46:20] Also entweder Pflege von Angehörigen Erziehung wo man einfach aus dem Beruf dann tatsächlich mal raus kann ich glaube auch persönliche Weiterbildung oder auch demokratisches Engagement da auch mit mit gemeint und die Idee dahinter ist dass man zum einen beruflichen Unterbrechung stärker normalisiert und.Ja genau und dann eben auch Raum schafft für für Pfleger.Es ist nicht schön das zu sagen finde ich aber was für mich da jetzt vielleicht liegt es an Frau Bücker vielleicht hat sie es nicht mit aufgeschrieben vielleicht gibt es da Finanzierungs Ideen aber das muss man halt ehrlicherweise mitdenken also wenn Personen über so lange Zeiten ihres ihres Erwerbslebens oder ich weiß nicht genau von wann bis wann das gedacht ist diese 9 Jahre.
[47:08] Quasi aus dem Beruf aussteigen muss das ja müssen ja trotzdem ihren Lebensstandard vermutlich irgendwie erhalten können und wie das finanziert werden kann weil das wirklich lange Zeiten sind das steigt jetzt zum Beispiel nicht dabei und das finde ich ein bisschen schade weil ich finde.Das Idee die das Modell klingt spannend aber das sind halt also so so unschön wie das ist und das halt zentrale Fragen die geklärt.Oder zumindest mit erklärt werden müssen wie man das finanzieren könnte das ist ja kann ich dir jetzt leider nämlich ja dann nämlich nicht nicht mitteilen quasi wie das gedacht wird ja.
[47:45] Naja danach geht sie ein bisschen auf den Begriff Freizeit ein und.Bezieht sich da auf die Wissenschaftsforschung Helga Nowotny die schon vor vielen Jahrzehnten glaube ich gesagt hat naja unsere Zeitbegriffe sind irgendwie völlig unterbestimmt also wir haben einfach keine angemessene Diskussionen zum Thema Zeit also wir haben irgendwie Arbeitszeit und wir haben Freizeit und das sind die beiden.Begriffe die wir kennen und darüber darunter summieren wir alles und dass das Haut irgendwie nicht so richtig hin weil das alles total verengt und eben nur in zwei Bahnen denken lässt und Freizeit meint dann eben auch nur Zeit die freies von Arbeit und das ist.Sie nicht mehr zeitgemäß also ich glaube Freunde Wort nie schlägt vor von übrig Zeit zu sprechen, weil Freizeit eben häufig von anderen Verpflichtungen eingeschränkt ist also keine Ahnung wir müssen trotzdem unseren also wir müssen nicht aber wir sollten unseren Rasen mähen wir sollten ab und zu unserer Haare schneiden wir müssen auf jeden Fall ab und zu einkaufen gehen und das ist ja alles jetzt nicht Spaß an der Freude gewissermaßen sondern mehr sind halt trotzdem Verpflichtungen die halt einfach nur nicht durch Erwerbsarbeit bestimmt sind und.
[49:01] Ja deswegen hat sich vielleicht ein bisschen der Begriff mieta mir tatsächlich etabliert als weiterer Zeit Begriff und.Das ist ja dann letztlich quasi die Ausnahme von klar geplanten Freizeitaktivitäten und eine Zeit die keine bestimmte Absicht erfordert und wenig anspruchsvoll ist und.
[49:20] Was Frau Böcker aber sagt und da gebe ich ihr absolut Recht die ist aber häufig viel zu kurz und das sind so minimal Zugeständnisse im Alltag die man sich abbringt also es sind dann ja Sachen wie ich stehe zehn Minuten früher auf damit ich in Ruhe meinen Tee vor der Arbeit trinken kann oder mein Cappuccino oder was auch immer man gerne trinkt oder.Ich lasse mir ausnahmsweise mal einen Vollbart ein und habe 20 Minuten in denen ich einfach nur da liege und das.
[49:47] Dass Frau Bücker sagt und ich glaube das stimmt auch wenn man einfach echte und ausreichend freie Zeit hätte bräuchte man solche, ja solche Hilfen wie meetime als Konzept überhaupt nicht also sie findet es quasi ein bisschen absurd dass wir sowas uns ausgedacht haben als gesellschaftlichen Begriff um.Ja so so kleine Zeit Inseln zu schaffen die wie wir aber alle wissen irgendwie zum einen nicht häufig eintreten und zum anderen keine langfristig echte Erholung in überforderten Zeitstrukturen schaffen ja ich weiß nicht ob du da so mitgehen kannst.
[50:23] Ja schon.Und gleichzeitig eben auch diese Unterteilung in Zeit und Erwerbs Zeit und nicht ich finde dass ich tue mich da ein bisschen schwer mit.Ich muss dann immer ein bisschen an auch an Personen denken die ich aus der Familie in Südamerika kenne und.Das ist so ein krasser Unterschied zu wie wir das Wahrnehmen also ich kenne da zum Beispiel eine eine Freundin die ist Anwältin.Und die hat jetzt ein kleines Kind und die hat aber natürlich eine große Familie auch im Hintergrund und die steht jeden Tag um 3 Uhr morgens auf.Weil sie drei Stunden zur Arbeit pendelt aber das ist in Südamerika ja das sieht doch und und und.
[51:15] Ja da arbeitet dann bis mittags und dann geht sie zurück und ab 3 Uhr ist sie dann bei der Familie und das ist normal weißt du und die hatten Bürojob und und wenn wenn ich das so höre ich ich habe gar keine Kategorien wie ich das Bewerten also wie ich das einordnen soll wenn ich aus unserer Zeit ich sag mal Zeit Perspektive oder arbeitsperspektive von von hier Mitteleuropa komme und das finde ich schon.Ich habe dann auch viele Gespräche darüber geführt und gemerkt ganz viele Personen die haben ganz einen anderen Zeit begriffen dass wird nicht unterteilt in.Oder da ist das Pendeln ist dann vielleicht diese me-time weißt du oder das ist nicht so das zähle ich jetzt zur Arbeit und dafür muss ich jetzt das und das Verlangen und jetzt bin ich zu Hause und jetzt füttere ich mein Kind das ist jetzt care-arbeit und danach setze ich mit einer halben Stunde irgendwo hin und das ist dann meine.
[52:07] Time bist du also ich finde dass diese verstorben und auch dieses Benennen von was tue ich jetzt gerade zu welchem Zweck wem dient das ich tue mich damit schwer ich ich verstehe das dass das nötig und notwendig ist um dann zu argumentieren ich verstehe auch total diese Ungerechtigkeit die du dahinter steckt und gleichzeitig will ich das nicht was ich.Also finden danke erstmal für den Beitrag so ich glaube ich kann das ein bisschen ja ich glaube ich bin da bei dir also ich merke auch dass ich irritiert bin von dieser ja von diesen Zeiten die immer wieder aufgemacht werden was ich aber einen guten. finde ist dass die freien Zeiten die wir bei uns hier produzieren häufig nur.Ja es sind produzierten Zeiten die quasi am Rand der Erwerbsarbeit stehen und der Erwerbsarbeit zeigt so gewissermaßen abgerungen werden das kann ich schon irgendwie nachvollziehen.
[53:06] Und ja genau Frau Böcker schlägt dann vor vielleicht sollten wir im Gegensatz zu Freizeit vielleicht mal von Alltags sprechen das ist einfach als weiterer Begriff der keine falschen Hoffnung macht gewissermaßen.
[53:20] Genau und.
[53:21] Was sie noch aufmacht und das finde ich ganz gut ist das nicht nur es nicht nur um Zeit geht die man objektiv zur Verfügung hat neben Erwerbsarbeit sondern auch Kraft diese Zeit zu nutzen die, bleibt neben der Erwerbsarbeit also wenn Menschen das Gefühl haben ich kann mich irgendwie nur noch vom Fernseher berieseln lassen wenn ich nach Hause komme, also sie hatte das Beispiel einer intensivpflegerin während der corona-pandemie die das halt gesagt hat naja nach der Arbeit ist mein Tag einfach vorbei ich fahre nach Hause und ich.Kann noch also ich muss noch was essen.
[53:57] Das ist es dann aber auch zu mehr bin ich inhaltlich quasi nicht mehr in der Lage und sie sagt das ist einfach ein Problem also so schön es ist dass Leute Objektiv vielleicht gemessen mehr freie Zeit zur Verfügung haben ist ein bisschen die Frage wie Kohärenz sind diese Zeitblöcke also haben Leute Zeiten am Stück die sie für etwas anderes als Lohnarbeit einbringen können oder sind das immer nur kleine Sachen die immer wieder unterbrochen werden durch durch anderes und ja genau sie sie zeigt so oder zeichnet das Bild einer einer müden Gesellschaft und macht sie daran fest dass wenn Menschen gefragt werden was sie mit einer Stunde Zeit diese geschenkt kriegen würden also der Tag hätte einfach morgen 25 anstatt 24 Stunden wird am häufigsten Schlaf genannt.
[54:43] Menschen sagen am häufigsten hätte ich eine Stunde mehr dann würde ich diese Stunde einfach schlafen nicht ich würde.Aquarell malen nicht ich würde mich in der Partei gründen ich eine Partei gründen nicht ich würde mich in der Bürgerinitiative engagieren nicht ich würde zum Sport gehen sondern ich würde einfach mal schlafen und das finde ich es schon schon Zeit bezeichnet also ja was ich am Anfang schon mal gesagt hat den Punkt macht sie in dem Kapitel auch noch ist das Freizeit erst dann wirklich Freizeit ist wenn man etwas tut was auch mal nicht Mittel zum Zweck ist sondern.Ja quasi aus der Lust an der Freude geschieht also sie sagt na ja wenn man Sport macht um.Eigentlich sich gesundheitlich etwas Gutes zu tun dann ist das keine reine Freizeitbeschäftigung sondern dann ist das etwas was man tut um etwas anderes zu erreichen.
[55:32] Wobei ich da auch wieder anführen würde naja das lässt sich vermutlich nie ganz auflösen also ich kann trotzdem.Spaß an Sport haben und wissen das tut mir gesundheitlich gut also die die Trennung ist vermutlich gar nicht so einfach möglich aber ich verstehe schon dass wenn Leute quasi immer an inneren Schweinehund überwinden müssen und das machen einfach nur weil sie wissen dass irgendwie körperliche Betätigung wichtig ist um gesund zu bleiben dass das dann nicht das richtige ist oder wenn ich keine Ahnung nur Lebensratgeber lese damit ich beruflich erfolgreich bin und nie einfach nur lese weil ich Freude am Lesen habe dass das dann keine Freizeitbeschäftigung in dem Sinne ist das sehe ich schon.
[56:13] Sie schließt das Kapitel mit dem Punkt und das finde ich ist einfach wahr und daran lässt sich wenig drehen.Also sagt naja wenn wir über ökonomische Ungleichheiten sprechen dann kann man schon sagen naja Geld lässt sich halt prinzipiell zumindest umverteilen da kann man natürlich auch drüber streiten ob das genug passiert oder nicht aber Zeit halt nur begrenzt also klar man kann sich teilweise Zeitblöcke freikaufen, beispielsweise Reinigungskräfte aber man kann niemanden sagen naja dein Tag hat heute mehr Stunden als er gestern hatte das kann man nicht, nicht um verteilen und das heißt als Beispiel hat sie nachher die alleinerziehende Mutter kann nur zeitlich entlastet werden wenn jemand wirklich ihre auf ihre Aufgaben abnimmt also wenn jemand.Ich betreue heute dein Kind heute Nachmittag und das reicht es nicht denen quasi.400 Euro für die care-arbeit in der Woche zuzugestehen da haben die dann im zwei nicht nicht mehr Zeit hochheid so dann spricht sie ein bisschen darüber am Ende wie man Zeit mit mit Kindern verbringen oder wie man.Zeit für Kinder denken sollte also sie macht einfach den Punkt von naja Kinder sind irgendwie das was gesellschaftlich Zukunft ist und das heißt er im entsprechend sollte sich um sie sollte genug Zeit für sie zur Verfügung stehen.Und.
[57:31] Genau da muss irgendwie dann auch geklärt werden wie soziale Sicherungssysteme funktionieren ich meine damit bei der Lage der Nation auch drüber gesprochen wie das funktionieren kann sie sagt naja kindgerechte Zeitkultur beinhaltet auch Orte und Zeiten wo Gruppen und generationenübergreifend zusammengekommen werden kann und damit man einander versteht das finde ich einen spannenden. also sie hat glaube ich nichts prinzipiell zum Beispiel gegen Ganztagsschule als Konzept gesagt aber naja wenn wir aber alles also jede Betreuungssituation quasi institutionalisieren weil wir familiär oder auch in man kann sich ja also nicht das denkt sie nicht als Kleinfamilien also sie denkt auch queerer Form der Kindererziehung immer immer mit und oder Erziehung auch in freundschaftlichen Kontexten dass man eben auch mal Kinder von also.
[58:27] Eine von Freundinnen übernimmt und sich einmal die Woche um die kümmert oder so das denkt sie alles mit also nicht dass sie denkt das ist irgendwie so mega konservativ.Oder sie sagt wenn wir das alles institutionalisieren und alles in in gesellschaftliche.Ja Organisationsformen einfach packen dann bleiben die halt auch unter sich also es hat einfach einen Wert an sich wenn das Enkelkind mit den Großeltern zusammen Zeit verbringen kann weil.Das für beide Seiten die Zeithorizonte öffnet also wenn man mit jemandem der eine Vergangenheit erlebt hat interagiert dann wird diese Vergangenheit anders begreifbar als wenn man in einem Schulbuch darüber liest und wenn erwachsene Menschen die Bedürfnisse und Sorgen von Kindern oder Jugendlichen hören dann wird ihre Zukunftsorientierung eine andere also erwachsene Menschen können mit.Über die Interaktion mit Kindern und Jugendlichen über.
[59:23] Also ein Zeithorizont erfassen den sie selbst nicht mehr erleben werden und der kann für Sie relevant sein und das ist auch politisch relevant weil gerade alte Menschen natürlich politisch hier in Deutschland absolut.Über Wasser haben sagt man das so also sie sie bestimmen Wahlen einfach überproportional stark mit weil sie so eine große Gruppe sind.Und Teresa Boca sagt naja in der Zukunftsorientierung und dass das nicht egal ist kann eben hergestellt werden durch diese persönlichen Kontakte, sie spricht sich dann auch noch für ein familienwahlrecht auf also so und dass Kinder darüber Mitspracherecht erhalten also auch für Absetzung von Wahlalter setzte sich aus aber setzte sich ein und eben auch dafür dass Eltern für ihre Kinder mit wählen dürfen was, Demokratie theoretisch glaube ich herausfordernd ist das umzusetzen aber ich finde das prinzipiell keine unattraktive Idee.Genau das dass ist so dass das eine Kinder Kapitel quasi was nicht so sehr auf die die Verteilung in Familien an sich abzielt ja.
[1:00:24] Genau sie sagt dann noch Kinder sind keine Lebensentscheidung sondern Menschen und eine Gesellschaft die Kinderführung verzichtbar hält gibt die Zukunft auf also das ist so ihr Plädoyer zum Schluss.
[1:00:35] Genau dass ich das mit der Lebensentscheidung in Teilen anders sehe habe ich ja schon gesagt genau und.Die ich finde das letzte Kapitel was vor dem Fazit steht noch mal total wichtig weil sie da von dieser care Perspektive die in dem Buch einfach sehr viel Raum einnimmt noch mal abstrakt nicht abstrahiert sie macht einfach noch mal einen anderen Punkt auf und das ist überschriebene Zeit für Politik also.Dass sie sagt naja das die Vereinzelung die man gewissermaßen ja auch erleben kann wenn irgendwie Zeitstrukturen nicht mehr synchronisiert sind wegbrechen Menschen das Gefühl haben ich habe auch keine Kraft mich einzubringen dass das eben einfach politisch schwierig ist, weil ja Demokratie die über dauerhaft das Engagement und auch Wissensweitergabe funktioniert und das auch natürlich ungleich verteilt sind ich weiß jeder der sich mal Politik kommunalpolitisch engagiert hat.Wird wissen dass da überwiegend männliche Rentner sitzen also zumindest kenne ich das so und.
[1:01:40] Das ist nicht schlecht dass die da sitzen aber andere Gruppen sind halt auch massiv unterrepräsentiert und der gerade Männer sind halt die die sich auch die die Zeit.Nehmen sich politisch einzubringen und darüber auch Ämter besetzen weil eben auch ganz viele andere Sachen einfach an Frauen hängen bleiben also wenn wenn sich der Mann dafür entscheidet er bringt sich irgendwie im lokalen Verein in der Politik in der Bürgerinitiative ein und zu Hause ist ein Kind das gepflegt werden muss und die Frau bleibt da und kann sich nicht mit einbringen dann ist das einfach ungleich und das moniert sie durchaus.
[1:02:13] Genau also sie sagt einfach Zeit am Modus einfach nur eine große Hürde für langfristiges Engagement und freiwilliger Arbeit die er häufig auch einfach in Abend.Zeiten stattfindet was einfach nicht für alle Menschen im gleichen Umfang leistbar ist jemand der so ungebunden ist wie ich der kann das zum Beispiel gut machen andere Leute können das einfach nicht die anders verpflichtet sind.Genau und da hat sie einfach den den Wunsch dass sich das ändert und.Sie sagt na ja wir haben es halt auch hingekriegt dass so die Selbstsorge und das Kümmern um die eigenen Belange irgendwie als höchste Freiheit betrachtet wird und die Organisation des Zusammenlebens dahinter zurücksteht und das sieht sie als Problem ja genau ich überlege gerade ob hier noch ein wichtiger Punkt dabei ist.
[1:03:03] Naja was halt offensichtlich ist dass weniger Erwerbsarbeit wenn wenn das umgesetzt würde natürlich eine neue Neuverteilung von, ermöglichen würde habe ich ja oben auch schon vorgestellt dass vielleicht mehr mehr Raum für Engagement übrig bleibt.Genau also sie sie will damit schreibt sehr Männer und das finde ich noch mal wichtig also dass die Ablehnung einer Erwerbs zentrierten Zeitkultur eben nicht bedeutet zwingt untätig zu sein und irgendwie nur auf der Couch rum zu legen was wo man ja auch argumentieren könnte dass es durchaus legitim ist sondern dass das Freiräume schaffen soll für neues und freies welche Zeit verwenden quasi ja und zum Schluss macht sie noch mal das überschrieben mit keine Utopie der macht sie im Prinzip den Punkt auf naja die.Wer wer solche Modelle wie sie in dem Buch vorgestellt werden vorschnell als utopisch verurteilt der lehnt Veränderung ab und diskreditiert das ungerechtfertigter Weise also sie erfordert eigentlich dazu auf sich auf diese Gedankenexperimente mal einzulassen die ihr zumindest für mich in Teilen auch radikal klingen also so große Teile der Erwerbsarbeit quasi zurückzubauen da muss ich mich gedanklich auch erstmal mit anfreunden und darauf einlassen und sie sagt na ja aber wir müssen da wieder ins denken kommen also wir haben lange Arbeitszeitverkürzung als gesellschaftliches Ziel betrieben.
[1:04:25] Und irgendwie haben wir aufgehört damit so ein bisschen bzw naja es ist ja schon in der Debatte aber.Oder vielleicht ermuntert sie dazu diese Debatte so weiterzuführen aber mir ich habe gemerkt mir fällt es auch gar nicht so leicht.
[1:04:39] Und dann ja genau sagt sie das natürlich auch bei gerade bei jungen Menschen ein großes Interesse an mehr Erwerbsarbeit da ist und.Genau das also ich glaube sie hatte auch ein bisschen Hoffnung in der in der jungen Menschen mal gucken ob das auf Dauer trägt.
[1:04:59] Und damit bin ich tatsächlich am Ende des Buches angekommen.
[1:05:04] Vielen Dank ja die die letzten zwei drei Kapitel klingen sehr spannend da ich glaube da kann ich sehr viel nachvollziehen.Davor haben wir haben ja auch viel ein bisschen ein bisschen viel Kritik geübt an diesem Buch aber auf jeden Fall vielen Dank also mir hat es einige Denkanstöße gegeben.Mir ist.
Mehr Folgen & Literatur
[1:05:31] Dazu eingefallen an Folgen die wir schon über dieses Thema oder zum zu ähnlichen Themen gemacht haben ich ich gehe davon aus du hast du würdest das auch vorschlagen dass es natürlich die Folge 1 von Hartmut Rosa unver nicht unverfügbare Resonanz habt ihr da vorgestellt ich habe es tatsächlich nicht in meiner Liste mit drin aber das ist erwähnst ja, ja und dazu würde ich also man kann natürlich auch alle alle Bücher von ihm empfehlen.Wo es halt irgendwie um diese ganze Zeit Soziologie geht die die.Ich sag mal kleineren kürzeren Unverfügbarkeit oder Beschleunigung und Entfremdung heißt es glaube ich sind mir eingefallen und eben Resonanz.
[1:06:20] Die sind finde ich sehr sehr gut zu lesen zu diesem Thema eine andere Folge.Die wir gemacht haben das ist Folge 7 und 40 das ist das Buch zum Buch Erschöpfung der Frauen.Ich glaube das habe ich also nee ich weiß das habe ich vorgestellt und ich kann auch das Buch sehr empfehlen dass es von Franziska Schutzbach.
[1:06:43] Wo es eigentlich auch um um es geht um genau diese Themen ein bisschen von der anderen Perspektive beleuchtet aber ich finde es ein sehr ich habe das mit mit sehr viel.Wertvollen Gedanken oder ich konnte daraus sehr viel ziehen aus diesem Buch.Insbesondere weil es sich eben auch sehr auf unser auf unsere jetziges auf den Ist-Zustand bezieht ich konnte da sehr viel nachvollziehen ja das fand ich auch sehr gut wir haben das glaube ich zusammen gemacht und die Folge meine ich.
[1:07:16] Ich habe noch ein anderes Buch das hat nichts per se mit mit Soziologie zu tun aber mit der Zeit und das ist eine kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking ist mir in der Welt gekommen ich finde ich habe jetzt erst vor vor einigen Wochen habe ich.Das Buch eine kürzere oder die kürzeste Geschichte der Zeit gelesen ich glaube das ist noch mal irgendwie.Entweder ein bisschen noch Laien verständlicher als das andere aber ich finde beide sehr gut wenn es um die physikalische Komponente Zeit geht.
[1:07:45] Und eine letzte Empfehlung wer das Buch das heißt auch einfach nur Zeit von rüdiger Safranski.Und zwar ist das eine Sammlung von ich sag mal Essays zur Zeit und verschiedenen Aspekten der Untertitel vom Buch heißt was Sie mit uns macht und was wir aus ihr machen und da geht es auch teilweise um Literatur um Philosophie und und verschiedene Zeit Begriffe und mir hat das sehr gut gefallen als ich das damals gelesen habe.
[1:08:17] Ja vielen Dank.Ich gucke mal meine Liste also zum einen kann ich sehr empfehlen auch wenn es also es ist ein Fachartikel dem ich Studio mal irgendwann gelesen habe der ist von Helma Lutz und Eva palenga Möllenbeck.Und er heißt das care chain Konzept auf dem Prüfstand eine Fallstudie der transnationalen care Arrangements polnischer und ukrainischer MigrantInnen wo es genau um diese chains eben geht und die zum einen das Konzept noch mal vorstellen was in den 2000ern glaube ich in also 2000 glaube ich das erste Mal genannt wurde und dann eben eine sehr prägnante Fallstudie in zweifamilien durchführen und das ist total interessant zu lesen und macht einfach sehr deutlich was es bedeutet wenn diese care chains von ja vom Besten aus gestartet werden genau ich glaube dann habe ich schon ein paar mal empfohlen einfach als kurzen Band.
[1:09:14] Aus der Einsichten Reihe von transcript Prekarisierung von Mona Mutter K also ein kurzes Buch dass ich mit der Erosion der der Normalarbeitszeit ja das Konzept Prekarisierung spricht und dann kann ich noch empfehlen das ist aber deutlich umfangreicher von Robert kastei die Metamorphosen der sozialen Frage eine Chronik der Lohnarbeit also was.Wie hat sich unser Begriff von Lohnarbeit eigentlich entwickelt was hat sich gesellschaftlich getan und was hat das für ner soziale Fragen bedeutet.
[1:09:52] In welcher soziale Fragen stellen wir vielleicht heute ich glaube das Buch ist von, neun das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt genau in dem Buch von Frau Bücker zitiert wird ja Helga Nowotny und die hat das Buch geschrieben Eigenzeit Entstehung und Strukturierung eines Zeitgefühls.89 war das das habe ich selber nicht gelesen aber ich dachte man kann es ja mal verlinken wenn es schon zitiert wird und ich glaube auch schon mehrfach empfohlen habe ich.Über die Zeit von Norbert Elias also einem der großen deutschen Soziologen von 84 ist einfach ja es wahnsinnig gut ich habe es jetzt auch mehrere Jahre nicht gelesen aber es ist extrem gut und spricht.Also mir ist prägnantesten im Kopf geblieben quasi der Wechsel von zyklischer Zeitwahrnehmung gesellschaftlicher also wir denken in Ernte Abfolgen und jedes Jahr ist gleich hin zu einem linearen Zeitverständnis von wir bewegen uns auf einem Zeitstrahl und es gab mal anfangen und das Ende ist offen wie was das gesellschaftlich gemacht hat und wie sich das durchgesetzt hat.Fand ich total spannend zu lesen das Buch ist auch nicht besonders dick an Folgen habe ich mit da ein Buch habe ich noch und zwar das ist ein Roman und zwar die Zeit die Zeit von Martin Suter von 2012 kennst du das.
[1:11:08] Ich habe es nicht gelesen er ist irgendwie ein total abgefahrener Roman ich habe es voll Weise nicht vor Jahren gelesen es geht um Peter Thaler der ist glaube ich irgendwie Sachbearbeiter oder so irgendwas langweiliges und.
[1:11:24] Und seine Frau wird erschossen und er kommt mit ihrem wird nicht nicht zurecht und er probiert ob halt quasi alles zurück bauen kann um die Zeit zurückzuholen also ein bisschen die Frage ob Raum und Zeit irgendwie oder wie die zusammenhängen und ob das funktioniert also wirklich ein skurriles Buch irgendwie ja aber ich habe es damals gern gelesen fand es ganz gut erzeugen habe ich mitgebracht Folge 19 die Bedeutung von Klasse von Bell hugs das habe ich vorgestellt ich habe in Folge 26 die Rettung der Arbeit von dieser Herzog vorgestellt wo es eben darum geht naja also da da geht es um das ganze Thema Erwerbsarbeit aus etwas positiveren Perspektive welche Rolle sie spielen kann für die Gesellschaft dann hat Nils in Folge 29 Nichtstun von Jenny Odell vorgestellt was finde ich ganz gut passt was so er quasi ich glaube sie Künstlerin eigentlich und das ist so ein bisschen der ja kritische gegen also ist so ein bisschen Rebellen toom dass da quasi stark gemacht wird gegen.
[1:12:26] Gegen eine Kultur in der man immer ganz viel tun und schaffen soll dann habe ich noch folgen 39 ich hoffe ich habe es jetzt gerade nicht vergessen und du hast du schon genannt vom Ende des Gemeinwohls ich finde passt auch ganz gut von Mike assemble das hattest Du vorgestellt und weil ich ja zwischendurch aufgeworfen habe dass alles was hier im Buch diskutiert wird total spannend ist aber ich mich ein bisschen Frage.Wie man das finanzieren soll dachte ich vielleicht lohnt es sich Mythos Geldknappheit von Maurice hoefken noch mal zu hören das war Folge 66 das hat Holger vorgestellt weil vielleicht können wir uns das Geld einfach drücken permanent money feary das wäre ja ganz cool.
[1:13:04] Ja das ist das was ich noch mitgebracht habe sehr schön vielen Dank.
Ausstieg
[1:13:13] Ich glaube da bleibt nichts übrig als euch auf unsere Medien weiterzuleiten und zwar sind wir im Internet und dazwischen zwei deckel.de offenbar das ist unsere Website mit allen Infos zum Podcast wir sind auch auf Facebook und dazwischen zwei Deckeln.Vertreten wir sind auf Instagram und x unter at Deckeln also Deckel mit n am Schluss so finden und schließlich auf Mastodon unter ZDF podcast. social ihr könnt uns sehr gerne Kommentare dort hinterlassen auch auf allen gängigen Pott.Podcast Plattformen freuen wir uns immer über Rezensionen oder Sternchen wenn es das zu vergeben gibt und ja ich bedanke mich herzlich für die Vorstellung Christoph und bis bald bis bald vielen Dank fürs Zuhören macht’s gut tschüss.
Quellen und so
Intro und Outro der Episode stammen aus dem Stück Maxixe von Agustin Barrios Mangore, eingespielt von Edson Lopes (CC-BY).
Das Umblättern zwischen den Teilen des Podcasts kommt hingegen von hoerspielbox.de.
Zwischen zwei Deckeln findest du auch im sozialen Medium deiner Wahl: Mastodon und Bluesky.
Der Beitrag 070 – Alle_Zeit von Teresa Bücker erschien zuerst auf Zwischen zwei Deckeln.

Feb 1, 2024 • 1h 13min
069 – Wie Gefühle entstehen von Lisa Feldman Barrett
In unserem Podcast geht viel um Strukturen und Gesellschaft und weniger um das Individuum. In dem Buch dieser Episode stellt die Psychologin Lisa Feldmann Barrett eine Verknüpfung zwischen diesen beiden Ebenen her:
In ihrem Buch „How emotions are made“ oder auf deutsch „Wie Gefühle entstehen“ entwirft sie einen vollkommen neuen Blick auf die Entstehung und Bedeutung von Emotionen. Ihr zufolge sind diese keine universellen, genetisch vorgegebenen Reaktionen auf externe Impulse, sondern individuelle und kulturell erlernte Konzepte, die uns helfen, unserer eigenen Körperwahrnehmung einen Sinn zu verleihen.
Shownotes
ZZD 008: „Objektivität“ von Lorraine Daston und Peter Galison“
ZZD 037: „Im Wald vor lauter Bäumen“ von Dirk Brockmann
ZZD 049: „The collapse of chaos“ von Ian Stewart und Jack Cohen
ZZD 064: „The Web of Meaning“ von Jeremy Lent
Buch: „Grüne fahren SUV und Joggen macht unsterblich“ von Thomas Bauer, Gerd Gigerenzer, Walter Krämer, Katharina Schüller
Buch: „Warum dick nicht doof macht und Genmais nicht tötet“ von Thomas Bauer, Gerd Gigerenzer, Walter Krämer.
Buch: „Personality Isn’t Permanent von Benjamin Hardy
Buch: „Hyperobjects“ von Timothy Morton
Buch: „The WEIRDest People in the World“ von Joseph Henrich
Buch: „The World Behind the World: Consciousness, Free Will, and the Limits of Science“ von Erik Hoel (Blogposts von Nils)
Buch: „Denken. Wie das Gehirn Bewusstsein schafft“ von Stanislas Dehaene (Blogposts von Nils)
Buch: „Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are“ von Frans de Waal (Blogposts von Nils)
Link: Unstatistik – RWI Essen (rwi-essen.de)
Quellen und Co
Intro und Outro der Episode stammen aus dem Stück Maxixe von Agustin Barrios Mangore, eingespielt von Edson Lopes (CC-BY).
Das Umblättern zwischen den Teilen des Podcasts kommt hingegen von hoerspielbox.de.
Zwischen zwei Deckeln findest du auch im sozialen Medium deiner Wahl: Mastodon und Bluesky.
Der Beitrag 069 – Wie Gefühle entstehen von Lisa Feldman Barrett erschien zuerst auf Zwischen zwei Deckeln.

Jan 11, 2024 • 1h 8min
068 – Auf leisen Sohlen ins Gehirn von George Lakoff und Elisabeth Weling
Das erste Buch im neuen Jahr ist „Auf leisen Sohlen ins Gehirn“. Hierin erläutert George Lakoff im Gespräch mit Elisabeth Wehling die Grundzüge seiner Metapherntheorie und deren Folgen auf die politische Meinungsbildung. Wir können nämlich gar nicht anders, als in Metaphern zu denken. Das kann und wird ausgenutzt. Wir erfahren, warum Steuererleichterung kein neutrales Wort ist, und was die Tatsache, dass wir unser Kind in der Nacht trösten, wenn es weint, mit unserer politischen Einstellung zu tun hat.
Shownotes
Buch: „Hier liegt Bitterkeit begraben“ von Cynthia Fleury
Buch: „Der letzte Sommer in der Stadt“ von Gianfranco Calligarich
Buch: „Tintenwelt 4. Die Farbe der Rache“ von Cornelia Funke
Buch: „Metaphors We Live By“ von George Lakoff und Mark Johnson
Buch: „Thinking Fast and Slow“ von Daniel Kahneman
Buch: „Verkehrungen ins Gegenteil. Über Subversion als Machttechnik“ von Sylvia Sasse
Buch: „Schiffbruch mit Zuschauer“ von Hans Blumenberg
Buch: „Short Cuts / Heinz von Foerster“
Buch: „Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“ von Paul Watzlawick
ZZD018: „Muster“ von Armin Nassehi
ZZD028: „Die Realität der Massenmedien“ von Niklas Luhmann
ZZD034: „Amerikas Gotteskrieger“ von Annika Brockschmidt
ZZD051: „Linke Daten Rechte Daten“ von Tin Fischer
ZZD061: „Die gespaltene Gesellschaft“ von André Kieserling und Jürgen Kaube
Transkript
Einstieg
[0:00] Music.
[0:15] Willkommen zur Folge 68 von zwischen zwei Deckeln EUR.Podcast und herzlich willkommen im Jahr 2024 mein Name ist Christoph und ich habe heute Amanda mit dabei heute.Schön dass ihr wieder eingeschaltet habt bei uns gibt es keine Pause es geht einfach im normalen Rhythmus weiter und bevor wir gleich in die.Buchvorstellung Starten von heute möchte ich einmal von Dir wissen Amanda womit du dich gerade beschäftigst was hat dich die letzten Wochen umgetrieben.
[0:49] Ich beschäftige mich.Eigentlich nicht mit so fröhlichen Themen auch ein bisschen der aktuellen des aktuellen Weltgeschehens geschuldet ich habe ein Buch gelesen über das Böse das fand ich zwar gar nicht so gut ich werde Hannah Arendt mal wieder lesen auch mit über das Böse, und habe so ein bisschen thematische Bücher hier bei mir liegen 1 auf dass ich mich sehr freue ist hier liegt Bitterkeit begraben von Cynthia Fleury einfach als sehr sehr gute Rezensionen hatte das ist eine Psychoanalytikerin und einen sehr analysiert darin Ressentiment und was das eigentlich für unsere Gesellschaft bedeutet und auch für die Demokratie.
[1:34] Ja okay das ist.
[1:37] Ja okay intensiver Themenkomplex für die dunkle Jahreszeit der vielleicht aber da auch hingehört ich habe da ich habe noch ein schönes Buch geschenkt bekommen von der Freundin der hat das heißt der letzte Sommer in der Stadt von Jean Franco calligarich einfach so als Ausgleich hat sie gesagt damit ich halt da nicht so in den dunkeles Loch falle wenn ich mich mit der mit solchen Themen die ganze Zeit beschäftige sehr gut wie schön ja dann vielen Dank an deine Freundin schön dass Leute in deinem Umfeld sich um Ausgleich bemühen ja.Bei mir sind es tatsächlich jetzt auch Bücher gewesen ich lag jetzt die letzten die letzte Woche eigentlich flach mit einer vermutlichen richtigen Influenza wünsche ich keinem kann ich nicht empfehlen macht echt keinen Spaß also Leute damit ist nicht es ist nicht zu spaßen und es auch wirklich nicht lustig.Naja und auf jeden Fall ich weiß nicht bist du in der ganzen Tintenwelt von Cornelia Funke drin.
[2:39] Nee vor 20 Jahren ja genau ich weiß nicht ob du mitbekommen hast dass sie ein viertes Buch rausgebracht hat, ja genau also das ist das ist passiert im Oktober das wurde x-mal verschoben und ich habe immer nur mitbekommen dass es verschoben wurde und wieder verschoben und wieder verschoben und jetzt ist es tatsächlich da und das habe ich nicht mitbekommen aber es ist eben erschienen letztes Jahr.
[3:01] Und ich habe gedacht ja dann kann ich mich da ja bald rein stürzen aber habe dann festgestellt dass ich inhaltlich wirklich nichts mehr weiß mit mir fehlt ganz viel mir fehlen nur ich habe ungefähr drei große Namen der in der oder vier der Herr der Hauptcharaktere und ganz grobe Linien aber es reicht eigentlich nicht um als Buch einzusteigen im vierten Band scheint es jetzt um Staubfänger zu gehen ich wenn du dich ein an ihn erinnerst also ein Glaube, der Lieblingscharaktere was der erwähnt und ich habe jetzt als ich krank im Bett lag die drei Hörspiele zu den eben bisher erschienenen Bänden gehört die alle nur so drei Stunden lang sind aber jetzt bin ich wieder in der Geschichte drin quasi und kann dann bald wenn ich Hemingway mit seinen Kriegsgeschichten endlich durchgelesen habe.Rüber wechselnd zu etwas spannendem zu Jugendliteratur und Band 4 die Farbe der Rache lesen da freue ich mich schon sehr drauf sehr cool ja das ist bestimmt auch so wenn man krank ist in gutes Hörspiel ich höre mir immer Momo an wenn ich krank bin oh das habe ich früher auch gemacht Momo war auf jeden Fall auch immer ganz vorne mit dabei und auch alle drei Bände, also ich hatte es waren so 3 Hörspiele unerhört ich in die Hörspiele ja ich hatte mir echt so ein paar Standard Sachen die ich gehört habe.
[4:23] Heute wiederum stellst du uns das Buch auf leisen Sohlen ins Gehirn vor das wurde geschrieben von George luckoff vermute zumindest dass er so ausgesprochen wird und Elisabeth wheeling oder Elisabeth wähling ich weiß nicht sie arbeiten beide in Berkeley oder haben es zumindest früher mal getan und sind linguistica innen.
[4:49] Und ja das Buch wir haben gerade so ein bisschen probiert zu recherchieren das ist offenbar mehrfach neu erschienen aber im Original wohl mal acht also ist schon ein bisschen älter und ich bin sehr gespannt was du uns dazu zu erzählen hast und wenn Du möchtest gib uns gerne einmal eine kurze Zusammenfassung.
Tl;dl
[5:16] Im Buch auf leisen Sohlen ins Gehirn erläutert George lakoff im Gespräch mit Elisabeth Wehling die Grundzüge seiner Metaphern Theorie und deren Folgen auf die politische Meinungsbildung.Wir können nämlich gar nicht anders als sie mit tafern zu denken und das kann ausgenutzt werden.
[5:31] Wir erfahren warum Steuererleichterung kein neutrales Wort ist und was die Tatsache dass wir unser Kind in der Nacht trösten wenn es weint mit unserer politischen Einstellung zu tun hat.
Buchvorstellung
[5:45] Also jetzt bin ich gespannt ob Du uns wirklich beide Sachen auch konkret in deiner Vorstellung beantwortest aber das sind ja Beispiele die Lust auf mehr machen wenn du Lust hast statt einfach direkt rein ich ich weiß auch nicht genau wie man das ausspricht aber Elis Elisabeth Wehling ist aus Deutschland deswegen ah ja okay so ich davon aus dass das auch so ausgesprochen wird und lake of ich glaube ich habe das mal in dem Podcast gehört dass er sich halt auch so Englisch dann halt mitnimmt ich ich mache jetzt das mal so einfach wieder besseren Wissens ja das klingt doch aber es sind doch solide Taten Quellen würde ich sagen.
[6:25] Ja gut ja also das Buch ist ein Gespräch zwischen den beiden wähling hat auch bei lakoff promoviert.Und es ist entsprechend sehr sehr gut lesbar es ist so ein Halbjahr ein Gespräch ein Interview in verschiedene Kapitel unterteilt aber jetzt nicht so dass das Gespräch irgendwie dann von neu beginnt sondern man hat er das Gefühl dass die Kapitel so im Gespräch dann oder danach einfach.Aufgeteilt worden sind damit es so ein bisschen Struktur hat.
[6:58] Ich finde das eigentlich ganz ganz schön weil wie gesagt sehr gut lesbar führt aber dazu dass natürlich auch gewisse Dinge jetzt nicht in in der theoretischen, Tiefe dargestellt werden wie man das jetzt von ja von einem von einem anderen Buch erwarten könnte.Aber ich finde der ja der Mehrwert liegt wirklich darin dass es das ist halt so die Fragen gestellt werden und die er dann direkt darauf eingehen kann und dann auch meine kritische Rückfrage kommt und das macht das Ganze ganz ganz schön.Ich habe vielleicht ganz kurz ich habe vergessen dass das Buch oder vergessen zu erwähnen dass das Buch im Kai Auer Verlag erschienen ist und von den kenne ich das Format durchaus ich habe so ein paar Kybernetik Sachen also so die Sachen um Heinz und Förster gelesen und das sind häufig auch so Gespräche also ja.Ich weiß nicht ob das so ein bisschen.Zum Stil von denen ist dass die das manchmal so zur abbilden aber ja genau Karl Auer Verlag kann man immer wieder gut machen spannende Bücher die die verlegen.Ja habe ich auch gedacht also ich werde da bestimmt mehr auch von dieser Reihe noch ein zwei ein bisschen genauer an anschauen.
[8:04] Ja in diesem Buch geht es.
[8:08] Oder es beginnt so ein bisschen mit der Metaphern Theorie von lakoff und lakoff ist ja ich sag mal der Vorreiter der das auch so ein bisschen aufs wissenschaftliche Parkett gebracht hat, als Linguist und und Metaphern dass sie das ist was was wir auch.Vor allen Dingen eigentlich in der Sprache verordnet und was er aber sagt Metaphern das ist nicht nur ein sprachliches Phänomen, sondern das ist eigentlich die Art und Weise wie wir die Welt wahrnehmen also wir denken in Metaphern wir leben sogar in Metaphern.Und wir wir erfahren die Welt in Metaphern und wir können nicht aus dem heraus also das geht gar nicht anders.
[8:49] Ein Satz den er oft sagt ist.Denken ist physisch und was er damit meint ist dass wir wirklich.Durch das also unsere Synapsen im Gehirn wenn wir.Etwas immer und immer wieder denken dann gibt es eine neuronale Verbindung oder die ist zumindest stärker als wenn wir halt einfach eine lose Assoziation zu was haben und er also mir ist die Konsequenz davon jetzt nicht unbedingt klar ich finde es klingt einleuchtend auch aus der Biologie her aber sagt halt immer ja wir müssen uns bewusst sein dass die Art und Weise auch wie wir aufwachsen führt auch wirklich zu einem physisch anderen Gehirn zwischen den Menschen und das bedeutet auch dass wir halt eben nicht alle gleich denken also dieses diese Idee von von dem einen Verstand von von dem, allgemeinen von dem allgemeinen verstand den wir alle teilen den gibt es die gibt es eigentlich nicht.
[9:52] Okay ja finde ich genau das finde ich sehr plausibel erstmal ja was.Also welche Metaphern oder in welchen Metaphern wir denken das ist wie gesagt sehr stark abhängig von von unseren sozialen Erfahrungen also eine ganz klassische Metapher die wir unbewusst ständig jeden Tag verwenden ist eigentlich das Vertikalität mit.Mehr von etwas zu tun hat und das ist finde ich sehr einleuchtend wenn man zum Beispiel in glaswasser wenn man da Wasser rein schüttet dann steigt natürlich der Wasserpegel, und das wird aber angewendet auf ganz verschiedene auch abstrakte Dinge also beispielsweise Preise steigen das Gewicht man man nimmt ein Gewicht zu das Gewicht steigt und das ist, natürlich eigentlich wortwörtlich macht das gar nicht unbedingt Sinn.Aber weil wir die Metaphern Höhe oder ja Höhe ist mehr bei uns so verankert haben nehmen wir das gar nicht mehr so wahr.
[11:02] Naja okay.
[11:05] Finde ich ja muss ich mich glaube ich erst noch Einfühlen in den Gedanken aber kommt schon so langsam ja ein ganz, klassisches Beispiel was er immer wieder gebracht hat, und ich glaube also auch schon schon sehr früh das ist die Metapher von Diskussion ist Krieg.
[11:28] Er nennt es jetzt in diesem Buch Diskussion ist physische Auseinandersetzung hat auch so seine die frühere Version ein bisschen korrigiert und was er damit meint ist aber dass wenn wir uns.Betrachten mit welchen Worten wir eine Diskussion oder ein Gespräch charakterisieren dann können wir beispielsweise mit Worte können treffen.Man kann los schießen schieß los man Ziel.
[11:58] Entschuldigung man sieht mit einer Bemerkung auf etwas ab wenn man positioniert sich man liefert sich ein Wortgefecht und so weiter also implizit verstehen wir Diskussionen als Krieg.Und das hat natürlich Auswirkungen darauf wie wir Diskussionen überhaupt führen also es gibt dann so das Beispiel ja man kann Diskussion auch anders verstehen zum Beispiel als Tanz dann ist es ein fiel mir ein Miteinander an und wir haben jetzt nicht diese Metaphern oder ich ich kann sie mir jetzt nicht so vorstellen aber ich finde die Idee ganz schön und ich finde es auch sehr spannend dass das absolut wahr ist man gewinnt eine Diskussion warum das macht gar nicht unbedingt Sinn ja das stimmt ja.
[12:43] Das ist so das sind so diese diese Beispiele die er bringt wenn er meint eben wird wir können gar nicht anders als darin zu denken und insbesondere abstrakte Ideen, da brauchen wir Metaphern um um das für uns verwertbar zu machen eine weitere abstrakte DS zum Beispiel Zuneigung, das ist für uns Zuneigung ist Wärme so eine so eine ganz klare Metapher auch man hat man wird mit jemandem warm eine Beziehung kann Erkalten so man kann kaltblütig sein vielleicht also alles so Dinge.Die jetzt in dieser Metapher verpassen und es ist auch nicht so dass das ist dann für für eine abstrakte Idee so eine Metapher gibt sondern ganz oft haben wir ganz viele verschiedene Metaphern die können sich durchaus auch widersprechen.Aber es ist einfach wir können gar nicht anders als in diesen Denkmustern uns zu bewegen.
[13:41] Das Denken ist.Was er sagt auch oder wir nehmen fälschlicherweise an das Denken bewusst ein bewusster Akt ist und er sagt eigentlich 80 Prozent des Denkens passiert unbewusst im Sinne von wir können uns oder wir machen uns eigentlich nicht bewusst was wir denken oder wie wir es denken sondern sie hat es passiert halt einfach.
[14:06] Und das mit mit den Metaphern hat das halt dann so ein bisschen die den Twist, wenn wir in Metaphern denken die bilden halt nicht die Realität an sich ab also er sagt es gibt so eine ich sag mal die Welt da draußen die gibt es für ihn und wir können die aber nicht so wie sie ist erfassen sondern eben nur in diesen Metaphern und Metaphern.Auf auf Englisch ist es metaforce hide and highlight also dass du kannst etwas nicht in seiner Gänze mit einem Metapher erfassen sondern es pickt also spezifischen Aspekt raus und versteckt vielleicht was anderes das kennen wir ja auch aus sprachlichen Metaphern dass das nimmst du um etwas zu verdeutlichen in der Regel und das sagte halt passiert auch mit den Metaphern in unserem Denken.
[14:58] Ja das ist so dass ja die die Kurzversion seiner Metaphern Theorie.
[15:06] Und was er dann macht ist er führt ein weiteres Wort ein was wir mittlerweile auch sehr sehr gut kennen das ist der Frame.
[15:16] Ich weiß gar nicht auf Deutsch ist der Rahmen ist das was man sagt der Rahmen.Ja ich habe das Gefühl vielleicht noch er ja Diskussionsrunden irgendwie.Ja schon aber ich habe das Gefühl dass was jetzt zumindest als framing irgendwie sich breit gemacht hat.Mit deutscher Rahmung nicht richtig erfasst oder was würdest du sagen ja ich hätte es jetzt auch so gefühlt ich ich nenne es mal Frames weiterhin weil er einmal schon auch das was wir unter framing dann verstehen.Seed it Frames ist ein Begriff der nennt das sind ebenso tief verankerte Frames die unser generelles Verständnis der Welt strukturiert das ist ähnlich wie jetzt mit mit den Metaphern.Und diese deepset Frames die machen eigentlich unseren unseren ich sag mal gesunden Menschenverstand jetzt das gesund könnte man wegstreichen auf Englisch werde dass der der Common Sense das macht es aus und auch da haben wir widersprüchliche Frames sind möglich wir können die einfach nicht gleichzeitig aktivieren.Man sieht das ganz klassisch wenn wir eine optische Täuschung ansehen aber wir können beides sehen aber wir können es nicht gleichzeitig sehen.
[16:40] Und das sagt der gilt halt für alles so nicht nur für optische Täuschungen sondern auch wenn wir ich sag mal eine politische Meinung oder sowas haben.Diese Frames sind.Sehr wichtig weil Frames übertrumpfen Fakten Frames Trump fact facts ist da der Spruch.Und zwar nehmen wir Fakten nur auf wenn sie auf einen Frame stoßen.
[17:12] In denen in denen sie auch passen und wenn nicht dann prallen sie einfach ab.
[17:17] Ja ja und das ist so ja das ist einleuchtend ich finde es trotzdem sehr spannend weil es natürlich.Ein bisschen so dieser Tendenz zuwiderläuft dass wir einfach mehr Fakten brauchen wenn man die Menschen informiert dann kommen ich sag mal dann kommen sie schon zum richtigen Ergebnis.Ich glaube das sind so Sachen die man mittlerweile also ich zumindest habt ihr jetzt mehrfach gehört.
[17:46] Und ich glaube dadurch haben sie sind sie für mich schon in meinem denk an und quasi mit drin aber gerade in Anbetracht dessen wie alt das Buch ist, sind das glaube ich Sachen die gar nicht immer intuitiv sich erschlossen haben weißt du wie ich meine ich glaube mittlerweile habe ich das Gefühl ja ja das weiß man doch aber vermutlich wusste man das noch gar nicht immer so.Ja ich sehe das auch ein bisschen so also viele Dinge sind sehr wenn man sie liest, für uns schon klar so wie du es auch gesagt hast und trotzdem hat es mir auch geholfen gewisse Sachen doch noch mal zu verstehen, also nicht dass das jetzt unbedingt wahrer ist was er sagt aber für mich so ein bisschen den Zusammenhang zu verstehen und manchmal komme ich schon nicht raus oder nicht aus diesem Denken heraus wenn ich denke aber wenn man wenn man sich doch einfach die Fakten ansieht dann muss man doch zu diesem Schluss kommen und das ist ich fand das dann schon hilfreich wie er das dann auf ja aufdröseln.Auch etwas was man eben aus der politischen oder was er dann sehr der politisch ich sag mal ja Propaganda ist zu stark aber.Informationsvermittlung zuschreibt ist dass man ausnutzt dass Frames halt immer aktiviert werden du kannst nicht wenn ich dir sage denke nicht an einen Elefanten dann links an eine Elefanten also das ist so dass das klassische und.
[19:14] Natürlich auch wenn man vom Gegenteil spricht dann wird ein Frame aktiviert und er sagt er bezieht sich sehr stark in dem Buch auf die amerikanische Politik.Für mich als Schweizerin ist das auch ein ja nicht immer so ganz nachvollziehbar weil dieses klare progressiv vs konservativ das fühle ich halt nicht ganz so mit aber er macht das sehr stark und und orientiert sich auch daran und sagt dann ja die die Konservativen die wissen schon seit 30 Jahren wie man wie man das macht also dass man eben wie man dieses framing nutzt und er sagt dann auch ja eben die progressiven die wissen halt also zu dem Zeitpunkt als das Buch geschrieben wurde konnten die das eben noch nicht gut ausnutzen und fallen dann auch immer wieder in diese gleichen mit Hafen rein die eigentlich die Konservativen nutzen und daher durch werden diese Frames in in der Bevölkerung auch in den Köpfen auch gestärkt obwohl sie eigentlich dass das verneinen aber weil sie das gleiche die gleichen Frames ansprechen verstärkt es das trotzdem.
[20:20] Ja ja genau das würde ich auch sagen auch ein ein Argument dass man jetzt mehr als einmal schon gehört hat aber vielleicht waren die mit die ersten diesmal gemacht haben schön aber ich habe auch immer das Gefühl das ist ein Dualismus der auf jeden Fall auf die deutsche Politik auch nicht unbedingt so richtig gut passt und ich würde auch sagen.Und die Konservativen zumindest die klassisch konservativen Kräfte hier sind jetzt nicht unbedingt immer die besten da drin das so abzurufen wie das vielleicht in den USA der Fall ist finde ich manchmal ein bisschen also.Ja in der politischen Literatur finde ich es manchmal ein bisschen schade wie groß der Fokus auf die USA dann doch häufig ist und wie wenig da der Blick auch.Auch mal selbst proaktiv geweitet wird ja finden es manchmal so ein bisschen ich habe das Gefühl dass Menschen die in den USA leben schon auch noch häufig das Gefühl haben das ist wirklich der Nabel der Welt ist und dass da alles stattfindet keine Ahnung vielleicht auch etwas auch etwas überspitzt aber so kommt es mir manchmal vor ja ich verstehe was Du meinst.
[21:31] Ja also ich finde ein sehr schönes Beispiel dass er nennt was ich mir so noch nicht davor überlegt habe ist das Wort Steuererleichterung.
[21:42] Und er sagt das wird in den Medien ganz klar als neutrales Wort verwendet da denkt man nicht drüber nach.Aber was ist eigentlich bedeutet ist dass Steuern eine Last sind und eine Erleichterung ist eine Befreiung von dieser Steuerlast.Und das ist eigentlich ein Frame der klar so jetzt bei ihm in in den Bereich der der konservativen Feld.Und die der einfach übernommen wurde und wir hinterfragen den denn dieses Wort kann ich mir.Und das finde ich schon spannend weil er sagt auch klar also dass das kann man machen aber steuern kann man natürlich auch ganz anders ansehen und wir können uns steuern auch als.
[22:28] Oder wir können ja die als als eine Rückerstattung verstehen für etwas was uns die Gesellschaft eigentlich vor vorgängig zur Verfügung gestellt hat und dann ist es dann sind Steuern plötzlich eine Frage oder Steuererleichterung ist eine Frage sehr zahlen wir eigentlich für unseren Anteil oder versucht mir auf Kosten der Gesellschaft was umsonst zu bekommen und dann bekommt das ganzen andere ganz andere Bedeutung plötzlich finde ich sehr schön.
[22:57] Jetzt, auch ein bisschen ich finde es ein bisschen plakativ ich finde es jetzt nicht so ganz vielleicht auch in der deutschen Übersetzung ich weiß nicht wie es auf Englisch ist nicht so ganz glücklich, aber er bricht dann alles so ein bisschen runter.Auf zwei Weltsichten und die sagt er findet man heraus wenn man Leute danach fragt.Wenn dein Baby in der Nacht schreit nimmst du es hoch.So ich habe es ein bisschen umgewandelt zu tröstest du dein Baby wenn es in der Nacht schreit wie gesagt ich finde das jetzt nicht unbedingt die passendste Frage aber ich verstehe was leider mit meint.Kannst du was damit anfangen.Womit das mit dem Baby hochnehmen ja hast du das mal gehört irgendwie so dieses diese Frage dass die was auszusagen hat über unsere politische Meinung die wurde mir so noch nie gestellt ne okay da kann ich nicht sagen.Gut er sagt nämlich es gibt zwei Varianten und das ist einerseits die das strenge Vater Modell.
[24:04] Und andererseits das fürsorgliche Eltern Modell oder Weltsicht so und.Grundsätzlich sind das wie zwei Frames die sind nicht wie gesagt ihr sie nicht ich sag mal exklusiv sich gegenseitig ausschließen also man kann und hat auch beide in sich aber man tendiert in der Regel, in Bezug auf ein Thema zu einer von diesen zwei Weltsichten und dass das strenge Vater Modell geht dann ein Heer mit Autorität mit.Ja Beschützer der Familie Belohnung und Strafe so taff love for the nose best so dass es so die diese Einstellung.
[24:48] So auch ein bisschen die die Annahme man kann sich, wie nennt man das auf deutsch aus dem am eigenen Shop aus dem Sumpf ziehen ja.
[24:59] So dass und das fürsorgliche Elternmodus ist er so Verantwortung und Fürsorge natürlich Empathie Dialog Menschen werden nicht bewertet sondern sollen begriffen werden Toleranz ist, ist eine Stärke ist keine Schwäche so das sind so die zwei gegensätzlichen Modelle.
[25:20] Und was er sagt ist dass das Interessante daran ist dass beide natürlich ihre Berechtigung haben.Und dass beide aus Wohlwollen.Tun oder diese die Schlussfolgerung daraus ziehen die sie ziehen auch ein strenger Vater macht das eigentlich aus Liebe und Wohlwollen.
[25:43] Ja ja so das was ja.
[25:48] Ob das wohl immer so ist gute Frage frage ich mich gerade keine Ahnung aber da bin ich politisch jetzt natürlich auch gefärbt muss ich sagen.
[25:58] Ja aber das ist sehr ich finde das sehr wohlwollend muss ich sagen gegenüber so einem.Ja autoritären Erziehungsstil oder so also ja weiß ich nicht wie viel Gutes wollen die Leute denn ich war ja okay aber ich nehme das erstmal so hin im Sinne der Argumentation.Also wenn wir das jetzt noch mal auf die Steuern beziehen dann ist halt dann sind hohe Steuern jetzt.Aus strenger Vater Sicht sind eigentlich eine Bestrafung für moralisches Verhalten immer hat dann eigentlich man hat sich, ich sag mal Mühe gegeben man hat viel gearbeitet man hat das geschafft und dann wird man dafür bestraft und dass der aus der anderen Sicht wäre das halt ja.Das Selbstverständliche dass man ja wie was zurückgibt dass man auch auf die anderen berücksichtigt gibt und man eben nicht ich sag mal nicht alleine gegen die Welt ist sondern halt zusammen in der Welt.Und diese Auffassung also eben es ist ja es ist jetzt schon sehr ich sag mal, runtergebrochen auf diese zwei Pole und er sagt ein Drittel der Amerikaner die wechseln auch ständig da dazwischen also er nennt sie die bei conception die eigentlich beide Modelle Modelle kennen.
[27:19] Und was er dann weiter.Sagt wenn es um die Politik geht ist dass diese Metaphern Quatsch nicht Metaphern dass diese Modelle.
[27:34] Eigentlich dazu verwendet werden dann die politischen Wählergruppen anzusprechen.Also was das heißt dass die Konservativen sich zum Beispiel nie nach links bewegen.Was die ansprechend sind genau diese ich auf Deutsch würdest du es vielleicht wechseln WählerInnen nennen ich weiß nicht aber er meint es natürlich jetzt auf diese Weltsicht bezogen.Dass du die ansprichst die beides haben und dann versuchst die für dich zu gewinnen und dann halt wie die Frames aktivierst.Die bei denen gerade ziehen.Ja das ja ist ja auch moderner moderner Wahlkampf dass man das zuschneidet und so und ja okay genau finde ich sehr plausibel erstmal.
[28:24] Es geht dann weiter so mit.Politik und Metaphern in der Politik und da sagt auch ganz klar eben wir wählen nach moralischen Werten und nicht nach politischem Eigeninteresse.Und auch eben diese politische Mitte die gibt es eigentlich nicht also.Im Sinne von die gibt es jetzt für seine Erklärungstext die bewegen sich nicht nach links sondern sie adressieren einfach diese diese unterschiedlichen Frames in den Wille innen.Ja finde ich was ich bei so einem Wahlforschung besonders spannend finde ich glaube das trifft zumindest für Deutschland zu ich weiß nicht genau inwieweit das noch verallgemeinerbar ist und wir sind jetzt glaube ich auch ein bisschen älter die Erkenntnisse aber das gerade sehr gebildete Leute extrem, gefestigte Parteipräferenz.
[29:22] Okay also dass die gerade also quasi Leute wie Du und ich dass wir genau die sind die eigentlich nie wechseln und die quasi sich eigentlich recht rational informiert vielleicht sind und einfach sehr viel wissen oder wissen können zumindest und trotzdem ihre Wahlentscheidung nie, wechseln oder extrem selten das finde ich ganz ganz ja ist eigentlich fast ein bisschen kontraintuitiv also sind eigentlich wir sind keine besonders rationalen WählerInnen wird gesagt also mit uns meine ich jetzt unsere Bildungsschicht, was ich ja finde ich irgendwie spannend und warum ja das frage ich mich gerade auch das ist mir habe ich gerade nicht so richtig greifbar weil genau ich glaube es liegt einfach auch in diesem man hat seinen moralischen Wertekompass und an dem richtet man sich eben entlang und da hat man sich mal entschieden und dann dann bleibt man da aber so so ganz die Begründung warum das so ist habe ich gerade nicht nicht griffbereit muss ich vielleicht mal beizeiten nachliefern.
[30:25] Okay interessant ja dieses diese Einstellung also es ist halt schon wie gesagt ich finde ich finde das ein bisschen zu vereinfachen wir das darlegt aber schon auch irgendwo durch sehr passend ich merke ich habe das jetzt auch in den letzten in der letzten Zeit auch gemerkt in der Diskussion mit Freunden zum Beispiel dass man das schon auch wirklich auf diese, auf diese Grundannahmen runterbrechen kann weil ganz oft passiert mir dass wir diskutieren gegensätzliche es scheint gegensätzliche Meinungen aber eigentlich wollen wir ja das gleiche und und, und man kommt wie nicht auf den Grund warum wir dann zu so unterschiedlichen Konsequenzen kommen und da finde.Bildet das schon so ein bisschen eine Brücke zu auch zu dem selbstverständlich Selbstverständnis dass man selber hat ne also eben ist man jetzt eher so die.
[31:20] Ich sag mal die fürsorgliche Mama fürsorgliche Eltern Modell ist dass das was einen anspricht oder eher so dieses autoritäre was man gut findet.
[31:31] Wenn es um Außenpolitik geht, sagt er diese ganz ganz klassische Metapher das sind Nationen sind Personen auch dass nichts Neues für mich also das ist ganz, eigentlich das ganz klassische diese die Realismus Theorie die auch in der Politikwissenschaft ja seit Ewigkeiten die die es gibt und die sehr viel erklären kann und sehr oft ich finde auch sehr oft medial bemüht wird im Sinne von dass man da auch meiner Ansicht nach manchmal gar nicht unbedingt.Was anderes aufgetischt bekommt also eine einen anderen Erklärungsansatz jenseits von jetzt macht und nur Summen Spiel und so weiter.
[32:15] Und.
[32:18] Er sagt ihm also dieses Nation ist sind Personen das strukturiert halt den Diskurs sehr stark und auch Nation ist Familie also Vaterland Haushaltsplan alles Dinge wo man eigentlich so das eigene Familien Ding die eine Familie so auf die Nation projiziert und dann mit diesen Wörtern auch operiert und er sagt das ist auch ganz klar so ein Frame der von der von den Konservativen sehr sehr gut aktiviert wurde in den letzten ich sag mal 50 50 Jahren.
[32:57] Sehr viel dreht dann oder so ungefähr 100 Seiten des Buchs gehen dann um um Terrorismus also es ist halt auch Angesicht zu des Irakkrieges und so weiter als das Buch zuerst erschienen ist sehr viele geht darum ich möchte da nicht ganz spezifisch jetzt drauf eingehen aber vielleicht was ich interessant fand ist schon auch wenn er sagt.Oder wenn er das bezieht auf wie Nationen miteinander ich sag mal sprechen zum Beispiel er sagt Entwicklungsländer sind.
[33:34] Jetzt aus Sicht dieses strenger Vater Modells sind das eigentlich wie Kinder.Und auf die die Hierarchie ist also auch die Kommunikation ist hierarchisch und man diskutiert nicht sondern man schreibt eigentlich vor was zu tun ist.Und wenn zum Beispiel was nicht getan wird oder was nicht so umgesetzt wird wie man das gerne hätte na dann bestraft man das halt mit Liebesentzug.
[34:01] Das wären dann Sanktionen oder man ruft eben nicht an wenn eine Politikerin jetzt Präsidentin geworden ist und so weiter.Oh das ja das erinnert mich sehr an das Auftreten.Der deutschen Politik im Kontext der Finanzkrise gegenüber Griechenland das war auf jeden Fall so also ja auch irgendwie ja sehr absoluter Impetus von wir wissen es besser wir wir entscheiden jetzt für euch was richtig ist mit ja auch sehr harten politischen Realitäten dahinter also ja da finde ich passt das wie die Faust aufs Auge also wirklich ganz ganz doll, und ich finde es gibt noch ein bisschen eine andere Qualität weil einfach zu sagen ja wir wissen wie es besser geht das ist so ein bisschen was überheblich ist was durch natürlich durchaus mitschwingt aber ich finde wenn man dass sich so.Wenn man so darüber nachdenkt dass man das eigentlich wohlwollend meint ich weiß es halt besser Fabeln aus best nicht wie das Beste für dich auch wenn es dir im Moment wehtut oder auch wenn es jetzt schwierig ist finde ich das schon noch auch eine spannende Idee dahinter ja okay in dem Kontext konkret würde ich mich wirklich fragen ob ob das beste gewollt wurde aber.Ja rein vom Auftreten also rein von dem was formuliert wurde ist das natürlich so ob das dann stimmt oder nicht wäre für mich die zweite Frage aber ja.
[35:30] Ja ja total es wird auch dann natürlich im also im Nachwort sagt wähling auch.Man kann das alles schön so sprachlich analysieren natürlich ob das oder wie viel ich sag mal.Was jetzt wirklich die Absicht dahinter ist wie viel da extra ich sag mal manipuliert oder wie das wirklich ausgenutzt wurde das weiß man natürlich nicht, aber trotzdem können wir halt hören wir halt das was wir was wir hören und du hast jetzt vorhin die.Die Wirtschaftskrise genannt auch das ist so eine Metapher eine Wirtschaft als Gesundheitszustand.Jetzt eine national aber eben halt auch eine Person wenn man in dieser Metapher denkt also die Wirtschaft die kann kränkeln oder gesund sein eine Nation ist geschwächt wenn die Wirtschaft nicht so läuft auch das ist sowas das ist eigentlich.Total in der Wirtschaft ist was ganz abstraktes und wir verwenden dann irgend so eine ich sag mal so eine plakative Metapher von Gesundheit auf Wirtschaft.
[36:33] Ob das wirklich für uns ist das ganz selbstverständlich und ich habe mir auch das ich habe mir das vorhin einfach nie so überlegt dass das eigentlich nicht unbedingt Sinn machen muss oder nicht die einzige Option ist.
[36:47] Wenn es um wieder zurück in die USA die Achse des Bösen ist natürlich auch so eine Metapher oder so ein Begriff der der viel bemüht worden ist auch hier Achse.Ganz klar auch angelehnt natürlich an den Zweiten Weltkrieg.
[37:07] Oder ich mir an die Welt Kriege und und und was das halt in den Köpfen mit uns macht auch das ist natürlich impliziert dass es irgendwie.Ich sag mal eine Achse also alles auf einer Linie ist aber die Länder die da dazu gezählt worden sind die sie natürlich irgendwie verstreut das hat nichts mit einer irgendwie, zusammenhängenden, ja Front zu tun und auch das Böse also die hieß ursprünglich wohl eigentlich Achse des Hasses.Und wurde dann aber zur Achse des Bösen weil das natürlich auch viel einfacher also man kann ja nicht dagegen argumentieren weil das Böse.Wenn man gegen das Böse kämpft ist man automatisch das Gute.
[37:51] Und gegen das Böse ist ja wie auch alles erlaubt ja klar also das passt sehr gut in diese Außenpolitik die dann auch betrieben wurde.Ja und das Böse ist ja auf eine Art auch greifbarer als also bei Hass würde ich immer sagen, das ist ein bisschen wie bei Gender und so also Hasser hat was mit mit doing hate trade zu tun so vielleicht also es ist ja was.Also hast du es war sehr performatives so vielleicht und das Böse ist was sehr erstmal was sehr absolutes was Hass verbreitet vielleicht möglicherweise aber als Ziel viel besser vorstellbar ist.Ergibt das Sinn was ich sage.
[38:36] Ja ja und gleichzeitig ist natürlich Krieg gegen den Hass Krieg gegen das Böse.
[38:43] Das ist ein Krieg den du nicht gewinnen kannst also das ist schon und offenbar wurde auch immer gesagt also.Oder aus irgendwelchen Dokumenten hast du nur USA wurde dann ersichtlich dass man die Empfehlung hatte nie.Von einem Krieg gegen den Irak oder Krieg gegen Afghanistan zu sprechen sondern eben immer von diesem Krieg gegen den Terror.Auch weil das natürlich ganz andere, Implikationen hätte dann wenn man das gemacht hätte wenn wir noch mal jetzt kurz nach Deutschland kommen was ich ganz eigentlich eine lustige Anekdote finde ist.In den Ursachen von von dieser Koalition of the willing gesprochen wurde.Also da sind diese Staaten die sich dann angeschlossen haben dem Krieg angeschlossen haben eigentlich und auf Deutsch wurde das so ein bisschen.
[39:38] Man hätte das übersetzen können als Koalition der gewählten wurde aber oft als Koalition der Willigen übersetzt, das ist natürlich was ganz anderes und das wie der Spiegel gar nicht unbedingt was das englische aussagen wollte.Also die Koalition der Willigen dass ja das hat dann so ein bisschen den Nachgeschmack von ja wie wir.Wir sind die die Schafe die halt jetzt da mitmachen müssen wir haben keine andere Wahl und die Koalition der gewählten was vielleicht eher dem englischen Sinn näher wäre würde halt so dann.Ja wir wir machen dass wir haben die Willenskraft.
[40:17] Und ist auch ein bisschen der Frame die gemäss lakoff auch gewollt war also sich gegen das Böse zu stellen das ist denn das ist dann eine moralische.Das ist moralische Willenskraft wenn man man isst man das macht man nicht einfach sondern man muss dann als Nation auch wie die Stärke haben das zu wollen.Das ist so ein bisschen zur zur Außenpolitik und und den Metaphern etwas was ich auch ganz.Noch spannend fand ist das mit der Emotion und das in diesem strengen Vater Modell Emotionen, unterdrückt werden muss zum Beispiel damit man rational handelt also Emotionen wird als etwas.Ich sag mal schädliches oder irrationales verstanden ja und auch das ist etwas was wir vielleicht heute.
[41:17] Also was man heute weiß dass man natürlich nicht stimmt ganz generell für sage ich sag mal wie die mentale Gesundheit, aber trotzdem etwas ist was mir immer wieder begegnen auch wenn ich jetzt dass man wie sagt ja du kannst jetzt du kannst darüber nicht diskutieren du bist zu emotional dass das dann wie als Beleidigung aufgefasst wird obwohl dass das gar nicht meint sondern.Sondern dass es halt das ist normal ist oder dass Emotionen halt auch was sehr positives sein können und dass das nichts nicht getrennt ist von von Rationalität und mittlerweile weiß man auch dass es neurophysiologisch nicht unterschiedliche Dinge sind eine Kognition und Emotion ich würde sagen das ist auch ein klassischer also das was du die die Aussage ist auch ein klassisch sexistisches Toppers.Würde ich sagen also ich glaube es ist eher was was man Frauen sagt ja stimmt ja also auch.Dann die Dimension gibt es bestimmt auch ja total.
[42:20] Es geht dann gegen Ende des Buches wieder weg von von Politik und schaut sich dann noch die Religion und Metaphern an.
[42:30] Auch hier diese abstrakte Idee Gott begreifen wir natürlich in Metaphern gemäss lakoff.Was er auch dann sagt ist nur weil wir etwas ausschließlich in Metaphern begreifen heißt das nicht dass es nicht deswegen trotzdem existiert, das wäre eben das Beispiel von der von der Zuneigung zum Beispiel dass das haben wir dafür haben wir Metaphern.Aber das existiert ja trotzdem auch real und für Gott würde er jetzt dass das gleiche sagen und.Was ich ein entspannender. fand ist wenn er sagt unser Verständnis von Moral also von unseren Werten was er auch jetzt.Die ganze Zeit erwähnt wurde auch wenn es um die Politik geht die kommt sehr früh oder die entwickeln wir sehr früh und zwar vor der Religion.Wenn man man hört manchmal so ja Religion ist oder im Moral kommt aus der Religion und er sagt nee.Eigentlich umgekehrt wir haben unsere Moral schon und religiöse Werte entstehen dann wenn wir Religionen nach unserer Moral interpretieren.
[43:40] Spannend ja okay ja fand ich auch spannend.Weil man es auch ganz gut wieder runterbrechen kann wenn man wieder dieses fürsorgliche Eltern vs strenger Vater Modell nimmt dann wäre halt dieser strenger Vatergott das wäre das Hölle ne also man kommt in die Hölle und man wird bestraft oder altes und Testament zumindest ja.Und unter der fürsorgliche Gott das ist halt man bekommt Vergebung also man sollte tolerant sein man soll den Menschen vergeben und auch einem Selbstwert vergeben und das sind einfach ganz andere.Interpretationen schon auch von diesem von der Religion.Und auch bibeltreue beispielsweise Religionen die das Praktizieren.Gehören auch so ein bisschen diese strenge Vater Version weil natürlich dann die Bibel nicht durch ich sag mal die Kinder neu interpretiert werden kann.
[44:45] Das ist ja wie das dann das absolute also das passt da da wie auch rein oder auch Toleranz als religiöser Wert also.Dass das dass man oder ich sag mal so man hört oder gemäss laiko hört man.Das tolerant eigentlich ein säkularer wert ist.Und auch da sagt er das ist eigentlich nur der Fall wenn man aus dieser strenger Vater Religion an sich heraus argumentiert weil sonst ist Toleranz auch eigentlich Teil der Religion also es ist auch ein religiöser wert denn, wenn man das wenn man Religion so interpretiert dass man, seine Mitmenschen verstehen möchte tolerieren möchte möchte dass auch ihnen gut geht dann ist das natürlich genauso Teil von einer.Ja von einer guten Gläubigen Gläubigen Person dass sie tolerant gegenüber anderen Religionen ist.Und ein Beispiel für die Religion oder für diese Geschichte ist auch die von Abraham und Isaak, das ist er sollte seinen Sohn töten als Opfer und.Hat es dann also wollte das danach tun wurde dann in letzter Minute gestoppt von einem Engel gemäß Geschichte und.
[46:09] Hier gibt es auch diese Interpretationen dass man also lake of sagt er habe das so gelernt dass man.Dass die Moral von der Geschicht sage ich mal ehrlich ist dass man nicht sein Sohn töten soll egal wer einem das befiehlt egal ob das Gott war, und die anderen Interpretation ist halt Handeln ist eigentlich nur dann moralisch wenn man Gott ausschließlich gehorcht, oder uneingeschränkt.Folgt und das gar nicht erst hinterfragt und auch das sind so Dinge die ich finde das ist total plausibel wenn man das so hört und trotzdem.Passiert mir das oft wenn ich dann über Bibel gewisse Interpretation nachdenke dass ich diesen Switch eigentlich nicht mache.
[46:53] Ja das ist eigentlich klar gibt es Interpretationen aber dass die ja vielleicht viel grundlegender sind oder mit grundlegenderen Werten verbunden sind als man das vielleicht meint.
[47:05] Ich finde bei immer wieder bei Bibelgeschichten so spannend wie sie unabhängig davon was man da nun nun religiös von hält ob man dem nun anhängt oder nicht wie häufig sie als quasi.Doch relevante Stories noch zitiert werden und hier dann ja auch das finde ich auf eine Art irritiert dass mich mittlerweile fast schon einfach weil welche das Gefühl habe aber, wer sagt denn dass das jetzt die.Also dass die Geschichte von Abraham und Isaak wirklich die relevante Geschichte ist um uns was über keine Ahnung vielleicht da ja auch, freien Willen das würde wäre so das erste was mir ein Feld bei der Geschichte zu zu sagen also das ja ich merke dass mich das mittlerweile kitzelt das irgendwas in mir dass ich mich immer wieder frage aber warum sprechen wir denn eigentlich noch so viel darüber der ja trotzdem ist es würde ich sagen von den Bibelgeschichten ist die von Abraham und Isaak auf jeden Fall eine die total spannend ist und ich glaube es gibt ganz viele Interpretationen um um die Geschichte herum also vielleicht für den für den Nachgang noch mal spannend die nachzuschlagen.Ja wie gesagt es ist auch wie wieder sehr natürlich Ursa zentrisch und dort ist natürlich dieses god bless America und so weiter das ist schon hat schon noch mal eine andere auch politische Bedeutung.
[48:31] Ja es geht dann auch weg von der Religion und.Ich neige mich dem Ende zu aber noch etwas Interessantes finde ich dass der Begriff das essential League contested concept das ist nicht was was lakoff erfunden hat das wurde schon in den 50er Jahren benannt, und das sind eigentlich Ideen wie gesagt wie soll wie soll man das Zusammenfassen Ideen die.
[48:53] Einfach nicht so ganz klar fassbar sind oder Ideen die für alle Personen eine unterschiedliche Bedeutung haben können und er sagt Ideen haben in der Regel einen Grundgerüst.
[49:07] Und ganz viele Lehrstellen und die Lehrstellen die werden von uns eigentlich nach unseren Werten aufgefüllt.Und eigentlich sind wir uns eigentlich nur über diesen über diesen kleinen und Stricken ich sag mal Bedeutung Scan.An ein Beispiel dafür ist der Begriff Freiheit das ist so ein ganz klassisches essential Contest it concept und worüber wir uns einig sind ist das zum Beispiel Freiheit nicht bedeutet oder bedeutet nicht eingesperrt zu sein.
[49:40] So also physische Freiheit das ist wie ich glaube dass da können wir uns alle weltweit darauf einigen was aber spezifische Ausformungen oder von Freiheit sind das ist ganz unterschiedlich je nach Kultur und er bringt eine finde ich witzige Anekdote einer US auß.Politik beauftragten die ich glaube in Dubai war.Und dann vor einer Gruppe Frauen von Freiheit spricht und dann sagt ja für mich also jetzt halt für mich als Amerikanerin ist Freiheit als Frau ins Auto zu sitzen und überall hinzufahren wo ich wo ich hin kann und er sagt dann ja das stieß dann auch ein bisschen auf Empörung weil sie weil das Publikum dann gesagt hat ja also.Für mich ist Freiheit als Frau ins Auto zu sitzen und überall hingefahren zu werden ich habe sogar ein Chauffeur.
[50:37] Und das ist natürlich ganz ein anderer also generell so ziemlich blöd zum Beispiel dass es Freiheit Auto als Freiheit wahrzunehmen das finde ich ist schon etwas sehr amerikanisches ich fühle das gar nicht unbedingt so nicht.Aber ist natürlich ein schönes Beispiel von diesem von diesem Konzept.Ich bin gespannt was ich Auto als Freiheit so durchgesetzt hat ich finde zum Beispiel Auto als privater Raum in der Öffentlichkeit, wäre für mich ein viel nachvollziehbarer weiß ich nicht claim.Aber irgendwie ist es der nicht geworden was ich spannend finde aber das finde ich es eigentlich wenn ich das in meinem Umfeld beobachte warum Leute sich in der Stadt zumindest mit einem Auto fortbewegen dann geht es ganz wiederum dass man Privatheit in der Öffentlichkeit hat dass man nicht mit anderen Menschen konfrontiert ist nicht so sehr und das kann man dann ja vielleicht auch als Freiheit verpacken aber das ist eigentlich nicht das was die Leute umtreibt.
[51:33] Aber meinst du das kommt nicht auch aus den USA wo halt ich sag mal diese weiter die du hast und mit dem Auto und dann hast du ja dann hast du vielleicht dann ist das Bedürfnis von Privatheit geht da.Auch ein bisschen in den Hintergrund vermutlich ist es so ja diese, Worte die ihre Bedeutung wie gesagt auch das jetzt nicht nichts Neues aber trotzdem spannend wenn wir von Worten als Behälter entsprechende wir verpacken eine Information wir senden sie so dass nicht immer das alte Kommunikationsmodell und es wird dann wieder entpackt und lake of sagt ja wir entpacken halt nicht unbedingt das was eingepackt wurde.Also das ist halt das Problem an der Kommunikation und an diesen an diesen Bedeutungen und das kommt halt nur das klappt halt nur.Wenn wir gewisse sprech Regeln Frames Metaphern teilen dann können wir davon ausgehen dass wir irgendwie eine geteilte ich sag mal Wahrheit haben oder eine Basis finden aber das ist nicht selbstverständlich dass wenn wir ein Wort benutzen dass das auf der anderen Seite auch so ankommt dass das kennen wir alle.
[52:48] Der dass der Einfluss noch auf den Journalismus finde ich auch interessant dass es auch etwas was ich sehr oft, oder eine Mahnung die ich sehr stark vertrete ist dass Journalismus nicht objektiv sein kann, und lecker sagt auch ja man kann Tatsachen gerecht berichten aber eben nicht objektiv.
[53:10] Und der Grund dafür ist dass es keine neutrale politische Sprache gibt, also immer wenn wir auch Fakten ich sage mal Fakten die man durchaus verifizieren kann in Sprache verpacken, dann ist das nicht mehr neutral also es wird zwangsläufig irgendein Frame aktiviert und das kann ausgenutzt werden natürlich für Propaganda für aber das kann das passiert auch wenn man das nicht beabsichtigt.Und ich finde das kann man auch ausweiten auf Daten also man wir haben schon noch das Gefühl ja Daten sind irgendwie objektiv und auch da also.Daten einfach ich sag mal die die rohe Tabelle ja vielleicht aber das ist nicht die Form in der wir Daten konsumieren aber wir bekommen das in Statistiken im Sinne von in Diagrammen wo das wird halt eben auch in Worten beschrieben und auch da also das ist nicht mehr objektiv auch da haben wir eigentlich keine neutrale Sprache um von Daten und über Daten zu sprechen.
[54:18] Die uns eigentlich mental zugänglich ist.Ja im Anschluss daran ich hätte auch gesagt genau also Journalismus zum einen aber generell auch für die Wissenschaft ne also für also mit dem hohen Objektivität, hoch der der auch richtig ist aber trotzdem muss man sich glaube ich als Forscher in klar machen dass man natürlich immer normativ geprägt ist und ich meine es gibt eine wissenschaftstheoretische, sich dem normativen auf verschrieben hat zumindest in den Geistes und Sozialwissenschaften aber selbst wenn man das nicht wenn man der nicht folgt sollte man sich darüber klar sein dass man immer mit normativen Vorannahmen.Arbeitet und einfach das eigene Denken davon geprägt ist und ich glaube das ist auch ja ich weiß nicht genau wie man das in die Naturwissenschaften übertrieb überträgt aber auch da ist es glaube ich wichtig.Ja ja auch da es gibt so ein ich weiß nicht mehr von wem das Zitat ist aber objektivität ist.Ich glaube die Illusion eines Beobachters das eine.Beobachtung ohne Beobachter gemacht werden kann ja so das ist so dass wenn es um die Naturwissenschaften geht.Er sagt dann eben bewusst der Journalismus ist das was er sich wünscht also dass man eben diese Metaphern dieses framing auch immer wieder anspricht und aufzeigt also das nicht einfach verwendet wenn wenn die Politik das einem so präsentiert sondern wirklich auch sprachlich dass ich sag mal aufdröseln und und nicht nur wieder keut.
[55:44] Und zum Schluss vielleicht noch ein paar wenige Metaphern oder die in Deutschland auch bemüht werden dass es einerseits.Als es also wenn es um Migration geht die ganze das Flüchtlingswelle Strom Flüchtlingsstrom die Nation als Boot Boot ist voll man wird von Flüchtlingen überrollt das ist so dass.
[56:08] So ein bisschen die das was man oft hört auch mit der Klimaerwärmung, das ist Erwärmung ist halt wie das aktiviert eigentlich einem Frame den wir als gut empfinden warm ist gut und Klimakrise ist natürlich ein ganz anderes es gibt die Debatte habe ich auch stark stark stark stark mitbekommen ja zum Thema Migration noch was wir hier momentan in Deutschland zumindest als starkes.Starken Begriff haben müsst der der irregulären migration.Den ist faktisch aber nicht gibt also es wird immer wieder gesagt man müsste die irreguläre Migration eindämmen Griff kriegen was auch immer aber die gibt es einfach nicht es gibt keine irreguläre Migration es gibt Menschen die nach Europa kommen und danach Deutschland kommen und dann können Sie Anträge auf Asyl Duldung was auch immer stellen, aber der die migrationsbewegung an sich kann gar nicht irregulär sein und da hat sich ja was richtig richtig politisch festgehalten was einfach juristisch einfach falsch ist und das ist was was mich wahnsinnig aufregt also alles andere noch mal nachgelagert aber dass sowas so so leicht funktioniert wenn man wenn man quasi mal als Öffentlichkeit 3 Minuten nicht nicht ganz wach ist nicht sofort einschreitet und sagt nee Leute so können wir das nicht sagen ist echt echt bitter.
[57:33] Ja ja auch hier finde ich gibt es ein sehr gutes Beispiel das geht so ein bisschen in diesen in das Argument von den Steuern einfach wie wie es aufgebaut ist da geht es um die um die Flüchtlings Obergrenze auch so ein Begriff den wir immer gehört haben und willing sagt dann, wieso sprechen mir eigentlich nicht von der Flüchtlingsunterkunft gerecht werden ah schön ja also kann man natürlich auch so Frame wo sitzt man denn den Nullpunkt an dass man.Also dass man keine Flüchtlinge hat oder wir akzeptieren das als ein globales Phänomen das immer schon stattgefunden hat und dann ist das halt eben nicht der Nullpunkt keine Flüchtlinge sondern wie viele, sind denn zumindest überhaupt nötig.
[58:19] Oder geboten so mein Kopf von Hölzchen auf Stöckchen ja.Wichtige Debatte.
[58:31] Das wäre es gewesen wie gesagt viele Dinge eigentlich nicht neu ich fand das Buch trotzdem schön und ich man kann so ein bisschen auch ich sag mal assoziativ oder inspirativ lesen es geht ganz Ringen deswegen kann man das wenn man ja Wie gesagt vieles ist schon bekannt man lernt jetzt nicht unbedingt was fundamental Neues dazu.
Mehr Literatur
[59:00] Aber Kratzer als Gesprächs war ja total eingängig vermutlich zu lesen von daher ja vielen dank dir für die Vorstellung ich würde jetzt eher einmal anschließen und ein paar Folgen nennen von denen ich glaube dass sie ganz gut zur heutigen passen könnten und ja zum einen habe ich da die Folge 18 rausgeschrieben da hat Amina say und Mustafa nein falsch er hat Nils das Buch Muster von Amina sey vorgestellt und ja da geht es im Prinzip drum wie die digitale.Der Struck der wie Digitalisierung als Struktur in der Gesellschaft vielleicht schon angelegt ist, so kann man vielleicht am ehesten sagen und ich dachte dieses ganze Thema Muster Muster finden und Muster da suchen Muster Bildung.
[59:51] Dann habe ich die Folge 28 rausgeschrieben das ist die Realität der Massenmedien von Niklas Luhmann das habe ich vorgestellt ja geht es eben um die Massenmedien – Internet weil es das damals noch nicht gab.
[1:00:04] Passt glaube ich auch ganz gut zur Folge heute dann nicht Folge 34 weil wir jetzt auch ein bisschen über die USA gesprochen haben da Nils Amerikas Gotteskrieger von Annika Brockschmidt vorgestellt wo es auch ganz stark um die langen Linien der konservativen geht und ihre Macht Ergreifung Strategien so würde ich es glaube ich sagen also der der evangelikalen vor allen Dingen also das was hier im Buch jetzt auch schon ein bisschen angerissen wurde wie die Konservativen in den USA agieren, und dann habe ich noch da Folge 51 linke datenrechte Daten kannst du am ehesten was zu sagen du hast das vorgestellt von tin Fischer wo es auch genau um das ganze Thema Objektivität von Daten geht und das Wirklichkeit eben nicht unverfälscht abgebildet werden kann sondern immer in einem Kontext interpretiert also Daten in meinem Kontext interpretiert werden müssen und zu guter Letzt habe ich noch die Folge 61 das ist die gespaltene Gesellschaft von Jürgen Kaube und andere Kieserling das verbrauche ich vorgestellt wo ich auch wo ich weiß gar nicht wann genau ich den Gedanken heute während der Folge hatte aber es geht, um das ganze Thema ja wie gespalten ist denn die Gesellschaft wirklich an das ist vielleicht auch ein Frame den wir bedienen und ihre These ist eben na ja ganz so dramatisch ist es gar nicht.
[1:01:28] Es ist alles nicht so wild eigentlich ist noch viel zusammengehalten und wir bräuchten eigentlich erstmal eine vernünftige Definition davon was eine richtige Spaltung der Gesellschaft eigentlich sein soll hast du weitere folgen die du dazu werfen möchtest in den R.
[1:01:45] Nee ich bin total zufrieden mit deiner Auswahl sehr gut hast du eventuell weitere Bücher oder Podcasts oder was auch immer du uns mit auf den Weg geben möchtest.Ich habe das Buch metaforce believe by das ist auch von George lakoff ist anni sein Standardwerk ich hätte auch das vorstellen können dass da ist es mir Pragmatismus geschuldet dass ich das andere genommen habe das ist ich finde es extrem lesenswert einfach als es halt auch sein Standardwerk.
[1:02:12] Ein Buch thinking fast and slow langsames denken schnelles Denken glaube ich auf Deutsch von Daniel, kann man auch an Standardwerk wenn es um bei es und Frames und so weiter geht ich finde es immer noch auch sehr lesenswert wenn auch schon älter vielleicht gewisse Dinge schon überholt aber ich lese das immer noch gewinnbringend immer mal wieder ein Kapitel daraus und find das auch die Beispiele einfach sehr, sehr interessant.Ein neueres Buch was ich noch empfehlen kann ist das Buch verkehren ins Gegenteil über Subversion als macht Technik von Silvia Sasse das ist erschienen im Matthes und Salz Verlag also diese kleinen, ich glaube fröhliche Wissenschaftsbehörde.Da geht es auch darum eben wie man medial und politisch eigentlich diese verkehrte Welt wie die erschaffen wird auch in Bezug auf jetzt Russland und Ukraine.Und dann gibt es noch ein Buch dass ich weiß nicht ob es ob ich es empfehlen kann es gehört so ein bisschen dazu und zwar Hans Blumenberg da ist also philosophisch schon auch so, er hat also ich sag mal der hat schon sehr viel über Metaphern auch.Geschrieben ein kleines Buch von ihm das ist Schiffbruch mit Zuschauer.
[1:03:34] Es geht eigentlich darum oder seine metaphorologie geht darum dass es eben Dinge oder Einsichten gibt die man eigentlich durch wissenschaftliche Begriffe nicht abschließend beschreiben kann und Metaphern kann kann das so ein bisschen bebildern oder fassbar machen.Also das Buch ist ich finde es unglaublich anstrengend zu lesen ich nerve mich auch immer so ein bisschen.Philosophische Bücher die zu prätentiös sind was wenn dann irgendwie Latein und Griechisch und Französisch alles geschrieben wird und nicht übersetzt ich habe da schon Mühe mit Arendt wenn das die ganze Zeit griechische Wörter drin stehen hast du das ist ein absolutes gemacht was soll das also wirklich ja wie gesagt also ich finde.Ich ich wollte Bloomberg jetzt einfach erwähnen weil Metaphern auch in der Philosophie in der Literatur das ist schon er hat das schon ein sehr wichtigen Beitrag geleistet denke ich aber, es sei dem motivierten der motivierten Leserin überlassen ob man sich das antun möchte oder nicht.
[1:04:42] Ja schön vielen Dank.
[1:04:46] Ich habe noch nur zwei Bücher heute nicht nicht so viel aber ich möchte mit einem Zitat starten was ich ganz schön finde ich selber weiß von mir dass ich eine nicht triviale Maschine bin und von daher ist die Hoffnung dass ich mich verstehen werde einfach nicht zu erfüllen das kommt aus dem Einführungstext hin zu den Shortcut das müsste Band 5 von den Shortcut von 2001 also von 2001 Verlag sein dass ist Heinz von Förster.
[1:05:16] Den ich ja am Anfang schon mal kurz erwähnte und ich dachte wir nehmen jetzt hier einfach mal mit rein passt vielleicht nicht an jeder Stelle ganz genau aber genau geht eben bei ihm immer um Kybernetik und in dem Bändchen wird also in den Shortcut werden immer verschiedene kleine Texte von Autorinnen versammelt und die irgendwie so einen ersten lesezugang zu einem Autoren ein Autorin.Ja vermitteln sollen und ich finde das ist auch hier ganz gut gelungen hier sind so schöne Texte drin wie Einführung in die natürliche Magie Ethik und Kybernetik zweiter Ordnung Wissenschaft ist Unwissen solche Sachen und der letzte Text ist warum sind Computer musikalisch also er hat auch viel Computerwissenschaft gemacht und irgendwie ja also Heinz von Foerster lesen ist immer macht ein bisschen Knoten in den Kopf aber ist auch echt lohnenswert und dann weil wir so viel über Wirklichkeit heute auch gesprochen haben zumindest in meiner Empfindung würde ich noch mal wie wirklich ist die Wirklichkeit von Paul Watzlawick mit an die Hand geben.
[1:06:16] Genau einfach ja Watzlawick eben auch als als Kommunikations affiner Mensch.Mit mindestens einem sehr bekannten Zitat und ja ich glaube das Buch kann auch lohnen ja und bringt auch glaube ich so ein bisschen Konstruktivismus noch mal nach ja.So weit es wären meine beiden Empfehlungen noch super danke, sehr gut ja hast du noch was was du unseren Hörerinnen mitgeben möchtest,
Ausstieg
[1:06:53] ist klar dann ja vielen Dank euch fürs Zuhören wir hören uns in drei Wochen wieder ich habe keine Ahnung da ist Nils doch nils ist dran aber was er vorstellt kann ich euch noch in keinster Weise sagen und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen wenn ihr Lust habt uns weg da zu lassen dann tut es gerne über unsere Webseite zwischen zwei decken.de da könnt ihr einfach unter jeder Folge Kommentare hinterlassen hat es euch gefallen was ist euch noch aufgegangen was welche Bücher haben wir in den Verweisen am Ende vergessen so was könnt ihr uns da gerne lassen und ansonsten könnt ihr uns auf Facebook folgen da heißen wir zwischen zwei Deckeln sowie der Podcast auf Instagram heißen wir so wie das letzte Wort also at Deckeln und auf Mastodon sind wir zu finden unter zzd Podcast.
[1:07:44] Social oder so ähnlich ich werde es auf jeden Fall verlinken das ist bei was Du dann immer ein bisschen immer ein bisschen schwieriger ja damit ist die Folge jetzt am Ende und macht’s gut bis bald tschüss.
[1:07:58] Music.
Intro und Outro der Episode stammen aus dem Stück Maxixe von Agustin Barrios Mangore, eingespielt von Edson Lopes (CC-BY).
Das Umblättern zwischen den Teilen des Podcasts kommt hingegen von hoerspielbox.de.
Zwischen zwei Deckeln findest du auch im sozialen Medium deiner Wahl: Mastodon und Bluesky.
Der Beitrag 068 – Auf leisen Sohlen ins Gehirn von George Lakoff und Elisabeth Weling erschien zuerst auf Zwischen zwei Deckeln.

Dec 21, 2023 • 1h 31min
067 – Jahresabschluss 2023
2023 war unser erstes vollständiges Jahr in neuer – sprich größerer Besetzung. Wie letztes Jahr auch haben wir uns daher zusammengesetzt und stellen euch unsere medialen Fundstücke vor, die es aus unterschiedlichen Gründen nicht in den Podcast geschafft haben.
Shownotes
Buch: The Year of Living Biblically von A.J. Jacobs
Buch: Keine Bibel von Christian Nürnberger
ZZD011: „Religion für Atheisten“ von Alain de Botton
Buch: Ein Hof und elf Geschwister von Ewald Frie
ZZD001: „Resonanz“ von Hartmut Rosa
Buch: Maxwell’s Demon von Steven Hall (dt. Maxwells Dämon)
Podcast: The Skeptics Guide to the Universe
Podcast: Hoaxilla
Zeitschrift: Blätter für deutsche und internationale Politik
Zeitschrift: Le Monde Diplomatique
Buch: On Food and Cooking von Harold McGee
Buch: Das Lexikon der Aromen- und Geschmackskombinationen von Karen Page und Andrew Dornenburg
Buch: The Vegetarian Flavor Bible von Karen Page und Andrew Dornenburg
Buch: Salz. Fett. Säure. Hitze. von Samin Nosrat
Serie: Salt. Fat. Acid. Heat. (Netflix)
Online-Zeitschrift: Republik Zwei Artikel aus der Republik zum “Reinlesen”:
Artikel: Trump liegt falsch von Marie-José Kolly (Beispielartikel aus dem Republik-Format “Ich hab mich getäuscht”, 16.12.2022)
Artikel: Die Barbarei der Hamas von Daniel Strassberg (10.10.2023)
Suchmaschine: kagi
ZZD060: Chokepoint Capitalism von Rebecca Giblin und Cory Doctorow
Artikel: Google Search is Dying von Dmitri Brereton
Quellen und so
Intro und Outro der Episode stammen aus dem Stück Maxixe von Agustin Barrios Mangore, eingespielt von Edson Lopes (CC-BY).
Das Umblättern zwischen den Teilen des Podcasts kommt hingegen von hoerspielbox.de.
Zwischen zwei Deckeln findest du auch im sozialen Medium deiner Wahl: Mastodon und Bluesky.
Transkript (automatisch erstellt)
Einstieg
[0:00] Music.[0:18] Hallo und herzlich Willkommen zu Episode 67 von Zwischen 2 Deckeln, eurem Sachbuch-Podcast.Dieses Jahr geht es leider nicht so schön auf, dass wir die Jahresabschluss-Episode gleich mit einer Runden-Episode feiern können.Wir haben uns aber trotzdem dafür entschieden, zu sagen, ja, ein neues Jahr, ein weiteres Jahr, Zwischen 2 Deckeln geht zu Ende.Wir würden gerne ein mit euch und für euch feiern und deswegen habe ich heute dabei Holger, Christoph und Amanda.Hallo zusammen.Also heute mal wieder in voller Besetzung und heute auch mal wieder im gewohnten Jubiläumsfolgenformat sozusagen, wenn ihr euch noch daran erinnert.Jeder, jede von uns hat heute zwei Arten von Medien mitgebracht.Es müssen noch nicht mal unbedingt Bücher sein, die wir euch vorstellen möchten.Einfach so ein bisschen Dinge, die es vielleicht aus dem einen oder anderen Grund nicht in den Podcast geschafft haben, die keine Bücher sind und deswegen eben irgendwie nicht ins Format passen, aber die wir euch trotzdem vielleicht für die Weihnachtsferien mitgeben möchten, falls ihr irgendwie inspirierende Lektüre, Ideen, Gedanken und so weiter haben möchtet, nicht darauf verzichten möchtet, dann habt ihr hier die Gelegenheit, das mitzunehmen.Und deswegen brechen wir unser Format so in ganz vielerlei Hinsicht heute.Und ich übergebe jetzt direkt an Holger, der uns etwas vorstellen möchte.
Buch: „Die Bibel und Ich“ von A.J. Jacobs
[1:43] Ah, hallo. Also ich werde zuerst ein Buch vorstellen.Und ein bisschen in Tradition zu letztem Jahr ist es ein Buch mit einem humoristischen Bezug zur Religion. Das habe ich jetzt heute erst festgestellt, dass ich da irgendwie wieder was Ähnliches ausgewählt habe.Und zwar möchte ich vorstellen von A.J. Jacobs, The Year of Living Biblically, auf Deutsch erschienen als Die Bibel und Ich.Also ich habe es persönlich im englischen Original gelesen, deswegen der englische Titel.[2:19] Also dazu muss man wissen, das Ganze steht so ein bisschen in der Tradition des amerikanischen jüdischen Humors und der Autor ist ein Journalist und hat, bevor er dieses Buch geschrieben hat, schon mal ein ähnliches Buch geschrieben, in dem er die komplette Encyclopedia Britannica durchgelesen hat und so ein bisschen es da so aufgebaut hat, dass er sozusagen anhand der Buchstaben so durch die Enzyklopädie durchgegangen ist, aber zwischendurch auch immer so ein bisschen berichtet hat, wie es mit ihm damit gegangen ist.Und er hat dann also ein ähnliches Projekt auch gemacht in Bezug auf die Bibel.Also das Ganze ist auch schon eine Weile her.Das Buch ist schon ein bisschen älter, ist erschienen 2007, also nur, dass man das grob einordnen kann.Und er hat dann also gesagt, Begründung war, sehr viele Leute beziehen sich, also zumindest in der amerikanischen Kultur, und da ist es auch noch etwas mehr als hier, denke ich, darauf, dass die Bibel bestimmte Dinge sagt und versuchen damit.[3:28] Bestimmte Ansichten, also gesellschaftliche, politische Ansichten zu begründen.Und dann hat er sozusagen als Projekt gesagt, was ist denn, wenn ich mal versuche, das wirklich durchzuziehen. Hat sich dann also die Hossowka…Die Bibel durchgelesen und nach den Regeln in der Bibel gesucht.Das sind nicht wenige, das sind ziemlich viele.Und hat dann also gesagt, okay, er ist, wie gesagt, eigentlich Jude.Dann hat er gesagt, okay, er will erst mal versuchen, das Ganze, nur die Regeln aus dem Alten Testament zu befolgen.Und für acht Monate und dann vier Monate lang noch die Regeln aus dem Neuen Testament dazuzunehmen, wobei die meisten spannenden Sachen eigentlich eher auf die Regeln aus dem Alten Testament bezogen sind in dem Buch.Also, genau. Und hat dann also dieses Projekt durchgezogen und dann auch wieder seine Erfahrungen als Buch geschrieben, allerdings, wie gesagt, sehr humorvoll.Es hat diesen gewissen Sachbuchaspekt, dass man dabei auch ein bisschen was über die Bibel lernt, weil er sich zum Beispiel dann auch darauf bezieht, welche Regeln das teilweise sind.Und natürlich sind die Regeln, die einem so im Kopf bleiben, sind natürlich meistens eher die etwas ungewöhnlichen.[4:52] Und man sieht dann auch, wie er versucht, Regeln dann umzusetzen und in seinen Alltag einzubauen, ohne dass er dadurch große Probleme kriegt, sagen wir mal.Aber er stellt dann auch relativ schnell fest, es gibt halt bestimmte Regeln, die sind gar nicht so einfach einzuhalten, gerade in der modernen Welt.Also zum Beispiel gibt es die Vorschrift, dass man, ich glaube, sich nicht rasieren darf.Das heißt, er hat dann auch am Ende des Ganzen, also hat er einen sehr vollen Bart.Das gibt es auch als schönes Bild auf dem englischsprachigen Cover der Ausgabe, die ich habe.Er hat auch das Problem, dass es zum Beispiel Kleidervorschriften gibt, wo Mischstoffe verboten sind und stellt fest, dass es nicht so einfach ist, Kleidung zu bekommen, die dieser Regel gerecht wird.[5:46] Ja, also das sind dann schon mal so die ersten Probleme, die dann auftreten, hat dann aber auch noch andere Sachen, zum Beispiel gibt es dann die lustige Geschichte, dass es, also lustige in Anführungszeichen, dass in der Bibel gibt es ja eine Vorschrift, dass man eine, ich glaube eine Woche, nachdem eine Frau ihre Menstruation hatte, sie nicht berühren darf.Und das findet seine Frau natürlich überhaupt nicht gut, dass er versucht, diese Regel durchzuziehen, wie man sich vorstellen kann.Und in den strengen Auslegungen ist es wohl sogar so, dass man noch nicht mal Dinge, man darf sich auf keinen Stuhl setzen, auf dem die Frau gesessen hat zum Beispiel.Und seine Frau setzt sich dann einfach aus Trotz auf möglichst viele Stühle, sodass er damit hinstehen muss.Also so in dem Geist ist halt das ganze Buch. Wenn ich mich recht erinnere, das ist ein bisschen her, dass ich es gelesen habe.Ja doch, doch, sie wird im Laufe dieses Jahres, seine Frau auch schwanger und sie kriegen noch weitere Kinder.Das heißt, er musste es glaube ich nicht das ganze Jahr durchhalten, aber zumindest am Anfang war das wohl ein Problem.[7:01] Dann, genau, es sind einfach sehr viele solche Anekdoten.Es ist teilweise auch reflektiert, wo relativ am Ende zum Beispiel feststellt, dass so die Vorschrift, dass man täglich beten soll und dann auch die jüdische Tradition, bestimmte Gebete zu sprechen, auch eher aus Pflichtgefühl, also dass das doch einen bestimmten Effekt hat, wo man sich mehr sammelt und dass das auch eine positive Auswirkung auf sein Leben hatte.Aber es sind eben auch einfach sehr viele sehr obskure Geschichten.Also er hat das Problem, dass in der Bibel steht ja, man soll, jetzt muss ich gerade aus dem Englischen übersetzen, Adulterer, also ich glaube Menschen, die ihren Partner betrügen, würde man das am besten übersetzen, soll man steinigen.Und jetzt hat er natürlich das Problem, wie soll er diese Regel befolgen?Also zum einen muss man ja erst mal feststellen, wer das ist.Und zum anderen ist Steininger etwas, was in der modernen Welt jetzt nicht so bekannt ist.Und er beschließt es dann zu lösen mit Kieselstein, indem man dann mit Kieselstein irgendwie durch die Stadt läuft und dann sozusagen davon ausgehen, dass die meisten Leute, wahrscheinlich nach den biblischen Vorschriften das begangen haben, dann so Hinterkieselsteine auf Leute schnippst, um diese Regel befolgen zu können.[8:26] Wow, insgesamt wow. Ja, also genau. Also es ist ein sehr, also es ist ein Buch, das ich gerne gelesen habe, sagen wir mal so.Vielleicht noch eine Sache, also er bezieht sich dann auch auf manche der ungewöhnlichen Regeln in der Bibel und eine, die mir dann immer im Kopf geblieben ist.Er sinniert dann darüber. Leute fragen ihn, was ist denn die seltsamste Regel seiner Meinung nach, die in der Bibel steht und er sagt dann, naja, also da steht, dass wenn zwei Männer sich streiten und die Frau des einen dazu kommt, den Streit aufzulösen und dabei an das Gemächt ihres nicht Ehepartners packt, dass man sie umbringen soll.[9:17] Wo er dann darüber sinniert, wie zum Teufel diese Regel aufgestellt wurde.Also es muss ja irgendwie, ob diese Situation mal vorgekommen ist oder ob da irgendeine Angst des Autors hinter steckt, das werden wir wohl nicht mehr klären können.Aber es ist schon interessant, was für Regeln da so drin stehen und wohl auch, wo die herkommen.Er versucht so ein bisschen eingebunden das Ganze, also er hat sich auch als Aufgabe gegeben, mit drei fundamentalistischen Gruppen, die zu besuchen und mit ihnen zu reden, aus verschiedenen Hintergründen.Versucht also auch so ein bisschen journalistisch dran zu gehen, dass er nicht nur diese lustigen Anekdoten hat, sondern auch so ein bisschen über die Geschichte der, ich sag mal, Wahrnehmung der Bibel und wie sie sich so auf die Gesellschaft ausgewirkt hat, eingeht.Also deswegen finde ich, es ist auch so ein bisschen, hat so was Sachbuchmäßiges, auch wenn es überhaupt nicht wie ein Sachbuch geschrieben ist.Insgesamt finde ich, es ist ein sehr amüsantes Buch, auch in gewisser Weise lehrreiches was auch gerade wegen dem Autor so einen gewissen schönen Spirit hat.Genau. Weiß nicht, ob ihr da noch Nachfragen zu habt?[10:45] Nachfragen nicht direkt, aber ich muss natürlich sofort an eine alte Episode denken. So sagt es, dass manche Dinge auch so ihre Funktion haben.Da hat mir, glaube ich, in Episode 10, habe ich ja Alain de Botton’s Religion für Atheisten vorgestellt.Was da vielleicht ganz gut, ganz gut zu passt.[11:00] Ich hätte ein Buch, was ich dazu in den Ring werfen wollen würde.Ich glaube, ich habe das auch schon ein paar Mal erwähnt.Das heißt Keine Bibel von Christian Nürnberger, der quasi da den Anspruch verfolgt, die wichtigsten Kernbotschaften der Bibel relativ modern aufzubreiten, so dass man nicht die ganze Bibel lesen muss und er geht so die wichtigsten Geschichten einmal durch.Und das fand ich ganz lohnenswert zu lesen. Das fand ich ganz gut.Und ich glaube, er liest es relativ modern.Ich glaube, man kann die Bibel auch anders lesen, aber trotzdem gibt es da ein paar sinnstiftende Botschaften, die man mitnehmen kann.Und passt ja jetzt vielleicht auch ganz gut in die Zeit, das Buch.Und lohnt sich auch für Menschen, die nicht christlich glauben.Ja, also wie gesagt, gerade hier das Buch von L.J.Jacobs, egal ob man es jetzt im Deutschen, wie gesagt, da heißt es Die Bibel und ich, oder im Original liest, ist, glaube ich, es ist eine sehr amüsante Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen.So, dann bin ich mit meiner Buchvorstellung zu Ende und würde dann an Christoph übergeben für seine erste Vorstellung heute.
Buch: „Ein Hof und elf Geschwister“ von Ewald Frie
[12:13] Ja, vielen Dank. Ich stelle euch vor ein Hof und elf Geschwister von Ewald Fri.Ewald Fri ist Historiker und hatte auch eine Professur in Tübingen, meine ich.Ja, und das Buch habe ich gehört, glaube ich. Ich glaube, das gab es als Hörbuch auf Spotify. Ich glaube, da habe ich es gehört.Und ich habe es sehr, sehr gerne gehört. Es ist ein extrem gutes Sachbuch.Es hat dieses Jahr auch den deutschen Sachbuchpreis gewonnen und ich glaube, wurde auch in irgendeiner Liste vom NDR ausgezeichnet.Und im Prinzip, ja, also das, was der Titel verspricht, darum geht es auch.Also Ewald Fri hat zehn Geschwister, alle elf Kinder kommen von der gleichen Mutter.[12:54] Und sind also eine sehr große Familie, die auf einem Bauernhof groß geworden sind.Und es geht ein bisschen drum, ja, also das erste Kind wird 1944 geboren und das letzte 1969.Und Ewald Frieff fasst das selber als, naja, es geht halt um die Zeit vom Attentat auf Hitler bis zur Wahl Willy Brandts zum Bundeskanzler.Das ist so die Spanne, die ungefähr umfasst wird. und dann geht es auch noch ein bisschen in die 70er Jahre rein.Und für mich war das Buch insofern spannend, als dass ich da durchaus einen eigenen Familienbezug herstellen kann, weil meine Familie mütterlicherseits auch aus dem Münsterland kommt, genauso wie die Familie, die hier porträtiert wurde.Und das fand ich daran sehr spannend. In den Podcasts im Gänze hat es das Buch nicht geschafft, weil es einfach ein bisschen kurz ist.Also es sind nur 170 Seiten und das hat für die komplette Stunde, würde das, glaube ich, nicht so richtig reichen.Aber genau deswegen hat mich das damals angefixt und deswegen habe ich es gerne gehört.Das Buch hat vier Kapitel. Familie, Bauernschaft und Dorf ist das erste.Dann gibt es die Jahre meines Vaters, die Jahre meiner Mutter und seinen eigenen Auszug aus diesem ganzen Komplex, in dem er groß geworden ist.[14:05] Und das, was in dem Buch deutlich gemacht wird, ist im Prinzip der Abschied vom bäuerlichen Leben als Lebensform.So bezeichnet das Ewald Fri selber. Also es gab eine Lebensform, die eben das Leben auf Höfen und als Bauer, Bäuerin, Familie war.Das gab es einfach ganz verbreitet in der Bundesrepublik.Und der Abschied davon, dass das heute nur noch ganz, ganz, ganz wenige Menschen so leben, der ist recht still und heimlich passiert und wurde so gesamtgesellschaftlich in der Form auch gar nicht so stark reflektiert.[14:39] Das vielleicht so zum Einstieg. In dem ersten Kapitel geht es ganz viel um die Struktur der Familie und um das Thema Dorf-Außenbeziehungen.Also es geht um die Ortschaft Nottullen, in dem das ganze, in dem der Hof angesiedelt ist oder das Dorf in der Nähe ist, eben Nottullen.Und Frieh startet damit zu sagen, naja, für dazu, was Wohlstand war, da war Landbesitz eigentlich damals entscheidend.Und da war gerade auch seine Familie recht gut situiert, war ein großer Hof mit viel Land und dementsprechend hat sich seine Familie auch dem Dorf überlegen gefühlt.Also das Dorf gab’s, weil da eben Kirche, Frühschoppen, Amt und Post waren und später auch das Freibad und das Kino.Aber erst mal war man so ein bisschen eigentlich als Bauernschaft unter sich und als Familie unter sich und hat auch so ein bisschen auf die DörflerInnen hinabgesehen.Die galten als nicht so richtig frei, weil die hatten ja keinen eigenen Hof, nicht so richtig Landbesitz.Und das kippte dann erst später, meint er, als man irgendwann festgestellt hat, naja Besitz ist nicht gleich Autonomie.Also so ein Leben als Bauer, Bäuerin bringt ja auch sehr viel Unfreiheit mit sich, weil man eben an den Rhythmus der Tiere gebunden ist.Man kann nicht in den Urlaub, es sind immer nur kleine Ausflüge möglich und das zeigt sich dann auch in den Lebensgeschichten der verschiedensten Geschwister, die dann eben auch Lehrerinnen, Erzieherinnen, Pharmazeuten wurden oder eben wie Ewald Fri selbst Professor.[16:07] In die Jahre meines Vaters geht es ganz stark darum, wie Rindervieh-Zucht ein großer Stolz sein kann.Also der Vater als Bauer war da sehr erfolgreich, gerade in Westfalen gab es das Buntvieh, also die Buntkühe, wo es dann darum ging, welches Prachtexemplar welche Nachkommen bringt.Und da gab es komplizierte Zuchtbücher.Und der Vater scheint mehrere Preise gewonnen zu haben. Und das ist natürlich dann mit der Industrialisierung oder Massentierhaltung irgendwann gekippt, als es dann irgendwann um künstliche Besamung gab von Tieren und man sich auf irgendwelche, ja nicht mehr quasi lokal irgendwie getourt ist und da irgendwelche Tiere, die anderen begattet haben, sondern dass man das einfach durch Menschenhand quasi durchgeführt hat mit entsprechend.[17:02] Industrieprozessen und großen Filmen, die da ihre Gene quasi vermarktet haben.Genau, und dann in die Jahre meiner Mutter geht es eben ganz, ganz stark um die Rolle der Mutter auf diesem Hof, die für sich als Errungenschaft in der Ehe gesehen hat, dass sie nur Hausarbeit und keine harte Hofarbeit übernehmen musste.Also sowas, was man heute vielleicht als eher unemanzipiert begreifen könnte.Die Frau hat sich eben um alles im Haus gekümmert, war für sie offenbar ein starker Emanzipationsschritt, weil eben ganz viele andere Bäuerinnen, die nicht so wohlhabend waren oder denen es nicht so gut ging, die mussten sich eben auch auf dem Feld platt und kaputt arbeiten oder krumm arbeiten, steht, glaube ich, im Buch.Und das war bei ihr eben anders. Und wie sie quasi die Familie zusammengehalten hat, allen immer vermittelt hat, dass es ein gemeinsames Zuhause ist, zu dem sie auch wieder zurück können, falls ihre Karriereambitionen nicht funktionieren sollten.Das wird da eben auch ganz, ganz stark.Ja, besprochen. Ewald Frie hat für das Buch Gespräche oder Interviews mit all seinen Geschwistern geführt.Also es ist schon mit wissenschaftlichem Anspruch geführt, dieses Buch oder geschrieben.Also er hat sich, glaube ich, entsprechend Interview-Leitfragen-Fäden zusammengebaut und hat die eben mit seinen Geschwistern durchgegangen.Und ja, das finde ich, macht das so sehr spannend.[18:32] Und das, was Fri meint, was ganz spannend ist, ist, dass das Leben damals ihm, dem Mittelalter, eigentlich näher scheint als unserer Zeit.Also gerade in den 40ern und 50er Jahren. Einfach noch harte Handarbeit auf dem Land.Man hat noch mit Flügen gearbeitet, mit Sensen.Alles noch nicht motorisiert. Und das kippt dann eben, ja, so seit Mitte der 60er-Jahre, als dann eine starke maschinelle Prägung einkehrt und dann eben auch das Höfesterben langsam beginnt.Da sind wir dann Anfang der 70er-Jahre mit dem Beginn der Massentierhaltung.Und ja, er zeichnet auch nach, wie wichtig die Einführung des BAföG für ihn und seine Geschwister war, also wie sehr das emanzipiert hat.Und ich meine, das als Bildungsexpansion kennen wir als SoziologInnen natürlich auch. Und da kann man sehr viel bundesrepublikanische Frühgeschichte oder Mittelgeschichte anhand dieser Familiengeschichte nachzeichnen.Und ja, das Leben in den 60er Jahren oder Anfang der 70er Jahre war dann auch schon ganz anders als dieses Leben, was er eben als Mittelalter näher beschreibt, als der heutigen Zeit.Und ich finde, daran sieht man die Rasanz von gesellschaftlichem Wandel sehr gut.[19:46] Ich hatte gerade am Anfang schon mal gesagt, dass die Bauern die Oberhand hatten in diesem Mikro-Gefüge gegenüber den Leuten aus dem Dorf und das kippt dann, aber ja, ursprünglich war es noch so, dass die älteren Brüder nicht zum Fußball durften, das war unter der Bauernwürde, sondern nur zum Reiterverein und das Einzige, was neben Hausaufgaben entledigt werden durfte, also andere Bildungstätigkeiten waren überhaupt nicht möglich, sondern das war dann erst Ewald Frieh, dem das ermöglicht wurde, der galt offenbar sehr früh schon als Sonderling.[20:20] Und so, also er durfte dann aufs Gymnasium und all das, das wurde ihm dann ermöglicht, aber eigentlich eben, ja Bildung war nicht unbedingt angesehen und das ist dann halt irgendwann gekippt.Und so haben wir einen Wandel von so einer stolzen Bauernfamilie mit eben einem beeindruckenden Zuchterfolg bei den Tieren und hohem Prestige hin zu so einer kommunizierten Rückständigkeit.Da geht es dann darum, dass dann auf einmal von, also bei den jüngeren Geschwistern in der Schule gesagt wird, boah irgendwie stinkt ihr nach Hof und Tieren und das, ja auf einmal waren die auch nicht mehr so wohlhabend.Also die gesellschaftliche Entwicklung ist ein bisschen an anderen Stellen passiert und hat da vielleicht Wohlstand gebracht, aber bei ihnen eben nicht.Andere sind in den Urlaub gefahren, das war ihnen eben weiter nicht möglich, solche Sachen. Und auch Kleidung wurde gepflegt, wenig neu gekauft.Und ja, das ist da in gewisser Weise auch ein sozialer Abstieg einfach gewesen.[21:19] Die Schwestern und Frauen widmen sich dann zunehmend der katholischen Kirche und der Jugendarbeit und das ist dann auch ihr Bildungszugang, also in der katholischen Landjugend, glaube ich.Und das ist nochmal ein wichtiger Punkt in dem ganzen Buch.Genau, dass die bäuerliche Lebensform so still und heimlich sich verabschiedet, habe ich schon gesagt, und es eben unterbeleuchtet.[21:46] Ja, und was ich noch ganz spannend fand, ist, dass Ewald Friesig am Ende des Buches fragt, ob seine Lebensgeschichte eigentlich eine Aufstiegsgeschichte ist.Er sagt, na ja, seine Wohnung ist deutlich kleiner als das, was seine Eltern hatten. Er besitzt kein Land und kein Haus.[22:01] Seine Eltern sind zumindest mit hohem gesellschaftlichem Status gestartet, den er dann natürlich jetzt auch wieder hat.Aber ja, auch die Frage des materiellen Wohlstands, die natürlich jetzt bei ihm deutlich höher ist, meint er, naja gut, das ist ja aber ein genereller Fahrstuhleffekt.Also grundsätzlich, keine Ahnung, warme Wohnung, Klamotten, die man sich leisten kann, das betrifft ja einfach sehr viele Menschen.Also er zieht das Fazit eines soliden Unentschieden, was ich einfach ganz interessant finde, weil die Bildungskarriere natürlich enorm ist von Eltern, die vielleicht gerade so schreiben konnten, hin zu er ist Professor.Und das ist sein ehrliches Fazit an der Stelle. Das fand ich schon ganz interessant und kann das Buch nur empfehlen.Ich finde, es ist auch gut eingelesen für diejenigen von euch, die es vielleicht hören wollen.Ja, absolute Empfehlung von mir. Meine einzige Kritik wäre vielleicht, dass dieser Familie in dem Buch quasi alles passiert und die Begründung dafür, warum zum Beispiel eine Maschinisierung einsetzt und warum es dann zu einem Höfesterben kommt, das wird alles nicht so sehr beleuchtet.Also es wird immer nur als Faktum gesetzt, dass es so ist, aber nicht so sehr, was die dahinterliegenden Gründe sind.Und genau bei der Kürze des Buches hätte es dafür sicher noch Platz gegeben, das an ein, zwei Stellen zu ergänzen.Habt ihr Fragen, Anregungen, Ergänzungen?[23:23] Finde ich hat schon eine krasse Aussage, dass jemand der aus dem bäuerlichen Landleben kommt und Professor wird ja auch anscheinend mit entsprechender Professur und Tübingen ist jetzt ja auch nicht irgendeine Uni, dann am Ende zu dem Schluss kommt, dass das eigentlich keine, wenn man mal ehrlich drauf guckt, kein Aufstieg war.Ja finde ich auch. Also das ist ja dieses Argument von Hartmut Rosa, man muss im Grunde aufsteigen, aufsteigen, aufsteigen um irgendwie nicht völlig abzurutschen.Also genau, ob man das teilt von außen, ist sicherlich noch eine zweite Frage.Ich finde, es ist aber auf jeden Fall ein spannender Blickwinkel, der auch einfach klar macht, wie sich auch Bewertungen ändern.Also was als wichtig gesehen ist, was Ansehen bringt, dass das eben nicht so was Fixes ist, sondern was, was sich durchaus mit der Zeit auch verändert.Ja, da bin ich ganz bei euch. Ja, wenn ihr jetzt weiter erstmal nichts habt, dann übergebe ich jetzt für die erste Vorstellung von Amandas Medien an Amanda überraschenderweise.[24:37] Danke Christoph für deine Buchvorstellung. Meins hat es auch bisher nicht in
Buch: „On Food and Cooking“ von Harold McGee
[24:41] den Podcast geschafft, aus dem gegenteiligen Grund.Meines ist nämlich 900 Seiten lang.[24:48] Und zwar handelt es sich um das Buch On Food and Cooking von Harold McGee oder McGee, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht.Und das ist eigentlich so das Koch-Sachbuch, was es so eigentlich gibt.Habt ihr davon, habt ihr schon mal davon gehört?Nein. Noch nicht? Okay. Nee, tatsächlich auch nicht. Ich auch nicht.Es ist, ich finde das nämlich ganz spannend. Also es ist ein Buch, das ist 1984 zuerst erschienen und ist auch ganz in diesem, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das qualifiziert als 80er-Jahres-Stil bezeichnen kann, aber es ist halt wirklich so eine profunde Sammlung von Wissen und mit extrem vielen Details, sehr nüchtern geschrieben, ohne Bilder.Also es gibt Illustrationen, so eher schematische, schwarz-weiß, aber sonst keine Farbbilder darin und entsprechend macht es das Buch einfach extrem reich an Wissen.Also man kann das wirklich so nennen.Und es ist kein Kochbuch in dem Sinne, dass da Rezepte drin wären, sondern es ist eigentlich fast eher so ein historisches, chemisches Abhandlung über alles, was mit Kochen und mit Lebensmitteln zu tun hat.[26:13] Wie gesagt, es sind 900 Seiten und die sind auch, also das Interessante daran finde ich wirklich, dass ich mindestens ein, ich sage mal, Fakt lerne auf jeder Seite, die ich lese.Also es ist wirklich so beeindruckend, was diese Person zusammengetragen hat an Wissen über Lebensmittel und übers Kochen. Ich mache euch mal ein Beispiel.Das Ganze ist in 15 Kapitel eingeteilt. Beginnt dann mit Milch und Milchprodukten, Eier, Fleisch usw.Bis hin zu Süßigkeiten und Alkohol usw.Und nur schon das Kapitel über Eier sind 50 Seiten.In jedem anderen Kochbuch würde ich ein, zwei Seiten erwarten und ein, zwei Fun Facts dazu, wie ein Ei so ist und wie das entsteht.Und Harold McGee macht das einfach so ausführlich. Er beschreibt dann die Entstehung eines Eis in der Henne.[27:14] Und auch das eben nicht mal so schnell, sondern über vier Seiten.Und da wird jede Stunde der Ei-Entwicklung beleuchtet. Also von den neun Wochen, die das Ei zuerst im Ovar der Henne, ja, wo es sich darin noch befindet.Und dann die letzten 25 Stunden ab dem Zeitpunkt, wo das Ei, also das Eigelb, muss man dazu sagen, das Ovar verlässt.Bis es dann am Schluss mit der Kalziumhülle hinten rauskommt.[27:47] Das klingt so ein bisschen amüsant und ein bisschen ein, Das ist ein, wie sagt man, ein Overkill.Aber trotzdem finde ich es als Nachschlagewerk sehr hilfreich.Insbesondere, wenn man einen analytischen Zugang zum Kochen hat und sich klarmachen möchte, wie was funktioniert.Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, liest man ein Rezept und dann steht da eine spezifische Anweisung. Und man denkt sich, ist das wirklich notwendig?Oder wieso steht das da jetzt? Warum muss ich das jetzt kühl stellen oder warum muss ich die Eier, wieso sollten die jetzt frisch sein oder eben lieber nicht so frisch?Und diese Dinge, die klärt er wirklich bis ins letzte Detail einfach auf.[28:34] Ich mag das persönlich sehr gerne. Ich finde, es ist ein absolutes Must-Have für alle Hobby- oder professionellen KöchInnen.[28:44] Und wie gesagt, es gibt einfach so viele Details, die man dann auch, die man heute einfach nicht mehr findet.Ich habe dann so versucht, ein bisschen zu dem Wissen auch über Chatshipiti zu kommen.Einfach als Vergleich, weil es ist schon ein bisschen outdated, jetzt so ein dickes Buch daheim zu haben, weil die Info, die gibt es ja irgendwo schon.Und trotzdem schätze ich einfach immer noch sehr diese kuratierte Form von einfach zu einem Thema, was gibt es darüber, was ist wichtig, was nicht und wo kann man da weiterlesen.Da stehen auch so Sachen drin, dann geht es um Milch beispielsweise und da stehen die verschiedenen Auflistungen von Fett und Proteinen, aber nicht nur von Menschenmilch und Kuhmilch, sondern von Büffelmilch, von Kamelmilch, von Fenwalmilch.Also wirklich die skurrilsten Details sind da drin.Und überhaupt nicht aufgeregt aufgezogen. In vielen modernen Büchern habe ich das Gefühl, dann steht da irgendwie so ein Kasten mit Farbe.Und dann ist das so dieses spezielle Detail, das da hervorgehoben wird.Und bei ihm ist das einfach so irgendwo im Text, irgendwo in der Tabelle.Und man denkt sich einfach so, das muss man ja alles mal zusammengetragen haben irgendwie.Und für die Milch ist übrigens ganz interessant, das habe ich auch jetzt gelernt in der Vorbereitung.[30:07] Beispielsweise hat Kuhmilch doppelt so viel Proteingehalt als Milch des Menschen, also Muttermilch.Und zwar, weil auch zum Beispiel Kühe ihr Gewicht verdoppeln in der halben Zeit als die Menschen.Also Kühe brauchen 50 Tage für die Verdopplung des Gewichts und Menschen oder Babys verdoppen ihr Gewicht in der Regel so nach 100 Tagen.Und das sieht man auch im Proteingehalt der Milch.Das ist tatsächlich doppelt so hoch bei den Kühen im Vergleich zu den Menschen.Der Fettgehalt ist bei vier Prozent bei den meisten. Bei Finwalen sind das 40 Prozent.Also Finwalmilch, das ist schon so halb Butter.[30:59] Ihr merkt schon, ich könnte hier Tausende Anekdoten erzählen aus diesem Buch.Auf die man so stößt, wenn man da durchblättert und sich was anliest.Deswegen kann ich das nicht in einem Podcast vorstellen. Aber ich dachte, ich leg’s euch trotzdem mal ans Herz, falls ihr jemanden kennt oder zu diesen Köchinnen gehört, die ja so einen Zugang schätzen, auch die wissenschaftlichen und historischen Anekdoten zu den Lebensmitteln und zu den Gerichten.Dann ist das definitiv ein Kauf, der sich lohnt.Ja, habt ihr dazu Fragen? – Nee, ich glaube, doch, eine Frage hätte ich.Das heißt aber, das Buch ist auf dem Stand von 1980 oder was auch immer du gesagt hast. – Ah ja, das habe ich nicht gesagt.Genau, es ist 1984 erschienen, wurde dann komplett überarbeitet 2004 und liegt jetzt in dieser Version vor, wenn ich richtig informiert bin.Es gibt wohl jetzt eine deutsche Übersetzung seit einigen Jahren.Ich glaube aber nicht, dass die inhaltlich neu gemacht wurde, sondern ich glaube, es ist 2004, ja, also es ist nicht super neu, gar nicht, aber viele Dinge sind natürlich schon irgendwie so universell gültig.[32:20] Ich glaube, da gibt es weniger Veränderungen, als man so denkt.Ja, wobei so ein paar Kochmythen, ich weiß nicht, ich bin relativ tief in dem YouTube-Sumpf von guten Köchinnen drin.Es gibt schon ein paar Mythen in der Zubereitung, die glaube ich schon nochmal überholt sind.Aber trotzdem ist so ein Standardwerk natürlich cool. Ich hätte ein Buch, was ich da anfügen wollen würde, denn ich finde Kochbücher, die keine Rezeptbücher sind, tatsächlich auch sehr spannend und sehr gut.Und ich möchte euch ans Herz legen das Lexikon der Aromen und Geschmackskombination.Das habe ich hier stehen von Karen Page und Andrew Dornenberg.Es gibt, glaube ich, mittlerweile das auch in der vegetarischen Variante, aber auch die Variante mit Fleisch. Ich esse ja keins, ist absolut tauglich.Zu einfach jeder Zutat, die euch einfällt, findet ihr in dem Buch.[33:14] Ideen wie man das kombinieren kann und was wie gut dazu passt in unterschiedlichen abstufungen also normal geschrieben ist passt gut und dann je fetter und, großgeschriebener und kursiver es ist desto besser wird also Ja das kann ich sehr sehr sehr empfehlen wenn man einfach ohne rezept kochen möchte und aber wissen möchte was eigentlich ganz gut zu der zutat passt die man hat ich weiß nicht wie viel seiten das sind aber sind, Also ich glaube ich habe noch nie irgendeine zutat da drin nicht gefunden, Ja, genau, das kann ich euch mit ans Herz legen.Wir haben tatsächlich die vegetarische Variante dieses Buches und auch irgendwann die fleischhaltige gegen die vegetarische ausgetauscht, weil die natürlich nochmal so ein bisschen differenzierter ist bei den Gemüsen, bei den Kräutern, bei den Gewürzen, auch bei den Fleischersatzprodukten.Also das kann ich tatsächlich auch empfehlen. Ich würde aber auch noch ein Buch auf den Stapel legen.Da hatte ich jetzt fast erwartet, Christoph, dass du das vorstellst.Das ist nämlich Salz, Fett, Säure, Hitze von Samin Nosrat.Es gibt dazu auch eine Netflix-Serie, glaube ich.Die kann man sehr empfehlen. Genau, die Serie ist extrem gut.Wie gesagt, Salz, Fett, Säure, Hitze heißt das Buch. Das ist halt nicht so wissenschaftlich wie das Buch, was Amanda gerade vorgestellt hat.[34:23] Aber bietet sehr schön so die Prinzipien hinter diesen vier ganz zentralen Koch-Elementen.Und da lernt man auch sehr viel fürs praktische Kochen und fürs Rezepte-Sich-Selber-Ausdenken.Es sind halt nicht, wie du auch sagtest, keine Rezepte drin, die man einfach nachkochen kann, aber dafür lernt man halt was übers Kochen.Das vielleicht auch noch als nächste Ergänzung.[34:46] Ja, cool. Ich muss noch zu den Mythen sagen, die du erwähnt hast, Christoph.Harold McGee hat lange Zeit, glaube ich, einen Blog geschrieben in der New York, im New York Magazine, glaube ich, wo er genau das eigentlich macht.Also er guckt sich so Kochmythen an und widerlegt oder bestätigt diese.Und im Buch passiert das schon auch, weil ich habe das vor einigen weil mein Bruder mich was gefragt hat wegen Salzkochen mit Salz im Wasser.Dann habe ich das dort nachgelesen. In dem Buch ist das über zehn Seiten verteilt.Wenn du Gemüse vorher salzt und wenn du das Fleisch, und wenn du es zuerst ins Wasser, dann passiert dies und das.Ich habe sehr viel gelernt, aber es ist nicht so schön konzis oder gesagt, wie man das von so einer Mythos-Wiedergabe hört. Erlegungen erwarten könnte.Aber ich glaube, da ist dieses Buch, was jetzt Nils erwähnt hat, auch sehr gut dafür zu haben.Also dann kann man so aufbauend, kann man sich diese Bücher zulegen, je nachdem, wie detailreich man das möchte.Ja, dann übergebe ich gerne noch dir, Nils, für dein Buch.
Buch: „Maxwell’s Demon“ von Steven Hall
[36:11] Ja, dankeschön Amanda. Wir bleiben weiter im fröhlichen Wechsel der Formate.Bei mir gibt es zwar auch ein Buch, aber tatsächlich ein Roman mit stark philosophischem Einschlag.Auch wieder eine der Gründe, warum es nicht in diesem Podcast gelandet ist, aber wer mein Weltenflüstern hört, hat es da vielleicht schon gehört, nämlich Maxwell’s Demon von Stephen Hall.Gibt es auch in deutsche übersetzung heißt da überraschenderweise maxwells dämon, Ist wie gesagt ein Roman, aber um den Romanteil geht’s mir hier gar nicht.Es geht im Kern um einen erfolglosen Autor, der eigentlich so seinem verstorbenen Vater nachfolgen möchte, der ein sehr erfolgreicher Autor war.Der Vater hat aber irgendwie den Sohn nie so richtig wahrgenommen oder gefördert.Er hatte dann aber so ein, ja, Kompagnon, Ziehsohn, Nachfolger, irgendwas sich rangezogen.Andrew Black, der einen ganz erfolgreichen Roman geschrieben hat.Äh, ne, nicht nur ganz erfolgreich, extrem erfolgreich. danach aber verschwunden ist.Und jetzt bekommt halt die Hauptfigur Jahrzehnte später seltsame Nachrichten von dem Vater und der aber eigentlich schon tot ist. So, das ist ja erstmal so das Setup.Klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Thriller-Plot, aber wie gesagt um die Handlung geht es gar nicht oder das war zumindest nicht das, was mich an dem Buch gereizt hat, sondern es geht ganz stark um eine philosophische Frage, nämlich nach Chaos, nach Ordnung, nach persönlichem Sinn, nach sozialem Sinn, den wir uns irgendwie schaffen und machen.[37:40] Und da werde ich euch jetzt so ein bisschen anhand von Zitaten und so ein bisschen Strukturierung mal durch das Buch durchgeleiten.Ich fand so eine Sache, die auch schön an das Thema anschließt, was wir hier im Podcast ja mal schon hatten mit dem Buch von Samira El-Wassil und Friedemann Karich, den erzählenden Affen, da gibt es jetzt bei Stephen Hall das schöne Zitat. Aber wir sind hoffnungslose Storybuilder.Wir sind schlaue Gedächtnisse, die einen Sinn in den großen Geräusch unserer Erfahrung machen, indem wir Buchende, Selektion, Sortieren, Zischen, Bestellen, Arrangieren und Kontextualisierung in eine klare Liste von Grund- und Effektplotpunkten machen.[38:18] Man ist in dem Buch immer so ein bisschen an der Grenze zwischen, wie wir uns die Welt erklären, wie wir auf die Welt blicken, eben in diesen klaren Kausalbeziehungen, dass das aber ganz viel damit zu tun hat, wie eben auch Geschichten aufgebaut sind und wie wir Geschichten erzählen.So diese Parallele, an der sich das Buch die ganze Zeit lang belegt.Und was er eben auch sehr schön macht, da ging mir als Soziologe dann das Herz auf.[38:43] Dass eben diese Geschichten und dieses Leben, in dem wir leben, halt bei weitem nicht nur irgendwie eins ist, das mit der natürlichen Welt zu tun hat, sondern in hohem Maße irgendwie auch strukturell, sozialstrukturell und sozialen Konstruktionen geprägt ist.Auch da wieder ein schönes Zitat. Is the world you live in every day made more from rocks and grass and trees or from articles, certificates, records, files and letters?Also auch da wieder das schöne Zeichen, ja eigentlich ist so, von dem was uns im Alltag betrifft, das sozial konstruierte fast schon relevanter als so die physische oder in Anführungszeichen natürliche Welt.Ähm, finde ich da einen schönen Punkt.Den vertieft er aber leider nicht allzu sehr. Er geht dann ganz stark so auf den Schwerpunkt eben dieser Geschichte, dieser Narrative, den wir folgen und denen wir auch einfach vertrauen.Ähm, er nennt das dann auch irgendwo praktische kleine Boxen, in die wir die Welt packen können und die uns Orientierung bieten.Also dieses volle Struktur, Komplexität der Welt, die wir irgendwie schaffen, so kleine Kästchen zu packen.Und da hilft uns zum Beispiel die Logik, diese Boxen zu glauben, gerade wenn sie uns erstmal nicht so angenehm stehen. Da gibt es auch schon wieder einen schönen Satz.Sometimes a logical conclusion is so wild, so wonderfully bizarre, that only the fact that it is a logical conclusion allows any sane person to imagine it in the first place.[40:05] Also das sind so diese Brüche im Wissenschaftlichen, also wenn man sich jetzt ein bisschen tiefer auskennen, wenn man so im Bereich Quantenmechanik denkt, wenn man aber auch in so einen Bereich.[40:15] Soziale Konstruktion von bestimmten Dingen reinguckt, die einem auf den ersten Blick völlig unlogisch erscheinen und völlig kontraintuitiv, aber wenn man eben genauer in die Argumentation dahinter guckt, dann alleine die Qualität der Argumentation oder die Schlussfolgerung, die sich ergeben, dann doch einen dazu bringt, ja doch, das kann ich mir irgendwie vorstellen.Das finde ich auch einen schönen Kontrast oder einen schönen Punkt bei dem Thema, wieso glauben wir eigentlich an Wissenschaft, was glauben wir eigentlich der Wissenschaft.Dass das tatsächlich ein ganz großer Schritt ist, in diese logischen Schlussfolgerungen oder wissenschaftlichen Schlussfolgerungen so sehr zu vertrauen, dass wir dann sogar unseren eigenen aktuellen Wahrnehmungen misstrauen, fand ich auch einen schönen Punkt.Aber das ist eben auch das, was dann eben an den Wänden dieser kleinen Boxen irgendwie reißt und rüttelt und die immer wieder kaputt macht.Und das ist eben auch genau das, was der Roman tut.Einerseits auf der Ebene der romanen Handlung, auf die ich jetzt aber gar nicht viel tiefer eingehen möchte und muss und möchte, aber eben auch bei einem selbst als Leserin da so ein bisschen drüber nachzudenken.[41:19] Und dann eben auch diese Kontrolle, die diese kleinen Boxen geben, zu untergraben.Und uns so ein bisschen, dem Leser, der Leserin, so ein bisschen das Gefühl von Kontrolle über das eigene Leben zu nehmen.Was jetzt ja vielleicht auch ein bisschen diffizil sein kann.Auch da wieder ein schönes Zitat.The truth is, none of us has have the slightest idea what we’re in for when we get up in the morning.A phone rings, a shadow dances across a wall, a plane falls out of the sky, a letter arrives out of the blue and, before we know it, the world is a different place.[41:55] Das sind so diese Vorher-Nachher-Momente, die man dann doch vielleicht in seinem Leben auch kennt und wo ich jedem wünsche, dass sie positiv sind, aber wie die Realität halt so ist, sind sie das dann doch oft auch leider nicht.[42:10] Das Buch ist, wie ich schon sagte, philosophisch, geht auch so ein bisschen auf den Zusammenhang zwischen Sprache und Denken ein.Da sind so zwei Zitate, die kurz nach kurz nacheinander auftauchen.Das erste Zitat ist The Word is the Atom of the Mind. Kann man jetzt ein bisschen inhaltlich darüber streiten, aber schön wird es mit dem Zitat danach.Words like atoms are mostly empty.So, diese beiden Zitate zusammengesetzt, finde ich, ergeben eine schöne Aussage über Sprache, über Denken, über Bedeutung, mit die man auch ein bisschen tiefer einsteigen kann.Es gibt da noch einen Begriff, der ganz stark auftaucht.Das ist der Begriff der Entropie. Holger, jetzt musst du mich korrigieren, wenn ich groben Blödsinn erzähle.Aber den hatten wir ja auch schon so ein bisschen im Podcast.[43:01] Der erste Gedanke dahinter, ist glaube ich relativ unstrittig, dass unser Universum, unsere Welt, wie auch immer man es nennen will, in irgendeiner Form von sich aus dem Chaos entgegen strebt, also der Auflösung von Ordnung, dass immer weniger Struktur sozusagen da ist, wenn man nicht Energie investiert, um Ordnung aufrecht zu erhalten.Ja, ich würde noch die kurze Anmerkung machen, dass man wirklich, also im physikalischen Sinne, wirklich Unordnung sagen sollte, weil Chaos im mathematisch-physikalischen Sinne eigentlich nochmal eine dritte Kategorie ist. Okay.Ja, dann versuche ich es Unordnung zu nennen, meiner Sprachlichkeit da angemessen zu sein.[43:44] Und da gibt es einen schönen Satz. The only thing necessary for the triumph of chaos is for the repairman to do nothing.Das ist auch so ein schönes Zitat. Erinnert mich auch wieder an ein Buch, was wir im Podcast hatten, die Innovation Delusion von Lee Vincenzo und Andrew Russell.Der ja auch im Grunde genau das Thema sehr groß und sehr praktisch sozusagen machen, das macht Stephen Hall jetzt hier in seinem Buch nicht.Und dann kommt er eben auch wieder genau mit dieser Analogie, die ich gerade hatte.Einerseits wir als Menschheit, die wir sozusagen unser Leben oder unsere Welt verstehen, irgendwie mit viel Energie in eine gewisse Struktur, in einen Orden bringen.Aber dass das im Grunde auch genau das ist, was AutorInnen tun, die eine Geschichte erzählen.Also weil auch eine Geschichte ist halt im Grunde irgendwie in Ordnung gebracht.[44:33] Und da schreibt er oder sagt er jetzt noch ein bisschen was über das Schreiben, auch da wieder ein Zitat.Good stories seem to just work, but they are actually made to work by the artfully concealed application of a shitload of time.Eine Narrative, fast verloren zu Chaos und Entropie, nur um mirakulös gerettet und in den letzten Kapiteln ausgesucht zu werden, aufgrund eines strukturell rettenden, ordnungspflichtigen Zwischensatzes.[45:21] Wo er dann noch hingeht, das ist dann aber auch der letzte inhaltliche Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist im Grunde so ein bisschen, wie wir jetzt mit diesen Geschichten umgehen.Und da fange ich mal mit einem Zitat an und ordne das danach so ein bisschen ein.He’d called hyperlinks atom bombs, punching great toxic holes into texts, collapsing their structures, leaving them bleeding focus, logic, fact and sense.Er sagte, dass ohne eine ledige Schutzmasche oder eine einfache Papierseite alle Narrativen Korruption und kankerlose Mutationen entstanden hätten, mit Gott-weiß-was von anderen Geschichten und Texten, die in und aus leuchten.Er sagte, dass diese Spirale von Pollution und Diffusion nur zu einer Verlust der Ordnung, Struktur und Funktion führen könnte.Erhobener Chaos, erhöhter Verschleiß und letztendlich ein total entropischer Verlust.Nicht zu sehr auf die Goldwaage legen, aber das ist, glaube ich, ein schöner, ich weiß nicht, ein schöner, aber ein spannender, vielleicht auch ein bisschen beunruhigender Gedanke, mit dem ich aus der Vorstellung hier rausgehen möchte.Wer da ein Buch Interesse hat, es liest sich wie ein komplexer Roman oder ein sehr, oder ein eher einfaches philosophisches Buch, irgendwie so an der Grenze.Wer darauf aber Lust hat, findet da sicherlich viele spannende Inspirationen, Gedanken und Ideen.[46:45] Habt ihr dazu Punkte, Anmerkungen, Gedanken?Ja, einmal den Gedanken, den du ja auch selber gerade schon genannt hast, dass man immer so ein bisschen aufpassen muss mit so den literarischen Bildern über Naturwissenschaft, weil die natürlich, wenn man jetzt zu sehr ins Detail geht, dann findet man da natürlich immer irgendwelche Sachen, die da nicht so ganz passen.Ich hatte noch einen zweiten Gedanken.Es hat mich irgendwie ein bisschen an Terry Pratchett erinnert. Ja.Weil der ist ja auch sehr gut da drin so, ich sag mal, philosophische Gedanken auch so ein bisschen in seinen Büchern mitzuverpacken, also, oder war, er ist ja leider schon verstorben, hatte auch viele, viele Anspielungen auf so Wissenschaft, moderne Wissenschaft, was er da so gelesen hat.Und er hat auch diesen schönen Ausspruch, ich glaub der ist auch von einem Charakter, den hat er aber auch so manchmal in Interviews gesagt, wo er gesagt hat, der Mensch ist das, wo der, ich hab’s immer noch auf Englisch gehört, aber ich versuch’s mal grad ad hoc zu übersetzen, wo der aufsteigende Affe den fallenden Engel trifft. Ah ja.[47:58] Und irgendwie fühlt ich mich eben so ein bisschen daran erinnert, an dieses Bild.Ich glaube aber tatsächlich, also ich bin voll bei dir, dass hier, dass Stephen Hall weniger literarische Bilder auf Naturwissenschaft anwendet, sondern eher naturwissenschaftliche Bilder auf literarische Themen.Nein, nein, nein, das meine ich, aber es ist halt immer so ein bisschen das Risiko, wenn man das naturwissenschaftliche Bild anwendet, passt das auch nicht immer so ganz.Auch vielleicht deswegen, weil die meisten Autoren dann auch nicht die Tiefe der naturwissenschaftlichen Dinge durchdrungen haben.Also ich hatte jetzt bei dem Buch, hat mich das nicht so angesprungen, wie es das sonst oft tut, aber ich bin erstens auch nicht so tief im naturwissenschaftlichen drin.Ähm, aber es ist, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, das ist völlig klar.Ja, nur weil ich jetzt schon beim ganzen Thema Entropie, Chaos, Unordnung jetzt in meinem Kopf schon wieder rumschwört, was da genau die Unterschiede sind, unter welchen Bedingungen das eigentlich gilt, unter welchen vielleicht nicht, und das ist natürlich dann …Aber er schildert zum Beispiel auch Maxwell’s Demon relativ detailliert und irgendwie Experimente, die es dazu gab, wie das irgendwie gemacht wurde und wie das widerlegt wurde. und so, also nicht widerlegt wurde, wie damit umgegangen wurde.Das ist schon also auch auf der Hinsicht glaube ich spannend und ich glaube es ist deutlich fundierter was das angeht als viele andere Bücher, die mit denselben Bildern arbeiten.Wie gesagt, schaut es euch, wenn ihr Interesse habt, einfach mal an.[49:24] Wenn von den anderen keine Fragen, keine Punkte kommen, übergebe ich direkt weiter an Holger für die zweite Vorstellung.
Podcast: „The Sceptics Guide to the Universe“
[49:38] Das passt auch ein bisschen zu dem, was ich gerade noch so als Kommentare hatte.Ich möchte einen Podcast vorstellen.Man könnte sagen, ein wahres Urgestein des Podcastens, dieses Podcast gibt es nämlich schon seit 2005.Das ist so in etwa die Zeit, wo ich überhaupt angefangen habe, Podcasts zu hören, auch wenn es noch ein paar Jahre gedauert hat, bis ich dieses Podcast gefunden habe. Und das Podcast heißt The Skeptic’s Guide to the Universe.Hat inzwischen auch, ich glaube, zwei Bücher hervorgebracht.Also vielleicht begegnet man dem irgendwann auch nochmal ausführlicher im Podcast, aber, also in unserem Podcast.Es soll mir aber generell darum gehen, diesen Podcast vorzustellen.Also, wie gesagt, es gibt es seit 2005, erscheint jede Woche, also immer samstags, das hat inzwischen auf, also Stand heute, 14.Dezember 2023 auf 961 Folgen gebracht, also schon eine gute Menge an Stoff.Ist hervorgegangen aus der amerikanischen Skeptikerbewegung, wo man dann jetzt vielleicht nochmal sagen muss, was das denn genau ist.Das ist also eine Bewegung, die versucht, gegen Pseudowissenschaften, gegen Aberglaube.[51:04] Anzugehen und kritisches Denken und in diesem Zusammenhang auch die, ja insbesondere die Naturwissenschaften, aber generell die Wissenschaften zu fördern.Genau, also vom Format ist es so, es gibt eine Gruppe, ein Team, also es gibt den Hauptmoderator, das ist ein, wenn ich mich gerade nicht täusche, ein Medizinprofessor und der hat also ein Team, das sind irgendwie zwei seiner Brüder plus noch zwei andere Moderatoren, Co-Moderatoren, die sich immer über verschiedene Themen austauschen.Also es hat im Laufe der Jahre ein bisschen, auch hin und wieder mal so ein bisschen im Format gewechselt, so wie es im Moment ist, ist es, dass in der Regel am Anfang so ein bisschen, so ein bisschen einfach Banter ist, also einfach so ein bisschen sich austauschen über was, was gerade so im Leben der, des Teams passiert.Und dann wird in der Regel stellen verschiedene Mitglieder des Teams verschiedene, verschiedene Themen vor.Das sind oft einfach wissenschaftliche, also interessante wissenschaftliche Erkenntnisse, die also in der letzten Zeit passiert sind.[52:28] Teilweise auch mit einem Bezug dann konkret zu skeptischem Denken oder kritischem Denken, also klar, wenn es irgendwie eine sozialwissenschaftliche Studie gibt über bestimmtes menschliches Verhalten, dann ist das natürlich immer was, was da gerne genommen wird, aber es sind auch viele Physikthemen dabei, Materialwissenschaften, also im Grunde so alles, was man irgendwie in so einem guten, so Scientific American oder sowas finden könnte.Hin und wieder wird es auch noch ergänzt durch Interviews mit Gästen zu verschiedensten Themen, in der Regel auch eher mit einem wissenschaftlichen Hintergrund.In der frühen Phase des Podcasts haben sie auch hin und wieder mal Interviews gemacht mit jemandem, der irgendwie eine Pseudo-Wissenschaft vertreten hat, um danach dann unter sich zu diskutieren, wo denn der Denkfehler ist.Das ist auch, wie ich dieses Podcast als erstes gefunden habe.Da hatte ich nämlich ein Video auf YouTube gesehen, was die Theorie der wachsenden Erde vorgestellt hat.[53:36] Und irgendwie war mir klar, dass das nicht sein kann, aber ich hatte irgendwie, hatte es für meine Gedanken damals nicht so richtig sortiert.Bin dann auf dieses Podcast gestoßen, wo dann der Hauptvertreter dieser Theorie zu der Zeit, der auch das Video gemacht hat, interviewt wurde und sie dann also so auch ein freundliches Interview gemacht haben, aber durchaus mit kritischen Fragen, aber ohne irgendwie böswillig zu sein und danach noch mal ein bisschen unter sich diskutiert haben, wo denn so die Denkfehler liegen.[54:07] Und das ist auch eine Sache, die immer wieder durchkommt. Ähm, dass immer wieder, dass auch so ein bisschen nebenbei man einfach so ein bisschen das kritische Denken mitbekommt, wie man da rangeht.Also, manchmal wird es auch noch mal explizit erklärt.Also, auf, auf, äh, Leserzuschriften oder auch hin und wieder einfach mal so als Spiel, was denn bestimmte logische Fehlschlüsse sind, die man so machen kann.Ähm, und …Das ist also was, also eine einzelne Folge wird einen da jetzt nicht dazu bringen, dass man ein super kritischer Denker ist, aber wenn man das ein bisschen regelmäßiger verfolgt, dann ist das sozusagen nochmal ein Abfallprodukt, würde ich sagen, dass man immer mehr lernt, wie man denn auch kritisch über Dinge nachdenkt, wie man auch Themen diskutiert.Genau.[55:01] Das wäre soweit meine Vorstellung.Vielleicht noch anmerkenswert, das hängt also zusammen mit einer solchen Skeptiker-Vereinigung, die in Neuengland in den USA sich befindet.Die Sie organisieren auch Tagungen, teilweise auch online, jetzt seit Corona.Haben auch einen YouTube-Kanal, wobei ich den Podcast deutlich spannender finde, als das, was sie sonst noch so haben.[55:39] Genau. Und wie gesagt, haben auch schon zwei Bücher hervorgebracht.Vielleicht werde ich an irgendeinem Punkt auch nochmal eins davon vorstellen.[55:50] Gibt es von eurer Seite erstmal Anmerkungen oder Fragen dazu?Vielen Dank erstmal. Ja, danke. Sorry, was war zu sagen, Holger?Genau, eine kleine Sache noch einfach, dass man das einschätzen kann.Also eine Folge ist zumindest jetzt auf dem aktuellen Stand in der Regel irgendwie zwischen anderthalb und zwei Stunden, Also meistens würde ich sagen so ein Dreiviertelstunden lang.[56:19] Ich möchte dazu nur ergänzen, Hoke Siller, den, ich glaube, ja, kann man glaube ich so sagen, den skeptischen deutschen Podcast, der sich der Skeptiker-Innenbewegung verschrieben sieht, ja, die beschäftigen sich viel mit so Legends, ja, Medien, Kultur, Wissenschaft.Eine Folge ist da auch irgendwas zwischen einer Stunde und zwei lang.Ich persönlich höre den gar nicht so viel, aber ich finde, er sollte an dieser Stelle erwähnt werden.Ja, also den kenne ich auch. Ich würde sagen, The Skeptic’s Guide, A, gibt es natürlich, glaube ich, schon länger.Und ich finde die, also das Format ist noch mal ein bisschen anders, also es ist auch viel Wissenschaftsnachrichten, mehr als bei Hulk Silla, soweit ich das jetzt gerade aus dem Gedächtnis sagen kann.[57:08] Genau, also vielleicht einfach ein bisschen anderer Schwerpunkt.Ich habe so bei Hulk Silla den Eindruck, dass die dann wirklich noch stärker, auf dieses kritische, also sozusagen darauf gehen, wo liegen irgendwelche Hoaxes, was sind Dinge, also was ist Pseudo-Wissenschaft und der Ansatz von The Skeptic’s Guide to the Universe ist so ein bisschen andersrum, also es ist sehr viel zeigen, wie denn richtige Wissenschaft läuft, also durchaus auch nicht unkritisch, also so Themen wie Replication Crisis oder sowas sind da auch durchaus bekannt.Und kommen halt hin und wieder auch mal wieder auch mal vor, aber sozusagen positiv zeigen, wie denke ich kritisch über Sachen.[57:50] Und in so einer Folge, würde ich sagen, ist meistens mehr Wissenschaftsnachrichten als kritisches Denken, also als Pseudowissenschaft kritisieren, sagen wir es besser so.Also es ist so ein bisschen mehr der Ansatz, das andersrum zu machen.Insofern kann sich das natürlich dann sehr gut ergänzen.Ja, wenn, ich weiß nicht, ob es sonst noch Anmerkungen gibt von eurer Seite?Von mir nicht. Ja, dann würde ich auch weitergeben an Christoph.[58:31] Vielen Dank. Ja, jetzt kommen wir zur größten politisch-wissenschaftlichen Monatszeitschrift
Zeitschrift; „Blätter für Deutsche und internationale Politik“
[58:38] im deutschsprachigen Raum. Ich möchte euch die Blätter für deutsche und internationale Politik vorstellen.Die erscheinen seit 1956 und ich habe sie seit, keine Ahnung, irgendwann in meinem Bachelorstudium, also sowas wie 2013, 14 in verschiedenen Abständen immer wieder abonniert gehabt und jetzt habe ich sie seit Jahren dauerhaft abonniert.Die erscheinen im Eigenverlag und sind damit unabhängig und verstehen sich als Forum für aktuelle politische Diskussionen und dem würde ich soweit auch zustimmen und haben dabei den Anspruch, Wissenschaftlichkeit mit politischer Intervention zu verbinden.Also was ich an der Zeitschrift sehr schätze.Es sind sehr fundierte Artikel, die vielleicht nicht auf dem Niveau von, oder nein, sicher nicht auf dem Niveau von wissenschaftlichen Papers Quellen zitieren, aber immer ein Quellenverzeichnis am Ende haben.Und so kann man dem, was da gesagt wird, ein bisschen auf den Grund gehen.Und es ist nicht alles so nur Meinungsjournalismus.Ja, ein Heft hat 128 Seiten, immer, jedes einzelne Mal, wobei mir das auf meinem Kindle nicht so auffällt.Also erscheint auch digital. Und die haben mittlerweile 13.000 AbonnentInnen, schreiben sie, und eine Auflage von 13.500 in der gedruckten Variante.[1:00:01] Ja, ich gebe mal vielleicht die… Also ich finde es schwierig, eine Zeitschrift vorzustellen, aber ich habe mir vorher überlegt, wie mache ich das?Und die haben so vier Phasen der Selbstkategorisierung, also der Genese ihrer Zeitschrift.Und die dachte ich, gehe ich einfach mal mit euch durch, damit man weiß, wo sie dann am Ende herkommen.Also sie sagen, sie sind eigentlich, ja, aus so einer, also sie kommen aus so einem bürgerlichen Anspruch.Und das scheint ein feststehender Begriff zu sein, den ich gar nicht so kenne.Also sie waren neutralistisch ausgerichtet, so hieß das wohl damals.Und dabei ging es darum, ja, die deutsche Einheit im Prinzip in einer Zeitschrift zu, abbilden zu wollen, jenseits jeglicher Blockbindung, also weder DDR noch BRD bezogen.Und zum Staat hatten die einen sehr breiten Herausgeberkreis, also da waren Leute aus der Bayernpartei, von der CDU und auch Mitglieder von linken Verlagen mit drin, unter anderem dann später auch noch Robert Scholl, also der Vater von Sophie und Hans, also wirklich ein sehr breites Bündnis und die Blätter werben immer mit dem Ausspruch, dass sie eine Insel der Vernunft in einem Meer von Unsinn seien.Das kommt von dem Theologen Karl Barth und eben aus dieser Anfangszeit.Und dann, ja, das ist so die erste Phase und ab Mitte der 60er Jahre, ausgehend von den Ostermärschen und der Bewegung gegen den Atomtod.[1:01:27] Wurden die Blätter dann zu einem, ja, doch recht wichtigen und einflussreichen Organ der bundesrepublikanischen Linken.Der Bayern-Kurier hat damals sogar getitelt, dass sie das Zentralorgan der APU, also der außerparlamentarischen Opposition sein und sie hatten eine Nähe zur DKP, erschienen im Paul-Rugenstein-Verlag, der teilweise aus der DDR finanziert wurde.Also das ist ein nicht so rühmliches Kapitel, muss man einfach sagen, also da gab es schwierige Phasen.Und dann so ab 89, da hat sich abgezeichnet, dass besagter Verlag, in dem die Blätter damals erschienen, insolvent wurde und die damalige Redaktion hat die Zeitschrift dann in die Eigenständigkeit überführt.[1:02:12] Und ja, so seit den 1980er Jahren verstehen die RedakteurInnen sich dann auch als Adenauerische Linke, was ich einen schönen Begriff finde, also die die Westbindung stark begrüßten und sich dann eben auch stark an Werte der westlichen Moderne gebunden fühlten so vielleicht.Also man hat so eine insgesamte Annäherung an linksliberale Kräfte.Zu dem Zeitpunkt wird dann unter anderem auch Jürgen Habermas für den Herausgeberkreis gewonnen und der ist es immer noch.Ja und dann gibt es eine vierte Phase so ab 2003, 2004.Da ziehen die dann aus dem schönen Bonn ins schöne Berlin und es gibt auch einen generationellen Umbruch bei den RedakteurInnen.Ich glaube der bekannteste Redakteur jetzt gerade dürfte Albrecht von Lucke sein.Die Geburtsjahre von einem Redakteur sind so 67 bis 79. Ich glaube, es ist mittlerweile ein fünf- oder sechsköpfiges Team.Zu dem Zeitpunkt gibt es dann auch einen Digitalisierungsprozess.Ich habe ja gerade schon gesagt, ich lese das Ganze digital.Die gedruckten Varianten sind aber auch sehr, sehr schön. Also die werden hier bei mir im Haus auch mehrfach abonniert und wenn ich die immer mal sehe, finde ich die auch ziemlich gut.Es gibt auch kompletter Podcast mittlerweile, in dem jede Ausgabe…Einmal besprochen wird. Also es gibt so einen Grobüberblick über die Themen, die da verhandelt werden.[1:03:31] Ja, die Aufteilung einer Blätterzeitschrift ist im Prinzip auch immer gleich.Also starten tut jede Ausgabe mit einer Rubrik namens Kommentare.Die sind nicht so lang und eben ein bisschen pointiert und eben auch durchaus mit Meinung versehen. Und ich habe einfach mal die aktuelle Ausgabe angeguckt und geguckt, was es da so gibt.Ich zähle nicht alle Artikel auf, aber doch einige, damit man vielleicht so ein bisschen einen Überblick bekommt.Also der erste Kommentar in der aktuellen Ausgabe ist Israel Palästina, das doppelte Trauma.Dann gibt es nochmal was zu Gaza, keine Perspektive ohne internationales Engagement.Dann was zur Wahl in der Schweiz. Da steht nämlich Schweiz Doppelpunkt, rechts gleich normal, also eine Normalisierung rechter Position in der Schweiz.Ich weiß nicht genau, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber ja, ist da ja einfach ein Problem.Vielleicht kann Amanda im Anschluss zwei Sätze dazu sagen.[1:04:29] Und dann geht es nochmal um Polen, zurück zur Demokratie, aber wie.Was ich bei den Blättern aber immer gut finde, es gibt auch starke internationale Fokus.Also Also einmal geht es um Indien, also um Modi’s Vision von Indien, inwiefern das Indien zum Verhängnis werden könnte.Und sie haben auch einen starken Blick auf Lateinamerika, was ich gut finde, weil das eine Region ist, die in meinen Augen eher unterbelichtet ist im deutschsprachigen Raum.Da gibt es jetzt einen Kommentar zu Venezuela.Im Anschluss an die Kommentare gibt es immer ein Stück der, das heißt, Debatte, wo es einfach, ja, es sind einfach sehr, es sind eben Debattenbeiträge.Es gibt auch immer wieder Debattenbeiträge, die sich auf vorangegangene Artikel aus den Blättern beziehen.Also da sieht man, dass auch eine gewisse Breite in den, ich würde insgesamt sagen, linksliberalen Positionen vertreten wird, wo dann tatsächlich auch miteinander diskutiert wird.Es gibt eine Kolumne, die läuft dieses Mal unter die Ökonomie der Frauen und dann würde ich sagen, das Kernstück von den sind, aber die ausführlichen Analysen und Alternativen, wie das dort heißt.[1:05:44] Da wird diesmal ein längerer Artikel, da finde ich dann eben die Quellenverweise auch sehr wichtig.Da gibt es einen Artikel diesmal, der heißt Im Strudel der Wut, der Krieg in Gaza und die Neuordnung im Nahost von Jörg Armbrüster.Dann gibt es einen Artikel von Salman Rushdie in der aktuellen Ausgabe, Der Frieden in einer Zeit der Lügen, warum wir die freie Rede verteidigen müssen.Und dann gibt es noch ein Artikel von Gaulinier Artaille, die Wahrheit muss an den Tag, was die 89er-Revolution mit Iran und Nahost verbindet.Also ja, da jetzt gerade aktuell ein sehr nachvollziehbar eben einen starken Nahost-Fokus.Also man sieht schon eine gewisse Orientierung am aktuellen Politgeschehen, aber dadurch, dass die nur monatlich erscheinen, habe ich immer das Gefühl, es ist ein bisschen Tempo rausgenommen. Und so hat sich eben Zeit genommen für etwas tiefere Analysen.Es ist nicht ganz so in der Hast des täglichen Journalismus verfasst, was ich sehr gut finde, ohne dass man thematisch gar keine Alltagsanbindung hat und völlig Themen ohne Kontext, ohne aktuellen bespricht.Ja, und dann gibt es am Ende immer noch eine Kategorie, die heißt Buch des Monats.Da wird eben ein Buch vorgestellt. Ja, und die heutige Ausrichtung, da verstehen Sie sich selbst als aufgeklärte linke Position, da würde ich mitgehen.[1:07:04] Tendenziell sehr unaufgeregt, aber trotzdem mit politischem Anspruch geschrieben.Und ich würde sagen, es gibt, ja, was auch noch ein wichtiger Fokus ist, ist ja einfach Kapitalismuskritik mit Tendenz zu Postwachstumspositionen.Da würde ich mich jetzt mal so aus dem Fenster lehnen, dass man das so sagen kann.Ja, das zu den Blättern für deutsche und internationale Politik.Ich kann sie euch sehr empfehlen. Sie haben auch immer wieder Probeabos als Angebot und so. Also, wenn ihr nur mal reinlesen wollt, geht das.Auch, wie gesagt, wenn ihr mal ein Gefühl dafür haben wollt, dann lohnt auch der Podcast, um da reinzuhören, um mal zu wissen, ob das was für einen sein könnte.Und ich mag einfach dieses Einschritt zurücktreten, und aus der Perspektive einen Blick auf die Welt entwickeln, ohne aber völlig den Tagespolitbezug zu verlieren und eben den internationalen Blick auf Regionen in der Welt, die nicht in der deutschen Presse sonst so stark vorkommen, den schätze ich auch sehr.Gibt es was, was ihr dazu loswerden wollt?[1:08:14] Also ich kenne die Blätter nicht, aber ich habe immer mal wieder in Podcasts, ich höre, kommt auch allbrecht von Lucke immer vor.Insofern habe ich da dann gewissen Bezug und ich denke ein breiterer Blick als das, was man normalerweise so in den Medien hat, das ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Sache zu haben.Also ich lese sie tatsächlich auch unregelmäßig, ich würde auch gar nicht mal so sehr sagen, dass es die Breite des Blickes ist, auch wenn die natürlich ein bisschen breiter ist, dem neuen ist auch was, über Venezuela zum Beispiel ein Artikel, und es ist tatsächlich die Tiefe und die Unaufgeregtheit und auch die Differenzierung in den Artikeln, die da oft einfach, ja so ein bisschen den Stress rausnimmt aus dem Nachrichtengeschehen, auch wenn die Artikel schon teilweise echt lang sind und ja schon auch manchmal archtrockengeschrieben, so ne. Finde ich auch.[1:09:07] Ja genau, das ist glaube ich dieser Spagat, weil es eben einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch gibt und der ist im Deutschen eben nicht verbunden mit einer besonders illustren Sprache.[1:09:19] Ja, jetzt würde ich aber an Amanda abgeben und deinen zweiten Medieninhalt.Ja danke, ich mache noch kurz einen Kommentar zu deinen, zu den Blättern.Ich habe die auch abonniert, ich lese die auch regelmäßig und mag genauso wie du auch den Blick mal so ein ein bisschen über den Kontinentalrand hinaus.Muss aber sagen, was mir hier fast noch besser gefällt, ist Le Monde Diplomatique, was noch wirklich noch viel eine internationalere Ausrichtung hat.Natürlich schon so mit linker Schlagseite.Aber da finde ich, ja, da lese ich immer wieder über Länder, die ich sonst einfach nicht auf dem Schirm habe.Le Monde Diplomatique ist wirklich auch sehr, sehr gut, das stimmt.Ich weiß nicht wie die bei euch verlegt wird.Bei uns gibt es die zusammen mit einer, also man kann die einzeln abonnieren, wird aber mit der TAZ zusammen verteilt.Ich weiß nicht wie das bei euch ist.Hier auch. Also ich habe jetzt letztendlich erfahren was der Rhythmus ist.Immer am zweiten Freitag im Monat liegt die Le Monde Diplomatique der TAZ am Freitag bei.Okay, sorry, bei euch ist die Taz, bei uns ist die Wots, ja, aber das ist, dann ist das das ähnliche Modell wie bei uns.[1:10:38] Ja, ich mache eigentlich in sehr ähnlichem Sinne weiter.
Online-Magazin: „Republik.ch“
[1:10:42] Ich habe mir auch überlegt, so jetzt die Blätter zu nehmen und vorzustellen, habe dann aber gedacht, ich bleibe in der Schweiz und nehme ein Magazin von hier, Das heißt Republik, ist ein Online-Magazin, also republik.ch.[1:11:00] Und ja, wurde crowdgefundet im 2018 gegründet und ist leserfinanziert.Also ich glaube, es ist genossenschaftlich auch organisiert und hat unterdessen so ein 28.000 LeserInnen, die werden dann auch immer als VerlegInnen angesprochen und wie gesagt nur online verfügbar.Die Republik veröffentlicht jeden Tag ein, zwei, drei Artikel ungefähr und ich finde auch, dass das eines der besten journalistischen Medien ist, dass ich regelmäßig lese und das im Moment hier zur Verfügung steht.Einerseits ist das natürlich bedingt durch die Unabhängigkeit, also dadurch, dass es leserfinanziert ist.Es gibt keine Werbung und so weiter und so Was ich aber auch sehr toll finde, sind die unterschiedlichen Formate, die die Republik anbietet.[1:12:15] Da gibt es beispielsweise das Format, also man muss so sagen, es gibt verschiedene Arten von Artikeln, und die werden dann so gruppiert, und eine Art von Artikeln, die nennt sich Format, Das ist dann so ein gewisses Thema oder eine gewisse Form, die dann da bedient wird.Dann gibt es Kolumnen, das ist halt, ja, wie man es kennt, eine Person schreibt regelmäßig über ein Thema.Da hat zum Beispiel Sibylle Berg hat eine Kolumne in der Republik geschrieben, die heißt Berg’s Nerds.Also auch, ich glaube, sie hat das Buch, irgendwas mit Nerds heißt, heißt ihr Buch, was vor ein paar Jahren erschienen ist.Ich weiß gerade nicht mehr. Also in diesem Zusammenhang hat sie dort auch eine Kolumne veröffentlicht.Eine andere Form sind Serien, also wenn ein Thema eben nicht nur in einem Artikel abgehandelt werden kann, dann wird das manchmal auch aufgeteilt und dann wird ein Thema über verschiedene Artikel verteilt.[1:13:28] Ein Format, was mir gefallen hat, ist Ich hab mich getäuscht.Da haben AutorInnen ja über einen Sachverhalt geschrieben, den, wo sie selbst sich reflektiert haben und dann halt sich selber infrage gestellt hat und auch vorgestellt haben, was sie jetzt eigentlich, wie sie anders über etwas denken.Beispielsweise gab es einen Artikel darüber, wie eine Person, die hier den Militärdienst nicht gemacht hat, sondern den Zivildienst und auch sich politisch gegen die Wehrpflicht eingesetzt hat, wie sie dann mit Beginn eigentlich des Ukrainekriegs so ein bisschen in dieser Ansicht eigentlich gekippt ist.Und das finde ich ganz spannend, weil das sind so, ja, das liest man ja nicht einfach so oder man muss ja wie auch ein Format finden, wo man genau diesen Kippmoment darstellen kann und das finde ich schön, dass das dort ein Gefäß gefunden hat.Ganz grundsätzlich sind die Artikel, finde ich, haben eine sehr angenehme Länge, also die sind in der Regel so fünf Minuten mindestens lang, aber auch zum Teil 20 Minuten oder länger.[1:14:50] Und es gibt es jetzt neu auch als Audio, also jeder Artikel wird als Audio veröffentlicht und zwar eingesprochen von SprecherInnen professionell, was ich sehr cool finde, dass man sich das auch so anhören kann.[1:15:08] Ja, und ein weiteres, finde ich, sehr großes Plus ist, und ich glaube.[1:15:16] Das Magazin wurde dafür auch schon ausgezeichnet, ist die Interaktivität oder die Zusammenarbeit oder das In-Dialog-Treten mit der LeserInnen-Schaft.Und auch da gibt es wie eigentlich zwei unterschiedliche Formate.Das nennt sich einerseits gibt es die Debatte. Da kannst du als AutorIn eine Frage zu deinem Artikel eigentlich eröffnen oder, ich sage Thema eröffnen und da kann man darüber diskutieren und du bleibst als Autorin auch immer da ein bisschen mit dabei und kannst dich da auch einbringen in die Diskussion.Und das Zweite, das nennt sich Dialog, das ist so was man auch von Zeitungen und Online-Formaten generell kennt, also einfach die Kommentarspalte eigentlich.Aber auch dort, also mit sehr klar definiertem Kodex, was man wie, wo schreiben soll.Man muss sich auch anmelden im Sinne von nicht, also man kann natürlich seinen Namen nennen, Man kann aber auch anonym seinen Kommentar verfassen, aber muss immer eine Rolle angeben.Du kannst nicht einfach drauf loskritisieren, sondern du musst sagen, ich spreche jetzt in der Rolle von so und so.[1:16:39] Und dann deinen Kommentar so verfassen. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich da zum Teil von Tageszeitungen oder so die Kommentarspalten ließ, spätestens nach dem dritten Kommentar, dann driftet es ab in irgendwelches gehässiges Hick-Hack.Und das ist dort nicht der Fall. Und ja, zum Teil auch wirklich gewinnbringend zu lesen, finde ich.[1:17:06] Ja, das finde ich so die speziellen Dinge an der Republik.Eine Leserin hat das, finde ich, ganz schön zusammengefasst.Da ging es um einen Beitrag zur Medienförderung und Gesetz, das wir in der Schweiz diskutiert haben.Und sie sagt ja, die Republik liefert zwar nicht das tägliche Brot, wohl aber das Salz in der Suppe.Und ich fand das ganz schön, weil es eben nicht so eine klassische Tageszeitung ist, sondern zwar täglich Artikel publiziert werden, aber die schon auch teilweise sehr gut recherchiert, sehr fundiert sind, aber eben so diese Lücke überbrückt, was wir jetzt von den Blättern gehört haben oder was wir uns von der Tageszeitung oder vielleicht von einem Newsfeed erwarten.Ich glaube, da liegt die Republik genau dazwischen.[1:17:58] Ja, habt ihr dazu Anmerkungen?Ja, ich hätte direkt eine Frage. Es ist dann aber sehr auf die Schweiz bezogen oder gibt es auch internationalere Themen?Ja, das ist ein guter Punkt. Es ist schon zum Teil sehr, also es hat viele Artikel, die sich natürlich explizit auf die Schweiz beziehen.Genauso viele aber, die jetzt nicht explizit einen Bezug haben.Das ist, ich finde, man kann das dem Titel relativ einfach entnehmen, worum es jetzt gerade geht oder ob es jetzt sehr, na ja, nur Schweiz-spezifisch ist.Was auch ganz eigentlich cool ist, ist, die Artikel sind frei verfügbar, also man muss nicht Mitglied sein, um die lesen zu können.Wenn man einen Link geteilt bekommt, dann kann man den lesen, also die Artikel kann Was man sich sozusagen einkauft mit der Mitgliedschaft, abgesehen davon, dass man das Medium unterstützt, ist eigentlich der Index der Links.Du kriegst dann eine kuratierte Form von, was die Zeitung so rausgibt.Und eben diese Formate und die Feeds einmal am Tag. Oder was war diese Woche wichtig und so.[1:19:20] Man kann da auch reinlesen, wenn man einen Link bekommt, ohne das.Einfach so noch als Nebenbemerkung, aber ja, also es ist natürlich eine schweizer Zeitung, ein schweizer Magazin mit Fokus aber nicht nur auf die Schweiz.Sonst hätte ich sie hier nicht vorgestellt.[1:19:41] Es kann ja auch sein, dass du dachtest, die deutschsprachige Welt weiß nicht genug über die Schweiz.Also das wäre ja auch legitim.Ja, nee, also diesen pädagogischen Anspruch würde ich mir jetzt nicht anmaßen.Nee, also man kann es durchaus, ich glaube, auch sehr gewinnbringend als deutsche Person lesen.Entweder, wenn man sich für die Schweiz interessiert oder auch für andere Themen.Ja, wenn sonst keine Anmerkungen sind von euch, dann würde ich noch dem Nils übergeben.
Suchmaschine: „kagi“
[1:20:22] Ja, danke dir, Amanda. Jetzt hast du gerade den pädagogischen Ansatz sozusagen abgelehnt.[1:20:30] Ich komme vielleicht mit ein bisschen mehr davon rein. Ich möchte euch nämlich eine Suchmaschine vorstellen.Ist jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber es schließt tatsächlich relativ direkt an, auch an Folge unseres gemeinsamen Podcasts hier, nämlich an die Folge 60 zu Chalkpoint Capitalism von Rebecca Giblin und Cory Doctorow.Ähm, da geht’s im Grunde darum, wie Online-Plattformen, unter anderem eben Google, es geschafft haben, sich so in einer Vermittlerposition zu positionieren, zwischen Leuten, die etwas verkaufen wollen und Leuten, die etwas kaufen wollen.Ähm, im Fall von Google ist es vor allen Dingen Werbung, äh, also Leuten, die Werbung verkaufen wollen und Leuten, die Werbung kaufen wollen.Und, ähm, das hat mich so ein bisschen dahingebracht, äh, mal zu gucken, was gibt’s denn an Suchalternativen.[1:21:16] Und es gibt tatsächlich eine kleine Nische, in der sich mehrere Suchmaschinen trummeln, die ein ganz ungewöhnliches Geschäftsmodell haben, zumindest für eine Suchmaschine.Die lassen sich nämlich einfach von ihren Nutzern bezahlen.Natürlich auch von ihren Nutzerinnen. Das heißt, es gibt ein paar Suchmaschinen, die man abonniert, wie jedes andere Tool auch, und dann irgendwie ein paar Dollar im Monat für zahlt, und dann eben aber eben diese Suchmaschine nutzen kann.Und ich bin seit ein paar Wochen teste ich Kagi aus, also K-A-G-I, genau diese Funktion zu haben.Und ja, ich möchte euch die mal so ein bisschen vorstellen, ein bisschen mitgeben, um euch vielleicht auch mal so ins Denken zu bringen, wie auch Tools, die wir so alltäglich nutzen, anders aussehen können.Denn gerade wenn man mal so Richtung Google guckt und so die Qualität der Suchergebnisse bei Google.[1:22:06] Wenn man mal nicht so die ganz grundlegenden Dinge sucht, sondern etwas vertieftere Sachen, etwas komplexere Sachen oder fundierte Informationen in Dingen, die sehr stark kommerzialisiert sind, dann stößt man bei Google doch sehr schnell auf Grenzen.Ja, weil da entsprechende Suchmaschinenoptimierung, eingekaufte Werbung, einfach, oder auch der Versuch von Google zu raten, was man eigentlich sucht, doch irgendwie gut verhindern, dass man das findet, was man eigentlich sucht, das war so auch noch ein weiterer Ausgangspunkt, da gibt es auch zwei, drei spannende Artikel, die ich gerne in die Show-Notes packe.Und deswegen habe ich jetzt mal Kagi ein bisschen ausgetestet.Das ist eine Suchmaschine aus den USA, also kommt auch irgendwo aus dem Silicon Valley.Gibt’s auch schon nicht erst seit gestern, irgendwie so seit 5 Jahren oder so.Ist aber ein ganz kleines Team und ja, ich bin tatsächlich relativ zufrieden mit der Suchmaschine.Die nutzen tatsächlich auch erstmal den Google Index, weil der ist einfach riesig und groß.[1:23:07] Nutzen aber auch noch weitere Indizes, also andere Suchmaschinen wie ein Bing, wie ein Yandex, auch noch spezifischere Suchmaschinen, irgendwie Forensuchmaschinen, News-Suchmaschinen, die es noch da draußen so gibt, auch unabhängige Formate.Und bauen dann sozusagen aus den Ergebnissen, die sie aus den Suchmaschinen kriegen, so ein eigenes Ergebnisfeed.Nicht so wie MetaGear Fair, die noch kennt, oder die gibt es, glaube ich, auch noch, die das dann explizit machen, so Google liefert die 10 Ergebnisse und Yandex liefert die 10 Ergebnisse, sondern versucht, einen eigenen Relevanzalgorithmus da noch drüberzulegen, das zu sortieren, Unsinn auszufiltern, ähm, und so weiter und so fort.Und was halt das Spannende ist, was ich einfach so noch nie das Gefühl hatte, ich bin auf einmal interessiert daran, mich mit den Features meiner Suchmaschine auseinanderzusetzen.Also, dann kommt irgendwie eine E-Mail, ja, wir haben jetzt eine neue Version gelauncht, dann guck ich neugierig in das Change Log, was gibt’s denn an neuen Features?[1:24:03] Und das ist halt tatsächlich bei einer Suchmaschine ist man das nicht gewöhnt.Jetzt letztens hatte ich den Effekt, dass ich merkte, oh, da sind tatsächlich Artikelsuchergebnisse gekennzeichnet, die wahrscheinlich hinter einer Paywall liegen.So, ne, da ist einfach ein kleines Symbolchen dran. Oder was dir Kagi eben auch erlaubt, ist bestimmte Domains aus deiner Suche auszuschließen.Ne, zu sagen, nee, Ergebnisse von der Seite gibt mir das gar nicht.Oder zumindest in der Priorität runterzustufen und zu sagen, Nee, Ergebnis von der Seite gibt mir nur, wenn sie wirklich richtig gut passen.[1:24:34] Das gleiche kannst du aber auch andersrum machen. Du kannst Suchmaschinen in der Priorität nach oben stufen, äh nicht Suchmaschinen, Seiten, Domains und du kannst auch Seiten oder Domains quasi anpinnen.So, gib mir die bitte immer.Das sind so Möglichkeiten, wie du auf einmal deine Suche customizen kannst.Es gibt auch, sie nennen das Lenses, also Linsen, die du konfigurieren kannst, wo du sagst, ja, wenn ich diese Linse benutze, dann durchsuche bitte immer folgende 10 Seiten.Oder auch nur folgende 10 Seiten. Oder durch Sucht das ganze Netz ohne diese 10 Seiten.Ähm, es gibt auch noch ein paar vorkonfigurierte, die noch ein bisschen spezifischer sind.Es gibt zum Beispiel eine für Rezepte oder für das Small Web, also für so kleinere Blogs und Foren und so, die jetzt bei der normalen Suche irgendwie komplett hinten rausfallen.Das ist auch noch so eine Möglichkeit, die du machen kannst.Ich guck mal eben, was das noch an Lenses gibt.Academic natürlich, Forums, Programming, PDFs, World News. Das ist jetzt alles Dinge, die man mit Google im Zweifel mit entsprechenden Suchparametern auch teilen, zumindest nachbauen kann.Aber hier sind sie halt ganz stark irgendwie rein integriert.Auch andere Features, ich nutz das zum Beispiel ganz gerne in meinem Browser, dass ich irgendwie so einen Shortcut hab, dann sagt er, wenn ich jetzt A, Leerzeichen drücke, dann suchen wir mal bitte Amazon.[1:25:50] Wenn ich von Google wegkommen will, mit Amazon zu kommen, ist auch nicht so ganz ideal, aber wir kennen alle das Problem dahinter.Und dann muss ich halt in meine Adresszeile nur eingeben, in manchen Browsern, A Leerzeichen und dann den Suchstring und dann sucht der mir und Kagi macht das halt dann eben auf der Ebene der Suchmaschine.Weil das unterstützen nicht alle Browser auf die gleiche Weise.Bei Firefox kann man das zum Beispiel nicht so sehr customizen wie ich das gerne hätte.Bei der Suchmaschine kann ich das und dann funktioniert das auch im Handy, auch wenn ich irgendwo anders bin, mich nur einloggen in meinen Account.Ähm, all solche Dinge. Also das find ich tatsächlich super spannend, super spannenden Ansatz.Äh, die experimentieren auch mittlerweile so ein bisschen mit KI-Dingen rum, wo ich ja sehr skeptisch bin, ähm, aber glücklicherweise muss man als User sagen, ich möchte jetzt hier irgendwie was mit KI machen und dann macht es dir das, äh, aber es zwingt es dir nicht auf und macht es schon gar nicht irgendwie intransparent und behauptet irgendwie, es wäre nicht dahinter oder so.Also das fand ich tatsächlich einen sehr spannenden Ansatz, ähm, ich guck mal, was es noch irgendwie an, äh, Und große Features gibt es.Es gibt natürlich keinerlei Werbung.Die tracken auch deine Suchergebnisse.Nicht außer im Hinblick, wie viel hast du gesucht, weil das ist eben, daran hängt das Lizenzmodell so ein bisschen. Ich guck mal, was es noch gibt.[1:27:01] Ja, man kann auch so Sachen machen wie das CSS der Ergebnisseite, also die Optik der Ergebnisseite sich ein bisschen zu gestalten.Natürlich gibt es die ganzen üblichen Suchoperatoren. All solche Dinge kann man da bauen.Und das finde ich einfach sehr spannend und sehr sympathisch.Einfach mal zu gucken, okay, wie kann so eine Suchmaschine funktionieren, die nicht immer auch irgendwie den Zielkonflikt hat, Werbung verkaufen zu müssen.Sondern der es wirklich darum gehen kann, möglichst gute Ergebnisse zu liefern.Ich sag nicht, dass die immer perfekt sind.Ich hab das Gefühl, sie sind im Schnitt deutlich besser als die der anderen Suchmaschinen, aber zaubern können die halt auch nicht.Gerade wenn viele Sachen irgendwie hinter den proprietären Formaten irgendwie bei Facebook oder hinter einer Twitter-Paywall verschwunden sind sozusagen, da kann natürlich auch Kaji nicht viel tun.Und den Rückgang der kleinen Seiten und so könnt ihr auch nicht an sich ausgreifen.Aber ich fand das einen sehr spannenden Ansatz, das zu versuchen.Und was, wo ich gesagt hab, da guck ich mir mal genauer an.Ähm, das kostet … Man kann es kostenlos nutzen für 100 Suchen.[1:28:01] Und ich glaub, für fünf Dollar im Monat kriegt man 300 Suchen im Monat, und für zehn Dollar im Monat kann man so viel suchen, wie man will.Find ich auch wieder legitim, weil man einfach noch mal so ein bisschen drauf gestoßen wird, dass jede Suche des Unternehmens, bei dem man sucht, ja dann doch irgendwie auch Geld kostet, im Sinne von Serverlast, von Bandbreite, die irgendwie begleitet werden muss.Die Erstellung des Indexes muss ja auch refinanziert werden und so weiter und so fort. Also, das finde ich einen spannenden Gedanken.Da vielleicht für euch mal auch, also euch da draußen oder euch drei hier im Podcast, mal ein bisschen den Gedanken in den Kopf zu geben.Vielleicht, selbst bei den Suchmaschinen, kann man mal gucken, ob es nicht bessere gibt, als die, die man tagtäglich so nutzt.Und Datenschutz und fehlendes Tracking ist nicht das einzige Kriterium, Indem eine Suchmaschine es besser machen kann als Google.[1:28:47] Habt ihr dazu Fragen? Finde ich sehr cool, dass du das vorgestellt hast.Ich kenne die nicht, werde ich mir auf jeden Fall anschauen.Insbesondere das mit den Lenses, das klingt … Und mit den Pins auf Websites.Finde ich sehr cool, dass das möglich ist.Und auch, was du jetzt gesagt hast mit diesen … Man unterschätzt ja schon auch, weil das einfach so niederschallig verfügbar ist, dass jede Suche einen CO2-Abdruck hinterlässt.Das ist schon gar nicht in unseren Köpfen drin.Mit so einem Modell wird das wieder ein bisschen sichtbarer. Oder bewusster.
Ausstieg
[1:29:36] Das klingt nicht so, als würden wir da noch was nachschieben, von daher vielen Dank, Nils.Ja, liebe HörerInnen, damit geht auch unser Podcastjahr zu Ende, aber keine Sorge, es geht direkt im Januar, ich glaube am 11.Geht es weiter und ich glaube Amanda wird euch wieder ein Buch vorstellen, dann wieder im üblichen Format, alles so, wie ihr es kennt.Wenn ihr Lust habt, lasst uns doch vielleicht ein bisschen Feedback zur heutigen Folge da, Das wäre ganz cool.Am einfachsten geht das, wenn ihr auf unsere Appseite zwischenzweideckeln.de geht und dann uns vielleicht einfach einen Kommentar hinterlasst. Hat euch das gefallen?Wie findet ihr das, wenn wir alle zu viert auftreten? Sollen wir nächstes Jahr irgendwas anderes machen?All solche Fragen kreisen mir jetzt durch den Kopf und ich freue mich, wenn wir von euch hören.Wenn die Webseite nichts für euch ist, dann folgt uns gerne auf verschiedenen sozialen Medien.Ich glaube, wir spielen gerade noch drei aktiv. Und das ist einmal Instagram mit dem Handel at deckeln.Mastodon mit dem Handel at zzd at podcast.social.Und auf Facebook findet ihr uns auch einfach unter dem Podcast Titel zwischen zwei Deckeln.Ja, und damit bleibt mir nur noch euch eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen, sofern ihr sie denn feiert und dann gut ins neue Jahr zu starten und wie gesagt dann hören wir uns auch schon ganz bald wieder. Macht’s gut. Tschüss.Tschüss zusammen. Tschüss! Tschüss! Macht das gut!
Der Beitrag 067 – Jahresabschluss 2023 erschien zuerst auf Zwischen zwei Deckeln.

Nov 30, 2023 • 1h 14min
066 – „Mythos Geldknappheit“ von Maurice Höfgen
In dieser Folge wird die Modern Monetary Theory als erfrischende Sicht auf das Finanzsystem vorgestellt. Maurice Höfgen erklärt, wie Geldschöpfung funktioniert und warum Staatsverschuldung nicht negativ sein sollte. Zudem wird die staatliche Jobgarantie zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit als Lösung diskutiert. Herausforderungen der monetären Souveränität in der Eurozone, sowie die Auswirkungen der Geldknappheit auf Stabilität und Vertrauen der Bürger werden beleuchtet. Ein spannender Einblick in alternative wirtschaftliche Ansätze!

Nov 9, 2023 • 1h 26min
065 – „Baustellen der Nation“ von Philip Banse und Ulf Buermeyer
Im Buch „Baustellen der Nation“ von Philip Banse und Ulf Buermeyer werden vielfältige Herausforderungen in Deutschland thematisiert. Eines der Hauptprobleme betrifft die marode Infrastruktur, einschließlich Brücken, Straßen, Schienen und Datennetzen, die auf jahrzehntelange Vernachlässigung zurückzuführen ist und zu erheblichen Schulden von mindestens 457 Milliarden Euro geführt hat. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Digitalisierung, bei der Deutschland im internationalen Vergleich hinterherhinkt. Es werden Probleme wie das Onlinezugangsgesetz und die Notwendigkeit einer einheitlichen IT-Struktur behandelt. Das Rentensystem in Deutschland wird aufgegriffen, einschließlich der Herausforderungen des Umlageverfahrens und der Notwendigkeit von Reformen. Föderalismusreformen und der Einfluss des Bundesrats werden als politische Themen beleuchtet. Schließlich wird die Bekämpfung von Rassismus diskutiert.
Shownotes
Kliodynamik (Wikipedia)
Kondratjew-Zyklus (Wikipedia)
Klimaforscher Anders Levermann bei den DLF Zwischentönen
Buch: „Die Faltung der Welt“ von Anders Levermann (Verlagswebseite)
Podcast: „Lage der Nation“
Buch: „Baustellen der Nation“ von Philip Banse und Ulf Buermeyer (Verlagswebseite)
schwarze Null (Lexikon der Wirtschaft auf bpb.de)
DB-Aufsichtsrat bringt gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft DB InfraGO AG auf den Weg (deutschebahn.com)
Podcast-Folgen: Lage der Nation 274 & 276 „Raus aus der Flaute“ (Teil 1 & 2)
Podcast-Folgen: Lage der Nation 301 & 302 „Digitalisierung in der deutschen Verwaltung“ (Teil 1 & 2)
Wie sind die Vermögen in Deutschland verteilt? (Hans-Böckler-Stiftung, 2017)
Soziologe Michael Hartmann (Wikipedia)
Lastenausgleich (bundesfinanzministerium.de)
Gute Arbeit, gute Löhne, gute Renten (verdi.de)
Königsteiner Schlüssel (gwk-bonn.de)
Staatlicher Pensionsfonds (Norwegen) (Wikipedia)
„Die AfD ist keine Protestpartei“ (Marcel Lewandowsky auf tagesschau.de)
ZZD055: „Die Werte der Wenigen“ vom Philosophicum Lech
ZZD052: „The Innovation Delusion“ von Lee Vinsel und Andrew L. Russell
ZZD048: „Die Altenrepublik“ von Stefan Schulz
ZZD044: „The Entrepreneurial State“ von Mariana Mazzucato
ZZD039: „Vom Ende des Gemeinwohls“ von Michael J. Sandel
Graphic Novel: „Kapital und Ideologie“ von Claire Alet und Benjamin Adam
Buch: „Träge Transformation“ von Sascha Friesike und Johanna Sprondel
Buch: „Ironie des Staates“ von Hellmut Willke
ZZD031: „Quantum Economics“ von David Orrell
ZZD032: „Schulden“ von David Graeber
ZZD056: „Die grosse Consulting-Show“ von Mariana Mazzucato
ZZD058: „Merchants of Doubt“ von Naomi Oreskes und Erik M. Conway
Buch: „Lobbyland“ von Marco Bülow
Buch: „Realitätssschock“ von Sascha Lobo
Podcast: „In guter Verfassung“
Intro und Outro der Episode stammen aus dem Stück Maxixe von Agustin Barrios Mangore, eingespielt von Edson Lopes (CC-BY).
Das Umblättern zwischen den Teilen des Podcasts kommt hingegen von hoerspielbox.de.
Zwischen zwei Deckeln findest du auch im sozialen Medium deiner Wahl: Mastodon und Bluesky.
Transkript
Einstieg
[0:00] Music.
[0:16] Herzlich willkommen bei der 65 folge von zwischen zwei deckeln heute wird christoph euch ein buch vorstellen und genau ich bin holger und höre ihm dabei zu hallo zusammen wie geht’s dir so christoph ich bin ganz gut zurecht ganz ganz guter dinge muss ich sagen also alles alles irgendwie so weit im lot viel viel los so freizeitmäßig also irgendwie viele freundinnen die ich momentan sehe und die wochenenden rasen so dahin aber das ist schöner freizeitstress gewissermaßen ja und dir ja bei mir ist es ähnlich also meine wochenenden sind und wie im moment relativ gefüllt, relativ viel mit meinem tanz hobby aber ja es sind ja sachen die einem prinzipiell spaß machen insofern beschwere ich mich da nicht sehr schön Das finde ich gut.
[1:15] Genau, dann gehen wir doch direkt mal zu der Frage, was dich denn gerade beschäftigt.Ja, also ich muss sagen, politische Situation gerade im Allgemeinen.Ich merke, ich lese nochmal sehr viel zum ganzen Thema Nahostkonflikt, Gaza -Streifen.Da gibt es natürlich, ist man, irgendwie hat man, glaube ich, seine Vorannahmen und seine gewisse Grundbildung. Grundbildung, zumindest ich, und habe mich vor Jahren auch mal intensiver damit beschäftigt.Aber das, ja, jetzt im Zuge der jüngsten Entwicklung des letzten Monats dort, ist das nochmal irgendwie die vertiefte Lektüre momentan. Ja, genau.
[1:57] Ja, es ist auch so ein Thema, wo ich immer denke, das ist, es gibt viele Leute mit einfachen Meinungen, aber in Wahrheit ist das ganze Ding halt einfach wahnsinnig kompliziert.Also zumindest, wenn man so ein bisschen genauer mal sich damit beschäftigen möchte, denke ich.Ja, glaube ich auch. Und ja, gerade aus einer deutschen Perspektive ist es, glaube ich, wichtig, also vermutlich aus jeder Perspektive weltweit, aber vielleicht ist da so eine deutsche Perspektive, wenn man die man ja nun mal einfach hat, einfach wichtig, ein gutes Bild, ein möglichst genaues Bild vielleicht sich zu machen und eine gewisse vertiefte Expertise zu entwickeln.Aber was treibt dich denn um? Ja, ich hatte… Ich bin… Es hängt vielleicht auf gewisse Weise…Ja ganz ganz entfernt sogar damit zusammen ich bin vor ich weiß nicht und wann im laufe der letzten woche über einen podcast auf die idee der klee klei dynamics heißt es glaube ich gestoßen.
[3:11] Und find das ganz spannend, hab jetzt mich noch nicht so reingearbeitet, außer mal ein, zwei Interviews zu hören, also Podcasts zu hören, hab aber schon jetzt ein weiteres Buch zum Thema, zu genau diesem Thema auf meiner Leseliste.Und was Clio Dynamics ist, das ist also der Versuch, historische Prozesse mithilfe von Methoden, ich sag mal so aus der Richtung Datenanalyse, zu beschreiben und zu verstehen.Geht das dann in so Richtung, keine Ahnung, so Kondratiefzyklen und so ein Zeug?
[3:51] Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, was ein Kondratjew -Zyklus ist, insofern kann ich diese Frage gar nicht beantworten.Das ist so eine Theorie von, ich glaube, der war, oh Gott, war der russisch, glaube ich, der Herr Kondratjew?Eine Theorie der, ja, im Prinzip zyklischen Wirtschaftsentwicklung.Also ja, dass man, dass in Techniken investiert wird, dann gibt es einen Aufschwung und dann setzen sich Innovationen irgendwie durch und dann gibt es weniger Investitionen so rum und dann gibt es wieder einen Abschwung und dann wird wieder in neue Sachen investiert und dann hast du so, ja, so wellenartige Wirtschaftsentwicklung quasi.Ja, sowas könnte da sicher auch vorkommen. Wie gesagt, ich habe bisher so zwei, etwa einstündige Podcasts zum Thema gehört.Und von dem Menschen, der da interviewt wurde, das Buch ist jetzt auf meiner Leseliste.Also ich zumindest das Hörbuch habe ich auch schon angeschafft.Ich bin jetzt in den letzten Tagen nur noch nicht dazu gekommen, da wirklich weiter reinzuhören.Aber das Grundkonzept ist einfach, dass man erst mal Daten sammelt zu historischen Themen und dass man dann, ich sag mal so.
[5:10] Das klingt jetzt immer so komisch, aber ich sage mal, eine naturwissenschaftlicheren Ansatz dann macht, dass man also sagt, okay, wir formulieren mal eine Hypothese.Wie, was erwarten wir, wie die Dinge sich verhalten und dann gucken wir uns die Daten an, ob das das auch wirklich hergibt.Oder man versucht auch, computergestützt verschiedene Szenarien durchlaufen zu lassen, was denn passieren könnte und guckt sich an, wie wahrscheinlich bestimmte Dinge sind.Was natürlich immer voraussetzt, dass man irgendwie eine halbwegs brauchbare Modellierung überhaupt hat.Aber sowas testet man dann ja in der Regel auch an vergangenen Daten.So wird das bei Klimamodellen ja zum Beispiel gemacht.Und genau, es ist halt so ein anderer Blick, um, geschichtliche Zusammenhänge zu erforschen.Und ich finde das einfach ganz spannend, sicher, weil ich vielleicht auch ein bisschen zahlenaffiner bin.Aber ich denke auch, das ist eine spannende Erweiterung, wo man manche Dinge sieht, die man mit den klassischen Ansätzen vielleicht nicht so gut sieht.
[6:27] Und ich denke ja eh immer, dass es ganz gut ist, so verschiedene Blickwinkel zu haben.
[6:34] Und genau deswegen finde ich das ein ganz spannendes Konzept, wo ich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen reinschnüffeln will.Was denn da genau läuft und was da so Erkenntnisse sind, die vielleicht aus anderer Quelle nicht so kommen.Dazu fällt mir ein Interview ein, das meine gute Freundin empfohlen hat, in den Zwischentönen des Deutschlandfunk.Radiosendung eigentlich, wo ein Klimafolgenforscher, also Herr Anders Lebermann, interviewt wurde und der ist Physiker und bezieht irgendwie, vielleicht kannst du dazu mehr sagen, die Idee der Faltung auf Klimafolgenforschung und entwickelt darüber irgendwie offenbar eine Idee von Wirtschaftswachstum, das vielleicht relativ entkoppelt von Ressourcenverbrauch stattfinden kann.Und der hat jetzt auch ein Buch geschrieben und das ist bei mir jetzt auf der Leseliste auf jeden Fall.Die Faltung der Welt, wie die Wissenschaft helfen kann, dem Wachstumsdilemma und der Klimakrise zu entkommen.Also irgendwie sehr interessant und für mich auch ein Meter weg von dem Denkhorizont, den ich sonst so habe, weil halt ein Physiker mal spricht. Und ja, aber was Physiker mit Faltung der Welt meint, weiß ich natürlich erstmal nicht sofort.Ja, ich muss jetzt gerade dran denken. Es gibt eine mathematische Operation der Faltung.
[8:03] Das müsste jetzt auch nochmal, muss ich gestehen, das habe ich jetzt 20 Jahre lang nicht gebraucht.Ja, ein bisschen weniger als 20 Jahre, sagen wir mal so 15 Jahre lang ziemlich sicher nicht gebraucht.Da müsste ich nochmal die Details nachlesen. Das war aber so eine Geschichte, wo man irgendwie, glaube ich, mit einer bestimmten zwei Funktionen kombiniert und darüber integriert. Egal.Also es ist eine bestimmte mathematische Operation. Sehr gut.Ich verlinke das Interview einfach mal und das Buch findet ihr dann sicher auch, falls euch das interessiert.
[8:39] Prima. Okay, wollen wir dann einfach mal zu dem aktuellen Buch kommen. Ja, sehr gerne.Und zwar stellst du uns vor, Lage der Nation. Fast, fast so heißt der Podcast.Die Baustellen der Nation stellst du uns vor.Und mein Fauxpas kommt daher, dass dieses Buch geschrieben wurde von dem Team des Podcasts Lage der Nation.Und zwar, dieses Team, das ist zum einen Philipp Banse, der lange als Moderator und Reporter für den Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur gearbeitet hat, vor allem Hauptstandstudio Berlin und immer dort den inhaltlichen Schwerpunkt der deutschen Innenpolitik, Klima-, Umweltpolitik, Digitales und Bildung hat.
[9:30] Und er hat das Buch geschrieben, zusammen mit Ulf – jetzt weiß ich nicht, ob man ihn Burmeier oder Burmeier ausspricht, Burmeier, der ist promovierter Jurist, war unter anderem auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesverfassungsgericht und am Berliner Verfassungsgericht und ist Mitbegründer der Gesellschaft für Freiheitsrechte.Ich glaube, da war er auch lange im Vorstand, wenn ich mich da richtig erinnere und setzt sich da also für die ich sag mal, Rechte der Bevölkerung auch immer noch aktiv ein.
[10:11] Genau. Das Buch ist, also quasi taufrisch, ist bei Uhlstein in diesem Jahr erschienen, ich glaube, irgendwie vor so ein oder anderthalb Monaten in etwa. Ja, sowas, ja.Genau. Und ich muss auch sagen, ich selber höre auch den Podcast und ich habe das Buch auch bei mir liegen, habe das jetzt aber extra noch nicht gelesen, damit ich hier in der Podcast -Folge ein, möglichst unvoreingenommener Zuhörer sein kann.Ich hoffe, du hast danach noch Lust, das zu lesen.Aber ja, es liest sich ganz gut weg. Ja, habe ich auch den Eindruck.Alles klar. Dann Möchtest du uns ein kurzes TLDR geben? Ja, sehr gerne.
Tl;dl
[11:01] Im Buch Baustellen der Nation von Philipp Banse und Ulf Burmeier werden vielfältige Herausforderungen in Deutschland thematisiert.Eins der Hauptprobleme betrifft die marode Infrastruktur, einschließlich Brücken, Straßen, Schienen und Datennetze, die auf jahrezehntelange Vernachlässigung zurückzuführen ist und zu erheblichen Schulden von mindestens 457 Milliarden Euro geführt hat.Ein weiterer zentraler Aspekt, der im Buch verhandelt wird, ist die Digitalisierung, bei der Deutschland im internationalen Vergleich hinterherhinkt, und es werden Probleme wie das Onlinezugangsgesetz und die Notwendigkeit einer einheitlichen IT -Struktur behandelt.Das Rentensystem in Deutschland wird aufgegriffen, einschließlich der Herausforderung des Umlageverfahrens und der Notwendigkeit von Reformen.Auch der Föderalismus wird aufgegriffen und der Einfluss des Bundesrats werden als politische Themen beleuchtet.Und ja, im letzten Kapitel wird dann noch die Bekämpfung von Rassismus diskutiert.
[11:59] Ja, das klingt ja nach einem sehr breiten Themenspektrum. Dann bin ich auch
Buchvorstellung
[12:04] gespannt, wie du das jetzt genau alles vorstellen möchtest und freue mich auf deine Zusammenfassung von dem Buch.Ja, bin auch gespannt, wie gut das klappt, aber das wird sicherlich irgendwie gehen.Wer den Podcast etwas intensiver verfolgt hat über die letzten, ich würde sagen, keine Ahnung, zwei, drei Jahre, der wird bei der Lektüre des Buches merken, dass einfach sehr viele, die haben so ein paar Spezialfolgen gemacht, wo sie sich noch mal intensiv mit einzelnen Themen auseinandergesetzt haben.Sonst ist das ja quasi eine wöchentliche, ja, sowas wie eine Wochenschau vielleicht früher nur als Podcast und inhaltliche Aufarbeitung.Aber sie haben eben so Spezialfolgen, wo sie gewisse Themen noch mal aufarbeiten und man merkt, dass die auf jeden Fall stark vorkommen.Das heißt, wer den Podcast gut gehört hat über die letzten Jahre.
[12:59] Dem dürfte sehr viel sehr bekannt vorkommen und man weiß, wo die Hintergrundinfos herkommen und die intensive Beschäftigung. Ja.Also den Podcast Lage der Nation.Ja, genau. Den Podcast. Nicht unseren Podcast. Nicht unseren Podcast.Ich habe auch verschiedene Folgen dazu schon, glaube ich, verschiedenfach hier verlinkt.Also keine Ahnung, die Folgen zu Windenergie zum Beispiel oder auch die zur Digitalisierung finden sich, glaube ich, schon in irgendwelchen Shownotes und werden es heute, wird es wieder so sein.
[13:25] Ja, aber ich starte erst mal. Also der Aufschlag von Ihnen ist, dass Sie halt sagen, so wie ich es gerade in der Kurzzusammenfassung schon gesagt habe, naja, dass wir quasi Deutschlands Infrastruktur ziemlich auf Verschleiß gefahren haben.Eben wie gesagt, da nehmen Sie Brücken, Straßen, Schienen und Datennetze auf und das hat zu, Sie nennen es Infrastrukturschulden und ich glaube, es ist auch einfach ein Fachbegriff von eben diesen 457 Milliarden Euro geführt.Also Sie meinen, wenn man die Infrastruktur modernisieren wollte auf einen aktuellen Stand, dann wären das eben die Kosten, die man da in die Hand nehmen müsste.Und ja, Sie führen das eben auf die Sparsamkeit der letzten Jahre und Jahrzehnte, die politische, zurück.Und das Ganze hat dann natürlich gravierende Folgen auch für die Wirtschaft, weil wir darüber die Energiewende zum einen beeinträchtigen, aber auch so ganz stumpfe Sachen haben wie längere Staus auf den Straßen, was natürlich Probleme in der Konsumgüterverteilung mit sich bringt, wenn keine Ahnung, oder kaputte Brücken, wo dann LKW nicht drüber fahren können, die dann irgendwelche Umleitungsstrecken kaputt fahren, weil sie dafür eigentlich zu schwer sind und so.
[14:30] Ja, und genau, dass die Bahninfrastruktur auch Modernisierung vertragen könnte, wissen wir, glaube ich, alle.Das gleiche gilt für Wasserstraßen, genau, was zu steigenden Baupreisen führt, weil wir ganz viele Baumaterialien nicht über die Wasserstraßen, die wir eigentlich haben, transportieren können.Ja, so, das ist quasi Ihr Aufschlag und das ist quasi im Kern eine starke Kritik an dieser Politik der schwarzen Null, die ja ganz lange betrieben wurde.Ich verbinde die sehr mit Wolfgang Schäuble als Finanzminister.
[15:05] Christian Lindner möchte da aber sicherlich hin, wieder auch zurück.Also der besteht ja auch auf der Schuldenbremse der Einhaltung der sogenannten und ja.Ich glaube, Olaf Scholz hat die auch verteidigt.Also es ist ein breiter Konsens, der da irgendwie leider zum Tragen kommt.Und ihr Argument dafür, warum das so gemacht wird, ist, dass sie sagen, naja, langfristige, also der langfristige Nutzen von Infrastrukturinvestitionen zahlt sich politisch kurzfristig kaum aus.Also, das ist keine Ahnung. Wenn man in verschiedene Sachen sehr viel Geld steckt, dann sind das halt erstmal merkliche Kosten und das ist Wählenden nicht unbedingt geheuer und dass sich das irgendwann mal rentiert, ja, das, davon, damit gewinnt man nicht unbedingt Wahlen, wobei ich dem Argument nicht unbedingt folgen würde, weil ich glaube.
[16:01] Dass gerade konkrete Infrastruktur, dass die Modernisierung braucht, das ist schon allgemein akzeptiert und ich glaube über funktionierende Bahnnetze oder einen vernünftigen Glasfaserausbau oder so, da freuen sich schon alle drüber.
[16:19] Ja wobei es vielleicht ja auch einfach die sache ist dass dass man es halt jetzt wirklich merkt also ich glaube wer im moment in deutschland lebt der merkt einfach was passiert wenn die infrastruktur nicht nicht mehr richtig gut ist während wenn man einfach immer in der umgebung mit guter infrastruktur lebt dann merkt man das gar nicht so sehr das stimmt das ist immer nur im kontrast wenn man in ein anderes land kommt und da ist es nicht so Und es gibt Länder, da ist es durchaus noch deutlich schlimmer als bei uns, aber wir sind halt schon an einem Punkt, wenn man das irgendwie vor 30 Jahren Leuten gesagt hätte, dass es in Deutschland mal so aussehen würde, also jetzt vielleicht nicht beim Thema Digitalisierung, weil das neu war damals, aber bei Qualität der Straßen, Anzahl der Baustellen, Brückenproblem deutscher Bahn, das hätte einem da keiner geglaubt.Und vielleicht ist es, jetzt ist da denke ich schon wäre ein breiter Konsens da, aber die Ursachen dieser Politik, die liegen ja 25 Jahre in der Vergangenheit. Ja, das stimmt.
[17:29] Ja, was ich auch als Problem einfach sehe, ist, dass wenn du nicht laufend investierst und deine Infrastruktur erhältst, dann kommst du halt irgendwann an den Punkt, dass du merkst, oh, jetzt muss ich aber.Und dann hast du halt von jetzt auf gleich unendlich viele Bahnbaustellen zum Beispiel oder sehr viele Autobahnen, die modernisiert werden müssen.Und das wird auf einmal angegangen, was natürlich dann kurzfristig zu massiven Problemen führt in den Streckenführungen.Und da hätte man das einfach kontinuierlich investiert, so wie die beiden sich das wünschen.Also die hätten gerne Investitionsfördergesellschaften, nennen sie das, wo einfach dauerhaft in Infrastruktur investiert wird und auch den Kommunen einfach Gelder an die Hand gegeben werden. weil die Kommunen natürlich auch für einiges politisch verantwortlich sind, aber kein Geld haben, was sie investieren können.Also sie möchten, dass die stärker geschützt oder unterstützt werden.
[18:20] Dann wäre man gar nicht an diesen massiven Problemen angelangt.Und eine Sache, Sie sagen, was erstaunlich ist, ist es gar nicht, also alle merken, die Infrastruktur ist kaputt, aber wir haben lange keine vernünftige Buchhaltung quasi darüber geführt, wie kaputt sie ist.Also es gibt keine richtige Transparenz darüber, was eigentlich in welchem Zustand ist.Und da hätten Sie ganz gerne regelmäßige Berichte, die auch standardisiert sind, weil das offenbar auf den unterschiedlichen Föderalismus -Ebenen auch unterschiedlich gehandhabt wird, was man wie häufig und in welcher Art erfasst und so.Und da wünschen Sie sich eine gewisse Vereinheitlichung. Das ist im Prinzip der Aufschlag ins Buch. dass einmal der der Rundumschlag der Fuß dann alles weitere würde ich sagen ein Stück weit drauf.
[19:10] Also kann ich gut nachvollziehen. Ich sehe jetzt auch schon Parallelen zu anderen Büchern, die wir hier schon hatten oder generell auch Themenkomplexen, die immer wieder vorkommen, auch in unserem Podcast.Ja, auf jeden Fall. Da ist, glaube ich, alles ganz gut anschlussfähig.Danach sprechen sie über Digitalisierung, dass Deutschland da hinterherhinkt, also gegenüber Ländern wie, keine Ahnung, Dänemark, Estland, Finnland oder auch der Ukraine, die sie jetzt Beispiel nennen, ist, glaube ich, allgemein bekannt.Also es gibt andere Länder, da kriegt man automatische Benachrichtigungen für Kita -Plätze und das Elterngeld wird einfach gezahlt, ohne dass man sich um irgendetwas kümmern muss, weil es zum einen die Idee gibt, wohin man das Geld überweisen muss und naja, der Staat ja sowieso erhebt, welche Kinder zu welchen Elternteilen gehören und man das einfach zusammenknüpfen kann.Und dann kann man sich ja ausrechnen, dass die Eltern Geld bekommen oder man weiß, naja, ab, keine Ahnung, drei Jahren oder so gibt es einen Anspruch auf einen Kitaplatz, keine Ahnung, wie die politischen Regelungen genau sind.Und dann kann man halt auch sagen, so, hier wir haben für ihr Kind einen Platz oder sowas.Und das sind einfach Dinge, ja da sind wir einfach massiv hinten dran.Sowas gibt es halt nicht.
[20:27] Wobei ich da auch manchmal das Gefühl habe, dass das vielleicht auch einfach nicht ganz gewollt ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Das kann gut sein.Also ich, wenn ich mich rechtlich dran erinnere, geht man bei seiner Steuerzahl, bei seiner Steuererklärung zum Beispiel an, ob man Kinder hat, und da ist auch ein Konto, allein schon wenn, für die Rückzahlung, die man vielleicht kriegt, also.Ja. Diese Information hat der Staat.Also zumindest bei abhängig Beschäftigten dürfte das kein Problem sein.Oder bei jedem, sagen wir so, bei jedem, der eine Steuererklärung irgendwie mal abgegeben hat, müsste man das eigentlich haben. Ja, genau, müsste man haben, aber so, also, dass die digitale Verwaltung nicht so läuft, wie man sich es vielleicht wünschen könnte.Ja, ich glaube, da muss man auch nicht drum herum reden, gewissermaßen.
[21:19] Ja, und einfach. Ist leider wahr. Ja, genau, also sie machen es unter anderem, machen sie verantwortlich, diese verzögerte Technikbereitstellung für Direktzahlung, die ja eigentlich kommen soll, die dann ja an die Steuer -ID, glaube ich, gebunden sein soll, was DatenschützerInnen natürlich auch nicht ganz unberechtigt auf den Plan ruft, die sagen, naja, dann hat man eine Identifikationsnummer, über wo alle möglichen Daten zusammenlaufen sollen, das ist vielleicht auch nicht so ganz wünschenswert, aber sie fordern da gewissermaßen Transparenzregister ein, also Datenabfrage durch den Staat soll man in einem Onlineportal einfach nachgucken können, wann wollte welche Behörde was über mich wissen und dann kann man darüber eben sich einen Überblick verschaffen.Da haben sie auf jeden Fall, glaube ich, nachvollziehbar gute Ansätze, wie man mit solchen Datenschutzbedenken umgehen könnte.
[22:13] Und ja, Sie meinen, diese Staatsinkompetenz hemmt einfach sinnvolle, ja zum Beispiel auch klimapolitische Maßnahmen, also Klimageld ist ja jetzt eh gerade vorm Tisch, weil der Topf, der dafür benutzt werden sollte, schon komplett verplant ist.Aber die Direktzahlungen sind halt nicht einfach an jede BürgerInnen, weil man eben nicht genau weiß, wo das Geld für jede Person hingehen sollte.Das ist alles nicht so ganz klar und liegt bei 700 Stellen. Und wenn das anders wäre, dann könnte man das vielleicht auch machen.Und ja, das Finanzministerium möchte da etwas entwickeln, aber bis jetzt klappt es halt nicht so ganz. Mal schauen, ob es 2024 kommt.Ja, so, und Sie meinen, das hemmt halt einfach, wenn wir diese digitalen Strukturen nicht haben. Ja.Ja, das ist sicher richtig. Also, keine Ahnung. Ein Beispiel, das Sie auch anführen, sind die digitale Datenerfassung während der Pandemie.Also die Behördeninteraktion hat da ja überhaupt nicht geklappt.Das war in keinster Weise digitalisiert und das hat sicherlich konkrete Menschenleben gekostet, Maßnahmen verzögert.Also hier das Kontakt -Tracking, wie hieß das nochmal?Das hat ja einfach viel schlechter funktioniert als in anderen Ländern.
[23:35] Einfach schade. Sie gehen dann nochmal weiter zu dem Online -Zugangsgesetz.Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Bis zu irgendeinem Jahr, was glaube ich eigentlich schon abgelaufen ist, sollten so und so viele Behördensachen, die drei… Achso, ja, das ist eine dunkle Erinnerung.Verfügbar sein und das wurde dann irgendwann runtergekürzt auf digital verfügbar heißt das pdf soll online als antrag zur verfügung stehen oder so ähnlich was die behörden dann intern damit machen ob sich dann ausdrucken weiter faxen ist ihre sache aber ja da, da haben wir fällt gerade nur sowas ein ich habe neulich und wie so ein meme gesehen Das ist, dass Fax als Technologie irgendwie so alt ist, dass es theoretisch möglich ist, dass ein Samurai -Krieger eine Fax hätte schicken können.
[24:27] Das war, ich glaube, irgendwann in den 1850er, 1860ern ist das Fax erfunden und irgendwann in den 1890ern sind die Samurai sozusagen offiziell abgeschafft worden. Das heißt, es gab eine gewisse Periode, wo das prinzipiell möglich war.
[24:41] Einfach nur mal so als Kontext, was für einer modernen Technologie unsere Behörden da arbeiten.Das ist sehr witzig. Ja, da kommt im Prinzip auch schon eine Föderalismuskritik drin vor, weil Kommunen für ihre Softwarebeschaffung im Großen und Ganzen selbst zuständig sind.Die wenden sich an einzelne Anbieter, Anbieter, also Softwareanbieter für alle möglichen Prozesse.Es sind immer Spezialsoftwaren, kann man sich ja vorstellen.Verwaltungsdienstleistungen sind recht speziell, die machen nicht alles mit Word und Excel.
[25:11] Und diese Softwareanbieter haben natürlich ein gewisses Interesse daran, dass die Käufer dazu angehalten werden, ihre Produkte zu nehmen.Das heißt, die haben untereinander inkompatible Dateiformate im Normalfall.Und das heißt, jede kleine Kommune, jedes Land kocht sein eigenes Süppchen immer wieder, weil die halt für alles selber verantwortlich sind und wir nicht so was haben wie einen, digitalen Marktplatz oder eine Standardisierung der Dateiformate, was irgendwie auch zwischen Gerichten teilweise den Austausch von irgendwelchen E -Akten und so über Ländergrenzen hinaus erschwert.Ja, das ist einfach auffällig. Dann haben Kommunen natürlich auch kein Geld, um IT -Profis einzustellen, denn das sind teure Fachkräfte, die es dazu noch wenig ab Markt gibt.Die verdienen in der freien Wirtschaft einfach viel mehr. Das heißt, sie haben am Anfang das Beispiel von einem Förster in der Kommune, der da auch die digitale Verwaltung organisiert und macht.Also er wurde immer wieder im Wald beim Bäume fällen quasi angerufen und es wurde gesagt, Programm XY läuft nicht mehr, kannst du dich nicht mal kümmern.Also das ist das Level von Expertise, das wir häufig haben.
[26:22] Was ja nicht heißt, dass der Förster nicht auch Ahnung von IT haben kann.Nee, genau. Er scheint Ahnung gehabt zu haben, aber ich glaube, das parallel zu bespielen, ist schwierig und ja, genau.Vielleicht sollte man einfach dezidierte IT.Personen einstellen, die sich, die das vielleicht auch mal richtig gelernt haben und sich nicht quasi on the job erworben haben, ja.Genau. Und natürlich gerade diese, ich glaube gerade dieses Thema der Standards einfach zu definieren, ist halt wahnsinnig wichtig.
[26:55] Und eigentlich, wie du ja schon gesagt hast, müsste man das ja eigentlich sogar international machen.Ja, das eigentlich müsste das ja am besten auf EU -Ebene passieren, dass da einfach gesagt wird, es muss diese Schnittstellen geben, was ja einfach nur heißt, dass ich die Daten, wenn ich die aus einem Programm exportiere, in jedes von den anderen wieder importieren kann und dass das halt einfach ohne große Probleme läuft.Und für solche, also ich meine mein erster Gedanke war so, ja Gott, aber wie sollen das funktionieren, das ist ja voll der hohe Anspruch, wie soll das klappen?Das Gegen-, also das Beispiel dafür, dass so etwas funktionieren kann, das die beiden immer wieder anführen, ist die gute alte klassische E -Mail, die ja von 700 unterschiedlichen Anbietern und Providern genutzt wird.Aber im Großen und Ganzen hat man sich eben mal auf Verfahrensstandards geeinigt.Keine Ahnung, IMAP, POP3 und keine Ahnung, was es noch alles gibt.Ich kenne die technischen Hintergründe nicht, weil für mich funktioniert es ja einfach.Das heißt, ich kann dir von jedem Account ein E -Mail schreiben und du kannst sie überall empfangen und wir können sie beide lesen.Also es gibt solche Standardsetzungen im digitalen Raum. Man muss sie halt nur mal hinkriegen.Aber es gibt Beispiele dafür, dass sowas funktionieren kann.
[28:07] Ja, ich meine das Internet, das lebt ja auch davon, dass es das World Wide Web Protokoll gibt, was halt mal geschrieben wurde und was einfach standardmäßig festlegt, wie diese Kommunikation läuft und das Internet gab es auch schon, ich glaube, 20 Jahre vorher, das war halt nur so schwierig zu benutzen, dass das nur so ein paar Leute an Unis und beim Militär gemacht haben, bis jemand sich dann, also.Tim berners -lee halt dieses protokoll geschrieben hat am zern um und für die kommunikation zu vereinfachen ja genau das ist.
[28:42] Ich glaube da ist es mangel so ein bisschen am willen vielleicht auch am wissen bei den entscheidungsträgern ja denke ich halt noch recht ahnungslos sind aber prinzipiell möglich ist wäre das glaube ich alles. Denke ich auch, ja.Sie schlagen dann sowas wie einen App -Store für die Verwaltung quasi vor, wo quasi die Rahmenrichtlinien durch die öffentliche Hand gesetzt werden und dann können private Anbieter ihre Lösung da ja anbieten und verschiedene und dann können können Verwaltungs -Sub -Einheiten das einfach zukaufen, aber die äußeren Standards sind dann eben gesetzt, was ich finde ich erstmal ganz ganz plausibel klingt.Also ja, sie suchen dann noch.Ich bei anderen sachen auch passiert ja das kann sein ja also im prinzip die ausschreibung ja auch also das ist ja ein digitales ausschreibungsmodell was quasi auf dauer gestellt wird also genau sie geben noch einen finde ich ganz kluges argument für die suche nach it talenten mit an die hand den den verwaltung und sagen naja bei euch gibt es halt prinzipiell sinnvolle arbeit also bevor als ProgrammiererInnen das nächste Computerspiel entwickelt, mit dem man über irgendwelche Pay -to -win -Sachen probiert, den SpielerInnen das Geld aus der Tasche zu ziehen, ist doch vielleicht eigentlich der Anreiz.
[29:59] Sinnvolle Staatsaufgaben komfortabel umzusetzen.Eigentlich doch ganz sinnstiftend. Das fand ich ganz schön.Und abseits von so Komfortfunktionen sagen sie halt auch, na ja, Digitalisierung der Verwaltung ist einfach notwendig aufgrund des demografischen Wandels, der uns ins Haus steht.Also auch da werden viele Leute in Rente gehen und dann haben wir noch weniger Personal und wenn die weiterhin alles händisch und ausgedruckt machen, dann geht das alles nicht.
[30:27] Wobei ich da jetzt allerdings auch nochmal…So ein bisschen den bogen schlagen würde zu dieser kernthese das dass man immer überall gespart hat es ist natürlich auch ein punkt man hat halt bei den gehältern auch gespart ja das ist nicht ist in der wirtschaft auch passiert aber beim staat ist das noch ein bisschen perfider weil der so eine einheitliche struktur hat das heißt du kannst schwerer den leuten die du wirklich brauchst einfach mehr zahlen wie das jetzt ein wirtschaftsunternehmen dann gezwungenermaßen irgendwie macht, aber das ist ja auch man hat auch nicht in die leute investiert ja man hat nicht genug neue stellen geschaffen man hat die nicht attraktiv genug gemacht auch finanziell aber auch mit dem ganzen drumherum und das macht es natürlich dann auch schwerer da experten zu finden ja und du hast glaube ich jetzt auch einen gewissen ruf als verwaltung einfach weg also sowas manifestiert sich ja und dann.
[31:23] Musst du denen erstmal wieder gerade rücken quasi, selbst wenn du es mit allem, was du hast, probierst.Also ich glaube, das ist nicht so einfach.Aber auch da, mit sowas wie der schwarzen Null verhinderst du das ja letzten Endes auch wieder.Ja klar, natürlich. Weil es dann immer daran scheitert, dass du das Geld nicht aktivierst, was du dafür brauchen würdest. Naja, also die Politik der schwarzen Null ist wirklich, ja, Hanebüchen.Naja, im nächsten Kapitel beschäftigen sie sich dann einmal ganz konkret mit der Deutschen Bahn, was ja ein ganz spannendes Unternehmen ist.Also sie sagen, zentrale Probleme der Bahn sind natürlich auch die marode Infrastruktur, Also im Prinzip ja die ja vor allen Dingen ja das Gleisnetz, das ja nicht nicht intakt gehalten wurde und das Ganze geht eben auf diese neoliberalen Börsenfantasien der 90er und 0er Jahre zurück.Also da sollte die Bahn ja mal an die Börse gehen, was dann letztlich kurz vor knapp gestoppt wurde, weil die Kurse eingebrochen sind.Aber man hat trotzdem den Schwerpunkt eben auf Gewinnorientierung gesetzt auf kurzfristige.
[32:33] Also ich muss auch sagen damals war das so ein vielleicht der einzige halbwegs positive outcome der finanzkrise das genau deswegen diese bahn dieser bahn börsengang nie passiert ist.Ja das war ganz gut aber trotzdem also von dem von dem ziel dahinter hat man halt nicht ganz abgelassen also man entsinnt sich vielleicht noch an das kofferwort bahnchef medorn den es zwischendurch glaube ich gar nicht einfach nur als hartmut medorn gab sondern nur als bahnchef medorn.Der das eben ja entsprechend getrimmt hat und man hat eben ganz viel quasi alles was nicht sofort Profit abwirft wurde gecancelt.Das heißt ja die die Säuberung von irgendwelchen Bahnhöfen keine Ahnung irgendwelche kleinen Strecken die nicht die Hauptverkehrsachsen bedienen das alles wurde ja einfach runtergefahren.Und die Bahn wurde in keine Ahnung wie viele Untergesellschaften auf gesplittet die alle für sich Gewinn abwerfen mussten.Also wieder Beispiel Bahnhof Säuberung, wenn du in der Gesellschaft der Bahnhofsreinigung, keine Ahnung wie die heißt, bist und du sollst Gewinn abwerfen, dann lohnt es sich natürlich, Bahnhöfe weniger in Stand und schön zu halten, was aber natürlich repräsentativ katastrophal ist.
[33:48] Ja, das ist ein ganz, ganz trauriges Thema. Ja, also ich weiß auch nicht wie viele Subkonzerne die Bahn hat, aber es sind wirklich absurd viele, was natürlich die ganze Steuerung top -down total schwierig macht.Da wurde jetzt ja gerade politisch eine Reform beschlossen, da geht es ja auch…
[34:06] Wie ist das? Ich glaube, die Netzinstandhaltung soll jetzt gemeinwohlorientiert ablaufen, ist aber trotzdem, verbleibt die im DB -Konzern, also mal gucken, ob das letztlich was bringt, aber da gibt es so erste Ansätze für Reformen.Aber diese Verästelung führt auch dazu, also die Deutsche Bahn ist ja ein Unternehmen des Bundes, aber ihr gehört quasi nur die oberste Ebene, nur auf die kann sie einwirken und alles da drunter ist dann wieder in der Konzernstruktur der Bahn gefangen.Das heißt, der Bund kann auch gar nicht so in die Bahn reinregieren oder durchregieren, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. Das war mir auch nicht ganz so klar.
[34:43] Aber ist das nicht was, was man im Prinzip jetzt als Hauptanteilseigner, könnte man ja auch eine Strukturreform einfach von oben obstruieren?Ja, genau das ist ein bisschen die Frage.Also ich habe das Gefühl, da bewegt sich gerade auch ein bisschen was, aber wir wissen ja auch, in welchen Händen das Verkehrsministerium über die letzten Jahrzehnte lag.Das war immer bei der CSU und jetzt liegt es bei der FDP, was jetzt vielleicht auch nicht die Parteien sind, die das größte Interesse an einer ganz tollen Modernisierung der Bahn haben.Ich glaube, die haben ihre Prioritäten tendenziell bei anderen Verkehrsmitteln und das macht es politisch natürlich nicht ganz einfach, dass man das eben so vergeben hat, wie man es getan hat.Ja, aber ich glaube, das ist auch wieder so ein Thema, wenn der politische Wille wirklich da wäre, das würde natürlich würde das jetzt eine gewisse Zeit brauchen, weil klar, eine Struktur umbauen ist immer schwieriger, als sie aufzubauen.Aber wenn der politische Wille wirklich da wäre, dann würde man das auch hinkriegen.
[35:48] Aber ich glaube, ich stimme zu, dass man nicht den Eindruck hat, dass der politische Wille da sehr ausgeprägt ist.Also das scheint einfach so zu sein. Ich meine, die Probleme kennen wir ja alle.Also die Pünktlichkeitsprobleme der Bahn und auch häufig mal Sitzplatzprobleme, weil irgendwelche Züge und so fehlen. Also das kennen wir.Wo sie ein bisschen eine Lanze für die Bahn brechen, sind die unfairen Rahmenbedingungen im Vergleich zum Flugverkehr.Also der Fliegen wird ja einfach stark subventioniert. Also es gibt keine oder kaum Kerosinsteuern und die Bahn wird eben voll besteuert.Da sehen sie auf jeden Fall Nachbesserungsbedarf, dass zumindest die Alternativen nicht immer mit so unfairen Attraktivitätsvorteilen in Bezug auf Preis daherkommen.Also ich glaube grundsätzlich würden sie sich da eine Subventionsumlage wünschen.Also ich würde sagen, da gibt es auch einfach Fehlanreize, wie da subventioniert wird.
[36:43] Genau, also ich finde die lanze kann man schon brechen ich bin ja auch passionierter bahnfahrer und macht es total gerne aber es macht einem es wird einem nicht immer leicht gemacht die dieses reiseerlebnis so toll zu finden wie es wie ich also ich finde es großartig wenn es funktioniert aber es klappt halt echt auch nicht mehr in allen fällen oder nicht mehr in den meisten fällen so.Naja, also ich kann von mir selber sagen, dass ich durchaus in einigen Fällen, wo ich eigentlich sogar gerne die Bahn nehmen würde, dann doch irgendwie dabei endet, mit dem Auto zu fahren, einfach weil die Bahn nicht zuverlässig ist oder die Verbindungen so schlecht sind, dass man nirgendwo hinkommt, wo ich mir dann denke, ja ich will ja eigentlich, aber es wird einem halt nicht immer einfach gemacht. Ja, das ist einfach so, ne?Ja, dann gehen Sie auf den Ausbau der Windkraft ein.Also Sie konstatieren einfach, dass der Solaranlagenausbau in Deutschland soweit grundsätzlich positiv verläuft.Ich glaube, da haben wir jetzt ja auch schon wieder Ziele übererfüllt.Und beim Windkraftaufbau dieses Jahr ausnahmsweise, glaube ich, ja auch.
[37:54] Aber trotzdem ganz generell fokussieren Sie eben in den Windkraftausbau, weil ja, Energiewende steht eben an.Und ihr Hauptkritikpunkt sind die langen Genehmigungsverfahren für Windräder.Der liegt im Durchschnitt ungefähr bei sieben Jahren in Deutschland und ja, gibt halt verschiedenste Hindernisse, die so aufgemacht werden.Also einmal sind es teilweise Flächenprobleme, weil nicht genug Flächen bewilligt sind durch die Länder. Es gibt nicht immer den politischen Willen.Und die Genehmigungsverfahren an sich sind eben auch sehr komplex, weil Sachen wie Lärm, Schattenwurf, auf Abstand zu Gebäuden, Einfluss auf das Flugverhalten von Tieren, das Baurecht, das Wasserrecht, Naturschutzrechte und so beachtet werden müssen und das alles verzögert eben den Windkraftausbau in Deutschland und das ist ein Problem.
[38:45] Sie fokussieren auch auf diesen Naturschutzgutachten, die in Deutschland bis zu fünf Jahre dauern können und sagen einfach, das kann es irgendwie nicht sein, weil Millionen von Vögeln irgendwie auf deutschen Autobahnen sterben, aber die, keine Ahnung, wie wenig tausend Vögel es durch Windkraftanlagen sind in Deutschland, die werden immer hochgehalten und da wird es dann zum Problem gemacht und es gibt richtig gehende Vereine, die quasi ja strukturiert gegen Windkraftausbau klagen und die sind dann häufig auch verbandelt mit der Fossilindustrie Lobby und ja da gibt es und das immer unter dem Deckmantel des Artenschutzes quasi ja und da sagen sie nein wir müssen vielleicht mal den Schutz der Gesamtpopulation in den Blick nehmen also Flächen schützen in denen dann sich Tiere ansiedeln können und dafür dann trotzdem den Umbau der Energiewirtschaft voranbringen.
[39:45] Und wir haben ja schon über die Verwaltungen gesprochen, die nicht digitalisiert sind.Es sind unendlich viele Papierberge, die für Genehmigung von Windkraftanparks zur Verwaltung geschleppt werden. Und die kommen nicht hinterher.
[40:00] Und kriegen das nicht hin. Nur 64 % der Windkraftanlagen, die gebaut werden sollen, sind nach 24 Monaten genehmigt.Und sie schlagen eine sogenannte Genehmigungsfiktion vor.Es ist der Vorschlag, dass ein Schweigen einer Behörde als Zustimmung gilt, wenn sie nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums, dem man dann noch mal verhandeln müsste, reagiert.Dann könnten auch die Behörden nicht mehr alles absegnen, sondern könnten sich die Fälle angucken, wo man nach kurzer Zeit erkennt, hier müssen wir genau hingucken.Und alle anderen gelten einfach als genehmigt, wenn nicht innerhalb von keiner Ahnung welcher Zeitspanne gesagt wird, ja, nee, das geht so nicht, ja.Das ist natürlich ein generelles, wäre ein generelles Mittel, um Punkte, wo es Verwaltungsstau gibt, anzugehen. Ja, absolut, absolut.Ja, finde ich klingt gar nicht so verkehrt. Also ich kann mich dafür durchaus erwärmen.Ja, also zumindest in gibt sicher Bereiche, wo man das nicht will.Ja, weiß ich nicht. Jetzt Arzneimittelsicherheit oder sowas, da hätte ich das jetzt glaube ich nicht so gerne, dass das automatisch durchgewunken wird, wenn die Behörde und wie sich nicht äußert bis zum bestimmten Zeitpunkt.Also sprich und welche wirklich sinnvollen Regulierungen, aber genau, gibt eben auch Fälle, wo das vielleicht einfach ja bisschen gelockert werden könnte.
[41:23] Oder man einfach auch den Mitarbeitern in der Verwaltung ein bisschen mehr Spielraum gibt.Ich glaube oft haben die da so viele Regeln zu beachten und Gesetze einzuhalten, dass die ja glaube ich auch gar nicht mehr unbedingt so viel individuellen Spielraum dann haben. Ja, genau. Wenn du alles durchgucken musst, musst du halt alles durchgucken.Also das ist dann ja vielleicht, vielleicht ist dein grundsätzliches Gefühl schon auch, ja, das sieht im Großen und Ganzen sinnvoll aus.Aber ja, wenn die Regeln halt sind, wie sie sind, musst du durch, ne?Und dann landet das irgendwann in dem realen Irrsinn von extra 3. Ja genau.
[42:03] Wo dann die Frage ist, ob die Mitarbeiter dann nicht immer eigentlich nur versucht haben, die Regeln möglichst genau einzuhalten und die Regeln sind halt bescheuert.Ja so ist es. Genau, sie machen dann noch den Stadt -Land -Kontrast beim Thema Windkraft auf, der ist sicherlich auch wichtig, weil eben die Landbevölkerung dazu neigt.Im Großen und Ganzen kann man das glaube ich so sagen. naja, die in den Städten wollen irgendwie den Ökostrom haben und ihre Lade sollen.Wir laden hier alle ganz entspannt bei uns, aber bei uns sollen die Windkrafträder stehen. Das ist irgendwie nicht so witzig.Aber genau, da sagen sie, naja, sobald man anfängt, die Gemeinden von Anfang an einzubeziehen und die auch finanziell wieder stärker zu beteiligen.Ich glaube, das war historisch auch schon mal anders als es jetzt ist.Dann wird das auch, weil mittlerweile auch ja Investitionen in lokale Infrastruktur von auch Unternehmen gutiert wird.Also wenn die da dann günstig an Strom kommen können, weil irgendwie der Absatz direkt funktioniert oder so, dann läuft das Ganze auch anders.Und dadurch eben ja Steuereinnahmen generiert werden, Arbeitsplätze entstehen und so, dann klappt das auch quasi, ja.
[43:10] Ja, oder ganz banal, wenn die Gemeinde auch an den Einnahmen von so einem Windrad beteiligt ist Und dafür dann, was für ihre Einwohner tut, was auch immer das dann im Einzelfall genau ist, das merken die Leute ja auch.Und wenn man dann ganz klar formuliert, das weiß ich nicht, das Freibad haben wir jetzt mit Mitteln von den Windrädern renoviert, dann sehen die Leute ja direkt, dass das Nutzen für sie hat. und dann stehen sie positiv gegenüber.Ja, naja. Also okay, das ist jetzt Zufall, dass ich das so gewählt habe.Das ist ja, glaube ich, einfach ein sehr treffendes Beispiel.Also ich glaube, das bringt da viel auf den Punkt.
[43:50] In den nächsten Kapiteln geht es dann nicht so sehr um Infrastruktur, sondern die weiteren Baustellen, die sie ausmachen, sind im Prinzip sind es finanz, also persönliche Finanzfragen.Also einerseits Thema Privatvermögen und Vermögensverteilung in Deutschland und dann eben auch Erbschaften.
[44:09] Und ja, genau, dann haben sie noch ein Kapitel zur Rente und zwischendurch was zur Bildungspolitik. Bildungspolitik, das hängt aber alles zusammen, deswegen probiere ich das mal ein bisschen zusammenzufassen.Also in Deutschland ist es so, dass die reichsten 10%, 56 % des Privatvermögens besitzen und das reichste Prozent besitzt irgendwas zwischen, ja, also so um ein Drittel des gesamten Privatvermögens.Gleichzeitig sind aber 13 Millionen Menschen in Deutschland von Armut bedroht.Also wir haben da schon massive Ungleichheiten, ökonomische einfach.Und ja, sie zielen in dem Kapitel sehr stark auf die Erbschaftsstrukturen in Deutschland, weil in Deutschland circa 400 Milliarden Euro jährlich vererbt oder verschenkt werden.Und das ist eben auch sehr ungleich verteilt.Also nur eine von 13 Erbschaften wird besteuert. Und das sind meist die Erbschaften von sehr sehr reichen Menschen, die nicht besteuert werden, weil die eben sich zum einen auskennen, zum anderen die entsprechenden Anwälte haben, die sich auch auskennen.Und es ist so, dass so Unternehmensanteile, in denen dann ja große Vermögen letztlich liegen, ja, die kann man offenbar sehr gut quasi fast gar nicht besteuern bei Erbschaften. Solange man das früh genug verschenkt, dann geht das.
[45:28] Und da sind offenbar die reichen Personen viel, viel cleverer unterwegs als Menschen mit etwas weniger Geld und Gut.Und dann gibt es eben ganz viele Menschen, die gar nichts erben oder Schulden erben.Und da möchten sie auf jeden Fall ran.Sagen, naja, ein Problem, was wir da haben politisch, ist, dass Parlamente eben dominiert sind von sehr wohlhabenden PolitikerInnen.Also nur noch wenige Interessen, nur noch wenige vertreten konkret einfach durch ihre politische oder ihre soziale Herkunft oder auch ihre reale Vermögenssituation die Interessen von weniger reichen Menschen.Also Sie zitieren da den Elitenforscher Herrn Hartmann, der ist in Deutschland auch relativ bekannt. Und der sagt, naja, dass die politischen Eliten eigentlich meist aus den oberen vier Prozent kommen.Also die sind quasi selber betroffen von dem, was man vielleicht ändern müsste.Und ja, wir haben ja eine recht starke Besteuerung, wenn auch eine progressive Besteuerung von Einkommen in Deutschland.Also da müssen wir uns alle beteiligen, aber das sehen Sie halt in keinster Weise auf der Vermögensseite. Und da haben sie auch einfach recht.Die Vermögenssteuer wird seit 30 Jahren nicht mehr erhoben.
[46:43] Und ja, sie machen im Prinzip als Analogie zu dem, wir hatten mal den Lastenausgleich, ich glaube, so ab 52 in Deutschland, in der Nachkriegszeit, weil die PolitikerInnen damals Sorge hatten, dass sozialistische Ideen in Deutschland Fuß fassen.Deswegen haben sie den Lastenausgleich eingeführt, bei dem Vermögen besteuert wurden und glaube ich über, ich weiß nicht, 20 Jahre oder so musste anteilig was abgestottert werden.Und also gab einen gewissen Prozentsatz der Besteuerung und dann wurde es eben über Jahre mussten Teile davon eben bezahlt werden.Das war die Angst vom Kommunismus letztlich, dass die das getriggert hat und sie sagen, wir haben auch einen Vorschlag.Also ja, dass das Reiche und Unternehmen eben auch prozentuale Abgaben auf Vermögen bezahlen sollten.Und das könnte man dann zum Beispiel nutzen, um die Corona -Pandemie -Schulden des Bundes zu reduzieren. Ich finde, man kann sich aber auch ganz viele andere sinnvolle Dinge überlegen, die man damit bezahlen kann, wie zum Beispiel Infrastrukturausbau oder was auch immer.
[47:44] Und sie schlagen vor, na ja, die ersten zwei Millionen Euro für Individuen oder fünf Millionen für Unternehmen sollten steuerfrei bleiben.Also da, also es trifft echt nicht viele.Und der Steuersatz von irgendwas zwischen 10 und 30 Prozent soll dann für alle darüber über 20 Jahre abgestattet werden.Und sie sagen, na ja, das könnte bis zu 310 Milliarden für den Staatshaushalt bringen.Ja, das sind so, das ist so in Kurzzusammenfassung ihre Kritik an der deutschen Vermögensbesteuerung.Ja, ich finde, es ist ein ganz interessanter Gedanke, wie sich da auch der Zusammenhang, also diese Angst vorm Kommunismus.Also es ist ja schon so, man kann ja schon, wenn man so ein bisschen zurückguckt, glaube ich zumindest, dass man dann auch sehen kann, dass viele Maßnahmen, zumindest hier in Deutschland, auch erst kamen, nachdem der Ostblock zusammengebrochen ist, wo nicht mehr dieses Gegenbild da war, gegen das man gut aussehen wollte, dann konnte man sich halt erlauben, die Sozialleistungen zusammen zu kürzen und sozusagen einen guten Teil der Bevölkerung eigentlich schlechter zu stellen.
[48:59] Und diese Angst ist im Moment nicht mehr so da, aber ich habe auch schon mal den Gedanken gehabt, dass man, wenn man jetzt so aus einer kalt neoliberalen Sicht vielleicht sogar begründen möchte, warum Sozialausgaben sinnvoll sind, dass man das als eine Versicherung gegen Revolution betrachten kann.Ja, das ist glaube ich auch nicht unüblich.Weil es wenn es der bevölkerung irgendwie mal so richtig schlecht geht dann dann kommt sie vielleicht auf den auf die idee dass eine revolution besser für sie ist als das system zu erhalten und allein aus der sicht würde ich schon argumentieren dass sinnvoll ist für die wohlhabenden was abzugeben, Ich sag mal, ganz blöd, um ihre Haut zu retten, auf lange Sicht.Das Rentensystem unter Bismarck wurde jetzt auch nicht eingeführt, weil das irgendwie so ein wahnsinnig wohltätiger Mensch sein wollte auf einmal.Also das waren sehr konkrete Ängste, die da auch ihren Teil getan haben.
[50:02] Und vielleicht fehlt da so die Angst der Eliten davor, dass das Volk irgendwie sie loswerden, also irgendwann beschließen könnte, sie loszuwerden.Vielleicht fehlt diese Angst bei uns einfach so aufgrund der Geschichte der letzten Jahrzehnte, wo man dann dachte, naja, jetzt, wo der Kommunismus irgendwie nicht mehr das Problem ist, dann haben wir das Problem nicht mehr und man hat sich das Problem aber jetzt hintenrum selber wieder gebaut.Ich habe aber auch das Gefühl, wir führen so merkwürdige Diskussionen wie, keine Ahnung, Migrationsdebatte.Also die AfD kommt in den Umfragewerten auf 20 Prozent und auf einmal erzählen alle das Gleiche wie die AfD, nur manche lächeln noch dabei und andere halt nicht.Und die Frage, wie rassistisch man formuliert, was alle politisch am Ende wollen sie das Gleiche umsetzen. Das ist dann die Frage, die wir haben.Aber ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht sollte man einfach mal gute Sozialpolitik angehen und umsetzen, und vielleicht könnte man damit auch so was zurückdrängen.Ich hab manchmal auch das Gefühl, die Themensetzung ist so verquer.
[51:08] Ich hab das Gefühl, wir haben ja eine sehr konkrete Bedrohung eigentlich von rechts. und fragt mich genau, also fragt mich, warum man deren Themen dann so hinterher rennt. Das ist ja irgendwie ziemlicher Wahnsinn.Also während Corona hatte die AfD ja nicht gerade Oberwasser, weil sie offensichtlich politisch nicht setzen konnte.Keine Themensetzung und das, was sie dazu gesagt haben, war inhaltlich völliger Unsinn.
[51:33] Und ich denke manchmal, daran könnte man sich ein Beispiel nehmen.Also wenn man über Sachthemen diskutierte, vielleicht käme man dann da mal vom Fleck. Also vielleicht ist auch die die Wahrnehmung der Bedrohung von der Demokratiefeinde einfach nicht groß genug. Also keine Ahnung.Ja, wobei ich das sogar noch erweitern würde. Ich würde auch sagen, auch manche Debatten, die so von links geführt werden und herangetragen werden, sind halt letzten Endes Debatten für relativ kleine Gruppen.
[52:07] Das heißt nicht, dass diese Debatten nicht legitim sind, aber ich glaube, es gibt einfach sozusagen Probleme, die eine viel größere Breite der Bevölkerung betrifft, wo viele Linke und wie wenig zu sagen.Und natürlich, wenn du halt irgendwie Mühe hast, überhaupt deine Familie zu ernähren, in einer viel zu kleinen Wohnung lebst und die ganze Zeit Angst hast, deinen Job zu verlieren und in eine Hartz IV zu fallen, auch wenn man das jetzt Bürgergeld nennt, aber das ist ja nicht wirklich viel besser geworden.Und dann möchte dir jemand erzählen, dass das wichtigste Thema ist, Weiß ich nicht, wer denn jetzt auf die Damentoilette gehen darf.
[52:55] Das heißt nicht, dass das Thema, dass es kein legitimes Thema ist, wie man Transmenschen einbezieht, aber bei den Leuten kommt es halt so an, dass das halt ein Problem ist, was von ihrer Lebensrealität total weg ist, was aber auch die Energie wegnimmt, um irgendwie eine sinnvolle Verbesserung für sie zu erreichen.Und das ist ein Eindruck, den ich oft habe, also in vielen dieser Diskussionen, die beobachte ich, auch weiß ich nicht, ob man die Sprache gendern soll, da habe ich meine persönliche Meinung zu, aber letzten Endes denke ich mir, warum diskutieren wir eigentlich darüber, wo wir so viele, viel größere Probleme haben und darauf wird Energie verschwendet und man bietet ja auch gerade den Leuten von rechts, gibst du damit ja was in die Hand.Ja ja ich also ja dann hast du ein kulturkampf und dann wird nicht mehr über sozialpolitik diskutiert, bessere sozialpolitik würde halt auch vielen der menschen die in diesem kulturkampf sozusagen dann vertreten werden würde das wahrscheinlich mindestens genauso viel helfen wie wenn man und wie diese kultur kämpferischen themen dann löst ja und kulturkämpfe kosten kein reales geld das ist glaube ich auch ein thema du musst musst nicht an die an die ganz harten sachen eigentlich ran.Aber ich mit Blick auf die Zeit laufe ich nochmal weiter. Alles gut.Ich finde es sehr wichtig, dass wir über so etwas diskutieren.
[54:19] Also sie sprechen dann über das Bildungssystem in Deutschland, gehen quasi nochmal vom PISA -Schock aus und sagen, naja, trotzdem ist das Bildungssystem nach allem, was wir empirisch wissen, nicht unbedingt besser geworden.Also die Kinder und SchülerInnen schneiden den Teil noch schlechter ab und gehen dann auf die Reproduktion von sozialer Ungleichheit ein, also dass Kinder aus wohlhabenden Familien bessere Chancen auf Gymnasialempfehlungen haben.
[54:48] Kinder aus weniger wohlhabenden Familien für quasi die gleiche Empfehlung höhere Leistung bringen müssen. Das ist tatsächlich so.Ja, sie sehen dann ja Probleme in der in der Verteilung der Gelder, weil ja Geld auf basierend auf dem Königsteiner Schlüssel, das ist so eine Berechnungsformel, ja verteilt wird zu Ländern.Also Schulpolitik ist ja Ländersache. Und da haben wir dann eine sehr ungleiche Verteilung und man fördert bereits wohlhabende Länder überproportional stark, was eigentlich nicht die Idee ist.Und ja, da gibt es Gegenentwürfe, unter anderem von der GEW, die den multiplen Benachteiligungsindex vorschlägt, also zum Beispiel ein Land wie Bremen, das stark verschuldet ist, kriegt sowieso schon relativ wenig Geld, ist aber als Stadtstaat einfach überproportional stark davon betroffen, dass ihr Klientel nicht immer das Einfachste ist, um das mal so ganz allgemein zu formulieren.Einfach Städte haben einfach mehr mit Ungleichheit zu kämpfen als die durchschnittliche Landbevölkerung und Bremen kriegt dann aber wiederum relativ wenig Geld, verglichen mit Bayern, die sehr viel Geld bekommen, sowieso schon ein reiches Land sind, aber viel weniger Probleme haben.Und das ist einfach nicht besonders clever, wenn wir unser Geld so verteilen.
[56:08] Ich würde sogar noch eine sache sagen das ist jetzt gar nicht auf die länder bezogen was irgendwie auch wenn man darüber nachdenkt eigentlich ein bisschen komisch ist in deutschland haben wir immer noch diese logik das irgendwie ein gymnasial lehrer der ist ja mehr wert der kriegt dann mehr geld als grundschullehrer oder auch realschullehrer wo man dann eigentlich mal fragen müsste warum eigentlich Ja, das ist völlig, völlig.Also das ist, genau, irgendeine formale Qualifikationsfrage, die dahinter steckt, das verstehe ich schon.Aber wenn man jetzt mal überlegt, eigentlich ist doch irgendwie Grundschullehrer oder auch. Studiert und Referendariat haben sie alle hinter sich.Ja, aber jetzt einfach, also klar, also die Aufgaben sind anders.So ein Real – oder Hauptschullehrer, der muss halt ganz andere Probleme lösen.Das ist dann nicht unbedingt immer das fachliche, aber das ist auch nicht weniger schwierig und eigentlich, also Grundschullehrer müssen ja eigentlich die sein, die am besten bezahlt sind, weil das, was die tun, wirkt am stärksten nach, wenn man mal drüber nachdenkt.Das ist ja auch eigentlich so eine Schiefe, die wir in unserem System haben, wo auch nicht wirklich drüber diskutiert wird, ob man da nicht auch andere, andere.
[57:24] Finanzielle Strukturen bräuchte und andere Sachen dadurch auch wertschätzt. Ja, genau.Also Sie Münzen da, also im Prinzip sind das auch starke Finanzprobleme einfach, die da eine Rolle spielen und Sie sagen eben auch, naja, also wir müssen irgendwie den Bildungsföderalismus reformieren, der ja, glaube ich, mit sehr, also die, die Intention der Einführung des, nicht nur des Bildungsföderalismus, aber eben auch, war ja, ist ja eine Nachwirkung des, des Dritten, des Dritten Reichs.Ist das eigentlich Tätersprache, frage ich mich gerade? Ja, ist es, ne?Also, von Nazi -Deutschland. Ja, aber würde ich jetzt unter die nicht so wichtigen Diskussionen zählen, aber ja, ich glaube, es ist Theatersprache.Genau, also, es ist eine Reaktion auf die Gleichschaltung der Bildungspolitik eben in der Zeit.Von daher ist das nachvollziehbar, aber trotzdem muss da sicherlich irgendwie, muss da an den Föderalismus ran.
[58:18] Ja, aber auch da wieder Bildungspolitik zeigt Wirkung erst langfristig und soziale Ungerechtigkeit wird die Probleme, die wir haben, erst langsam reduziert werden und deswegen ist es vielleicht nicht immer politisch wünschenswert, sich darum zu kümmern.Also, ja, das ist schwierig, glaube ich.Und die Länder wollen ihre Hoheiten auch behalten.Also, ich weiß nicht, das ist auch nicht einfach, ja.Ja, ich glaube, du kannst damit halt auch nie wirklich gewinnen.Also, ich erinnere mich dran, das ist schon eine Weile her, wo dann, ich glaube, in Bremen sollten die Gymnasien abgeschafft werden.Da war, glaube ich, eine rot -grüne Regierung und vor allem die Grünen hatten das als Projekt und das haben sie dann aufgegeben, weil dann so die Eltern von Gymnasialkindern dann alle auf die Straße gegangen sind und das ist dann nun mal die Wählerschaft der Grünen.Und danach war das dann, glaube ich, nicht mehr so ein Thema, was da forciert wurde.
[59:23] Ja, das ist immer wieder ein Problem. Das gleiche hatten wir ja jetzt neulich beim Thema Elterngeld.Da war das ja genauso, wo es ja darum ging, dass dann vielleicht die Besondersreichen das nicht mehr unbedingt bekommen sollten und auf einmal gab es ganz große Proteste und Leute mit großem Nettoeinkommen oder Vermögen haben vorgerechnet, weil ja wie sie dann ihre Kinder nicht mehr durchbringen könnten und so und dann verschwindet sowas politisch auch schnell wieder.Ja, Sie sprechen dann nochmal über die Rente, die ja nicht mehr sonderlich gut funktioniert.Also eigentlich ist das ja ein Umlagesystem.
[1:00:05] Also nochmal zur Erinnerung, wir zahlen nicht ins Rentensystem ein und am Ende kriegen wir ausgezahlt, was wir alle auf unserem Sparbuch angespart haben, sondern wir alle geben monatlich was in die Rentenversicherung und das wird an die aktuellen Rentnerinnen umgelegt.Das Umlageverfahren trägt aber schon lange nicht mehr und wird stark steuersubventioniert.Also in den Haushalten, in den Bundeshaushalten ist die Umlage der Steuern an die Rentner in mittlerweile der größte Haushaltsposten.
[1:00:40] Was einfach daran liegt, dass früher als so in der Nachkriegszeit hatten wir mal den Zustand, dass sechs Arbeitende die Rente eines Rentners finanziert haben und jetzt sind es eben nur noch zwei und das geht vorne und hinten nicht auf und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass die Rente, die wir jeweils erhalten, für die wenigsten Menschen zu einem ja guten Überleben reichen wird.Also sie machen da nochmal ganz stark, dass bitte alle, die es irgendwie können, jetzt spätestens anfangen sollten, privat für ihre Alterssicherung zurückzulegen, machen dann einen Exkurs in ETF und so.Also auch da kriegt ihr ein bisschen was für die Altersvorsorge an die Hand und ich pflichte Ihnen bei, kümmert euch nach Möglichkeit, wenn ihr irgendwie Geld habt, das ihr zur Seite legen könnt und wenn es nicht viel ist, kümmert euch ganz, ganz dringend um eure Altersvorsorge.Die Rente alleine wird es nicht richten.Das ist einfach sehr, sehr absehbar. Ja, politisch haben wir das Problem, dass die Gruppe der RentnerInnen natürlich eine riesige WählerInnen -Gruppe ist, die man nicht verlieren möchte und die Leute kriegen auch objektiv nicht viel Geld.Was es aber schwierig macht, da ranzugehen, es ist ganz schwierig politisch Renten nicht zu erhöhen oder da Kürzungen vorzuschlagen oder so, obwohl der Posten in den Haushalten so groß ist.
[1:01:59] Ja, sie haben dann ja verschiedene, also sie sprechen auch unangenehme Themen an, also sie sagen, wir werden länger arbeiten müssen, wir werden alle immer älter, das heißt langfristig wird es nicht ohne gehen, also die Rentenzeiten sind mittlerweile einfach lang geworden und also sie deuten an, dass sie glauben, dass eine Erhöhung des Renteneintrittsalters außer Frage steht.Sie sagen, das kann dann gelingen, wenn längeres Arbeiten den Menschen auch ermöglicht wird.Also das heißt, so krankheitstechnisch sind sie eher dagegen, früher Renteneintrittsalter zu ermöglichen und mehr Rehabilitation und Prävention ja quasi von den Krankenkassen her zu forcieren.Und sie meinen, ja, wir brauchen halt einfach mehr Beiträge in der Rentenkasse.Also alle Erwerbstätigen sollten da einzahlen, also einschließlich der Beamten und Selbstständigen.Gerade bei der letzten Gruppe kenne ich auch einige, die das gerne würden.Aber für sie ist es einfach in keiner Weise lukrativ.Ja, das ist so das, was sie, was sie zum Thema Rente sagen.Und sie sagen natürlich, na ja, wir brauchen auch einfach mehr Einwanderung.Und wir brauchen eigentlich so ziemlich alle Menschen, die hier hinkommen möchten.Damit müssen wir nicht so tun, als könnten wir besonders wählerisch sein oder sollten es sein. Also die wirtschaftliche Seite Humanitärs ist sowieso noch mal eine ganz andere Frage.
[1:03:21] Ja und wofür sprechen sie sich noch aus, ein höherer Einkommen natürlich, also wer mehr verdient zahlt mehr in die Rentenkasse ein und hat dann langfristig was davon und wenn wir das nicht haben, dann müssen wir es eben alle mit unseren Steuern tragen und ja, stärkere betriebliche Altersvorsorge nennen sie noch, ja so ist es sehr, also wer erfahren möchte, wie die Rente sich auch genau berechnet, wie das System funktioniert, das ist wirklich ein ausführlichstes Kapitel, was sehr gut aufbereitet ist.Wobei es natürlich auch, auch da bestimmt politische Entscheidungen wieder hinterstecken, wie jetzt genau die Rente im Moment funktioniert.
[1:03:58] Und das sind auch Sachen, es ist halt im Moment auf eine bestimmte Art organisiert, das heißt nicht, dass es die einzige Art ist, wie man es organisieren könnte, es gibt andere Länder, die das anders organisieren.Sei es, dass man halt, wie die Schweiz das schon macht, alle mit einzahlen lässt, wie sie auch vorschlagen.Sei es, dass man irgendwie solche Fonds bildet, wie das in Norwegen passiert.Da ist es ganz spannend. In Norwegen und Schweden, da musst du, ich glaube, zweieinhalb Prozent deines Bruttolohns musst du in einen Fonds investieren, in einen Staatsfonds.Du kannst dir aussuchen, welcher Fonds das ist, aber du musst es machen.Das ist echt interessant. Ja, aber wie gesagt, einfach nur um den Horizont nochmal zu erweitern, dass es da durchaus verschiedene Ansätze gibt.Und dass es halt letzten Endes politische Entscheidungen waren, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind.Die waren aber nicht entgegen dem, was manche Leute behaupten, alternativlos.Sondern da hat sicherlich auch gewisses Lobbying mit reingespielt, ich meine jetzt für mich persönlich, ich arbeite im Bereich der privaten Lebensversicherung, also kann ich dem, sozusagen mich für meinen Job bedanken.
[1:05:08] Aber wenn man jetzt so ein bisschen nicht persönlich betroffen drauf guckt, man hätte das auch anders tun können und ich wäre auch generell für ein Mischsystem, privat und gesetzlich, aber ob man das so ausgestaltet sollte, wie es im Moment in Deutschland der Fall ist, da kann man durchaus berechtigt dran zweifeln.
[1:05:32] Ja, ich glaube auch. Also ich fand es allein für das Verständnis des Rentensystems nochmal ganz spannend, weil sie auch Äquivalenzprinzip und Rentenpunkte und all das nochmal genau erklären, wenn man da nicht so tief drin steckt, vielleicht aus Berufswegen, war das nochmal ganz interessant.Und für jemanden, für den die Rente zum Glück hoffentlich auch noch einen Meter weg ist, war das ganz gut.Also ich hatte neulich auch mal den Kommentar gehört, ich weiß leider gar nicht mehr wo das war.
[1:06:02] Dass gerade in den USA hat man ja sehr stark die Altersvorsorge an solche Fonds, Sparprodukte, diese Rentenfonds gekoppelt.Und das hat dann auch den Effekt gehabt, dass es plötzlich für den normalen Bürger, dass da plötzlich so ein hoher Wert an Börsenkurse gegeben wurde.Und das hat aber insgesamt der Art, wie die Wirtschaft und auch die Gesellschaft funktioniert, irgendwie langfristig nicht unbedingt gut getan.Ja, ich glaube auch, man muss da sehr, also man muss da mit Sinn und Verstand echt dran gehen.Aber so wie es ist, kann es auf jeden Fall nicht bleiben. Das ist völlig klar, weil es einfach auf Dauer nicht trägt.Also die Prognosen sind einfach, keine Ahnung, bis 2035 oder so, wenn wir weiter so die Steuern umlegen, könnte das die Hälfte des Bundeshaushalts ausmachen und das ist einfach, ja, das ist in keiner Weise, kann man das, kann man das wollen.Ich finde auch, auch für die Leute, die privat versichert sind, also auch für die könnte es mal ein Anreiz sein zu sagen, ey Leute, wenn wir die Renten dauerhaft mitfinanzieren mit unseren Steuern, dann möchten wir vielleicht auch Teil davon sein. Also das könnte ja auch eine Argumentationsweise mal sein.
[1:07:10] Ja, aber es sind natürlich auch noch andere Punkte. Also die Renten wären ja zum Beispiel auch mehr wert, wenn sie nicht besteuert würden.Das war ja früher auch so.Nur da hat man Pensionen hat man besteuert, Renten nicht. Dann hat ein Beamter dagegen geklagt, hat Recht bekommen.Und dann hat die Regierung halt die Wahl gehabt. Wie rum geht man es an?Ja genau. Und hat halt gesagt, dann besteuern wir jetzt halt alles.
[1:07:35] Ich habe auch interessanterweise mal einen Vortrag von Fabio Di Masio, war es glaube ich, als ehemaliger Bundesverfassungsgerichter gehört, der genau da meinte, er wäre der Meinung, man hätte das auch anders entscheiden können, als das Bundesverfassungsgericht das da gemacht hat und auch die Begründung genannt, womit man es hätte tun können, also auch das.Das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo man nochmal drüber nachdenken kann.Also da sind einige Sachen schief und irgendwie ist es auch das wieder so ein klassisches, okay, im Zweifelsfall belasten wir dann halt die, die vorher nicht belastet waren, mehr.
[1:08:18] Und sowas führt natürlich auch zu Unmut bei den, in der Bevölkerung, wenn wir wieder das Thema haben, warum bestimmte Parteien stark werden, obwohl man eigentlich, wenn man sich anguckt, was die so fordern, was die AfD so fordert, das ist ja, das meiste davon ist ja offensichtlich falsch, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt.Und hilft noch nicht mal den Leuten, die sich abgehängt fühlen.Macht es für die die Sachen eigentlich nur noch schlimmer.Aber irgendwo ist halt einfach ein Unmut da, bei vielen, der sich da glaube ich Raum bricht. Ja, das scheint so zu sein.Wobei ich glaube, ich auch denke, also, was ich auch wichtig finde, ich finde, dann ist man ja nicht so weit weg von so Protestwahl -Narrativen.Wenn man so Forschern wie Marcel Lewandowski zuhört, der sagt ganz klar, naja, das ist aber auch, also, gibt schon auch vielleicht ein paar ProtestwählerInnen, aber die Leute wählen auch einfach, was sie möchten.Also sie sind auch einfach hart rassistisch und sie wählen genau das und das sind auch einfach sehr gefestigte Einstellungen und Strukturen, die man jetzt nicht mehr so einfach unbedingt wegbekommt.Also er nimmt die Wähler in der quasi in keinster Weise aus der Verantwortung so.Ne ne, also dafür was man wählt ist man schon verantwortlich.Aber ich glaube, also zum einen ein gewisser Prozentsatz der Leute ist sicher Protestwähler. Ja. Ja.
[1:09:45] Vielleicht haben die auch einmal als Protestwähler angefangen und glauben es inzwischen, weil sie dem zu viel zuhören, so Effekte gibt es ja auch, dass man dann sozusagen, wenn man das einmal gemacht hat, dass man sein Selbstbild einem dann da, dass sich das dem anpasst, was man getan hat.
[1:10:05] Und teilweise wird ja auch jetzt zum Beispiel so rassistische Einstellungen, die werden ja teilweise auch aufgebaut.Und wenn dann immer wieder in der Öffentlichkeit drüber gesprochen wird und gesagt wird, hier, die Einwanderer sind schuld an deinen Problemen, dann gibt es halt einen Teil der Bevölkerung, der ist halt offen dafür.Der wäre aber auch zum bestimmten Zeitpunkt vielleicht offen für eine andere Erklärung gewesen, wenn man die ihm denn da geboten hätte.Ja, hast du sicher recht, ja. Und das ist was, was da glaube ich, ich sag mal, die Politik oder die etablierte Politik, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, hat das halt versäumt, weil sie sich auf bestimmte Interessen konzentriert haben, aus welchen Gründen auch immer.Vielleicht auch, weil sie selber dazugehören, vielleicht weil da der effektive Lobbyismus war oder ich glaube bei vielen auch, weil sie wirklich dran glauben, dass das besser ist, aber es ist halt in eine Richtung gegangen, die halt eigentlich dem widerspricht, was man eigentlich möchte oder auch was sie möchten und ja, da muss man halt jetzt gucken, wie man da wegkommt.
[1:11:17] Apropos Rassismus, ich überspringe jetzt nochmal das Föderalismus -Reform -Kapitel am Ende, da sagen sie im Prinzip, naja, der Bundesrat hat zu viel Macht und Landtagswahlen sind halt häufig doch auch von bundespolitischen Stimmungen gefärbt, was immer wieder dazu führt, dass man im Bundesrat Mehrheiten gegen Bundestagsgesetze durchsetzen kann, weil es eben diese Zustimmungsgesetze gibt, die Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017.
[1:11:42] Ja, immer wenn es um Finanzen der Länder oder Verfassungsänderungen oder die Organisations – und Verwaltungshoheit geht.
[1:11:49] Eben dann können Länder dagegen stimmen und ja, es gibt eben häufig den Passus, dass, wenn es Koalitionen gibt und eine Partei ein Problem mit einem Passus hat, man sich enthält und der Bundesrat ist eben so gestrickt, dass Enthaltungen wie Nein -Stimmen wirken und dann werden Sachen blockiert einfach nach Parteilinie.Und eigentlich ging es mal in der Idee des Grundgesetzes darum, dass immer, wenn die Interessen der Länder tatsächlich berührt sind und nicht nur, weil die SPD, die Union oder die Grünen oder wer auch immer gerade in der Position ist, ein Problem mit irgendwas hat, dass dann der Bundesrat eben einschreiten kann.Und da setzen sie sich zum Schluss nochmal sehr stark mit auseinander und schlagen da im Prinzip die Reform vor, dass diese Enthaltungen jetzt mal aufhören, weil sie sagen, naja, das verwässert halt Zurechenbarkeit von Entscheidungsprozessen.Wir haben Bundesgesetze, die beschlossen werden und dann werden die immer wieder verwässert, wie jetzt zum Beispiel beim Bürgergeld.Und am Ende brauchst du sehr, sehr breite Koalitionen, um irgendwas durchzusetzen.Also jetzt musst du eigentlich im Prinzip für wichtigste Gesetze, brauchst du eben SPD, Grüne, FDP und auch die Union als große Oppositionspartei, die eben in vielen Koalitionen sitzt.Und dann hast du am Ende Bundesgesetze, die durchgesetzt werden, die eben völlig politisch unklar zugerechnet werden können.Aber das nur ganz kurz, weil wir so weit fortgeschritten in der Zeit sind.
[1:13:12] Zum Thema Rassismus. Sie sagen am Ende, und da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil dann ich…
[1:13:21] Ich würde sagen, weil es mit dem Buch an sich, mit den Aussagen nicht so viel zu tun hat, aber sie haben am Ende noch mal ein sehr wichtiges Kapitel, wo sie sich, damit beschäftigen, dass sie eben als weiße, sehr privilegierte Männer dieses Buch geschrieben haben und sagen, naja, das, über das, was wir schreiben, das sind halt alles Sachen, die kann man politisch und juristisch angehen.Das sind ja viel Infrastrukturprobleme, die wir besprechen, aber die Kultur, die kann man über diese, also die politische Kultur, aber auch die allgemeine Kultur, die in Gesellschaftszustand kann man darüber eben schlecht adressieren, auch wenn das sicherlich mittelbar Effekte hat.Und sie reflektieren einfach nochmal sehr stark, wie implizit sie Rassismen verinnerlicht haben.Also auch sie als eigentlich aufgeklärte, auch sich links verstehende Leute.
[1:14:08] Und ja, sie sagen, sie geben noch mal so ein bisschen an die Hand, wie wichtig Perspektivwechsel sind.Wie das, damit man eben versteht, wie das Leben ohne Mehrheitsprivilegien aussieht.Wie wichtig vielleicht auch sorgfältige Wortwahl und auch Reflektion immer wieder sind über Annahmen und Gedanken, die man so mit sich vor sich her trägt.Und sie sagen auch, na ja, gerade an uns, und das bist dann auch du und das bin dann auch ich, eben mit so, wie wir gelesen werden oder wie wir quasi entlang der verschiedenen Differenzlinien in der Gesellschaft gelagert sind, wie wichtig es ist, dass Menschen wie du und ich oder die beiden eben auch gegen rassistische Äußerungen Widerspruch erheben, auch in Familien, in Freundeskreisen, weil wir eben dann doch relativ viel gesellschaftliche Macht haben, damit sich da eben was ändert.Und sie sprechen sich ganz stark für eine stärkere Repräsentation von unterrepräsentierten Gruppen aus.Und das war von meiner Seite die Baustellen der Nation.Ja, zum letzten Punkt hätte ich vielleicht noch eine kleine Anmerkung.
[1:15:17] Was mir persönlich immer ganz gut geholfen hat, ist…Mich auch immer wieder in sozialen Kontexten zu bewegen, die anders sind, als meine Haupt -Peer -Group, sage ich mal.Oder in gewisser Weise auch meine Peer -Group zu erweitern.Das hat bei mir immer ganz gut durch Sport geklappt, wo ich dann in Sportgruppen war, wo eben nicht nur, Studenten oder Studierte sind, sondern eben auch zum Beispiel Polizisten, Gefängniswärter, aber auch auch Hartz -IV -Empfänger, Menschen mit verschiedenen Migrationshintergründen und dass das auch ein Weg ist, um sich selber da so ein bisschen einen breiteren Blick zu kriegen.
[1:16:03] Also wenn man halt jemanden kennt, der wirklich Hartz -IV -Empfänger ist oder jetzt Bürgergeldempfänger, ich habe da immer noch die alte Sprache im Kopf, dann hat man da vielleicht auch einen anderen Blick drauf, als wenn man das nicht hat.Und wenn man auch wirklich ein paar leute kennt die nicht akademiker sind dann versteht man vielleicht auch ein bisschen besser wie die denken und wie die auf bestimmte diskussionen gucken als wenn man immer nur unter anderen akademikern idealerweise noch oder unter umständen noch aus dem selben fachbereich ist und ich glaube generell tut das jedem gut da einfach seinen blick zu erweitern.Man muss da nicht mit allem übereinstimmen, aber einfach, dass man so ein bisschen auch andere Lebenswelten selber mehr wahrnimmt über Menschen und nicht nur als Statistik oder als Ergebnis einer Umfrage.
[1:16:51] Ja, finde ich, finde ich ein gutes, gutes Schlusswort.
Mehr Literatur
[1:16:58] Soll ich mal eben die Folgen und Bücher in Schnellvariante durchgehen, die ich mir vorab überlegt habe?Ja, und dann kann ich noch ergänzen, was mir noch so eingefallen ist.Genau, zu den Folgen sage ich jetzt gar nicht viel.Ihr könnt sie anklicken und dann seht ihr die Kurzzusammenfassung, worum es geht.Also ich habe einmal die Werte der Wenigen vom Philosophikum Lech aufgeschrieben.Das ist Folge 55, Amanda hat vorgestellt.Dann Folge 52, The Innovation Delusion von Lee Winsell und Andrew L.Russell, das hat Nils vorgestellt.Ich habe die Alten Republik in Folge 48 vorgestellt von Stefan Schulz.In Folge 44 habe ich The Entrepreneurial State von Mariana Mazzucato vorgestellt.Und in Folge 39 hat Amanda vom Ende des Gemeinwohls von Michael J. Sandel vorgestellt.Ich glaube, die passen alle thematisch ganz gut. An Büchern habe ich mitgebracht einmal eine Graphic Novel, die ich finde sehr schlecht übersetzt wurde.Es hat mich wahnsinnig beim Lesen geärgert, aber ich glaube für so ein, ja, für vielleicht mal einfach mal zum Weglesen und dann doch irgendwie ein bisschen Einblick kriegen.
[1:18:07] Kapital und Ideologie. Also es ist eine Graphic Novel nach dem Buch von Thomas Piketty, geschrieben von oder gemalt, gezeichnet wie auch immer von von Claire Allais und Benjamin Adam, oder Benjamin Adam, keine Ahnung, und genau, dann habe ich ein kleines Reklambüchlein schon ein paar Mal empfohlen, das ist die träge Transformation von Sascha Friesicke und Johanna Sprondel, wo es eben vor allen Dingen auch um Digitalisierung geht und warum das alles so schwierig und langsam in Deutschland ist und zum Thema einfach, ja, Steuerungsfantasien beim Staat und warum das aus harttheoretischer Perspektive alles gar nicht so schwierig ist und verschiedene Paradoxien mit sich bringt und so Ironie des Staates von Helmut Wilke, der Systemtheoretiker auch.Ja, das sind meine acht Empfehlungen.Ja, dann hätte ich so ein paar von unseren alten Podcast -Folgen, die glaube ich so ein bisschen den Blick weiten auf, ich sag mal das Thema Wirtschaft, weil ich denke, dass viel an dem Reformstau auch daher kommt, dass da eine bestimmte Wirtschaftsideologie hinter steckt.Da fällt mir meine erste Folge ein, die Quantum Economics.Ja, sehr gut. und auch die Schulden, die dann direkt danach die Folge 32 war.
[1:19:31] Dann auf jeden Fall eigentlich alle Bücher von Mariana Mazzucato, wo wir einige schon hier im Podcast hatten.Du hast gerade schon The Entrepreneurial State genannt.Ich glaube auch, wie hieß das, genau, die große Consulting Show hatten wir auch schon, zu dem Thema mit den Lobbys, die zum Beispiel den Klimaschutz bremsen, also allgemein dazu Merchants of Doubt. das hatte ich vorgestellt, das sind glaube ich so an Podcasts die, die mir jetzt so einfallen, also an Podcast folgen.Was ich noch hatte, also noch zwei Bücher, ich hatte es glaube ich schon mal erwähnt, Lobbyland von Marco Bülow.
[1:20:26] Das hatte ich in der Weihnachtsfolge erwähnt, sicher ein aktivistisches Buch, muss man auch nicht mit allem übereinstimmen, gibt einem aber zumindest nochmal einen anderen Blick, so ein bisschen auf die Politik, wie die so abläuft und ein Buch, was ein bisschen ähnlich, aber zu einem ganz anderen Thema ist, wie die Baustelle der Nation Realitätsschock von Sascha Lobo.Das ist, glaube ich, noch vor der Pandemie erschienen und da geht es einfach um so die Herausforderungen, gerade auch im Umfeld der digitalen Welt oder generell unserer Welt, und wie die einen mental auch herausfordern.
[1:21:06] Und dann hätte ich noch jetzt, gerade beim letzten Thema ist mir noch eingefallen, einen Podcast, der heißt In guter Verfassung.Das ist eine Investition, also es ist abgeschlossener Podcast, der ist 2019 und zwar bis 2020 erschienen, zum Jubiläum des Grundgesetzes und da geht, wird also wirklich durch das ganze Grundgesetz durchgegangen.Mit verschiedenen Interviewpartnern, teilweise Rechtsprofessoren.Philipp Amthor ist auch relativ häufig dabei, weil der glaube ich zum Grund irgendwelchen Verfassungsfragen promoviert, aber es ist eigentlich eine recht breite Mischung an Gästen, die damit vorstellen.Und da ist auch ein Verfassungshistoriker dabei, der dann auch an einigen Stellen, wo es Verfassungsänderungen und sowas gab, kommentiert.Und es ist auch interessant, was alles so im Grundgesetz drinsteht, zum Beispiel war irgendwie, als es geschrieben wurde, noch gar nicht klar, für welches Wirtschaftssystem man sich entscheidet.Und deswegen sind da auch so Dinge wie zum Beispiel Enteignungen drin vorgesehen, falls man das tun will.Ja, es ist ganz spannend, mal so ein bisschen zu sehen, was denn alles möglich ist, auch in unserem System, so wie es im Moment ist, was einen selber überraschen könnte.
[1:22:32] Genau das wäre, wäre was mir jetzt so zum thema eingefallen ist ja super dann ist doch schon wieder einiges zusammengekommen ah ja diese spezialfolgen der lage der nation und den podcast an sich verlinke ich natürlich auch ja das ist das ja glaube ich völlig klar ja also auch sehr lohnenswert also von den zwei drei.
[1:22:52] Wochen Zusammenfassungs -Podcast, die ich höre, muss ich sagen, finde ich Lage der Nation ist meistens das Beste.Also am sachlichsten und am besten durchdacht in vielen Themen.Naja, ich finde gerade bei Ulf Burmeier einfach spannend, der hat einfach juristisch so enorm viel Ahnung und das ist halt bei einer politischen Berichterstattung abseits von allen Meinungen und so schon immer auch ganz wertvoll, finde ich.Ja und auch als Vertreter ich sag mal der der Freiheitsrechte schon durch die gesellschaftliche Freiheitsrechte hat er auch öffnen sehr schönen bürgerrechtlichen Blickpunkt auf Themen das finde ich auch sehr schön.Ja und ich will aber ohne Philipp Bannse jetzt ausnehmen zu wollen ich finde da merkt man einfach ein sehr sehr guter Journalist ist das das der das sein Handwerk da auch gelernt hat also das ist finde ich einfach auch auffällig gerade wenn die Interviewgäste haben das das merkt man dann schon ja.Ja und auch selbst wenn man mal mit einer Meinung die sie äußern nicht übereinstimmt aber es ist immer auf eine sehr gute Art vorgetragen. Ja.Also und man hat wirklich einen Überblick was in der Woche so politisch passiert ist. Und das ist wahr.Gut.
Ausstieg
[1:24:09] Music.
[1:24:24] Ich glaube, dann bleibt uns nur noch ein bisschen Hausmeisterei.Also, wir haben natürlich eine Homepage, Moment, zwischenzweideckeln .de heißt die, wenn ich mich richtig erinnere.Und bei den ganzen, wir sind auch auf Facebook als Zwischenzweideckeln.Und bei den ganzen sonstigen Social Media Seiten, da musst du mal kurz einspringen, die habe ich nie so im Kopf. Ja, also ich glaube Twitter können wir langsam mal ad acta legen, da tummeln wir uns nicht mehr, aber wir sind auf Mastodon unter, zzd at podcast .social und wir sind auf Instagram unter dem Händel Deckeln zu finden, ja.Ja, ansonsten könnt ihr uns in den üblichen Podcast Verzeichnissen und Playern finden, da wo es möglich ist, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns eine Bewertung oder einen Kommentar da lasst.Und freuen uns dann auf die nächste Folge und sagen bis dahin tschüss.
[1:25:29] Music.
Der Beitrag 065 – „Baustellen der Nation“ von Philip Banse und Ulf Buermeyer erschien zuerst auf Zwischen zwei Deckeln.

Oct 19, 2023 • 1h 27min
064 – „The Web of Meaning“ von Jeremy Lent
In unserer längsten regulären Episode bisher stellt Nils ein Buch vor, das viele Stränge zusammenführt, die sich hier durch unseren Podcast ziehen. In seinem Buch „The Web of Meaning“ nimmt sich der Autor Jeremy Lent nämlich nicht weniger vor, als das moderne westliche Weltbild aus individualistischem Kapitalismus, reduktionistischer Wissenschaft und allgemeinem menschlichen Überlegenheitsgefühl einer wissenschaftlichen Überprüfung zu unterziehen. Dabei kommt er zu dem für einige vermutlich überraschenden Ergebnis, dass der aktuelle Stand der Wissenschaft das westliche Weltbild in weiten Teilen widerlegt und eher den klassisch ost- und südostasiatischen Blick auf die Welt bestätigt.
Shownotes
Blog von Nils mit zahlreichen kurzen Artikeln zu den Themen des Buchs: Weltenkreuzer.
ZZD001: „Resonanz“ von Hartmut Rosa
ZZD003: „Alles ist relativ und anything goes“ von John Higgs
ZZD006: „Ein Sommer mit Wölfen“ von Farley Mowat
ZZD011: „Religion für Atheisten“ von Alain de Botton
ZZD018: „Muster“ von Armin Nassehi
ZZD027: „The Knowledge Machine“ von Michael Strevens
ZZD037: „Im Wald vor lauter Bäumen“ von Dirk Brockmann
ZZD038: „Anfänge“ von David Wengrow und David Graeber
ZZD043: „Der erweiterte Phänotyp“ von Richard Dawkins
ZZD046: „Erzählende Affen“ von Samira El Ouassil und Friedemann Karig
ZZD049: „The Collapse of Chaos“ von Ian Stewart und Jack Cohen
Bregman, R. (2020). Im Grunde gut: Eine neue Geschichte der Menschheit . Rowohlt.
Bridle, James: Die unfassbare Vielfalt des Seins. C.H. Beck
Daston, L., & Fischer-Barnicol, D. (2018). Gegen die Natur. Matthes & Seitz Berlin.
Gerhardt, V. (2016). Glauben und Wissen: Ein notwendiger Zusammenhang. Reclam.
Godfrey-Smith, Peter: Der Krake, das Meer und die tiefen Ursprünge des Bewusstseins. Matthes & Seitz Berlin.
de Waal, Frans: Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are?. W. W. Norton.
Wohlleben, P. (2019). Das geheime Leben der Bäume: Was sie fühlen, wie sie kommunizieren – die Entdeckung einer verborgenen Welt. Wilhelm Heyne Verlag.
Yong, Ed: Die erstaunlichen Sinne der Tiere. Kunstmann.
Zadeh, J. (2021). The Conscious Universe.
In der Episode nicht genannt, aber Amandas‘ Erachtens nach sehr lesenswert zum Thema:
François, B. (2021). Die Eloquenz der Sardine: Unglaubliche Geschichten aus der Welt der Flüsse und Meere. C.H.Beck.
Nagel, T., & Diehl, U. (2016). What is it like to be a bat? Englisch/Deutsch = Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Reclam.
Oreskes, N. (2019). Why trust science? Princeton University Press.
Quellen und Co
Intro und Outro der Episode stammen aus dem Stück Maxixe von Agustin Barrios Mangore, eingespielt von Edson Lopes (CC-BY).
Das Umblättern zwischen den Teilen des Podcasts kommt hingegen von hoerspielbox.de.
Zwischen zwei Deckeln findest du auch im sozialen Medium deiner Wahl: Mastodon und Bluesky.
Transkript
(automatische Transkription, nicht bereinigt)
[0:00] Music.[0:16] Hallo und herzlich willkommen zur Folge 64 von Zwischen zwei Deckeln.Ich bin Amanda und darf heute dem Nils zuhören.Hallo zusammen.So Nils, ich bin ein bisschen erkältet oder wie man in der Schweiz sagt verkeltet.Deswegen ganz glücklich, dass ich danach dir zuhören darf.Aber hatte das Vergnügen, mich übers Wochenende unter der Bettdecke zu verstecken und The Foundation, die Serie anzuschauen.Hast du sie gesehen? Erste Staffel, zweite Staffel noch nicht.Ich bin noch an der ersten. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen.Es gab Momente, da musste ich abstellen. Und ich dachte mir, ach nee, das geht jetzt echt nicht mehr.Und dann nach ein paar Stunden hab ich weiter geschaut. Ja, ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll.Ja, ich weiß tatsächlich auch nicht, ob ich die bingen wollen würde.Ich glaub, aber der Serie, der tut es ganz gut, wenn man zwischen den Folgen so ein bisschen Zeit hat.[1:16] Dass sich das Gesehene setzt und dass man nicht zu viel von dieser Art von Serie sozusagen wahrnimmt.Ah, meinst du? Ja, vielleicht. Ja, kann sein. Also ich musste wirklich auch abstellen, weil manchmal hat es mich schon ein bisschen genervt.Also, aber ja, das Buch ist schon lange her, als ich das gelesen habe, also die Trilogie von Asimov.Und es ist schon, ich glaube, ich lese es nochmal, weil die haben ja schon vieles verändert im Sinne von diverser und inklusiver und so weiter.Und ich würde schon das Buch gerne nochmal mit diesem Mindset lesen. Habe ich natürlich vor langer Zeit damals nicht so gemacht. Ich weiß nicht, wie gut die altern.Ja, also ich habe tatsächlich, ich glaube, Foundation selber auch noch nicht gelesen, aber andere Sachen von Asimov. Ich habe jetzt zu der Serie gehört, irgendwer sagt, ja, es ist nicht, also es setzt nicht die Geschichte um, die Asimov erzählt.Aber was es umsetzt, ist so das thematische, das atmosphärische, nur eben ins 21. Jahrhundert im Grunde transponiert.Also es ist im Grunde weniger eine Umsetzung, als wirklich so eine Interpretation, Transponierung irgendwie in unsere Zeit.Aber es ist jetzt auch nur Hörensagen wiedergegeben.[2:26] Ja, mal schauen. Mit was beschäftigst du dich im Moment? Ja, ich hab tatsächlich das Buch, was ich euch gleich vorstellen werde, hat bei mir so ein bisschen so ein, oh da will ich mehr drüber wissen Impuls ausgelöst und steigt jetzt gerade ganz tief so in dieses Thema Intelligenz bei Tieren ein.Also ganz tief im Sinne, wie man das halt so als Freizeitprojekt neben Job und Kleinkind tun kann.Und ja, vertieft das für mich so ein bisschen, schreibt darüber auch relativ viel, also wen das interessiert, weltenkreuzer.de gibt’s von mir gerade jeden Tag, jeden zweiten Tag irgendwie kurze Artikel zu genau dem Thema.Vielleicht auch ganz gut als Anschluss sozusagen an diese Episode, weil das tatsächlich für mich auch genau daraus, dem ersten Teil, den ich euch gleich auch vorstellen werde, entsprungen ist.Insofern ist das ganz spannend. Also ich lese viel, ich schreibe viel neben dem, was der Alltag halt so mit sich bringt.[3:16] Ja, ich kann das auch sehr empfehlen, dein Blog. Fand ich sehr spannend. Auch sehr eine gute Größe von deinen Beiträgen.Die kann man so schön häppchenweise lesen. War jetzt, ja, habe ich mir auch angeschaut natürlich jetzt für das Buch.Also sehr empfehlenswert. Ich, das Buch ist ja, bringst du mit von Jeremy Lent, das ist der Autor, der ist auch vor allen Dingen Autor, diese Person. Und das Buch heißt The Web of Meaning, Integrating Science and Traditional Wisdom to Find Our Place in the Universe. Ist 2021 erschienen und klingt jetzt nicht nach einem Buch, dass wir so mal schnell in der Stunde Ja, ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher. Meine Notizen sind relativ lang, aber nach hinten raus wird es immer diffuser und unschärfer. Insofern kann man im Zweifel wahrscheinlich auch irgendwo mittendrin, mittendrin so nach dem ersten Teil aufhören, ohne dass zu viel verloren geht.Okay, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Magst du uns gleich mal das TLDL geben?
Tl;dl
[4:22] Ja, gerne doch. In The Web of Meaning macht sich Jeremy Land auf den Weg, im Kern das gesamte grundlegende westliche Weltbild zu widerlegen.Er stellt sich gegen Individualismus, gegen wissenschaftlichen Reduktionismus, und gegen ein mechanistisches Weltbild.Und zeigt auf, dass der aktuelle Stand der Wissenschaft eigentlich eher der ostasiatischen Philosophierecht gibt, als unserer westlichen.
Buchvorstellung
[4:57] Okay, klingt nach ner Keule. Ja, ist es auch, aber ich fand es tatsächlich erstaunlich zugänglich. Also Jeremy Lent hat ein zweites Buch geschrieben, ein Prequel sozusagen, mit dem schönen Titel The Patterning Instinct, dass ich vor ein paar Jahren auch gelesen habe und wo ich mich damals entschieden habe, das ist nichts für den Podcast, weil es erstens noch dichter ist und weil ich zweitens auch bei weitem nicht alles glaube verstanden zu haben.Also jetzt ist es, bei dem Buch ist es auch so, ich habe definitiv nicht alles verstanden.Aber da war es so, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte, das irgendwie zusammenfassend vorzustellen.Hier bei dem Buch möchte ich ein Disclaimer vorweg schicken, er redet relativ viel über asiatische Philosophie.Also Taoismus, Buddhismus, in denen ich persönlich mich nicht auskenne.Das heißt, das, was ich hier darüber sage, ist das, was Jeremy Lent schreibt.Wenn da irgendwelche groben Missverständnisse, unzulässige Verkürzungen oder so drin sind, dann liegen die entweder bei Lent oder bei meinem Verständnis von Lent.Ich möchte hier nicht den Anspruch erheben, das in irgendeiner Form adäquat, abschließend oder präzise zusammenzufassen.Ich möchte das jetzt nur als Denkanregung und Ausgangspunkt für weitere Recherchen an den Stellen verstanden wissen.[6:12] Genau. Das vielleicht als kleiner Disclaimer vorweg, weil wir uns doch auch in Felder begeben, die aus einer westlichen, wissenschaftlichen Welt.Ja, die wirken oft sehr esoterisch, aber Lents Wege dahin sind sehr überzeugend.Okay, interessant. Sag ich als jemand, der auch sehr auf ein wissenschaftliches Schema normalerweise kommt. Aber fangen wir mal mit dem Buch an.Ich glaube genug vorgequatsche. Das Ziel, was Jeremy Lin verfolgt, ist glaube ich schon relativ sprechend.Er sagt nämlich, das habe ich gerade auch schon angedeutet, er geht da von dem Punkt aus, dass es sowas gibt wie Weltbilder, also so ein Blick auf die Welt und ein grundlegendes Verständnis der Welt, wie man der Welt gegenüber tritt.Und dass dieses Weltbild eigentlich im Grunde alles prägt, was wir tun. Als Individuen, aber auch als Gesellschaften oder als in irgendwelcher Art geartet Kollektive.Und er sieht da halt ein heutzutage weitestgehend dominantes westliches Weltbild und stellt dem so ein bisschen entgegen, eher ein südostasiatisches Weltbild, also primär China und Indien in dem Kontext.Und sein Punkt ist halt, dass uns das westliche Weltbild zwar zum aktuellen wissenschaftlichen Stand gebracht hat, dass dieser aktuelle wissenschaftliche Stand aber eher das asiatische Weltbild bestätigt.[7:29] Das ist so ein bisschen der Twist, der sich dann auch durch das ganze Buch durchzieht.Ich glaub, wenn man von dem Hintergrund auf die Sachen guckt, dann ist das auch ganz gut zu verstehen.Er hängt das Ganze auf an so, ja im Grunde sehr einfachen Fragen.Wer bin ich? Wo bin ich? Was bin ich? Wie sollte ich leben? Warum bin ich? Und wohin gehen wir?Die ganz kleinen, irgendwie nicht so relevanten Fragen, die man bestimmt mal in 5 Minuten beantworten kann.Lustigerweise ist sein Buch spannend aufgebaut.Er hat nämlich am Ende jedes seiner Kapitel und am Ende dieser großen Frageblöcke, also diese Fragen haben jeweils noch mehrere Kapitel drunter, hat er immer so eine Kurzzusammenfassung, so wirklich in einem oder zwei Sätzen.Was ich tatsächlich ganz spannend finde und sehr hilfreich, auch jetzt für die Vorbereitung dieser Folge.Ich möchte diese Fragen mit euch jetzt einfach mal durchgehen. Und dann gucken wir mal, Amanda, wo wir uns in irgendwelchen Diskussionen oder Fragen vielleicht ein bisschen vertiefen.Er fängt an mit, wer bin ich? Das ist tatsächlich auch für mich fast der spannendste Teil, aber naja, die anderen Teile sind auch spannend.Also, wer bin ich? Seine Antwort am Ende, ich werde die jetzt am Anfang immer einmal kurz geben auf Englisch.I am the integrated product of my animate and conceptual consciousness, an ongoing process of I and self, continually interacting.So, da steckt jetzt eine Menge drin und das wollen wir jetzt mal aufdröseln.[8:55] Also er hat hier, fängt er mit diesem Kontrast im Grunde dieser beiden Weltbilder, ich werde jetzt vereinfacht westliches und asiatisches nennen, auch wenn da natürlich viel mehr Komplexität hinter steckt.Und er beginnt beim Verhältnis von Mensch und Natur.Und er diagnostiziert, da ist er nun wahrlich auch nicht alleine, dem westlichen Weltbild, eine gewisse Entfremdung, also der Mensch, der sich nicht irgendwie als Teil der Natur versteht, sondern über die Natur erhebt, sich als grundsätzlich unterschiedlich versteht und eben in einer marxistisch-philosophischen Tradition auch als entfremdet.Das heißt, da ist irgendwie kein enger Bezug, keine Beziehung. Ist ja auch ein Topos, der bei Hartmut Rosa auftaucht, den wir in Resonanz ja auch schon besprochen haben, in Episode 1 glaube ich.[9:36] Und woher kommt diese Entfremdung? Und da setzt er jetzt beim asiatischen Weltbild an und kommt da mit dem Konzept des Wu-Wei.Das ist im Grunde was, was so ein bisschen, wenn man es auf Menschen überträgt, im Westlichen dem Flow entsprechen würde.Also so einem selbstverständlichen, natürlichen Ablauf der Dinge in Einklang mit allem drumherum, ohne irgendwie jetzt Nöte und Sorgen sozusagen.Also jetzt im menschlichen Sinne Nöte und Sorgen, sodass das natürliche Fließen, das Funktionieren der Welt, so wie sie funktionieren soll.Das nennt er Wu-Wei. Und jetzt gehen das asiatische und das westliche Weltbild, blicken unterschiedlich auf den Menschen in diesem, von diesem Punkt ausgehend.Man kann das auch so ein bisschen als so einen Naturzustand verstehen, wenn man jetzt westlich-philosophisch bleiben will.Ähm, und das westliche Weltbild sagt halt, der Mensch ist besonders, und das besonders Gute des Menschen ist, dass er rational denken kann, dass er konzeptionell denken kann, dass er Sprache nutzen kann, Und deswegen über diesem Flow, diesem natürlichen, diesem Wu-Wei erhoben ist, erhaben ist.So, das macht den Menschen aus und das ist das, was den Menschen gut macht, was den Menschen besser macht.[10:54] Okay. Im chinesischen Weltbild, im asiatischen Weltbild, die würden das auch erstmal sagen.Dass gerade die Sprache irgendwie den Menschen ausmacht und von anderem Leben in der Natur abgrenzt.Aber die würden eben auch sagen, dass das der Kern dieser Entfremdung ist.Das heißt, dass das sozusagen, wenn man es jetzt christlich framen würde, im Grunde die Ursünde wäre.Das Nutzen von Sprache ist das, was den Menschen aus der Natur entfremdet, aus dem Wu-Wei entfernt, Und woraus im Grunde alles andere, was wir jetzt auch so als Probleme in gewisser Weise wahrnehmen, als Entfremdung wahrnehmen, das daraus entsteht.[11:38] Weil wir eben nicht in diesem, uns nicht darauf einlassen, in diesem natürlichen, wahrscheinlich auch ein bisschen verklärt, Flow sozusagen zu leben.Okay, also Flow verstehen wir hier nicht im Sinne von Produktivitätsflow oder was ganz anderes?Ja, aber es geht so um dieses Gefühl. Es geht um dieses Gefühl, genau da zu sein, wo man irgendwie sein soll, genau das zu tun, was man gerade tun soll, ohne irgendwie, dass einem von links und rechts irgendwie der Kopf reinredet oder irgendwelche Sorgen da sind.Das ist eine sehr unzulängliche Übertragung, weil das eben, du hast völlig recht, bei uns immer eher so produktiv geframed ist.Aber es geht eher so um dieses Gefühl, dieses Strömen, dieses selbstverständliche Strömen der Natur vor sich hin.Okay. Und der Mensch könnte sich in diesem Strom mitfließen und wenn er das nicht tut, dann ist das jetzt in diesem Fall die Entfremdung.Genau. Ob er es könnte, weiß ich nicht, aber er tut es nicht.Okay.So. Aber genau. Das scheint mir so ein bisschen die Diagnose zu sein.[12:48] Lent macht das dann auch noch so ein bisschen biologisch, neurologisch fest.Da kannst du mir jetzt im Zweifel gnadenlos widersprechen, beziehungsweise Lent.Weil er eben sagt, er hängt das tatsächlich primär im präfrontalen Kortex auf.Der ja auch, wenn man so Bewusstseinstheorien sich anguckt, Neurologische Forschung, das ist auch das, was bei mir so aus anderen Kontexten hängen geblieben ist, ganz stark so diese, ja für Englisch würde man es Executive Functions nennen, irgendwie angeht, also so diese Selbstkontrolle im Grunde, dass wir irgendwie den ersten Impulsen nicht nachgeben, sondern in der Lage sind, Belohnungen aufzuschieben, unsere Wut irgendwie umzukanalisieren und nicht gegenüber ins Gesicht zu schlagen.Das ist das, was man mit kleinen Kindern sich auch irgendwann entwickeln sieht, so um 3-4 Jahre, ratet mal wie alt mein Kleiner gerade ist.Also das ist genau diese Instanz im Grunde, unser Kopf, die in der Lage ist, so diese ersten Impulse zu regulieren, sie auszubremsen, sie umzulenken.Da verankert er so diese Entfremdung so ein bisschen, weil es ist ja genau, was ich sagte, ihre Aufgabe.Das ist genau ihre Aufgabe, diese ersten Impulse umzulenken, auszubremsen.[14:00] Okay, ja. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wir kommen dann nachher nochmal hin, warum das nicht so komisch ist, wie es jetzt klingt.Weil Lent fordert nicht, dass wir alle einfach nur das machen sollten, was unser Kopf gerade sagt.Also wild um uns prügeln und keine Belohnung mehr aufschieben oder so, das sagt er definitiv nicht.Aber trotzdem ist da ein Haken drin, da kommen wir nachher nochmal wieder zurück, wenn es um das Ich und das Selbst geht.[14:26] Was wir als Menschen, gerade als Westler, sehr gut gelernt haben, ist uns auf unser konzeptionelles Denken zu verlassen.Das ist ja auch wirklich Kern des westlichen Selbstverständnisses.Wir denken rational. Die komplette dominante westliche Philosophie fundiert irgendwie auf ich denke, also bin ich.Auf benutze deinen Verstand, benutze deine Vernunft.Also die betont immer diesen rationalen, konzeptionellen, auch sprachlichen Aspekt des Denkens.Und was wir nahezu komplett verlernt haben zu nutzen, ist das, was Land Animate Intelligence angeht, also ich nenne es jetzt mal belebte Intelligenz, das ist so, ja, was uns unser Körper sagt, was unser Muskelgedächtnis sagt, was uns unsere Intuition sagt, sind ironischerweise die Sachen, die wieder auftauchen, wenn es zum Beispiel um Leistungssport geht, Wenn es um hervorragende, wenn es um Kunst, Musik spielen auf extrem hohem Niveau geht, wenn es um Expertenentscheidungen in Bruchteilen von Sekunden geht, dann taucht sowas wie Muskelgedächtnis und Intuition als Begrifflichkeit irgendwann wieder auf.[15:31] Aber es ist irgendwie sowas Besonderes, was Ungewöhnliches. Eigentlich denken wir Wessler konzeptionell rational.Aha. Und wenn er sagt verlernt, meint er damit, dass das in einer früheren Gesellschaft vorhanden war?Ich weiß nicht, ob er sagt, dass es in einer früheren Gesellschaft vorhanden war, er sagt aber, dass es vorhanden sein könnte.Okay. Ach da wieder, er argumentiert eigentlich nicht historisch. Also wenn ich sage verlernt, dann lese ich da immer was historisches rein, was er glaube ich gar nicht so tut.Weil dann müsste er die komplette Geschichte auch noch rekonstruieren und ich glaube, das wäre auch als Anforderung einfach ein bisschen heftig, aber auch an deinem Buch.Er macht das da, macht er das tatsächlich ganz gut in Abgrenzung oder in unserem Umgang mit nicht-menschlicher Intelligenz, also mit tierischer Intelligenz, auch wenn wir Menschen natürlich auch Tiere sind.Weil wir eben auch unser Verständnis der Natur darauf basieren im Grunde, dass nur konzeptionelle Intelligenz echte Intelligenz ist.Also können es auch nur wir Menschen. Weil nur das was wir Menschen können ist Intelligenz, also sind nur wir Menschen intelligent.Okay, ja das ist ein Zirkelschluss dann. Also ein ziemlich tautologischer Zirkelschluss.Er schafft da einen schönen Begriff. Man kennt ja wahrscheinlich diesen Begriff der Anthropomorphisierung.[16:53] Dass man Tieren menschliche Eigenschaften zuschreibt. Ohne dass das irgendwie zulässig wäre.Die Maus freut sich oder die Maus lacht. Dass wir Tiere vor dem Hintergrund menschlicher Schemata verstehen.Und das ist im wissenschaftlichen Kontext was kritikwürdig ist.So, wir dürfen das nicht interpretieren, was die Tiere da tun, wir müssen das irgendwie auf einem konzeptionellen Ebene irgendwie verstehen.Weil da gibt es einen schönen Begriff von Franz de Waal, den Jeremy Lent da noch aufgreift, das ist Anthropo-Denial.Da habe ich keine gute Übersetzung gefunden.[17:32] Dass wir aber auch nicht ins Gegenteilige verfallen dürfen und so eine kategorielle Unterschiedlichkeit zwischen Mensch und Tier einfach als gesetzt annehmen dürfen. Okay.Also ich lese gerade das Buch von Franz de Waal, wo ja genau das auch, wo das Thema ist, wo er halt auch sagt, Ja, es gibt aber auch einfach oft genug Tiere, wo man nach genug empirischer Beobachtung und Analyse zu dem Schluss kommen muss, das ist dann doch dasselbe wie beim Menschen.Zum Beispiel, dass manche Affen sich gegenseitig kitzeln und lachen und das irgendwie als soziales Bonding, Stimmungs-, Atmosphärenthema genutzt wird.So, und eine Kritik an Anthropomorphisierung würde halt sagen, nee, das darf man nicht als menschliches Lachen interpretieren.Und er sagt halt, warum denn nicht? Wir sind doch im Grunde auch nur Tiere.Sollten wir nicht erstmal davon ausgehen, dass die Dinge sich sehr ähnlich sind und dass wir diesen Unterschied, dass das eben nicht menschliches Lachen ist, dass der nicht eigentlich belegbedürftig wäre?Find ich immer eine sehr spannende Perspektive. Ja, da gehe ich mit, solange es halt nicht normativ aufgeladen ist.Also das ist ja dann das Problem.Ja, genau. Klar. Also wir sind jetzt erstmal so bei einem wissenschaftlichen Verständnis. Ja.[18:44] Genau. Er sagt halt auch, dass man menschliche Intelligenz eigentlich nicht als wir sind intelligent und Tiere nicht, denken müsste, sondern als eine spezifische Form von Intelligenz.Eine andere Form von Spezialisierung.Tiere können das in ihren Kontexten halt auch. Die brauchen halt bestimmte Dinge nicht.Das ist auch wieder aus Franz de Waal, aber Franz de Waal sagt halt auch, es ist halt nicht fair von einem Eichhörnchen zu verlangen bis 10 zu zählen.Das muss nicht bis 10 zählen können.[19:13] Das hat nichts mit seiner Intelligenz zu tun, dass es nicht bis 10 zählen kann.Weil warum sollte es bis 10 zählen? Lernen.Also wir müssen Intelligenz immer sozusagen, das ist jetzt auch wieder eher Franz De Waal als Jeremy Land, müssen wir im Kontext, im Lebensraum, in der Umwelt der entsprechenden Spezies verstehen.[19:32] Und was dann? Jetzt kommt ein weiteres. Jetzt haben wir diese belebte Intelligenz und Lent versucht dann das so ein bisschen zusammenzubringen mit menschlicher Intelligenz und hat da, das ist ein Thema, das kommt später nochmal stärker auf, auch den Aspekt von Gefühlen.Weil er im Grunde sagt, so Handlungssteuerung passiert auch bei Menschen und bei Tieren im Grunde über eine Art von Gefühlen.Und weniger über die echte Rationalität.Das was wir Menschenrationalität nennen. Und er sagt, Gefühle könnten so ein bisschen sowas sein, im Grunde Indikatoren für die Abweichung vom Normalfall.So irgendwas im System läuft gerade nicht so wie es soll. Das löst ein Gefühl aus, damit das System reagieren kann und dieses so wie es soll wiederherstellen kann.[20:23] Okay, aber das Gefühl wird, das kann ich wahrnehmen. Also das kann ich schon so rational dann aufgreifen. Oder nicht?Ja, da geht er nicht mehr in die Tiefe, weil er das auch nur von Antonio Damasio übernimmt und nicht selber entwickelt, das Argument.Also es gibt ja generell in der Emotionsforschung diese Spannung zwischen, ist es jetzt ein physiologischer Zustand, also ein körperlicher Zustand?Und was ist wirklich das Gefühl, was wir dem zuschreiben?Also ich hab irgendwie einen Erregungszustand im System und wenn ich das jetzt richtig im Kopf hab, ist zwischen dem Erregungszustand Freude und dem Erregungszustand Angst physiologisch kein Unterschied zu erkennen oder kein großer Unterschied zu erkennen.Woraus die unterschiedliche Bewertung des Gefühls kommt, ist halt die Situation, der Kontext, in dem wir diesen physiologischen Erregungszustand haben.Und das ist glaube ich auch wieder so ein Punkt, wo jetzt Len sagen wird, das macht ihr glaube ich nicht explizit, das ist halt eine kulturelle Zuschreibung.Das ist, also dieses physiologische Gefühl, das ist Element Intelligence.Die Zuschreibung, das ist Angst oder das ist Freude, das ist konzeptionelle Intelligenz.Weil wir dem was zuschreiben. Und jetzt wird vielleicht auch klarer, warum wir eben nicht auf den ersten Impuls reagieren, weil der erste Impuls, da steckt auch schon konzeptionelle Intelligenz hinter.Kommen wir gleich aber noch ein bisschen ausführlicher zu.[21:42] Und das ist auch wieder was, was aus der Emotionsforschung, glaube ich, mittlerweile eher mir Stand zu sein scheint, ist, dass das rationale Denken, was die Handlungssteuerung angeht, oft eher rechtfertigt, warum das Handeln jetzt rational ist, aber nicht die Ursache für dieses Handeln ist. Ja, okay.Das sind so diese ganzen klassischen Begriffe, Dissonanzreduktion, irgendwie Rechtfertigung von Handeln.So, ja, Expostrationalisierung ist, glaube ich, auch noch so ein schöner Begriff.Ja. dass man im Endeffekt sagt, ja, das war doch vernünftiges Handeln, obwohl es eigentlich halt dann doch im Normalfall primär emotional getrieben ist.Also das ist so diese Spannung, die er da so ein bisschen aufmacht, was ich ganz spannend finde.Finde und das bringt ihn dann jetzt immer wieder eher im westlichen begrifflichen kontext zu dem griffen ich und selbst.[22:27] Und das kennt vermutlich jeder, das ist so dieses, ah, ich hätte doch das und das machen sollen, ich habe aber was anderes gemacht.Da sind irgendwie so diese zwei Stimmen im Kopf. Die eine, die was tut und die andere, die das beurteilt, was man tut.Oder das kommentiert, was man tut. Und das ist im Grunde so das Selbst und das Ich. Also das Selbst ist der Teil, der handelt, der agiert.Der auch nur im Moment existiert, der jetzt nicht irgendwie ganz viel gelernt hat, der einfach in der Situation irgendwie ne Wahrnehmung hat und auf diese Wahrnehmung in irgendeiner Form reagiert.Und dann gibt es das Ich, das wäre jetzt bei Freud wahrscheinlich eher das Über-Ich.[23:09] Das irgendwie so die internalisierte Kultur ist, dass du sagst, ja man macht das so, man macht das so, dieser physiologische Zustand in der Achterbahn bedeutet bei dem einen Angst, bei dem anderen Freude, da kommt genau dieser Kontrast irgendwie auch ins Spiel, Und Lent zieht das so ein bisschen weiter bis zu, ich glaube es ist bis zu Platon, mit dem Körper-Seele-Split.Also das ist auch so eine Grundlage des westlichen Denkens.Es gibt irgendwie den Körper, so die Fleischmaschine.Und es gibt die Seele. Das ist das Denken, das ist der Kopf, das ist die Vernunft.Auch da, ihr seht jetzt wahrscheinlich so ein bisschen die Parallelen, wie die sich so durchziehen durch die verschiedenen Argumente.Wir haben auf der einen Seite den Körper, dann haben wir diese belebte Intelligenz, dann haben wir dieses Wu-Wei aus der asiatischen Philosophie und wir haben das Selbst.[24:00] Und dann haben wir eben das Denken, die Seele, das Rationale und wir haben das Ich. Also das ist so ein bisschen so ein Gegenpol.Also ich würde die nicht als Gegner verstehen, sondern so als zwei Pole, die irgendwie immer beide da sind.Und was wir Westler halt gut können, ist, dass das Ich das Selbst kontrolliert.Also, dass das rationale Denken die Gefühle irgendwie kommentiert, rechtfertigt, geringschätzt ja auch oft.Und das führt zu so einem dauernden Konflikt. Das führt zu so einer dauernden Interaktion, irgendwie so einer dauernden Spannung, die irgendwie ein schlechter Ausgangspunkt, eine schlechte Situation ist, in der man eigentlich nicht sein möchte.Und das ist das, was wohl in der buddhistischen Philosophie, glaube ich, als Dukkha bezeichnet wird. Also dieser Zustand, dass ich und das Selbst irgendwie nicht für dieselbe Mannschaft spielen, sondern irgendwie gegeneinander gestellt sind, statt irgendwie miteinander zu agieren.[25:04] So, das war jetzt der wilde Ritt durch den ersten Abschnitt.Könntest du nochmals den Satz wiederholen, den du zu Beginn genannt hast, den englischen?I am the integrated product of my animate and conceptual consciousness, an ongoing process von Ich und Selbst kontinuierlich interagieren.[25:27] Ich glaube, jetzt wird das klar, was damit gemeint ist. Ja, absolut. Ich habe jetzt aber noch nichts wahnsinnig Neues darin entdeckt.Für mich war jetzt auch nicht so viel neu da drin, als einzelnes Wissen.Also außer dieser Bezug zur chinesischen Philosophie, der war mir nicht klar.Aber ich fand es unglaublich kohärent mal zusammengefasst.Und es ist halt auch nur der erste Schritt des Buches. Wir sind ja im Grunde immer noch in der Exposition.Wobei ich das Buch da auch am stärksten finde, muss ich dazu sagen.Weil es das einfach sehr, sehr gut zusammenfasst. So, ähm, wo bin ich?Der nächste Punkt, das ist im Grunde die Frage, was ist das Leben?Ich muss jetzt mal salopp zu sprechen.Du hast 5 Minuten. Ich hab 5 Minuten, genau. Also, Jeremy Lenz Antwort auf Englisch. Ich bring sie am Ende auch nochmal, das ist glaube ich eine echt gute Idee, Amanda.Jeremy Lenz Antwort ist, I exist in a fractally connected, self-organized universe, where everything relates dynamically to everything else.[26:45] Oh, das klingt ein bisschen nach Gaia. Ja, er macht es nicht explizit, aber die Andeutung habe ich auch gehört.Er kommt erstmal von einem anderen Punkt. Er kommt erstmal vom westlichen Reduktionismus.Westlicher Reduktionismus ist eine Grundlage dessen, was wir moderne Wissenschaft nennen.Das ist im Grunde der Gedanke, dass wenn ich ein System verstehen will, reicht es, wenn ich seine Bestandteile verstehe.Wenn ich die Bestandteile verstehe, verstehe ich auch das ganze System.[27:17] Das heißt, der westliche wissenschaftliche Blick, lange Zeit, das hat sich in den letzten Jahrzehnten ein bisschen geändert, das muss man dazu sagen.Aber der wissenschaftliche Blick war lange Zeit in erster Linie auf die Objekte gerichtet.Auf einen Gegenstand, auf ein Ding.Und was er oft übersehen hat, sind die Wechselwirkungen und Relationen zwischen Dingen.Also hat halt irgendwie ein Organismus sehr detailliert beschrieben oder irgendwie ein Zelltypus oder ähnliche Dinge, aber eben weniger darauf geguckt, wie dieser Organismus oder dieser Zelltyp beispielsweise mit anderen Organismen oder Zelltypen interagiert. Ja.Was da wechselseitige Abhängigkeiten sind, Wechselwirkungen sind und so weiter.Das ist so ein bisschen der, sieht er als den Grund. Er sagt nicht Fehler. Er streitet auch nicht ab, dass uns dieser Reduktionismus extrem weit gebracht hat.Ich glaube, er würde sagen, er kommt jetzt an seine Grenzen.Wir müssen jetzt lernen, das weiterzudenken, neu zu denken, das wieder mit einzubeziehen.Das führt so ein bisschen dazu, es gibt ja diesen schönen Satz, nur was messbar ist, wird auch betrachtet.Das ist ja auch ein Phänomen, was man gerade in Sozialwissenschaften auch beobachten kann.Das was ich mit Zahlen gut darstellen kann, das wird hoch dargestellt, so die komplexen Wechselwirkungen und Prozesse, die fallen oft so ein bisschen hinüber.[28:41] Und gerade wenn es um komplexe Systeme geht, da hatten wir ja auch mal ne Folge hier im Podcast zu von Holger, kann man damit im Grunde nur einen ganz kleinen Ausschnitt des Systems überhaupt verstehen und korrekt beschreiben.Und es werden so Konzepte übersehen, wie Selbstorganisation, also dass Systeme in der Lage sind, durch Interaktionen auf der unteren Ebene irgendwie eine, sich in eine Struktur zu bringen, die jetzt nicht von außen irgendwie vorgegeben wurde.Dass Systeme sowas haben wie Attraktoren, das heißt, dass Systeme nicht einen Gleichgewichtszustand haben, also man kennt das zum Beispiel aus der Betriebswirtschaft oder aus der VWL, da gibt es sowas als ein Gleichgewicht.So, das ist eine Situation, wenn die einmal erreicht ist, dann ist die stabil, dann bewegt sich da nichts mehr.[29:28] Und bei komplexen Systemen hat man diese Situationen im Grunde nie, was kann man aber haben, sind sogenannte Attraktoren.Das heißt, das sind so Zustände, um die herum sich das System im Normalfall bewegt.Und auf die es so normalerweise auch wieder zurückfällt. Das kann man jetzt beim Klima auch ganz gut beobachten, was passiert, wenn sowas sich auflösen könnte möglicherweise.Das Klima ist nie von Jahr zu Jahr gleich geblieben, aber es hat sich immer so in einem halbwegs stabilen Rahmen bewegt.Und jetzt sind wir gerade an der Stelle, wo das eventuell nicht mehr der Fall ist.Das bringt uns dann auch zum dritten Konzept, was Lent auch nur anreißt.Das sind sogenannte Phasenübergänge, wo im Grunde, nicht dass ich das jetzt vereinfacht ausdrücke, so ein komplexes System von einem Attraktor zum nächsten springt.Oder zumindest aus dem Attraktor, in dem es sich gerade bewegt, so aus diesem Band, in dem es sich gerade normalerweise bewegt, irgendwie sich rausbewegt.Das ist das, was wir, glaube ich, möglicherweise gerade beim Klima beobachten können.Es gibt so diese Diagramme mit den Meerestemperaturen, die gerade irgendwie jenseits von allen Temperaturen sind, die wir auch in den letzten Jahren jemals hatten.Das ist sowas, was sich Phasenübergang nennt, wo das System einfach seine Dynamik komplett wechselt.[30:41] Dann gibt es noch so ein Konzept wie Emergenz. Das ist was, das kannte die klassische Wissenschaft durchaus auch schon so ein bisschen.Das ist eben genau das Problem von dem untergeordneten System aufs übergeordnete System zu schließen.Wie wird aus Zellen ein Organ?Ich kann die Zellen irgendwie beschreiben, aber rein aus den Zellen heraus kann ich nicht unbedingt sofort verstehen, wie eine Leber funktioniert.Ich weiß jetzt nicht, ob das ein schlechtes Beispiel ist.Oder wie wird aus Einzelpersonen eine Gesellschaft?[31:14] So, ich kann die Einzelpersonen alle beschreiben und die Gesellschaft existiert da irgendwie dann drüber.Und es gibt so zwei grundlegende Ideen von Emergenz, das kenne ich jetzt aus der Soziologie.Es gibt einmal die sogenannte schwache Emergenz.Das heißt, ja, es gibt Gesetze für all das, was da passiert, wie aus dem Menschen eine Gesellschaft wird.Wir kennen sie halt eventuell nur zum Teil noch nicht.[31:35] Und es gibt die sogenannte starke Emergenz, die halt sagen würde, nee, so eine Gesellschaft ist strukturell, systematisch, qualitativ.Was anderes als eine Gruppe von Einzelpersonen.Also die Frage ist, ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile?[31:48] So kann man das Emergenzthema vielleicht zusammenfassen. Und Lent ist halt ganz stark auf der Seite der starken Emergenz.Er sagt halt, nee, das Ganze ist fast immer mehr als die Summe seiner Teile, zumindest sobald es um irgendwelche Art von Leben geht.Was dann aber mit rein spielt, das ist das, wo es für die klassische, kausale Wissenschaft wieder schwierig wird, ist, dass es sowas geben muss wie reziproke Kausalität.Das heißt, dass nicht nur der Mensch die Gesellschaft beeinflusst, sondern auch die Gesellschaft den Menschen.Okay. Bei Gesellschaft ist es, glaube ich, noch sehr intuitiv. Ja.Aber wenn wir jetzt in irgendwelche physikalischen Systeme reingehen oder sowas, wo man sagen würde, ja, aber das Atom bewegt sich halt, wie das Atom bewegt, da hat das, der Zustand des Wassers, Also das Wasser ist also Meerwasser, hat jetzt keinen Einfluss auf das H2O-Molekül in sich.So, und das ist so ein bisschen das, wo sich die klassische Wissenschaft schwer mit tut, noch.Auch das ändert sich in den letzten Jahrzehnten, wie gesagt, da ist jetzt nichts revolutionell Neues drin, aber er rekonstruiert das sehr gut, finde ich.Dass man da auch eben genauer gucken muss. Und das ist auch tatsächlich das, was wir beobachten.Das ist zum Beispiel das, was man beobachtet in der Genetik, mit dem ganzen Bereich der Epigenetik.[33:05] Also, dass immer klarer zu werden scheint, dass es nicht so das eine Programm gibt, dass man irgendwie halt bei Gebot eingepflanzt kriegt und dann wird das nur noch abgespult.[33:15] Sondern dass Gene dynamisch aktiviert und deaktiviert werden.Durch Bakterien, durch irgendwie Umwelteinflüsse, durch, ich glaube, es gibt sogar auch bakterielle oder irgendwie durch Neurotransmitter und ähnliche Dinge.Dass da tatsächlich auch Gene ab- und angeschaltet werden, die aktiviert werden können, die nicht aktiviert werden können.Sodass da im Grunde jetzt nicht der eine Bauplan, das eine Programm liegt, sondern eher so ein Skript, so eine Skript-Sammlung, aus der halt je nach Situation unterschiedliche Dinge abgerufen werden.So, da möchte ich dir jetzt einmal explizit die Gelegenheit geben zu widersprechen, weil ich vermute in dem Thema kennst du dich besser aus als ich.Ich widerspreche dem nicht. Ne, also das ist ja, ich tu mich so ein bisschen, also ich verstehe den Punkt, so, das Buch ist aber vor zwei Jahren oder so erschienen und ich finde so das ganze, das systemische Denken, also ja, Luhmann ist natürlich der berühmteste Vertreter davon, aber das hat sich jetzt ausgebreitet in ganz viele verschiedene Bereiche und ich finde das schon ein bisschen verkürzt zu sagen, Wir sind da immer noch nicht, also, weißt du, ich finde das ist schon, das wird schon sehr mitgedacht mittlerweile.Da direkt als Reaktion drauf, du hast völlig recht, das wird mitgedacht in der Wissenschaft.Das ist ja das, was ich gesagt habe. Das wird, glaube ich, so in der Wissenschaft oft mitgenommen, aber wenn man beispielsweise jetzt in die Schulausbildung guckt.[34:43] Wenn man beispielsweise in das guckt, was die jetzt nicht aktiv Forschenden, so dass das Weltbild ist, da ist es eben noch nicht so in dem Maße drin.Also ich glaube, das ist Lens Punkt.Vielleicht habe ich das jetzt gerade auch ein bisschen verkürzt dargestellt.Also du hast völlig recht, ich glaube wissenschaftlich gerade aktuell aktiv akute Wissenschaftler, tätige Wissenschaftler können gar nicht anders als das immer mehr zu berücksichtigen.Aber auch die haben ja noch ihre Schwierigkeiten teilweise damit Akzeptanz zu finden.So, in der Fläche, im Weltbild, in der Kommunikation, in irgendwie tradierten Wissenschaftsstrukturen und so weiter.Also ich glaub die Bewegung in diese Richtung ist deutlich da, sonst könnte Lenzi auch nicht so gut rekonstruieren.Und er sagt ja auch, der wissenschaftliche Stand bestätigt mittlerweile eigentlich eher das östliche, das asiatische Weltbild.[35:38] Also ich glaube, er wirft das nicht der aktuellen Wissenschaft vor, dass die das nicht tut.Sondern er sagt, unser Weltbild ist da noch nicht nachgezogen.Okay. So, das ist vielleicht nochmal als Klarstellung wichtig.Genau, also das ist so ein bisschen der Punkt, den er so zum Universum, sozusagen, so ein bisschen so grundlegend macht.Es gibt da noch zwei Begrifflichkeiten, die er wieder aus der chinesischen Philosophie entleit, die ich auch wieder ganz schön finde, das ist die Unterscheidung zwischen Material und Struktur, Das werde ich die Aussprache jetzt völlig, völlig zerstören.Zwischen Xi und Li.Also Xi ist im Grunde so ein bisschen das Material, das Physische, die Objekte.Und Li ist so ein bisschen die Struktur, in der es angeordnet ist.Also es gibt da die klassische Geschichte, Legende vom Schiff von Tesois.Wo eben der irgendwie unterwegs war und über all seine Fahrten und Reisen, ähm, am Ende das Schiff so viel repariert hatte, dass kein Teil des alten Schiffes noch im neuen Schiff war.[36:41] Aber trotzdem blieb es dasselbe Schiff. Ja.Und das ist im Grunde genau die Frage, die hier, die hier an dem Punkt deutlich wird, ne.Ich kann die Bretter untersuchen, damit lerne ich wenig über das Schiff als Schiff.Ich lerne was über das Schiff als Struktur aus Brettern. Mhm.Ähm, und das ist diese Unterscheidung zwischen, zwischen Xi und Li.Und unser Weltbild, ich versuch jetzt es sprachlich sauberer zu machen, ist halt immer noch mehr auf dieses Ski ausgerichtet als auf das Leben.Also auf das Material und weniger auf die Struktur. Das war dieser Block, wo bin ich? In welchem Universum bin ich? Sozusagen.So ein bisschen Kritik, Wissenschaftskritik im Grunde.[37:23] Ich bring den Abschlusssatz nochmal und dann gucken wir mal, ob da noch irgendwelche Unklarheiten oder Diskussionsbedarf besteht.I exist in a fractally connected, self-organized universe, where everything relates dynamically to everything else.[37:39] Was meint er denn mit fractally connected? Das habe ich jetzt übersprungen und erklärt. Da geht es ihm tatsächlich um so fraktale Organisation.Also da geht es ihm darum, dass das Muster, das man auf einer Ebene findet, auf der anderen Ebene auch wieder auftaucht.Also wenn ich jetzt sage, das gibt es ja zum Teil auch. Also es werden ja zum Teil Modelle aus der statistischen Physik oder aus der Fluiddynamik, also aus der Analyse von Flüssigkeiten, werden zum Beispiel teilweise eingesetzt für die Analyse von der Bewegung von Menschenmengen.Weil sich da einfach aus so Selbstorganisationsprinzipien ähnliche Dynamiken ergeben.Wo man diese Muster auf verschiedenen Ebenen wiederfindet.[38:20] Das meint er damit mit Fractally Connected.Ja auch da das klingt alles sehr einleuchtend finde ich ich überlege mir auch also ich wüsste jetzt nicht wie man dem widersprechen könnte oder das ist sehr intuitiv wenn man das so beschreibt und trotzdem sehe ich schon auch du hast jetzt zwar gesagt in der wissenschaft sei das nicht das problem aber ich sehe schon auch den die schwierigkeit das zu untersuchen also wo fängst du dann an also du kannst das postulieren ich gehe da total mit.Aber, klar, wenn man Wissenschaft so betreibt, wie wir das gemacht haben, und klar, das kritisiert er ja mitunter auch, aber trotzdem musst du dich ja immer auf irgendwas beschränken.Ja, klar.Ja, also ich sehe gerade noch nicht so ganz den Ansatzpunkt, oder wohin das weiterführt.Also, wie gesagt, ich würde das gar nicht so sehr als Wissenschaftskritik verstanden wollen, auch wenn ich es gerade so formuliert habe.Es ist eher eine Beschreibung dessen, wie das Weltbild aufgebaut ist.Ja, also du hast völlig Recht, irgendwie muss ich irgendwie begrenzen, aber es ist auch die Frage, worauf begrenze ich mich, worauf fokussiere ich mich.Und das ist glaube ich hier so ein bisschen das, wo wir ja auch wirklich einfach ein Schiff beobachten.Du hast ja gerade selber auch gesagt, das ist ja genau diese Bewegung, die wir gerade in der Wissenschaft beobachten.Epigenetik wird als Thema immer größer.Ja.[39:47] Gut, jetzt versucht ihr beides wieder zusammenzubringen. Also, was bin ich? Wie lebt man selbst in diesem System?Und jetzt wird es nochmal ein bisschen kontroverser. Und auch das, wo ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, das klingt immer so ein bisschen esoterisch, aber ehrlich gesagt, ich finde es da doch irgendwie wieder überzeugend.Und das bringt mich dann mich selber zu hinterfragen, was aber auch wieder zeigt, dass Lent Recht haben könnte.Weil das alte Weltbild einfach sehr stabil ist.Aber erstmal der Satz. Was bin ich?Part of life, I am integrated dynamic flow of negative entropy, following the same general principles as the rest of the natural world.[40:28] Lass mal erstmal kurz sacken. Was er in dem, der eben macht, ist im Grunde so ein bisschen ne Kritik unter anderem, zwei Zwei Dinge kritisiert er in dem Abschnitt vor allen Dingen, das ist einmal der Gedanke, das ich gerade auch schon mal angedeutet habe, dass es sowas gibt wie einen genetischen Bauplan, also den gibt, beschreitet er nicht, um Gottes Willen, aber dass mit dem im Grunde alles determiniert ist, dass das so das ist, was das Leben beschreibt und worüber sich alles erklären lässt.Und da wird auch wahrscheinlich wieder dieser Wechsel von Material zu Struktur ganz schön deutlich.Weil er eben sagt, eigentlich müssten wir viel weniger an der Stelle auf die Gene gucken.Also sie sind natürlich da, wo sie wichtig sind, relevant. Stellt überhaupt nicht in Anspruch.Sondern für ihn ist die Grundeinheit der Dynamik des Lebens im Grunde nicht das Gen, sondern die Zelle.[41:26] Einfach weil das, da ist etwas wo etwas passiert, wo irgendwie Dynamik stattfindet und die Zelle eben auch die kleinste lebende Einheit in dem Sinne ist.Aus der sich dann alles andere irgendwie lebende Systeme aufbaut. Das Gen ist halt eine Eigenschaft des Materials. Die Zelle ist Dynamik.Okay, aber was meinst du wenn du sagst die kleinste lebende Einheit in dem Sinne, in dem Sinne von was?Ähm, ja, da bin ich seiner Argumentation auch nicht so ganz gefolgt, er geht da sehr schnell, sehr weit, ohne das Ganze im Kern zu begründen, das muss ich nochmal ein bisschen genauer angucken.Ähm, aber er, wir haben ja gerade diese Idee von, von, von lebenden Dingen, die irgendwie auf, auf, auf sich verändernde Umstände reagieren und irgendwie so das System versuchen stabil zu halten.So, also das ist jetzt ganz klassischen hier Bertalanffy und wie hieß der anderen Sinne, systemtheoretischen Sinne, Autopoiesis.Also das System versucht sich selbst am Leben zu halten.Ja. So und das ist ja das, wo wir vorhin gesagt haben, das ist das, was wir bei Menschen dann Gefühle nennen, worauf wir dann irgendwie Handel basieren.Und wenn ich Lent an der Stelle richtig verstehe, ich glaube er macht das nicht explizit, würde er die Zelle als kleinste Einheit sehen, die genau diese Eigenschaft hat.[42:43] Die sich auch reproduziert, die auch Stoff wechselt, das ist ja oft so klassische Kriterien für Leben.Er geht sogar so weit, Zellen eine gewisse Art von Intention zuzuschreiben, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gehen.Zumindest noch nicht, ich glaube ich weiß aber wo er damit herkommt, ich weiß nur nicht ob es mich überzeugt.Weil die eben diese Zielgerichtetheit hat, sich selbst zu erhalten.Das ist das, was er Intention nennt und er zieht das zusammen und das ist jetzt wieder ein großer Sprung mit dem Konzept der Entropie.[43:21] Er zitiert da einen Autor, eine Autorin namens Lotka, der oder die wohl ein viertes Gesetz der Thermodynamik aufgestellt hat.Nämlich, dass das Leben dazu dient, Entropie zu reduzieren.So, jetzt müssen wir wieder ein ganz großes Fass kurz aufmachen.Entropie ist ein physikalisches Konzept, primär theoretisches Konzept, was ich jetzt auch wieder gnadenlos vereinfachen werde.Was im Grunde versucht, Chaos zu bemessen.Also das Fehlen von Struktur. Wobei Struktur hier sehr abstrakt gemeint ist.Also ein Wassermolekül ist extrem strukturiert.Aber das ist genau so eine übergreifende Dynamik, die sich auf vielen Ebenen findet.Dass Systeme immer dazu neigen, chaotischer zu werden. Ihre Struktur zu verlieren.Wenn diese Struktur nicht von außen irgendwie aufrechterhalten wird.[44:14] Und das ist eben Entropie zu reduzieren. Man kann das vielleicht einem einfachen Beispiel sich angucken, ich vereinfache wieder gnadenlos.Dinosaurier vor etlichen Millionen Jahren stirbt.Was passiert? Er zerfällt. Die Ordnung, die Struktur, die er hatte, löst sich sozusagen auf.Er wird entropischer, weil es nicht mehr das Leben gibt, was ihn zusammenhält.Was dann passiert, da kommt irgendwie, es wird Teil des Bodens, es wird immer mehr Druck, immer mehr Druck.Der Druck ist wie die Energie, die die Struktur produziert und er wird zu Kohle.Was machen wir Menschen jetzt? Wir baggern diese Kohle aus, verbrennen sie, produzieren damit wieder diffuse Energie, erhöhen wieder die Entropie.Also das ist so ein bisschen die Logik, die dahinter steckt.Als grundlegende Strukturidee, nicht jetzt bitte an diesem konkreten Beispiel.Das war nur der Versuch, es irgendwie illustrativ zu machen. Und dieses Fourth Law of Thermodynamics sozusagen, ich vermute, es ist mit dem Augenzwinkern so benannt, ist halt der Gedanke, dass das Ziel des Lebens im Grunde ist, Entropie zu reduzieren.[45:21] Und da tue ich mich jetzt ein bisschen schwer mit. Ja, verstehe ich. Geht mir genauso? Ich habe kein konkretes Gegenargument?Also ich finde halt, es ist so ein bisschen…Zuvor hast du gesagt, dass dieser Zirkelschluss, Intelligenz mit Mensch und weil der Mensch ist intelligent, so, das ist eine Tautologie und die sehe ich jetzt hier auch.Oder? Also man sieht was, das definiert man als Leben, man kann das mit Autopoiesis und so weiter, Systemtheorie kann man durchaus tun.Aber wenn man dann sagt, Leben dient dazu, Entropie zu reduzieren, dann ist das für mich genau so ein Zirkelschluss.Man hat was, das definiert man und das macht jetzt eine physikalische, hat diese Ausprägung. Findest du nicht?Ja, wobei, was ich daran spannend finde, ist, dass es eben auf dieser systemischen Ebene denkt.[46:10] Es definiert Leben über die Funktion in dem System. Es definiert Leben nicht über das, was eine konkrete Entität tut.Oder über eine Eigenschaft des Objektes. Also ich glaube, es ist dieser Wechsel auch wieder auf die Strukturebene.Ja, aber ich finde Leben an und für, also ich habe jetzt ein bisschen im Hinterkopf so die auch Theorien des kritischen Posthumanismus, da geht es, wenn man von, da wird auch der Begriff von der Emergenz oder der permanenten Emergenz davon gesprochen, wo eben auch Materie nicht passiv ist, also Mensch und Welt nicht dualistisch, sondern dynamisch.Und auch Materie hat eine transformative Auswirkung.Und Materie hat auch Agency, also eine Handlungsmacht, aber ohne intentionalen Akt, also nicht das, was du vorhin gemeint hast mit die Zellemacht hat eine Intention, sondern sie wirkt halt, auch ob sie das jetzt will oder nicht, hat sie eine Handlungsmacht.Und da finde ich halt, wo beginnt man? Man kann sagen, okay, Leben ist, das ist ja dann auch einfach ein Kontinuum, das beginnt dann irgendwo und wir definieren das.Also wie gesagt, da bin ich mir jetzt wieder nicht sicher, ob ich Lenz‘ Definition von Leben genau korrekt wiedergegeben habe.Woran ich mich konkret erinnern kann, ist dieser Weg, die Intention der Zelle.[47:21] Also diese Homöostase, dieses Selbsterhaltprinzip im Grunde, in gewisser Weise.Das ist, glaube ich, das, was er…Wo er es dran festmachen würde. Ich bin ja mal voll bei dir, vielleicht geht es sogar noch weiter.Aber das verstärkt ja sein Argument noch im Gegensatz zu dem, dass es abschwächt.Also das macht ja im Grunde noch wichtiger und noch zentraler, dass man eventuell noch nicht mal sinnvoll von Leben gegenüber Nichtleben reden könnte.Aber das wäre vielleicht dann auch ein nächster Schritt erstmal.Ja, okay. Also ich bin voll bei dir, da fange ich auch an, auch einfach weil ich nicht genug in den ganzen Theorien drinstecke, um das wirklich abschätzen zu können.Was ich noch ganz spannend finde, Auf einmal, und da wird’s conveniently passend, also es ist wieder so ein Fall, es passt auf einmal zu gut und wahrscheinlich zu plump, als dass es tatsächlich so sein könnte.Aber ich finde das Argument trotzdem ganz spannend. Er sagt nämlich, vielleicht sind wir auch einfach an dem Punkt, wo das System, was auch immer, jetzt kommen wir vielleicht noch ein bisschen in die Gaia-Perspektive rein, die er nicht explizit macht.Das die konzeptionelle Idee des Menschen im Grunde ein evolutionärer Schritt in die falsche Richtung war.Weil wir eben anfangen Entropie zu produzieren und nicht mehr sie nur zu reduzieren.Weil wir eben, plumpes Beispiel, die Kohle aus dem Boden holen und verbrennen.Auf einmal produzieren wir Entropie und wir reduzieren sie nicht mehr.[48:43] Und jetzt könnte man das weiterspinnen, das macht Lent nicht.Ich weiß auch nicht wie überzeugend ich das finde.Aber jetzt könnte man das weiterspielen in Richtung, ja, und das merkt in Anführungszeichen die Erde gerade und deswegen wird sie uns los.[49:00] Ist mir zu viel Intention, verstehe das jetzt bitte nicht als Ding, ich will das nur so als Gedankengang einmal in den Raum gestellt wissen.Was sagt er denn? Also für mich klingt das so ein bisschen teleologisch, also die Entropie, das ist so das übergeordnete Ziel, das, ich weiß nicht, das Universum verfolgt oder wer.Aber das ist ja tatsächlich physikalisch eine der existenten und auch ernst genommenen Theorien.Ja, einverstanden, aber wieso sollte dann, also welche Kraft, oder woher kommt denn Leben, also wie, oder was ist die, der Antrieb, dass man Entropie reduzieren sollte?Das ist tatsächlich wahrscheinlich, also das macht es nicht explizit, das würde ich tatsächlich, dieses Agency, diese Intention im Sinne des Selbsterhaltes.Also jetzt bitte nicht, als ich plane jetzt morgen nach da und dahin zu fahren, sondern nur im Sinne des, in meiner Umwelt passiert etwas, das hat negative Auswirkungen auf mich, auf mich und deswegen versuche ich, darauf zu reagieren. Also es kann reiner Austausch von Chemikalien oder für uns automatisiert gesehener Prozess sein, aber das ist glaube ich das, wo er das aufhängen würde.Müsste man jetzt wahrscheinlich noch mal ganz genau in den Text rein einsteigen, ob man das daraus rekonstruiert kriegt.[50:13] Genau, und der zweite Punkt ist nochmal das Thema Intelligenz, weil er Intelligenz nämlich als emergentes Phänomen verstanden wissen möchte.Und dann schließt sich auch wieder so ein bisschen der Bogen zu der tierischen Intelligenz, weil man Intelligenz im Grunde nicht auf der Ebene von Individuen verstehen kann, sondern auf der Ebene von Populationen.Oder, ähm, oder von, also Intelligenz funktioniert immer nur als emergentes Phänomen, daraus, dass viele Teile miteinander interagieren.In Menschen sind es halt Nervenzellen, ähm, in manchen tierischen Konstruktionen, bei Ameisen oder ähnlichen, sind es halt Individuen von Tieren.Die dann auf einer höheren Ebene, auf einer emergenten Ebene wieder ein gewisses Level von Intelligenz produzieren.Also wir haben hier Intelligenz auch wieder nicht als Eigenschaft eines Individuums, des Materials, Sondern wir haben Intelligenz im Grunde als ein Strukturphänomen.[51:04] Intelligenz als ein Phänomen, das dadurch entsteht, dass viele Dinge miteinander auf eine bestimmte Weise interagieren.Und dadurch ein ganz hohes Level an Problemlösungsfähigkeit im Grunde entsteht.Ja, finde ich ein guter Gedanke.Ja, fand ich tatsächlich auch. Jetzt wo ich das so erklärt habe, ist es mir auch nochmal viel klarer geworden und viel plausibler.Ähm, er geht dann auch, er vermischt dann irgendwie so teilweise Intelligenz und Bewusstsein und Bewusstheit, das wär mir ja auch noch wichtig jetzt einmal kurz klar zu machen, dass er, entweder vermischt er das oder ich habe es in meinem Verstehen vermischt.Ähm, weil er auch noch eine schöne Theorie anbringt, ich hab jetzt leider vergessen wie die Theorie heißt, aber das ist tatsächlich gerade anscheinend eine der wenigen, mehr oder weniger konsistenten Theorien von Bewusstheit.Die tatsächlich in dieser Emergenz, in dieser starken Emergenz, wie viel mehr ist das Ganze als die Summe seiner Teile, ein Kriterium für Bewusstsein sieht.[51:57] Im Grunde sagt an dieser Stelle, aus den Teilen entsteht ein Ganzes.An diesen Schritt hängt das Bewusstsein.Und sagt im Grunde, darüber kann ich das eventuell sogar quantifizieren.Den Grad an Bewusstsein. Ja.Wird auch, ich glaube, wenn man anfängt, das in diesem systemischen Denken zu denken, dann wird es klar.Ich glaube, es fällt uns, also mir zumindest fällt es schwer, in dieses rein systemische Denken reinzukommen.Aber das fand ich ganz spannend. Und entsprechend ist Bewusstsein eben auch nicht eine Eigenschaft, ist nicht ein Kern.Ich hab nicht irgendwo so in mir den Kern, der bewusst ist, das ist kein Material, sondern es ist im Grunde spontane Selbstorganisation.[52:43] Ich hab in meinem, irgendwo interagieren Nervenzellen in meinem Hirn und das, worauf die sich gerade richten, wo gerade irgendwie eine gute Verschaltung entsteht, was gerade in meine Aufmerksamkeit rückt, das ist das, was mir bewusst ist und wo mein Bewusstsein herkommt.Es ist nicht irgendwie so der Kern oder das, was immer da ist.Aber das Bewusstsein ist dann doch gebunden an eine Form von Individuum oder ist das so im Sinne von Panpsychismus? Alles ist Bewusstsein.Also erstmal ist es glaube ich ein Organisationsprinzip. Ich glaube es kann beides sein. Also ich frage, was nennst du Individuum?Genau, ja. Wenn man Intelligenz, jetzt sowohl im Menschen ist Intelligenz eine Interaktion von Nervenzellen, bei Ameisen ist es eine Interaktion von Ameisen.So, dann würde er wahrscheinlich, würde er möglicherweise sagen, dass auf einer gewissen, dass das Kollektiv an Ameisen ein höheres Grad, einen höheren Grad an Bewusstsein hat, als die einzelne Ameise.Die einzelne Ameise hat aber auch einen gewissen Grad an Bewusstsein, weil natürlich nicht jede Zelle irgendwie ne, auch ne Ameise ist nicht nur die Summe ihrer Zellen, sondern auch ganz viel Interaktion zwischen den Zellen und Wechselwirkung.Bei Menschen würde man wahrscheinlich eher sagen, dass der Mensch, wenn man ihn so als körperliches Wesen sozusagen versteht, dass der ein sehr hohes Maß an Bewusstsein aufweist und vielleicht eine Gesellschaftsstruktur ein bisschen geringeres Maß.[54:10] Also ich glaube da wird Bewusstsein auch nicht zu einer Ja-Nein-Frage, sondern eher zu so einer graduellen Frage, wo ist mehr Bewusstsein, wo ist weniger.Was ich tatsächlich nicht ganz unplausibel finde. Also ich finde das, wenn man sich auf dieses Systemdenken einmal einlässt, durchaus schlüssig.[54:28] Ja, ja, finde ich auch. Aber irgendwie tue ich mich da schwer mit, wo zieht man die Grenze?Ja, ich glaube, es gibt keine Grenze.Ich glaube, er würde keine Grenze zwischen Bewusstsein und Nichtbewusstsein ziehen.Ich bin einverstanden, aber das ist halt der Punkt, wo es dann ins Esoterische abdriftet.In dem Sinne, man kann das dann auch nicht mehr widerlegen, nicht jetzt wissenschaftlich, sondern man kann nicht dagegen argumentieren. Also wenn alles Bewusstsein ist und hat, was ist die Konsequenz davon?Äh, ja gut, man kann halt nicht, man kann halt nicht mehr, okay, aber das ist ja auch seine Aussage.Seine Aussage ist ja zu sagen, Bewusstsein ist keine sinnvolle Kategorie, als Ja-Nein-Kategorie.Okay, ja, einverstanden. Es ist eine sinnvolle Kategorie als graduelle Kategorie.Und dann wieder zu gucken, okay, wenn ich jetzt mal wirklich diese Theorie nehme, und es gibt wohl auch mittlerweile Techniken, da bestimmte Messungen irgendwie auf eine gewisse Weise vorzunehmen.[55:21] Also Messungen nicht im Sinn von, ich halte einen Piekser rein und dann kommt eine Zahl raus, sondern irgendwie Dinge da sauber empirisch zu erheben, Dann kann ich natürlich eigentlich problemlos sagen, ja da ist irgendwie jetzt, das Beispiel was ich gerade nannte, ist bei der Ameise das Kollektiv intelligenter oder das Individuum.Das ist dann wieder eine empirische Frage, die ich bearbeiten könnte. Oder bewusster, hat das mehr Bewusstsein.Das wäre dann wieder eine empirisch bearbeitbare Frage. Sie ist halt nur sehr anders gestellt.So und jetzt kommen wir auch in den Bereich, die zweiten drei Teile, die glaube ich auch erstens deutlich kürzer sind glücklicherweise und zweitens, wo es auch, ja wo dann halt die Frage kommt, ja was machen wir jetzt damit?[56:04] Also der nächste Teil ist, wie sollte ich leben? Aber ich gebe euch vorher nochmal den Abschluss von was bin ich?Als Teil des Lebens bin ich ein integriertes, dynamisches Fluss von negativen Entropien, folgend den gleichen Prinzipien wie der Rest des natürlichen Weltes.[56:22] Ich glaube vielleicht nochmal, was mir jetzt beim Sagen eingefallen ist, ich glaube er sagt einfach, wenn man sich zumindest den Bereich des Lebenden anguckt, gibt es keine qualitativen Unterschiede.Es folgt alles denselben Prinzipien. Das ist glaube ich so die kleine Aussage, jetzt wo ich es nochmal gelesen habe aus dem Aspekt.[56:40] Mhm, ja.Gut. Kommen wir zu, wie sollte ich leben? Wie gesagt, jetzt wird es hoffentlich ein bisschen knapper und kürzer.Als lebendiges Sein in der Mitte des Lebens sollte ich symbiotische, fraktale Erwachsenen für mich selbst, für den Menschen und für das ganze Leben erfolgen.Das musst du erklären. Ist aber glaube ich auch wieder wesentlich weniger kontrovers, als es sich aufs erste hören anhört.Also das erste ist, er kommt so ein bisschen von dem Punkt, es geht ja wieder in diesem Bericht der Harmonie.Das ist jetzt ein Begriff, der wird relativ groß. Da sind wir wieder bei diesem Flow, den ich am Anfang erwähnt habe, diesem Wu-Wei.Diesem natürlichen Fließen, diesem harmonischen Interagieren.Also auch dieses, diesen Fluss, den ich am Anfang meinte, der war nicht so ein mechanisches Ablaufen von Programmen.Sondern der war als ein harmonisches Miteinander interagieren und sich aufeinander beziehen.Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und das braucht in seinen Augen Kontraste.Harmonie kannst du nur haben, wenn da irgendwie mehrere Dinge sind, die miteinander harmonieren, die aber auch eine gewisse Eigenständigkeit haben.Also Harmonie zwischen Tönen, du hast dafür erstmal unterschiedliche Töne.Aber diese Töne können dann miteinander harmonieren.Das ist lustigerweise auch was, was Hartmut Rosa relativ stark macht.In seinem Konzept, seiner Theorie der Resonanz.[57:54] Wo er auch sagt, damit zwei Menschen miteinander resonieren können, Resonanz produzieren können, müssen sie auch erstmal für sich alleine stehen können.Das haben wir hier eben auch.Und deswegen sieht er auch zum Beispiel diesen Kontrast zwischen Körper und Geist, zwischen selbst und ich, über den wir gerade schon gesprochen haben, gar nicht als Problem.Sondern er sagt, das sind genau die beiden Elemente, die in eine gewisse Harmonie treten können.Aber wo man halt darauf achten muss, dass das passiert.Wo wir eben im Westen jetzt konkret viel stärker lernen müssen, auch auf diese belebte Intelligenz zu achten und zu hören.Und wenn man sich so anguckt, was man so an Krankheitsdiagnosen hat, dann passiert das ja auch.Also wenn ich jetzt irgendwie an einen Burnout denke oder so, wo ganz klar dann der Körper auf einmal auch anfängt, Dinge zu sagen, die der Geist vielleicht noch nicht so ganz verstanden hat.Und man dann erstmal mit dem Geist sozusagen nachziehen muss oder erstmal lernen muss, zu akzeptieren, was der Körper einem schon die ganze Zeit erzählt.Das ist so ein bisschen der Aspekt, wo er dahin will.Und der zweite Punkt, den er macht, ist, dass man eben auch bei der Beziehung zwischen Gesellschaft und Mensch genau auf so eine Harmonie achten muss.Dass ein gesunder Mensch eine gesunde Gesellschaft braucht.Und was wir über Gesellschaften bisher wissen, ist, dass die Gesundheit der Menschen darin und das Glück und die Zufriedenheit der Menschen darin gar nicht so sehr mit dem Wohlstandslevel verbunden ist, sondern mit dem Maß an Ungleichheit.Je ungleicher eine Gesellschaft, desto unglücklicher und unzufriedener und ungesünder sind die Menschen in ihr.[59:21] Lent sagt jetzt ein bisschen verkürzt, der kommt halt auch da nicht vom Fach. Liegt dann unterem daran, weil Ungleichheit Machtstrukturen schafft.Weil es auf einmal Leute gibt, die strukturell irgendwie Vorteile haben und das kein harmonisches System mehr sein kann. Da kommen wir jetzt auch so ein bisschen in Richtung David Graeber und David Wangrow mit ihrem Anfängerbuch.Ja, ja. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung.Was machen wir damit? Da fordert er zum Beispiel jetzt sowas wie eine Politik der Zugehörigkeit.Politics of Belonging, das ist wohl ein Konzept von Monbiot.Habe ich mir auch noch nicht genauer angeguckt, steht aber auf meiner Leseliste.Das eben, beispielsweise auch wenn man in Religion guckt, es ist nicht der Glaube, der Glück erzeugt.Wenn man sagt, dass religiöse Menschen sind wohl im Schnitt glücklicher, zufriedener mit ihrem Leben als nicht-religiöse Menschen.Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber davon geht er erstmal aus.Das es aber nicht der Glaube ist, der das Glück erzeugt, sondern dass Gemeinschaft und Zugehörigkeit sind, die es erzeugen.Was ich wiederum sehr plausibel finde. Und was wir halt in der heutigen Gesellschaft haben, wir haben die Werbung, in ihrer heutigen Form.Die hat im Grunde genau dieses Gefühl der Entfremdung, sowohl zwischen Individuen und Gesellschaft, aber auch zwischen ich und selbst, wo wir gerade gesprochen haben, massiv ausnutzt.Und dem Ich im Grunde Dinge erzählt, wie es das selbst doch irgendwie kontrollieren könnte und so.[1:00:40] Lustigerweise, ich weiß nicht, ich hab das irgendwie schon mal gelesen, jetzt in dem Buch nochmal, so der Urvater der Werbung, wie wir sie heute kennen, war lustigerweise ein Neffe von Sigmund Freud. Wusste ich nicht.Ja, irgendwo hatte ich schon mal gehört, aber jetzt, da war es mir nochmal prägnant aufgekommen.Und ja, es nutzt halt genau, wenn man jetzt sagt, dass man genau diese Spannung im Grunde zwischen über ich, ich und es, jetzt in der Freud’schen Theorie, die ja doch relativ gut zu diesem Ich-Selbst-Gedanken passt.Wenn man die jetzt ernst nimmt, dann ist klar, wo Werbung da rein spielt.Dass die genau da irgendwie über ich produziert, dass irgendwie Spannung da reinbringt.Alles nicht so ganz überraschend dann auf einmal. Aber es kann auch wieder sein, dass es einfach nur im Rückblick eine gute Geschichte produziert.Sonst weiß man ja nie.Muss ja nie so ganz sicher sein. Ja.[1:01:32] Er bringt da noch einen schönen begrifflichen Widerspruch, der auch Kontrast, der auch jetzt nicht neu ist, zwischen Eudaimonia und Euphoria, also der kurzfristigen, yeah, Freude, juchu, ich hab was neues gekauft.Und der langfristigen Zufriedenheit.Was man eigentlich wahrscheinlich Glück nennen sollte.Nicht die kurzfristige Glücklichkeit, sondern der langfristigen glücklichen Zufriedenheit.Ja, genau. Das kennen wir ja auch schon seit der griechischen Philosophie.Darf ich hier kurz nachfragen?Ja klar. Also wenn man jetzt die Frage, wie sollte ich leben, wie verankert, also ich verstehe, wie du das oder wie er das herleitet anhand dem Prinzip, den du vorhin genannt hast.Aber es hat ja schon auch so einen Aspekt, der da nicht daraus einfach ableitbar ist.Also das gute Leben, das ist nicht… Das praktische Tun.Ja, ja. Aber woher kommt denn die Begründung, dass Glück zum Beispiel zum guten Leben dazugehört?Ich glaube für ihn ist es die Annäherung an dieses Wu-Wei. Die Annäherung an dieser Harmonie.Aha, okay.Das scheint mir bei ihm der zentrale Weg zu sein. Also im Grunde die Auflösung, die Abschwächung dieser Entfremdung.[1:02:50] Okay, mhm. Es kommen dann noch so ein paar Einzelpunkte, zum Beispiel, dass die westliche Philosophie sehr davon ausgeht, dass der Mensch an sich egoistisch ist und ihm die Moral aufgezwungen werden muss.So, dass das Selbst ist der Gegner der Moral, dass ich muss die Moral durchsetzen.Tatsächlich, das ist ja auch ein Thema, was gerade immer mehr aufkommt, da gibt es ja auch das Buch von Rutger Bregmann, das eigentlich andersrum ist.Dass dieser Egoismus im Grunde schon eine Art, dass das ein erlerntes Muster ist und dass wir eigentlich aus einem viel kooperativeren, viel moralischeren Handeln rauskommen.Er zieht daraus den Schluss, das finde ich auch tatsächlich als Praxistipp noch mal gar nicht so schlecht.Wir müssen nicht Altruismus lernen, wir müssen Egoismus verlernen.[1:03:40] Fand ich eine ganz gute Perspektive. So, und dann auch noch das Beziehung zur Welt. Ich fang jetzt ein bisschen schneller zu werden, weil wir schon gut über eine Stunde sind.Auch das Prinzip der Beziehung zur Welt geht da auch nochmal rein, weil er sagt, der Mensch ist nicht anders als die Natur, der ist ihr nicht überlegen.Der hat auch keine Kontrolle über sie.Die Natur ist auch nicht der Diener des Menschen in irgendeiner Form.Sondern eigentlich müssten wir uns als Menschen in Beziehung zur Natur an den Prinzipien der Ernte orientieren.Diese zwei Prinzipien der Ernte sind im Grunde nur, leave some of what is gathered for animals and do not waste what you have harvested.Also lass den anderen was übrig und verschwende nichts, was du selber genommen hast.Und das sind eigentlich nicht so schwierige Prinzipien und sie sind uns eigentlich auch, glaube ich, allen ziemlich eingängig.Aber wir sind doch irgendwie sowohl als Individuen als auch als Kollektive ziemlich schlecht darin geworden.Und das ist glaube ich das, jetzt bringe ich nochmal kurz den Abschlusssatz zu, wie sollte ich leben?Als lebendiger Mensch im Lebensmittelwerk sollte ich ein symbiotisches, fraktales Erleben für mich, für den Menschheit und für das ganze Leben suchen.[1:05:01] Mhm, sehr schön. Gibt’s da noch Diskussionsbedarf von deiner Seite?Ähm, naja, nicht so ganz konkret.Aber, also was mich so ein bisschen, oder wie ich dich verstanden habe, sind die Ideen an und für sich, also diese prägnanten Sätze, die du jetzt genannt hast, die sind ja eingängig, aber was du mitgenommen hast, ist die Argumentation, wie er das tut.Ja, ja, ja. Die Argumentation dahinter. ich mich so ein bisschen, wenn es, es wird jetzt viel von der asiatischen Philosophie genannt, das ist ja auch nur, also es ist ja auch ein bisschen ausgesucht. Also man kann das schon, wenn man angenommen er erfindet, sagen wir mal er ist ein Gaia-Hypothetiker und dann passt das natürlich, wenn man sich die osteasiatische Philosophie rausnimmt, dann kann man das gut damit in Verbindung bringen. Wenn man sich aber dann in Südamerika irgendeine Philosophie herauspickt, dann passt das vielleicht nicht mehr so ganz.Deswegen, ich finde das so ein bisschen cherry-picked.Ich glaube, man darf zwei Sachen nicht verwechseln. Ich glaube, er sagt, die haben Recht. In vielem. Einfach, weil er auch sagt, da bringt mich die Wissenschaft heute hin.Wenn ich mal versuche, unser westliches Weltbild wissenschaftlich zu bestätigen, schaffe ich das mal.Finde ich ganz viele Widersprüche. Wenn ich auf diese Theorie gucke, dann finde ich diese Widersprüche nicht.[1:06:28] Also ich glaube, er geht da wissenschaftlicher dran, als es jetzt bei dir von mir wahrscheinlich angekommen ist.Weil er bringt tatsächlich auch… Ich kann halt nur nicht einschätzen, wie gut und wie standardisiert diese Wissenschaft tatsächlich ist, weil ich nicht genug in den Feldern drin stecke.Aber sie widerspricht jetzt, also das sind alles Argumentationenstränge, die ich an sehr vielen Stellen schon gelesen habe.Die mir deswegen nicht auf den ersten Blick irgendwie widersprüchlich erscheinen.Ich glaube, er sagt nicht, weil die diese Entfremdung nicht hatten, haben die das richtige Weltbild.[1:06:56] Das sagt er nicht. Also er sagt nicht, die Chinesen haben Recht, weil die haben diese Entfremdung nicht gemacht.Was dann ja übertragbar wäre, weil wer auch immer diese Entfremdung nicht gemacht hat, die müssten auch Recht haben.Das sagt er nicht. Er sagt, das ist ein Weltbild, was zum jetzigen wissenschaftlichen Stand besser zu passen scheint.Und dann darf er Sherry picken.Das stimmt, ja. Vielleicht um die Argumentation nochmal gerade zu ziehen, aber dein Punkt war glaube ich sehr sehr wichtig.Gerade auch diesen Esoterik-Vorwerf. So, jetzt kommen noch die zwei letzten Kapitel, die sind aber tatsächlich, glaube ich, relativ kurz, weil da wird’s dann nochmal ein bisschen esoterischer und auch wieder diffuser, weil er jetzt nochmal versucht, so dieses Handeln reinzubringen.Und das ist halt schwer. Wir haben halt keine Skripte, die wir nur noch aktivieren müssten dafür. Und er will halt auch nicht politisch werden. Aus guten Gründen vermute ich.Also dann kommt die nächste Frage, warum bin ich? Und dann kommt er einfach nur auf den Satz, I am here to weave my unique strand into the web of meaning.[1:07:52] So. Und da schießt er jetzt im Grunde komplett auf unser Ego.So auf dieses Gefühl, irgendwie was Wichtiges und Relevantes in dieser Welt zu sein.Ähm, erstens, ne, weil ich, ein Individuum, lassen sich immer nur als Teil des Ganzen verstehen.Und im Endeffekt ist der Mensch als individuelle Agent eine Zuschreibung.Ist eine Konstruktion, die unser Bewusstsein macht, damit sie irgendwie die Komplexität bewältigen kann.[1:08:20] So. Das ist, glaube ich, auch noch gar nicht mal so umstritten.Was, wo es jetzt ein bisschen kritischer wird, wo man ein bisschen mehr diskutieren könnte, wenn ich jetzt auch faktisch mehr wüsste, Was ja auch eine Entwicklung in den letzten Jahren, Jahrzehnten ist, dass man immer mehr dahinter kommt, dass das, was man so mystische Erfahrungen nennt, sei es jetzt durch Meditation, durch psychedelische Drogen, aber eher interessanterweise auch Kleinkinder hier als Beispiel, dass das eine andere Art von Weltbezug ist, die tatsächlich auch andere Zugänge zur Welt ermöglicht und vor allen Dingen uns aus dem, was wir Kultur nennen, dem Ich, also Kultur ist das, was in der Gesellschaft verortet ist, das Ich ist irgendwie dessen Repräsentanz, dessen innere Widerspiegelung in der Person.Dass uns das so ein bisschen ermöglicht, dahinter zu blicken.[1:09:07] Es ist ja immer häufiger, dass klar wird, dass irgendwie bestimmte psychedelische Substanzen möglicherweise helfen können, beispielsweise Depressionen zu behandeln.Und ich glaube auch andere psychische Krankheiten zu behandeln.Dass wir durch Meditation irgendwie auch physiologische Zustände erreichen, die wir einfach bewusst nicht erreichen können.Und dass das ein so ein Weg ist im Grunde, mehr auch wieder in diese belebte Intelligenz reinzugucken.Ja, aber auch hier finde ich, man muss aufpassen, dass man dann nicht in den Trugschluss verfällt, dass man das als wahrer wahrnimmt.Genauso mit Alkohol. Du bist nicht wahrer oder du sagst nicht Dinge, die du eigentlich meinst, wenn du betrunken bist. Du bist einfach anders. Oder enthemmt oder wie auch immer.Es produziert halt einen anderen Pol. Es produziert einen Pol, der vielleicht auch einen anderen Zugang ermöglicht.Wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel die ersten Astronauten im All, da muss ich leider nicht engendern, wie die ihre Wahrnehmung der Erde beschreiben.Als sie das erste Mal die Erde von außen gesehen haben.[1:10:10] Ich würde auch sagen, da verschiebt sich alles, weil auf einmal ein ganz anderer Blick möglich wird.Weil diese Loslösung, also wie gesagt, ich glaube, das nennt man eben auch Kleinkinder und da ist viel dran.Dass Kleinkinder viel belebter, im Sinne dieser belebten Intelligenz, viel weniger konzeptionell auf die Welt blicken.Und wir denen dieses konzeptionelle Denken ja im Grunde einbläuen müssen.Das ist ein ganz, ganz langer Lernprozess.Und deswegen hab ich die auch nebeneinander gestellt, weil es eben nicht, du hast völlig recht, das ist das was ich eigentlich meine.Ne, das ist das was, und das wird ja dann auch wieder vermischt, also es vermischt sich ja auch immer sofort mit konzeptionellem Denken, insofern lässt sich das nicht voneinander trennen.Daher müssen wir da auch tatsächlich vorsichtig sein, er geht da auch nochmal ein bisschen weiter rein, als wenn es darum geht, dass man auf die Intuition hören soll.Da gibt es dann auch so Dinge, wo man auch irgendwie einen schönen Autor, der sagt, wenn es um unsere Leute geht, wenn es um unsere In-Group geht, dann sollten wir auf unsere Intuition hören.Wenn es um unsere Out-Group geht, dann sollten wir so wenig wie möglich auf unsere Intuition hören.[1:11:16] Das ist ja interessant. Also, er ist da sehr differenziert. Ich muss das jetzt hier immer so ein bisschen verkürzt wiedergeben. Ich betone das deswegen immer wieder.Er ist da sehr differenziert und er ist da nicht so ein zurück in die Natur, so ein romantisches, romantisch verklärtes zurück in die ursprüngliche Natur und alles wird gut.Ne, er macht nur den einen Pol, der seiner Ansicht nach viel zu schwach geworden ist im westlichen Weltbild, den baut er auf, um den stark zu machen.Er will nicht den anderen klein machen, er will ihnen sozusagen nur, er will sie gleichwertig stellen.Ist vielleicht auch nochmal als Hinweis ganz wichtig. Das bringt ihn nämlich auch zu dem Schluss, das ist jetzt vielleicht genau die Zusammenfassung, es gibt keinen Dualismus zwischen Wissenschaft und Spiritualität.Es sind nicht zwei verschiedene Dinge.Dieser Dualismus ist Produkt des westlichen Reduktionismus, das haben wir uns eingeredet. Salopp formuliert.Das muss beides harmonieren, das muss irgendwie zusammengehen.Und Spiritualität jetzt auch hier bitte nicht als eine plumpe Religiosität oder autoritäre Unterordnung unter ein soziales System Kirche verstanden, sondern tatsächlich im Sinne dessen, was wir die ganze Zeit jetzt hier besprochen haben, eines anderen alternativen Zugangs zur Welt als das rationalen Denken.[1:12:29] Mhm, okay. Weil gerade spirituelle Texte sind ja auch immer Versuche, dieses Belebte wieder in was Konzeptionelles zu übertragen.Und das haben wir ja gerade auch, diese Schwierigkeit, was ist damit eigentlich gemeint und das ist ein bisschen anders konnotiert.Und der Begriff weckt irgendwie andere Erwartungen und so, das haben wir ja hier in der Vorstellung auch immer mal wieder.Das Problem, also da muss man sehr vorsichtig sein.Also deswegen nochmal dieses, warum bin ich? I am here to weave my unique strand into the web of meaning.Also es ist im Grunde ein Strom, ein Beispiel, Fluss, der irgendwie so mit da rein fließt und sich mit da rein knotet.Fand ich, find ich irgendwie auch einen beruhigenden Gedanken.Ja, ja. Ist ein schöner Satz.So, wohin gehen wir? Das ist tatsächlich jetzt aber nur nochmal so eine Zusammenfassung.Da hat er auch keine Zusammenfassung, da bringt er, lässt er den Leser, die Leserin am Ende auch nur mit einem Satz raus.What is the sacred and precious strand that you will weave?Also was ist der heilige und wertvolle Strang, den du heben wirst?[1:13:30] Er bringt noch so ein paar praktische Punkte, dass ein grundlegender Wandel eben des westlichen Weltbilds nötig ist, aber das ist glaube ich jetzt das ganze Buch gewesen sozusagen.Wir müssen da in gewisser Weise unser kognitives Betriebssystem anpassen.Es irgendwie schaffen vom Individualismus wegzukommen und mehr auf Eudaimonia und nicht auf Euphoria zu fokussieren.[1:13:51] Und tatsächlich den Bezug zur Realität wieder herstellen. Und zwar zur richtigen, zur echten Realität.Und nicht durch Konsum oder durch irgendwie vierfache Ebenen der Messung oder juristische Abstraktion, da hab ich ja auch mal zugeschrieben, irgendwie uns von der Realität zu entfernen.Sondern vielmehr in die Realität reinzugehen. Was ist gerade wirklich Sache? Was passiert?Und diese Bewertung, die damit ganz oft verbunden sind, erstmal nach hinten zu stellen.Das ist jetzt auch wieder philosophisch nicht neu, das kennen auch die römischen Stoiker, haben das auch schon so oder so ähnlich geschrieben.Es ist alles nicht neu, aber es ist doch alles ein bisschen untergegangen.Genau. Und es gibt dann noch ein Abschlusszitat, das ich noch kurz einbringen möchte.Ist ein bisschen länger, aber das glaube ich das ganze Problem gut zusammenfasst.Es braucht eine Metamorphose in fast jeder Aspekte der menschlichen Erfahrung, inkl. unseren Werten, Zielen und behördlichen Normen.Eine Veränderung dieser Größe wäre ein epokales Ereignis, auf der Ebene der agrikulturellen Revolution, die Zivilisation eröffnet hat, oder der wissenschaftlichen Revolution, die den modernen Welt engagiert hat.Und in unserem Fall haben wir keine Millenia oder Zenturen, in denen diese Revolutionen erfolgen konnten.Dies muss in ein paar Jahrzehnten am meisten passieren.[1:15:14] Mhm. Oder sonst was? Naja, aktuell, also sein Bezug für mich ist, äh, unser Umweltproblem.Klimakatastrophe, Ökosysteme. Also ihm geht’s jetzt, glaub ich, da tatsächlich, ganz im Sinne seiner Arbeit geht es ihm darum, als das System Mensch erhält sich selbst.Genau wie die Zelle, die auf irgendwie einen höheren pH-Wert in ihrer Umgebung damit reagiert, irgendwie bestimmte Dinge zu tun, Muss das System Mensch jetzt irgendwie als kollektive Intelligenz es hinkriegen, diesen Wandel vorzunehmen.Ob wir es schaffen oder nicht, ist offen. Es sagt niemand, dass das immer funktioniert.Gerade sieht es eher schlecht aus.Ja, ja. Wenn man mal ehrlich ist.[1:15:59] Yo. Brett gebohrt. 500 Seiten waren das, mehr.Ja, vor allem diese unglaublich dichte Seiten und unglaublich weit.Also er hat, glaube ich, an diesen beiden Büchern insgesamt zehn Jahre gearbeitet. Ah, okay, wow.Also er sagt auch, das ist so sein erstes großes Lebensprojekt gewesen. Mhm.[1:16:21] Und eben das Vorbuch, allein schon, dass es ein Vorbuch gab, bevor er dieses Buch geschrieben hat.In diesem Vorbuch geht er eben auch viel länger noch, viel näher noch in diese religiöse, in die Ideengeschichte, in die Religionsgeschichte rein und konstruiert das irgendwie ganz differenziert aus und so, also, wer in den Aspekt tiefer reinsteigen will, diesen historischen Aspekt, da würde ich tatsächlich eher dieses Patterning Instinct mehr anschauen.Da habe ich mich aber nicht in der Lage gesehen, das irgendwie ansatzweise zusammenzufassen.Okay ja vielen vielen dank nils war sehr spannend ich glaube es ist schon ein buch dass man lesen muss also im sinne von wenn man also ich habe ich habe viel mitgenommen aber ich ich muss natürlich oder ich darf auch ein bisschen die position der kritikerin hier ein ja sicher im podcast aber trotzdem für mich ist es sind schon viele konzepte haben so diesen dualismus na also dass ich und.Versus das Selbst oder emotional und rational und so weiter.Und ich fände es schon spannend, wie er das dann wirklich auflöst in diesem Ganzen, weil Er kommentiert sonst mit den gleichen …Dingen gegen die ihr eigentlich argumentiert aber eben ich glaube man muss das selbst lesen ich stelle mir das unglaublich schwierig vor das zusammenzufassen also vielen dank dafür.
Mehr Literatur
[1:17:43] Ich habe ganz viele assoziationen während dem zuhören natürlich gehabt einerseits zu folgen die wir schon aufgenommen haben du hast selbst schon erwähnt von wangrow graber und wangrow die anfänge das passt wahrscheinlich ziemlich gut dazu.Resonanz hast du auch erwähnt, das ist folge eins.Dann ich würde auch noch die folge zu Dawkins empfehlen, Extended Phenotype.Auch das Buch dazu, weil ich gehe davon aus, der Teil, wo es um Genetik geht, da geht es auch ein bisschen um diesen genetischen Determinismus.Und Dawkins ist so ein bisschen eher dafür bekannt, sein erstes Buch, aber er relativiert das auch sehr stark, dann in dem Buch, das ich vorgestellt habe und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil genau das passiert, wie ich mir das vorstelle, was er sich wünscht, dass man das eben dann ein bisschen in diesem anderen Zusammenhängen denkt.Ja, er bezieht sich vor allen Dingen auf Dawkins Selfish Gene an der Stelle, also diese Idee, dass das Gen die agierende Instanz ist, die irgendwie hinter allem steckt, weil sie sich weiter verbreiten will.Deswegen vielleicht auch nochmal klarer, warum die Zelle sich dagegen stellt, weil Dawkins in dem Buch zumindest dem Gen, so einen Agenten-Charakter fast schon zuschreibt.Ja, ja, ja.[1:19:00] Was mir auch in den Sinn, ich glaube, das hast du auch in einem Beitrag erwähnt, auf welchemkreuzer.de, das Buch von Nasehi, Musta?Mhm, ja. Ich glaube, das ist das, ja, wo es auch so um diesen Digital Twin geht, ne?Und ganz generell finde ich auch jetzt, mit der ganzen KI und Daten, ist ja auch mein Beruf, aber ich sehe da genau dieses Problem extrem stark.Man hat das Gefühl, man kann die Realität in Daten abbilden, aber das ist halt einfach ganz was anderes.Es ist eine Abbildung, aber es hat überhaupt nichts per se damit zu tun, wie es, na ja, auf das, was wir untersuchen möchten. Sie ist halt extrem verlustbehaftet. Genau.Das finde ich sehr… Da haben wir auch eine Folge drüber, glaube ich, irgendwie anzupfen.Ich such’s raus und pack’s dann in die Show-Notes.Bezüglich sonst Büchern, Glauben und Wissen von Volker Gerhardt, ist auch so ein kleines in Deutschland von Reklam, wo genau dieser Gegensatz auch diskutiert wird.[1:20:02] Was ich auch sehr spannend fand, ist von Lorraine Dustin, Gegen die Natur, wo es auch ein bisschen so um diesen Naturalismus-Begriff geht und wie wir den eben verwenden oder missbrauchen zum Teil auch.Also auch ganz dünn, aber dicht und interessant.Dann ein Buch, was ich sehr schön fand zu lesen, ist Das geheime Leben der Bäume von Peter Wohlleben. Kennst du es?Es ist auch auf meiner Liste tatsächlich jetzt. Im Nachklapp zu der Lektüre von The Web of Meaning ist bei mir eine Leseliste entstanden. Da steht das unter anderem auch drauf.Ja, finde ich sehr. Es gibt mittlerweile, ich glaube, ganz verschiedene von ihm, wo es um dieses Thema geht. Aber ich fand das auch echt sehr schön und erhellend, wie auch Bäume miteinander kommunizieren und so weiter.Also auch so ein spezifischer Blickwinkel auf dieses Thema.[1:20:55] Ja. Und du hast noch im Grunde gut von Pragman erwähnt, das ist bestimmt auch sehr lesenswert diesbezüglich.Und dann habe ich noch einen Artikel und zwar, es heißt ja The Conscious Universe, das ist im Nömer oder Noema Magazin erschienen, wo es eigentlich genau darum geht und auch um, Dieses Konzept von, ich glaube, was, Tononi war das?Ja, Tononi, genau, ja, richtig. Die Messung von Bewusstsein, ne? Ja.Ja, genau. Such ich noch raus und pack ich auch da rein. Ja.Generell, absolute Leser-Empfehlung. Das Noima, Noma, was auch immer Magazin, das ist bei mir tatsächlich auch im Feedreader.[1:21:36] Ja, das wär’s so von meinen Empfehlungen. Da hast du schon etliche, ich hab wieder den Vorteil, dass ich vorher Zeit hatte mir Gedanken zu machen, hast etliche von meinen Assoziationen aber auch schon gehabt.Ich hab noch ein paar mehr und auch ein paar andere. Bei den Episoden finde ich auch noch ganz spannend von John Hicks, alles ist relativ und anything goes. Das ist glaube ich Episode 3.Weil es da auch ganz stark so um Sinnsuch geht und um so ein bisschen, ja, das 20. Jahrhundert so als Übergangsjahrhundert, was so kollektives Denken und so angeht.Das schließt vielleicht gar nicht so schlecht an Lent an der Stelle an.Dann haben wir Folge 46, erzählende Affen, von Samira El-Ossile und Friedemann Karich.So für den Aspekt dieses Ich, das uns irgendwelche Geschichten erzählt.Und die Kultur, die uns irgendwie hilft, so Sinn zu schaffen, indem sie uns so Geschichtenfragmente anbietet.Seine praktischen Hinweise, da kommt von Land of Dinge, die ich auch bei Alain de Botton so ein bisschen praktischer gelesen habe, in Religion für Atheisten.Das war Episode 11. Und dazu generell so dieses, wie kommt man denn da hin, zu diesem Zugehörigkeit, zu eher Eudaimonia, weniger Euphoria. Das ist auch ein Thema in Religion für Atheisten von Alain de Botton.Dann haben wir tatsächlich ein ganz, ganz direkt umweltbezogenes Buch von Farlay Mowat, Ein Sommer mit Wölfen, Folge 6.[1:22:58] Dann haben wir ein Buch, wo es direkt um Komplexität geht. Das taucht ja auch immer mal wieder auf.Die hatte Amanda oder ich kurz angesprochen von Holger, die Folge 49, The Collapse of Chaos von Ian Stewart und Jack Cohen.Ähnlich bezogen, auch Thema Komplexität ist im Wald vor lauter Bäumen von Dirk Brockmann. Da haben wir ein ähnliches Thema auch.Und dann zum Thema Wissenschaftskritik hatte ich ja auch mal eine Episode gemacht von Michael Strevens, The Knowledge Machine, Episode 27, der ja auch im Grunde so ein bisschen zu dem Schluss kommt.Wissenschaft ist super gut und super wichtig und super toll, aber sie zeigt uns halt nur einen ganz bestimmten Ausschnitt aus der Welt.Und das ist auch richtig so. Und ich glaube, Lent würde so ein bisschen anschließend daran sagen, ja, den Ausschnitt sollten wir so langsam mal erweitern. Ja, ja, ja.So, das passt vielleicht auch noch ganz gut. Ja, ja, cool.Ja, jetzt habe ich gerade von meiner Leseliste erzählt. Da sind jetzt, habe ich euch mal noch vier Bücher mitgebracht, neben dem geheimen Leben der Bäume, das Amanda ja gerade schon angesprochen hat.[1:23:57] Das ist einmal Der Krake, das Meer und die tiefen Ursprünge des Bewusstseins von Peter Godfrey Smith.Das ist jetzt ein Beispiel, das kommt im Buch gar nicht so groß raus, aber tatsächlich sind so Oktopusse im Grunde eine Form von nicht-menschlicher Intelligenz.Also sie sind im Grunde wie eine Alien-Intelligenz, weil deren Intelligenz sich evolutionär mehr oder weniger unabhängig von unserer entwickelt hat.Und entsprechend viel können sie uns über das sagen, was es denn noch so an Intelligenz geben könnte.[1:24:24] Das bringt dann auch uns im Grunde direkt zum nächsten Buch, die unfassbare Vielfalt des Seins, jenseits menschlicher Intelligenz von James Bridle.Was im Grunde genau das ist, was das behauptet zu sein, also auch so ein bisschen versucht tierische Intelligenz mehr zu rekonstruieren.Franz de Waals Buchtitel, der nächste, ist an sich schon sehr aussagekräftig.Are we smart enough to know how smart animals are?Also sind wir klug genug zu wissen, wie klug Tiere sind? Also da kommt zum Beispiel unter anderem diese Idee der Anthropo-Denial her, also dieser Ablehnung, dieser übermäßigen Ablehnung, dass Tiere uns irgendwie ähnlich sein könnten.Gibt auch irgendeinen Artikel, einen schönen Gedanken, warum sind wir da so wild drauf, dass Tiere uns, dass wir so viel besser sind als Tiere, weil wir sonst uns schwer damit täten, die Umwelt so auszunutzen, wie wir das tun.Sprich, der Kapitalismus ist mal wieder schuld. Keine Ahnung, wie ernst man das jetzt nehmen muss, aber fand ich einen spannenden Gedanken.Und das letzte Buch, die erstaunlichen Sinne der Tiere, Erkundung in einer unermesslichen Welt von Ed Yong, wo es halt jetzt weniger um Intelligenz geht, sondern einfach um Wahrnehmung.Die aber ja natürlich im Grunde irgendwie ganz eng damit verbunden ist, weil ich kann irgendwie nur Dinge, auf Dinge reagieren intelligent, die ich wahrnehmen kann.Und wenn ich andere Dinge wahrnehme, dann werde ich auch irgendwie anders, anders intelligent reagieren.[1:25:42] Ja, das war meine Buchliste. Ich hab noch mehr, aber ich will euch jetzt nicht noch mehr zuknallen und wenn ich die irgendwann mal alle gelesen oder zumindest überflogen habe, dann gibt’s auf meinem Blog viel mehr Notizen dazu, das gibt jetzt schon viel mehr Notizen dazu, also falls euch das weiter interessiert, weltenkreuzer.de ist da gerade euer Freund.Vielen Dank. Ja, mir sind auch noch gleich ein paar in den Sinn gekommen, die pack ich dann einfach in die Show Notes, da kann man durchstöbern.Ja, so, das wär’s gewesen. Wir haben ein bisschen überzogen, war absehbar.
Ausstieg
[1:26:13] Ich hab’s befürchtet.Nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns im Internet auf unserer Webseite zwischenzweidecken.de.Ihr findet uns auf Social, Anti-Social Media, wie auch immer man das nennen möchte.Zwischenzweidecken auf Facebook, adddecken auf Twitter und Instagram, beziehungsweise X und X Instagram und auf Mastodon unter zzd.podcast.social. Wir freuen uns immer über Sternchen oder Anfragen oder Kommentare, also sehr gerne und sonst hören wir uns beim nächsten Mal.Tschüss zäme! Tschüüüüss![1:26:51] Music.
Der Beitrag 064 – „The Web of Meaning“ von Jeremy Lent erschien zuerst auf Zwischen zwei Deckeln.

Sep 28, 2023 • 1h 6min
063 – "Epistemische Ungerechtigkeit" von Miranda Fricker
Das Buch „Epistemische Ungerechtigkeit“ von Miranda Fricker handelt von den unterschiedlichen Arten, wie wir – als sozial situierte Menschen – uns gegenseitig Wissen vermitteln, und welche Ungerechtigkeiten damit einhergehen können. Der erste ihrer zwei zentralen Begriffe ist die Zeugnisungerechtigkeit, die immer dann auftritt, wenn man jemandem nicht glaubt, weil man gegenüber dieser Person ein identitätsbezogenes Vorurteil hegt. Mit hermeneutischer Ungerechtigkeit beschreibt Fricker die Ungerechtigkeit, die dazu führt, dass eine Person ihre soziale Umwelt nicht adäquat beschreiben und deuten kann, weil ihr die kollektiv geteilten Begriffe dazu fehlen.
Shownotes
„Epistemische Ungerechtigkeit“ von Miranda Fricker (Verlagswebseite)
„Für den Zweifel“ von/mit Carolin Emcke (Verlagswebseite)
„Epistemisch“ (spektrum.de)
„Hermeneutik“ (philomag.de)
„Der talentierte Mr. Ripley“ (Wikipedia)
„Kontakthypothese“ (kontakt-gwa.de)
weitere Literatur und Empfehlungen
Miranda Fricker in der Sternstunde Philisophie
ZZD047: „Die Erschöpfung der Frauen“ von Franziska Schutzbach
„Wir müssen über Rassismus sprechen“ von Robin DiAngelo (Verlagswebseite)
„Über Ungerechtigkeit“ von Judith N. Shklar (Verlagswebseite)
„Das Ende von Eddy“ von Édouard Louis (Verlagswebseite)
ZZD013: „Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe rede“ von Reni Eddo-Lodge
ZZD034: „Amerikas Gotteskrieger“ von Annika Brockschmidt
ZZD038: „Anfänge – Eine neue Geschichte der Menschheit“ von David Graeber und David Wengrow
ZZD055: „Die Werte der Wenigen“ vom Philosophicum Lech
Adam Tooze bei Jung & Naiv
„Die Pest“ von Albert Camus (Wikipedia)
„Der Fremde“ von Albert Camus (Wikipedia)
„Gesellschaft als Urteil“ von Didier Eribon (Verlagswebseite)
„Rückkehr nach Reims“ von Didier Eribon (Verlagsbweseite)
„Gegen den Hass“ von Carolin Emcke (Verlagswebseite)
Transkript
Einstieg
[0:00] Music.
[0:15] Bekommen 263 folge von zwischen zwei Deckel in eurem Sachbuch Podcast mein Name ist Christoph und ich habe heute Amanda mit dabei.
[0:25] Göttin ja wir nehmen tatsächlich jetzt mal richtig früh morgens auf vor unserer Arbeit hier weiter so hier bei mir scheint gerade der Sonnenaufgang ins Arbeitszimmer ist das ganz schön und bevor wir gleich zum Buch kommen erstmal an Dich die Frage Amanda womit schlägst du dich gerade privat rum womit beschäftigst du dich.
[0:45] Rumschlagen ist das ist das Stichwort ich lerne nämlich japanische Moment ich lerne das schon seit Jahren und dann höre ich wieder auf weil ich frustriert bin und jetzt dann habe ich aber die Gelegenheiten endlich mal nach Japan zuzugehen in ein paar Wochen und deswegen ist das Projekt wieder von neuem Angelei cool, dass das freut mich dass du die Chance hast nach nach Japan zu gehen lasst uns ja richtig gut japanisch wäre ich mir nicht so einfach vor so mit eigenem Schriftsystem und so ist das ja nicht uns keiner Alphabetschrift ne.
[1:23] Ja ich ich lasse die Schritte okay also es gibt so dieselbe Schrift das ist einfach es ist einfach so wie.Halten keine Ahnung 100 Zeichen dass das geht da nicht ganz gut aber die Schwierigkeit die ich finde also ich mach vor einem komm mit mir Konversation.Dass der Syntax so anders ist also du kannst nicht einfach das.Irgendwie wird es in allen Sprachen die ich bisher gelernt habe unmöglich war das ein Satz einfach so ein bisschen.Veränder musst und dann dann kannst du den trotzdem übersetzen sondern du musst dich entweder wirklich überlegen was ist jetzt meine Intention was will ich sagen will ich jetzt eine Wahrscheinlichkeit ausdrücken die zu 90% eintritt oder zu 70 oder zu 40 und dann verwendest du ein Angebot Ausdrücke das ist schon eher das braucht irgendwie das macht es einfach total langsam ne also für jeden das brauche ich Ihnen.5 Sekunden Vorlauf hätte ich mir wirklich anstrengend vor.Erstmal aber er habe viel viel Erfolg weiterhin ich hoffe nur du bekommst dann in Japan gut zurecht ja und bei mir also bei uns im Umfeld oder heiratet eine sehr gute Freundin von uns und da sind wir auch hin.Also ich kann nicht soviel sehr wie meine Partnerin das sehr eingespannt und ansonsten.Geht die Nachbereitung der Ferienfreizeit jetzt auch schon wieder los das heißt da muss man sich kümmern und irgendwie, ja es ist das irgendwie viel Freizeit Verpflichtung die alle total schön sind aber es kommt gerade auch sehr geballte auf einmal.
[2:51] So so sieht’s aus ja was or wobei ich mich sehr gefreut habe ich find Interview Ben immer total, schwierig gerade mit Autorennen die ich eingestellt habe gerne mag also es ist nicht immer ein gutes Format finde ich aber ich habe jetzt gerade gegen den Hass von Carolin oder mit Carolin eben gelesen also das sind nur 150 Seiten und das wird es ging schnell das hat mich nicht wochenlang beschäftigt aber darüber habe ich mich sehr gefreut weil ich finde, die Interviews wirken sehr so wie sie auch spricht und wie sie wenn sie wenn sie irgendwo auftritt ja bis sie da auch auch erlebe also ich habe das Gefühl die die passen irgendwie gut zu ihr und ja dass das war irgendwie gut schön das gelesen zu haben.
[3:33] Ich find das Buch auch ganz toll ich habe das schon mehrfach empfohlen das ist das mit Thomas Strässle ja genau mit mit einem Schweizer zusammen.Sehr beeindruckend wie sie wie sieht es wie sie das schildert und es ist schön weil es das Buch spannt ja auch verschiedene Themen wie sie da darüber schreibt man dass ihr beeindruckend oder darüber spricht besser gesagt bin gespannt vielleicht ist es was für eine 1 folgen der wenig einige ein großes Buch verschwinden und verschiedene kleine vielleicht machen wir sowas irgendwann noch mal Nährwerte apropos Bücher du hast uns heute mitgebracht epistemische Ungerechtigkeit macht und die Ethik des Wissens das hat mir an Afrika geschrieben oder Miranda Fricker vielleicht auch ich weiß es nicht genau und das ist jetzt erst bei CH Beck dieses Jahr erschienen.Da beißt die englische Originalausgabe epistemic injustice power and ethics of knowing schon 2007 erschienen und du hast mich hier vermerkt dass das Buch das Hauptwerk von der Autorin ist und sie ist Philosophen die in Oxford promoviert hat und jetzt gerade ist irgendwie in New York tätig und.Ja spannend das nach 16 Jahren dass das dann den den Weg ins Deutsche gefunden hat weißt du weißt du irgendwas warum jetzt erst.
[4:56] Ich weiß nicht warum jetzt er ist ich weiß nur dass ich dass ich habe das gesehen im Buchhandel dachte yes ich bin so was du an Andi am Rad der Zeit was willst du mit meinen Büchern die ich hier lesen möchte dann habe ich gesehen alles ist 20 Jahre alt aber das Thema ist natürlich hochaktuell und ich weiß wirklich nicht warum das bisher nicht übersetzt worden ist aber.
[5:19] Manchmal habe ich das Gefühl habe mein Hirn bisschen im Nachteil weil es ist halt ein philosophisches Buch und, ich würde dass ich ich lese viel auf englisch und das ist das passt auch eher in der Regel aber ich ich lese das jetzt nicht aus Spaß ne Englisch und Deutsch geht’s schon ein bisschen einfacher und ich kann verpasst man halt schon irgendwas wenn man 20 Jahre dauert bis da, das übersetzt wird ja das ist tatsächlich so ja ich finde es insofern schade als dass wir ja auch eine wirklich bei unserer Übersetzung Landschaft hier im deutschsprachigen Raum ist ja auch wirklich gut also wenn wenn übersetzt wird ist das ja häufig dann auch von sehr hoher Qualität ich weiß nicht ob das in jeder Sprache so ist am von daher Nerven.Ich bin auch niemand der einfach nur des Genusses wegen gerne viel auf Englisch liest dass ich lese auch auf englisch aber wenn es eine gute Übersetzung gibt warum nicht mehr aber magst du uns eine kurze Zusammenfassung geben.
Kurzzusammenfassung
[6:19] Das Buch epistemische Ungerechtigkeit von Miranda Fricker handelt von den unterschiedlichen Arten wie wir als sozial situierte Menschen uns gegenseitig Wissen vermitteln und welche Ungerechtigkeiten damit einhergehen können.Hier unterscheidet sie zwei Arten einerseits die Zeugnis Ungerechtigkeit und an der Seitz die hermeneutische Ungerechtigkeit.
Buchvorstellung
[6:42] Das klingt tatsächlich nach nach anspruchsvoller Philosophie und nicht so sehr nach populär Sachbuch ich bin sehr gespannt und sehe meine Aufgabe darin Dinge nachzufragen und die sich vielleicht nicht sofort erschießen perfekt ja also wie gesagt die, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen vor der vor der Aufnahme es sind viele philosophische Begriffe in dem Buch drin es ist nichtsdestotrotz eigentlich aber sehr gut lesbar das muss man schon sagen vielleicht trotzdem zu beginnen also epistemisch das ist auch im Titel meint hier, in Bezug.Auf das Wissen auf die Wissens erlangen also immer wenn epistemisch als Adjektiv vorkommt dann ist das eigentlich gemeint also wie weg wie kommen wir zu wissen was bedeutet das für den Menschen wissen, zu erlangen eigentlich, Dream und hermeneutische ich sag’s auch gleich schon jetzt meint eigentlich die Interpretation oder die Deutung.Und jetzt in ihren ihrem Sinne oder in in in in dem Beispiel von vom Buch geht es insbesondere auf den Tee pretation der eigenen sozialen Realität.
[7:55] Wieso was ich weiß über mich und und und uns als Gesellschaft und wie ich das interpretiere und deute das Mainz mit hermeneutisch okay.
[8:07] Das Buch wie gesagt ist philosophisch und die Begriffe werden auch sehr systematisch hergeleitet also es ist.Sehr klar aufgebaut in diesem Sinne ich werde auch ein 2 Kapitel überspringen wo es einfach nur wirklich um um auch um die Verortung in der Philosophie geht aber es ist.
[8:26] Auch trotzdem sehr anschaulich geschrieben als ich viele Beispiele macht und viele Beispiele auch mit Literatur und Film z.b. aber sehr gut okay das wirst du nicht bei sowas manchmal wirklich einen ein Beispiel kann manchmal so viel mehr helfen als drei Seiten Erklärung das ist seine Teil gut wenn es macht ja genau was.Sie so ein bisschen hervorhebt ist man kennt man kennt vielleicht so bisschen die die die klassische Erkenntnistheorie oder Philosophie.Die sagt was sie versucht ist.
[9:04] Das ein bisschen aufzubrechen insofern als dass man den Menschen wirklich auch als sozial situiert begreift also dass es nicht die klassische Erkenntnistheorie die die den Menschen total abstrahiert man schaut ja wie kann man Wissen erlangen und so weiter.Sondern es geht darum sie denkt sich den Menschen in der Gesellschaft in einem sozialen Umfeld im in Machtverhältnissen auch.
[9:30] Und sagtest trotzdem also und dass das insbesondere auch einen einen sehr relevanten Teil 1 Einfluss hat auf auf die.
[9:38] Distance Erlangen mehr auf unsere soziale Praxis diesbezüglich und das finde ich gut also so so einer.Zum habe ich das so kennengelernt einer sozialwissenschaftliche Kritik an und ich sag mal so ein bisschen aseptischen Philosophie Überlegungen die sehr die dann häufig nur mit Alter und also mit Ego und Alter operieren also maximal eigentlich zwei, zwei Personen die miteinander in Kontakt treten und man sich dann von da ausprobiert sehr viel herzuleiten was.Glaube ich für fundamentale Überlegungen sehr viel Sinn ergeben kann aber natürlich eher nicht der sozialen Realität entspricht weil wir immer in Gesellschaft geworfen sind von daher freut mich dass wenn sie wenn sie das etwas anders angeht.Total aseptisch finde ich finde ich ein sehr schöner Begriff dafür er sie.Geht von gewissen Grundsätzen natürlich aus und einer davon davon ist das wissen.Eigentlich ein ein integraler Bestandteil davon ist was uns als Mensch was es uns als Mensch ausmacht oder was ja unsere Eigenschaft als als Mensch.Beruht darauf dass wir wissen gewesen sind eigentlich und dass wir auch das Wissen weitergeben und.Daraus folgt dass wenn wir das nicht tun können in deshalb auch immer dass wir dann eigentlich in unseren unserem Wert oder in unsere würde herabgesetzt werden.
[11:04] Baby überall so.Wenn also wenn wir nicht die Möglichkeit haben das was wir erlernt haben an andere weiterzugeben dann ist das irgendeine Art von deprivationserfahrung war sie.Genau das ist Quell von einer Ungerechtigkeit eigentlich.Weil manche Leute das können und andere können das nicht genau ja okay.
[11:29] Wenn also das ist so ein bisschen wissen und dann so macht habe ich schon gesagt spielt in ihrem Konzept auch eine Rolle und sie begreift macht, eigentlich als als die Fähigkeit die Handlungen von anderen Personen in einem sozialen Kontext zu beeinflussen.
[11:48] Das kann Einzelpersonen sein das kann aktiv oder passiv wirken oder das kann auch strukturell wirken, es ist ein bisschen eine andere Definition als ich noch auf dem Studium von Weber am kenne das dort wird er ja mir irgendwie den der eigene Wille betone und.Gegen gegen den Willen von anderen durchzusetzen ja doch mal bei gibt dass man stärker ist als andere ne also oder dass man mehr Mitte hat oder wie auch immer der ja dass man.Ja dass man seinen sein wegen auch gegen Widerstände durchsetzen kann so so Anfänger.Und bei ihr ist dass er also sie sagt dann auch explizites Machtausübung muss nicht zwangsläufig jemandem jemanden schaden, mehr als es kann schon auch hin also sie macht es ein bisschen generischer und sagt okay man kann niemanden damit beeinflussen wenn man macht hat aber es muss nicht zwangsläufig zu der negativ, ich mache mal ganz Acker dich negativ sein und.
[12:47] Was dann an ein weiterer Begriff der sehr relevantes für alles ist ist das glaubwürdigkeits Urteil und das ist also die die Basis worauf dann die weiteren Überlegungen sich aufbauen.Yunnan glaube die Glaubwürdigkeit Urteil ist eigentlich das was ich immer tue wenn ich mit jemandem spreche im Sinne von wenn ich beurteile ob diese Personen meine sprechpartner in glaube ich ist oder nicht also ich treffe eigentlich immer ein Urteil darüber Berkemann also in jeder sozialen Situationen jeder spreche Gesprächssituationen.
[13:27] Wahlprogramm urteilen wir darüber und und machen uns ein Bild davon ob die andere Person gerade wahrhaftig ist kann man das so sagen, ja sie ja sind sie Puzzle das natürlich dann noch sehr granulär auf aber ja ich glaube das kann man schon so sagen einfach genau ob man inwieweit man, eigentlich der Aussage traut und dass diese für sich selbst als wahr.Empfindet oder übernimmt was die andere Person sagt und es gibt hier also manchmal kann z.b. unterscheiden dass man einen glaubwürdigkeits Überschuss hat oder ein Glaubwürdigkeit Defizit das bedeutet also du hättest dir jetzt einen glaubwürdigkeits Überschuss wenn ich so total von dir begeistert wäre dass ich keine deine Aussagen kritisch hinterfragen ayayayay, ja und das ist so sie sagt dass es mit den meisten Fällen eher positiv es gibt es gibt einige.
[14:35] Fälle wo das auch sich negativ auswirken kann z.b. werden, angenommen du möchtest dass ich eine Arbeit von dir korrigiere aber weil ich weil ich dich so an himle mache ich das gar nicht kritisch schnell dann hast du sozusagen Nachteil davon dass ich das Unglaubwürdigkeit Überschuss, ähm hat immer in meinen Augen und das Gegenteil davon ist dass Glaubwürdigkeit Defizit also was dass ich eine Aussage von dir.Nicht traue oder weniger Trauer als ich das eigentlich könnte.
[15:09] Ich frage mich gerade wie viel das mit den anderen Menschen zu tun hat und wie viel mit einem selbst also.Ich muss dann denken dass man natürlich sozial Situationen haben kann wie wenn du jetzt meine Arbeit Korrekturlesen würdest dann dann kenne ich dich ja da.Oder oder wir kennen uns das ja eine gewisse Vorprägung und Erwartungshaltung da.Aber man ist ja auch in vielen sozialen Situationen indem man völlig ad-hoc urteilen muss und, da frage ich mich dann geht es so sehr um die anderen oder geht das ganz viel auch um meine eigene Einstellung zur Welt und da mein keine Ahnung z.b. institutionenvertrauen also glaube ich das, Banken oder so ordentlich ihr arbeiten und wenn ich dahin gehe und mein Geld einzahlen dann wird es schon alles klappen dann hat es ja gar nicht so viel mit dem Bank Beamten oder mit dem Bankautomaten heute aber mit dem Bank Beamten zu tun oder der Beamten.
[16:02] Sondern vielmehr damit optimal wie mein Grundvertrauen zur Welt ist weißt du ein bisschen was ich meine, das ist jetzt ein sehr sehr guter Einwand den bringt sie natürlich auch an und sie sagt eine ihrer Schlussfolgerungen ist auch dass man sich, gerade eben nicht nur auf das Gegenüber konzentrieren darf auch auch philosophisch sondern.An das ist ganz ganz viele Wand ist wie man selbst ist und jetzt nicht nur seine eigene Weltanschauung sage ich mal sondern auch die Beziehung die man miteinander hat also das hat ihm das Machtgefüge zwischen dir und von mir aus oder halt Zwischen uns als Gesprächspartnern dass das ganz relevant ist aber.
[16:50] Was sie leitet dann so diese generelle Einstellungen würden wie du jetzt wie man das vielleicht zusammenfassen kann her von stereotyp und Vorurteil und bei beim Stereotyp sagt sie dass das ist eigentlich ein.
[17:12] Also eine Assoziation zwischen einer bestimmten sozialen Gruppe und Gewissen Eigenschaft.Jetzt kommt hier zu einer zu einer Verallgemeinerung von von diesen Eigenschaften in Bezug auf eine soziale Gruppe in sozialen.
[17:32] In in der sozialen Interaktion Verb und ein Vorurteil ist dann so ein bisschen spezifischer in dem das ein Urteil ist.Ähm das sehr wieder ständig gegenüber gegenteiligen beweisen ist.Mehr also einen Stereotyp das ist ja so ein sowas allgemeines und sie beschreibst ihre type auch auch endlich als Kunststudium Bestandteil von diesem urteilen die wir Fälle na das ist nicht das ist nicht.Inferentiell Esstisch das meint er im Sinn von das ist nicht schlussfolgern nein ich sag nicht das und das und das ist so und aus diesem Grund glaube ich Dir jetzt natürlich kann man das rational irgendwie über Formen und und sich das überlegen aber sollte ein spontanes Urteil.Funktioniert nicht so sondern wir haben eines diese Stereotype irgendwie uns einverleibt durch unsere Sozialisation und die führen dazu dass wir spontane, ja spontane Einschätzungen Fällen können ja in einer Gesprächssituation und das Vorurteil das ist wie gesagt das ist dann so ein bisschen härter in dem Sinne als dass es halt natürlich auch ein negatives Vorteil sein kann.Und dass man das nicht so einfach korrigieren kann also dass das auch wenn man.Einer einer gegenteiligen Situationen ausgesetzt ist dass man das dann nicht im revidiert sie macht ein Beispiel.
[18:59] Wo es darum geht dass also es ist ein fiktives Beispiel so ein Gedankenexperiment wo es um einen jungen Mann geht der ist in einer Gesellschaft aufgewachsen wo entweder es gibt keine Frauen oder Frauen sind im mir hat damit keiner mit ihnen kann Kontakt und alle seine, ja deine intellektuellen Bemühungen oder Beziehungen hat er mit Männern geführt und da kommt der irgendwo in eine andere Gesellschaft.Und lernt dort Frauen kennen die durchaus natürlich intellektuell ebenbürtig sind und.Dann sagt sie ja also wenn er dann das.In der Eden Traktion merkt ok das ist es ein anderer sozialer Typ ne das ist jetzt eine Frau wenn man so wie sie das bestimmt und.Sie hat sie ist mir gleich ebenbürtig obwohl ich das so nicht kenne aus meiner Sozialisation dann ist es in dann hatte er zwar vielleicht ein Vorurteil davor aber konntest revidieren wenn er aber die soziale Erfahrung macht und Frauen kennenlernt, Vola ist ihm gegenüber einen Vorteil hätte oder hatte.Und das dann nicht revidiert also sozusagen auf seiner Position behaart obwohl er ganz viele Gegenbeweise hat dann ist das so ja.
[20:24] Die Eigenschaft davon dass es dass man sich auch ein bisschen schuldig machen in dieser Hinsicht.Ja okay wenn man wenn also wenn man nicht nicht bereit ist daran zu arbeiten und die die Gegenbeweise gegen seine Vorurteile annimmt und sie ignoriert dann.Bist du sehr müde offensichtlich verwerflich.
[20:43] Genau wir halt auch in Aussicht dieser Frau sag mir ne wenn wenn wenn sie jetzt mit ihm zum ersten Mal konfrontiert sind kann man ihn wie keine Schuld anlasten weil er hat es halt wenig einfach nicht anders gekannt hat ja aber nehmen wenn es dann immer weiter in Kontakt trotzdem so bleibt dann kann man durchaus sagen Kindern dann geschieht der Frau nicht an Ungerechtigkeit weil weil sie halt ja weil dieses Vorteil bestehen bleibt.
[21:13] Ja ok und das macht natürlich im Kontext von dann Machtgefüge auch.Sehr konkrete Unterschiede und macht sehr viel aus na so dass also das Beispiel mit der mit der Machtverteilung zwischen Mann und Frau und wer ihm wegen der Ebenbürtigkeit ist ja, in dem Fall jetzt konstruiert aber dann auch letztlich hier Gesellschaft nicht gar nicht so konstruiert sondern serial ne also ist es ja also das lässt sich ja sehr gut auf auf die wirkliche Welt übertragen.Ja total und und dass sie macht auch dann, hier ist was sie hinaus will ist da nicht ein ganz spezifisches Vorurteil und zwar das identitäts bezogene Vorurteil und das ist eines gegenüber anderen Menschen die.Aufgrund des sozialen Typus diese Menschen haben.Konstruiert vietnam es ist wirklich deine Identität bezogen und das verwendet sie dann auch in ihrer Definition von epistemische Ungerechtigkeit.
[22:17] Jetzt.
[22:20] Ich mache mal noch mal einen Schritt zurück epistemische Ungerechtigkeit das ist so der Überbegriff auch des Buches meint die Ungerechtigkeit die jemandem in seiner oder ihrer Rolle als Wissen Subjekt widerfährt.
[22:34] Und die eine Art davon das ist die Zeugnis Ungerechtigkeit und.Diese Zeugnis ist es auf Deutsch wenn ich so ein bisschen holprig weil, ich kann damit nicht so viel anfangen und auf auf englisch ist es testimonium injustice und Zeugnis meinte eigentlich einfach na ja eine Aussage in dem Gespräch die man mit einem Wahrheitsgehalt, blinken oder welche war die erste die die die wir haben gerade eben über die Glaubwürdigkeit quasi gesprochen das hatte aber auch ein Begriff ne oder.
[23:12] Genau ja also nee glaube die Glaubwürdigkeit ist eigentlich das was immer.
[23:19] Vorhanden ist ne also bzw die Glaubwürdigkeit Urteile das ist das was was du immer tust ja implizit im Gespräch da komme ich auch gar nicht raus sondern dass du das immer mit ja genau und als Zeugnis eine Zeugnis Ungerechtigkeit passiert immer genau dann wenn ich dich, wenn ich dir eigentlich keinen Glauben schenke obwohl ich das.Könnte und ich glaube ich ich schenke dir keinen Glauben weil ich ein identitäts bezogenes Vorteil dir gegenüber hege.Ja okay wir haben das ist so der zentrale Punkt der Zeugnis Ungerechtigkeit.Weil ich bin wer ich bin irgendwelche Strukturmerkmale mit kriege ich von dir keinen.Genau ja okay ganz klassisch oder klassisch leider das ist dass die glaube ich Kite wenn eine schwarze Person z.b. wenn wenn die Polizei an der schwarzen Person weniger gehabt als einer weißen ne das ist so ein klassischer Fall von Zeugnis Ungerechtigkeit.Auch das dass wir vorhin schon hatten nicht also die wenn diese gender macht identitäts macht im Spiel ist also wenn wenn ich als Frau zu Mann weniger Glaubwürdigkeit erhalte von einem Mann oder im Gespräch mit einem Mann.
[24:44] Und es gibt sie macht sie baut viele ihre Beispiele auf einem, auf einem Dialog auf von der talentierte Mister Ripley ich weiß kennst du den den kenne ich nicht nein kenne ich auch nicht jeden Fall ist der Hauptsatz davor es gibt darum einen Mörder zu finden und der Mörder ist natürlich befreundet mit mit der Person Dieter umgebracht hat und seiner Freundin und so weiter und in 1 haben alle ja das Bedürfnis nach die Wahrheit zu finden also die haben alle dass dieser Düsenantrieb.Aber Moritz das ist eben die Freundin von vom vom Verstorbenen die.Hat das auch aber die argumentiert halt bisschen gesagt mal.Intuitiver und wird dann ab gekannten mit Umsatzmarge es gibt weibliche Intuition und es gibt Fakten, ja und da haben wir dann so dass alles ein bisschen aufgehängt ist sein ich ganz ja ganz spannend weil.Meine Lieben das natürlich ganz viel steckt wenn es um diese Zeugnis und Gerechtigkeit geht.
[25:59] Jetzt.
[26:04] Es ist es ist so ein bisschen oder es ist einleuchtend dass das zu einem Unrecht wird ne also wenn man, wenn einem nicht geglaubt wird.Fricker sagt auch dass das ein bisschen unterschätzt wird also dass diese Art von Ungerechtigkeit eigentlich wie zu wenig.
[26:26] Ja zu wenig.
[26:30] Na gesprochen wird vielleicht also ich finde die ja ich finde die Dimension sehr einleuchtend aber muss auch ehrlich zugeben dass ich mir bis zu diesem Podcast.Wenn dann nur sehr implizit darüber Gedanken gemacht habe also im im Sinne von nur so wie du das gerade beschrieben hast wenn einer schwarzen Personen von der Polizei oder vom Gericht oder vielleicht ist es im deutschsprachigen Diskurs sind das ja noch andere Migrationshintergründe wenn die weniger Beachtung schenken finden dann.Du ist mir schon klar dass das ungerecht ist und nicht fair aber das ist so eine strukturelle Dimension ist ja ist vielleicht unterbelichtet wäre ich glaube ich bei bei Frau Fricker.Ja und ihr Anspruch ist natürlich auch das ganze auf dem Auffüllen eine philosophische Basis zu stellen anhand oder.
[27:20] Als Ausgangspunkt dessen man dann weiter im argumentieren kann also sie macht das natürlich sehr sehr analytischen diesen Sinne auch dass man.Dass das nicht nur im.Sie versucht das zu ein bisschen aus der ich sag mal auch der Soziologie wegzunehmen nicht weil das dort nicht auch hingehört sondern weil sie sagt, es gibt so eine und unfaire Dichotomie auch in der Philosophie ne da sagt man okay das ist jetzt irgendwie.Ethisch oder praktische Philosophie und das anderes analytisch aber das muss man wie zusammen denken und.
[27:54] Diese diese Zeugnis und Gerechtigkeit was ich dann spannend fand ist dass sie.Immer beide Seiten beleuchtet oder so klar das wissen du Subjekt im erfährt eine Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit wenn man ihm nicht glaubt aber.Eigentlich erfährst du als Täter in genau so eine Ungerechtigkeit oder tust du dir an weil du ja gar nicht zu wissen kommst.
[28:19] Na sicher wie du depriviert dich eigentlich von von einer möglichen Wissensquelle indem du diese Zeugnis Ungerechtigkeit begießt.Ich finde es hat zwei Seiten also einerseits kann es quasi kann es zwei Verlierer geben.Also wir hier jetzt bei dir aber wenn wir bei der Gericht Situation bleiben dann finde ich gibt es auch.Also es gibt einerseits die Person der nicht geglaubt wird die verliert und die also das macht schon mal das steht schon mal ein gewissen Abstand zwischen den den beiden Personen her und andererseits, gewinnt die andere Personen unverhältnismäßig ehrlich habe das Gefühl, also da da gibt es weißt du als wenn es wenn ich nur eine Person etwas verliert sondern weil die eine verliert gewinnt die andere noch dazu.Und hat quasi nicht nur den Vorteil darüber dass der einen nicht geglaubt wird sondern auch noch den Vorteil dass ihr mehr geglaubt wird das ist es ich finde es sehr verstärkend.
[29:16] Was ich habe das Handy in der gibt also jetzt total das ist das ist auch sehr ich will mal sagen sehen ein sehr soziologischer Standpunkt ne dass das kommt auch später bei der hermeneutischen Ungerechtigkeit noch mal sie betont dass auch sehr dass es eben dieses das ist natürlich nicht symmetrisch ist ne die Ungerechtigkeit einerseits.Also zwischen beiden ich sag mal Gesprächspartnern oder Partner innen ist es nicht symmetrisch aber auch ganz strukturellen nicht symmetrisch oder nicht gleichverteilt ne wenn du dann in in dieser epistemischen Hinsicht marginalisiert bist ist das nicht isoliert betrachtet sondern es geht in der Regel auch mit anderen Marginalisierung in einhergehen, und die verstärken sich dann wieder um ne also ganz grundsätzlich.Ist er ist in in in ihrem macht Verständnis haben natürlich die mächtigen weil meine Deutungshoheit auch auf das wissen was wir als Gesellschaft haben.
[30:18] Ja aber er ist ich verstehe schon deinen denn dein Ausgangspunkt zu sagen wenn wir.Wenn wir quasi der Rhein Wahrheitsfindung hinterher wollen eigentlich dann ist das dann Schaden wir uns damit auch selbst also ja.
[30:35] Ja das.
[30:40] Epistemischer das ist im Diesel dass das Wissen oder Wahrheit die Wahrheit suche schon fast ein bisschen nimmt bei ihr von sieben Kapiteln 61 ist es wirklich.Wie analysiert und liegt das sehr ausführlich da und kommt dann im letzten Kapitel zu dieser hermeneutischen Ungerechtigkeit.Und ich fand es ein bisschen verwirrend weil die systematisch gesehen eigentlich wo er der epistemischen kommt.Was meint man heute hier sie.
[31:19] Sagt das eine Art von von dieser Wissens Ungerechtigkeit kann darstellen dass ich.
[31:29] Wenn ich als soziales Subjekt nicht die Begriffe habe.Meine soziale Realität zu verstehen und zu interpretieren dann widerfährt mir euch eine epistemische Ungerechtigkeit das heißt ich erlebe irgendeine Situation ich bin in der Welt ne und kann.Diese spezifische Situation aber nicht richtig deuten ganz.Gutes Beispiel dafür ist das Thema sexuelle Belästigung also diesen diesen Begriff.Von sexuelle Belästigung Sex forestmen das gab es lange nicht nein das ist das war kein das war einfach eine Erfahrung die viele Personen gemacht haben.
[32:14] Und die sich aber einig so die sagten dieser kollektiven Deutung bisschen entzogen hat dann also dass das hat das dazu geführt dass.Viele ja in der Regel wann ist Frauen die davon will es betroffen waren sich irgendwie dass sich unwohl gefühlt haben in Situationen aber es gab keinen es wurde da abgeht Tanja es ist ja nur Flirten na ja es ist ja nichts schlimmes passiert ja oder unserer und, was geblieben ist es natürlich diese dieses Unwohlsein mit der Situation und dass man halt ihm schon merkt dass hier was nicht stimmt, aber dadurch dass es keine und ich bin ich finde das wichtig dass es Kollektiv geteilt ist und man kann ja sowas kann ja sein dass man für sich selbst schon im Begriff davon hat und das auch.Gar nicht in Frage stellt.Aber wenn das nicht kollektiv geteilt ist dann bringt dir das nichts mehr du kannst dann du kannst dich damit man nicht äußern ja ich finde auch es ist wichtig quasi wenn also es ist wichtig gesellschaftliche Begriffe von.Problemstellung zu etablieren die sich aufrufen können quasi wie wie als Navi als shortcut damit man sich auch nicht.Also die Situation muss sowieso erklärt werden und das ist gerade in den Fällen von sexueller Belästigung oder Übergriffigkeit oder sexualisierter Übergriffigkeit.
[33:33] Ist schon schon schwer genug dass du der das da Opfer immer wieder sich quasi auch noch jemand Retraumatisierung hingeben müssen weil sie die Situation in der Beschreibung noch mal durchleben aber ich finde auch es ist total wichtig dass wir, ja dafür wie dann feststehende Begriffe haben auf die, man sich beziehen kann damit sehr schnell sehr klar ist worum es geht gewissermaßen und damit ja auch eine gewisse Diskurs Vorprägung einhergeht und auch nur in dem Fall eine sehr berechtigte Verurteilung.Nein die nicht immer wieder neu verhandelt werden muss gewissermaßen.
[34:08] Ganz genau ja ja das ist auch gut wie du das sagst dass man das immer wieder neu verhandeln muss.
[34:16] Genau darum geht es oder es ist es diese Begriffe also sie sagt halt dass diese hermeneutische Ungerechtigkeit.
[34:25] Passiert insbesondere auch sozial marginalisierten Gruppen vermehrt ne also sozial marginalisierte Gruppen.Verstehen dass es so ein bisschen hart formuliert aber verstehen sich selbst manchmal nicht, im Sinne von sie sie haben keine Möglichkeit das was ihnen widerfährt eigentlich zu zu deuten und und sich dann auch dagegen zu wehren.Und da kommt eigentlich dieses.Im diese sag mal diese zeitliche Komponente von diesem zwei Hauptbegriffe im Buch ins spiegele somit wenn er noch mal zum zur zu dieser sexuellen sexualbelästigung kommen dann wenn ich keinen Begriff dafür habe was das ist, dann ja dann dann kann ich mich gar nicht erst wären oder ist das kann mich das kann mich fertig machen.Ja aber angenommen ich habe dann den Begriff und ich artikuliere das und ich spreche mit jemandem darüber und dann wird mir nicht geglaubt dann sind wir bei der Zeugnis und Gerechtigkeit.Das ist eigentlich ein zweifaches Ungerechtigkeit Potenzial das hier.Dass man hier hat und der martin hat sozial magine oder marginalisierten Gruppen haben hier ja laufen Gefahr dass sie auch auf auf beiden Ebenen eigentlich diese Ungerechtigkeit erfahren.
[35:48] Ja okay berlekamp verstehe ich komme ich mit.
[35:54] Ja so die die Folgen davon sind vielfältig.Es gibt so die die die für die Folge die die die die Einzelpersonen erleidet im Sinne von es kann dir natürlich einfach psychisch extrem bescheiden also auch.Auch eben diese Form die halt jetzt nicht.
[36:18] Nicht unbedingt eine Straftat weil es nicht unbedingt eine Straftat darstellt weil es sehr sehr schwierig ist zu fassen aber wenn es in in systematischer Form immer und wieder passiert dann kann es natürlich sehr sehr schwer wegen Fahrt nichtsdestotrotz haben, Andy sagt auch das.Das ist ein Problem darstellt bei der Ausbildung seine Identität ne also wenn du immer wenn dir immer und immer wieder nicht geglaubt wird.Weil du meine Mann ja einen bestimmten Identität Vorurteil ausgesetzt bist dann kann das auch produktiv werden also das kann z.b. wenn es sie macht ein.Also zitiert hier eine eine Studie die Lehrerinnen.Zu Beginn eines Schuljahres gesagt hat welche Schüler innen ein besonders hohes intellektuelles Entwicklungspotential haben und dann.
[37:17] Nach nach einer gewissen Zeit nach ein paar Jahren wurde dann untersucht wie er wir haben sich diese Kinder tatsächlich entwickelt und es war so dass die die genannt wurden auch tatsächlich viel viel besser abgeschnitten haben obwohl die Auswahl davon natürlich randomisiert waren ja nicht wirklich gemessen wäre irgendein Entwicklungspotential gehabt hätte sondern das war komplett.Zufällig die haben eben diese ja so eine selbsterfüllende Prophezeiung soll man das einfach so.
[37:50] Plakativ nennen möchte oder also man hat eine produktive Beeinflussung eigentlich durch das Vorurteil oder durch eben eine gewisse und Gerechtigkeit wer hat mir die indiart Studien sind in der Soziologie in Einführungsvorlesung und so zum Thema Ungerechtigkeit sehr sehr beliebt aber ja also sie sind halt auf der real ne also das also da gibt’s glaube ich mehr als nur nur eine die in solche oder ähnliche Richtung ziehen und ja genauso wie vor und Nachnamen dann doch sehr gute ja quasi Prädikat Uhren sind für für schulischen Erfolg ich hatte mal ich hatte mal einen Seminar oder ging es in der Pädagogik um ja auch um Gerichtsgutachten zum Thema wer VEVO dürfen Kinder bei Scheidung wo sollen sie leben und das war eine Gutachten in das Seminar bei uns gemacht hat und sie hat das, wirklich sehr verknappt gesagt und sie meinte naja Nachnamen sind Diagnosen das ist einfach so was natürlich hier.Vermutlich einfach ihre Arbeitswelt und springt und ihrer er irgendwie gemittelten empirischen Beobachtung aber natürlich auch im Quanten von starken Vorurteilen erzeugt und ja also.Das sein finde ich es einen ein gutes Studien Beispiel was du aufrufst oder was sie aufruft im Buch.
[39:08] Ja und und gleichzeitig ist das auch die Schwierigkeiten wie kommt man davon los also ich ertappe mich schon sehr sehr oft dass mir das auch passiert.Was Fricker im im Buch macht sie.Sollte so ein Teil des Buches geht um eine Sehne des Eichel meine Touren Tab Epistemologie, oder eine Apps dem Skitouren Theorie wo sie das noch so philosophisch hairlight und verortet aber im Endeffekt geht es darum und ich fand den Begriff zieh sie relativiert es dann zwar aber den Begriff einer Erkenntnis bezogenen affirmativ action eigentlich ganz gut also du kannst.Dich Ärztin in diesem Sinne tugendhaft als tugendhafte Zuhörerin verhalten indem du.Eigentlich von vornherein davon ausgehst, dass das was die Person sagt wahr ist und zwar in dem Sinne also immer wenn angenommen du hast eine Gesprächspartnerin dir dir, dir gegenüber hast du einen Vorurteil sein wir weil sie einen Namen hat z.b.
[40:20] Dann und vielleicht sagt dann die Person etwas dass dir seltsam vorkommt ne also die hat vielleicht eine Sprechweise die seltsam ist oder sieht sie, hat bekannt gewisse Begriffe nicht verwenden oder verwendet sie nicht und dass man dann eben nicht.Schlussfolgern oder oder zur Konklusion gelangt dass es an dieser an der Person liegt an der Gesprächspartnerin sondern an mir selbst, oder annanan dem Fehlen dieser geteilten ja Begrifflichkeit.
[40:52] Also das man nie dass man eigentlich als affirmativ action wie sagt man das im im Gericht, zugunsten des Angeklagten im Bergwerk also dass man nicht darf, davon ausgehen in und um sich probiert eigentlich eher meines Urteils zu enthalten immer wenn man merkt dass hier was nicht stimmt ich finde das gar nicht so ein schlechten Ansatz auch wenn es natürlich sehr ideologisch ist und und vielleicht auch ein bisschen utopisch aber.Man merkt ja schon oft.
[41:23] Das ist ja wie so ein bisschen Stachel oder ein Träger einer merkt es ist irgendwas seltsam in dem Gespräch und das finde ich im guten Enden Gute an kann man kann schon ich finde dich so.
[41:36] Übersteuern das immer wenn man das merkt dass man sich dann Gedanken darüber machen ist das so.Wenn man ein Gespräch super verläuft dann dann komme ich ja nie an den Punkt wo ich mich ja wo ich mich da Frage.Aber sobald man was seltsames merken sie benutzt weckst du mir gesellt seltsam dann wenn einer seltsam vorkommt dann kann man da dann kann man einsetzen oder und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht.Ja das würdest Du nicht gute Seite wie wieso 1.
[42:06] Ja aber du wovon ist das von Lennart Korn wer ist der crack in everything that’s how the light gets in das finde ich es ganz gut also so dieser Verdi die Notwendigkeit eines Bruchs damit überhaupt etwas passiert vielleicht so.Ja genau sie sagt auch dass es eigentlich die Voraussetzung für so wie man sozialen Wandel begreifen kann er also dass man dass wir.
[42:33] Eigentlich uns unsere Einstellungen anpassen können also es ist wenn man das so sagen dann klingt das komplett banal natürlich kennen wir das aber so wie sie das nicht philosophisch herleitet passt das sehr schön in in das Konstrukt ne dass das sehr wichtig ist.Dass sie diese Fähigkeit überhaupt haben und das ist vielleicht auch nicht selbst selbstverständlich ist im dass wir das können vorhin.Hattest du gesagt.Oder ja ist es gibt ein Beispiel in ihren Ausführungen wo es darum geht wie.
[43:12] Dürfen wir denn Personen aus einem sei mir anderen kulturellen oder ethnischen Kontext.Dürfen wir da überhaupt uns Gedanken darüber machen was sie oder dürfen wir sie verurteilen darüber was sie tun.Erhält man kann man kann so die die relativistische Position einnehmen sein her ist ist es geht nicht oder also die Intersubjektivität einerseits aber natürlich auch ja es gibt, viele Gründe weshalb man dagegen argumentieren kann dass man das nicht darf ein moralisches Urteil sozusagen über jemand anderen Zufällen der 1 Jahr der halt in ganz anderem Kontext sozialisiert ist und da sagt sie und es geht ja auch ein bisschen um um die Vergangenheit, dass man das durchaus darf also man darf durchaus sich Gedanken darüber machen was ein Gesellschaft hätte.
[44:09] Mit den Ressourcen die sie zu dieser Zeit oder in ihrem Kontext hat also Wissensressourcen zu was für einem Urteil sie hätten kommen können.Ja ich machen bei Spielsachen ganz persönliches mit dem Fleischkonsum also mir ist absolut klar dass es moralisch.
[44:28] Verwerflich ist Fleisch zu konsumieren oder so dass das eine rationale Einsicht.Ja trotzdem esse ich ich es nicht so viel Fleisch aber ich esse immer wieder Fleisch und dann ist die Frage was machen die in die zukünftigen Generationen damit ne also man kann mir entweder vorwerfen da du das ja eigentlich gewusst und trotzdem getan oder man kann auch sagen ja, stimmt zwar aber es ist einmal das moralische Klima im Moment ist immer noch so.
[44:59] Das ist halt durchaus Aldi akzeptiert ist ne also angenommen man bewegt sich jetzt nicht in einer bestimmten Bubble aber so ganz gesellschaftlich ist Fleischkonsum immer noch.Okay dann kann man das schon auch legitimieren im Nachhinein dass ich das nicht getan als ich habe jetzt nicht hin ich hätte jetzt nicht.Ein außergewöhnliches moralisches Urteil gemacht in intersur also das wäre wenn ich.Sondern es ist es halt wie so ein ein ein normales moralisches Urteil weil das halt noch in in meiner Welt so akzeptiert ist das, ja ich muss sagen ich habe immer sehr also ich habe gesagt seit Jahren sehr großen Respekt vor den Diskussionen mit denen Generation die die nach uns kommen so ein zwei also in 30 vielleicht nachher ob ich sie in 60 Jahr noch erlebe weiß ich nicht genau aber nur dein anderthalb Generation vielleicht 45 50 Jahre ich habe sehr viel also ich habe großen.Respekt vor den Verurteilung die uns da im bezug auf den Klimawandel die Klimakrise Island werden weil ich werde sagen können aber, ich habe kein Fleisch gegessen nicht aber bin sehr wenig Gefühl also verhältnismässig relativ wenig geflogen in meinem Leben, und ich ich habe doch irgendwie in meinem Rahmen das Gefühl gehabt ich hätte schon recht viel getan und trotzdem werden sie mit Funk und Recht sagen können aber ihr habt es trotzdem mal das kommen sehen ihr hattet alle Daten ihr wusstet alles und trotz.
[46:28] Ihr habt ihr trotzdem habt ihr die Erde so überhitzen lassen wie wie konntet ihr nur und vor den Diskussionen habe ich wirklich ein bisschen.Was ich Angst ist vielleicht ein bisschen groß aber schon ein bisschen bisschen Respekt weil ich glaube die Vorwürfe werden berechtigterweise sehr hart sein.
[46:42] Naja total es ist ja es ist es eh hier geht’s natürlich auch noch.Ja mit mit Handlungen an hier die die die Zukunft oder die zukünftige Generation selbst betreffen also es ist was wir jetzt tun betrifft an die Person die das moralische Urteil über uns fällt es ist ein bisschen anders wenn das jetzt nicht der Fall ist wenn man kann z.b. dann die Praxis das früher unverheiratet und Müttern das Kind weggenommen wurde und zur Adoption freigegeben wurde das betrifft abgesehen von den Personen die da ja die hat wirklich betroffen waren die Gesellschaft ja nicht jetzt mehr oder weniger passiert und da sagt ja aber man kann wie also dass das gängige Moral oder die.Ist er das was ich sage das nicht außergewöhnliche Moral Urteil wäre das zu akzeptieren weil eben.
[47:41] Keine Ahnung man hat irgendwelche Vorstellungen von dass man Kinder nur großziehen kann wenn man verheiratet ist aber man kann es durchaus und auch so sagen dass mein hättet auch zu dieser Zeit zu diesem außergewöhnlichen Urteil kommen können weil man z.b. weiß dass es Kindern besser geht wenn sie bei ihrer Mutter sind ne und man hätte dann damit durchaus auch gegen diese gängige Praxis argumentieren können.Und das ist was sie dann sagt hier ist dann diese Verurteilung eines nicht berechtigt aber vertretbar.
[48:18] Der mehr okay ja das ist so, wie konstruiert eben diese diese Zuhörerin als die tugendhafte Zuhörerinnen und das ist du hast es schon ganz zu Beginn gesagt ihm das eine Person die sich eben auch dessen den Machtverhältnissen bewusst ist nicht nur.
[48:42] Denen also denen zwischen zwischen den im Gesprächspartnerinnen des sozialen Typus des Gegenübers sein dass seine eigene Identität sozusagen also ist es ähm schon ein wenig sag mal ideales Kunstdruck dass sie gemacht aber ja das ist eigentlich so.
[49:03] Sie sagt schon dass das eigentlich die destilan müsste ne also um so unsere Leitidee wie wir auch gegen diese Ungerechtigkeiten vorgehen können und.
[49:16] Man hat man hat also man kann diese Tugend durchaus, erwerben aus indem man ihm diese diese kritische Haltung hat aber es geht auch Formen z.b. durch Vertrautheit nicht dass das automatisch so ein bisschen passiert.
[49:35] Also man kennt das dass wenn man.Ich nehme 1 ich sag mal man hat ein Vorteil jemandem gegenüber aufgrund seines Aussehens und dann spricht man mit dieser Person und dann eintritt das plötzlich ganz in den Hintergrund ne also weil also dass das Aussehen ist dann mit gar nicht mehr relevant und mit der Zeit lieben kann das auch so.Sich ein bisschen ausgleichen ich hatte einen sehr guten Dozenten im Bereich der der Politik app psychology und wir haben uns viel mit verschiedenen Glaubenssystem auseinandergesetzt und eben auch Rassismen und Vorurteil und so und wer mit ihm darüber gesprochen was was er glaubt wie man das denn beginn bekämpfen kann weil wir auch sehr viel über implizite Vorurteile und Stereotype gesprochen haben die man.Haben wir alles natürlich in dem Kurs waren war überzeugte aufgeklärte Leute die für sich in Anspruch nehmen grundsätzlich erstmal keine.Ja kann überzeugen Rassistin and sex ist innen und so weiter zu sein natürlich aber man hat ja seine seine impliziten Vorteile und er meinte also empirisch gesehen kann ich eigentlich nur sagen na ja ihr müsst ihr müsst eben Menschen kennenlernen von Gruppen von aus Gruppen von denen Ideen gegenüber ihr Vorurteile hegt, das ist der einzige einzige empirische.
[50:53] Empirisch belegte weg also ihr müsst Menschen anderer Hautfarbe kennenlernen andere Geschlechter was auch immer ihr müsst mit denen Kontakt kommen das ist der einzige einzige Weg um das zu brechen quasi was ein bisschen in die Richtung geht die du jetzt gerade aufgemacht hast.
[51:08] Ja finde ich spannend ist auch das was ich immer so gedacht habe es ist ich glaube dass das ist die kontakthypothese auch sehr genau.Aber es gibt.Durchaus ein ich auch vieles was dagegen spricht in also nicht spricht nicht dagegen aber es müssen sehr viele Bedingungen erfüllt sein dass das funktioniert, also z.b.Müssen wir oder ich muss mit mit dieser Person mit der ich in Kontakt trete einen endlichen sozialen Status ja der 1. ist es gibt irgendwie sechs Bedingungen eigentlich die erfüllt sein müssen damit das eben sonst kann er sich das auch ins negan ins Gegenteil amputieren.Dieser Kontakt ist nicht nur wenn er stattfindet dann auch positiv sondern kann durchaus auch.
[52:02] Ja was verstärken oder oder halt uns negative Geld von deinem Vorschlag gehören bisschen moralisch verwerfliche ich finde mein Mann macht dann andere Menschen zu schnell zu so Zootieren.Also du weißt du ich ich trete mit ihnen in Kontakt nicht weil ich mit ihnen in Kontakt treten möchte sondern weil ich das Gefühl habe ich müsste mal meine Vorurteile abbauen unter findest ich sie kennenlernen was irgendwie ein.LVR 1 ein guter es ist ein guter Wille erkennbar aber ich weiß nicht also ich mein instrumentalisiert Menschen damit ein Stück weit und macht sie zu, zwei Mittel zu einem Zweck und das sollen wir ja nicht aber hier ist.Da würde da würde fricke.de jetzt widersprechen und es ist sie zitierten BB von Nussbaum ich kann ganz schön finde da geht es geht ihm um diese Instrumentalisierung konkret ne und sie sagt dass bald wieder die Macht ist wenn wenn ich jetzt mit meinem Partner wenn ich meinen Partner auf dem Bauch liege, nein wir sind im Bikini auf dem Sofa liegen auf dem Bauch dann benutze ich ihn ja als Kopfkissen.Na ich instrumentalisieren das Kopfgefühl weil ich darf im Rahmen einer Beziehung machen.
[53:12] Indem er nicht immer nur das Kopfkissen ist.Was bitte ist das in Ordnung aber es ist nicht die Instrumentalisierung ein und an und für sich muss nicht immer ein Problem sein und ich glaube das ist hier auch dabei eine wenn du mit jemandem in Kontakt trittst wenn deine dein einziges Ziel oder wenn diese Person nur als naja als Objekt deiner.
[53:34] Steiner Feld Selbstoptimierung gleich mal dient damit du Vorteile Abbaus dann ist natürlich nicht ok aber wenn das so das hat er dann trotzdem meistens auch eine Dimension eines eine Interaktion und so weiter und dann ist es durchaus auch, ok Google Jacke ja.Das wär’s so vom Buch wie gesagt philosophisches Buch ich kann es sehr empfehlen insbesondere insbesondere die ersten drei Kapitel und das letzte falls man das lesen möchte.Und ich nehme an wir gehen auch ich kann gleich weitermachen sonst mit meinen weiteren Empfehlungen wenn das okay ist, ich glaube ich habe erstmal keine Fragen mehr ich freue mich sehr für die Vorstellung vielen Dank und genau das ist noch meine neue.Ja so ich ich blick noch mal neu auf auf Ungerechtigkeit oder ich habe noch meine neue eine neue neuen Gedankenanstoß für die Sensibilisierung von Ungerechtigkeit Dimensionen heute bekommen das hat mich sehr gefreut fande fand ich inspirierend irgendwie.
[54:43] Sehr schön das freut mich sehr,
Mehr Literatur
[54:50] Miranda Fricker das ist natürlich ein bisschen toller ihr selbst zuzuhören dass mir über sie und sie hat nämlich auch im Juli in der Sternstunde Philosophie über ihre Theorie gesprochen.Also das kann ich dir empfehlen diesen Podcast kann man im Internet nach hören.Was ist ein Buch was mir sonst sehr.Dass ich sehr präsent habe wenn wir wenn es um diese Themen geht ist dass wir haben auch nur dich haben wir haben den Pott passt Podcast Folge darüber gemacht dass es die Erschöpfung der Frauen von Franziska Schutzbach hat es war noch wir beide zusammen sogar bei mir genau Folge 47 war das, kann ich wirklich auch auch sehr empfehlen das Buch zu lesen weil es jetzt aus meiner.Mit meinem sozialisierungs Hintergrund genau das auch angesprochen anders hat viele Dinge benannt wie die man eigentlich kein Begriff hat.Sie hat so ein bisschen schwammig sind.Das finde ich eine sehr gute Leseempfehlung die dazu passt dann ein Buch was auch ein bisschen was ähnliches mir ausgelöst hat das ist das Buch von Robin diangelo wir müssen über Rassismus sprechen.
[56:02] Auch hat mir auch sehr viele Begriffe an die Hand gegeben oder ja Verständnis, gefördert im in Bezug auf diese auf diese Problematik und ein anderes Buch das habe ich selbst beim ich habe es erst angefangen.Aber ich habe es wurde schon in so vielen Büchern ich gelesen habe referenziert deswegen empfehle ich jetzt das einfach voll trotzdem das ist von Judith klar über Ungerechtigkeit, in ein ganz berühmter Aufsatz von ihr wo es ihm auch darum geht dass sie, und nicht von der Gerechtigkeit aus argumentiert im Sinne von das ist eigentlich der Standard und Ungerechtigkeit nicht sondern sie sagt Ungerechtigkeit ist echt das was wir.Was allgegenwärtig ist und auch pragmatisch will faßbacher ist und man kann halt auch wie von diesem.Von dieser Tatsache rausgehen nett ist das eigentlich der Standard ist Ungerechtigkeit gibt’s wie kann man das verhindern und ein letztes Buch.Das ist kein Sachbuch das ist das Ende von Eddy von Edouard Louis.
[57:17] Das habe ich gelesen in diesem Jahr was so ein bisschen ein autobiografisch Auto fiktionaler Auto fiktionale Beschreibung ist eines eines jungen Mannes Jugendlichen eigentlich der homosexuell ist und ja diese Beschreibungen wer sprach sprachgewaltig eigentlich da liegt und deshalb mir das in den Sinn gekommen dass ist auch weil es eben hier, um um deine inneren oder um seine Gefühle geht mehr und und eine gewisse Begrifflichkeit eigentlich fehlt ihm oder es fehlt ihm immer ziemliche das wirklich zu deuten oder es ist deine EMI überformt mit Vorstellung die die Gesellschaft im nimm dazu ja einpflanzt und so weiter und es ist ich fand sehr ein sehr schönes Buch schön im Sinne von sehr berührend auch her ihr das schildert ja.
[58:17] Was was hast du dir überlegt oder was ist dir denn sie gelernt zu mir ich habe noch eine eine relativ alte Folge ausgegraben da habe ich vorgestellt warum ich nicht länger mit weißen über Hautfarbe spreche von, Eddie Hirano lodge genau sie zeichnet da ja die Geschichte des Rassismus also eine eine Geschichte des Rassismus im UK im Prinzip nach und spricht ganz stark darüber wie sich das eben auch heute noch manifestiert also.
[58:47] Ja ich glaube in gewisser Weise anschlussfähig an die hier an die heutige Folge dann habe ich noch mitgebracht oder noch noch RCD Amerikas Gotteskrieger das ist Folge 34 und ich glaube nils hat die vorgestellt von Annika Brockschmidt ist vielleicht ein bisschen eine lose Assoziation aber einfach ja die die Unterwanderung des politischen Systems der USA und was passiert wenn ja vielleicht die falschen Leute zu viel Macht generieren und zu langfristige Pläne haben das klingt jetzt müssen Verschwörungstheorie verstößt das gar nicht sondern es geht halt um die Evangelikalen in den USA und ja wie sie einfach dass ja das politische System zerfressen und aushöhlen mit dann der der Wahl von Donald Trump weit seid spitze von dem ganzen und ich finde ja da ist schon viel viel drin von dem was was du heute skizziert hast dann habe ich im Sinne von so ein bisschen ja Vorurteile und Vivi sind Dinge eigentlich wirklich gewesen.
[59:53] Anfänger für die ersten 5000 Jahre einen Anfänger eine neue Geschichte der Menschheit so heißt das ganze das ist Folge 38 von David Graeber und David wengrow das hat auch Nils vorgestellt AWO einfach vor einem Jahr noch mal.
[1:00:09] Bitte auf jeden Stereotypen der menschheits Anfänger aufgeräumt wird und das dachte ich könnte auch ganz gut passen und dann hast du noch vorgestellt in Folge 55 die Werte der wenigen vom Philosophicum Lech und ich dachte das könnte insofern passend sein als dass er hier auch Namen der Kritik von macht Gefällen mit drin ist und in dem Buch oder in dem Sammelband Aufsatz, Jesaja es ist ein bisschen eine Eliten Analyse im Prinzip und, Anja Dahlke merkt man dann auf jeden Fall das macht auch nicht gleich verteilt das in einer Gesellschaft, ja und die Bedeutung Verfahren und dann abseits von unserem Podcast empfehle ich einen eine andere Podcast Folge und zwar war Adam tooze bei jung und naiv und 1 Thusis 1 Jahr Wirtschaftswissenschaftler oder ner Wirtschaftshistoriker er und er ist deutsch und auch englisch und war in Yale und ist jetzt glaube ich in New York an der Columbia University, und der spricht in diesem sehr lang Interview einerseits über seine Biografie die auch total spannend ist aber auch um selbst über selbst Produkt Reproduktion von Eliten also, er meint naja also bei mir in die Wirtschaft historie Lager kommen auch viele ich will also herzlich sehr viel mit Preußen beschäftigt und er meinte ja die Nachfahren der adligen, oder die die Adligen der auch heute noch in Spitzenpositionen sind die kommen gerne zu mir in die Seminare weil sie natürlich auch viel über ihre Vorfahren lernen.
[1:01:38] Was sind ihre konkreten urgroßonkel und sonst wie und ja und er spricht sehr da sehr viele drüber das ist ja welche welche Elite Auslese die Leute eben selbst auch betreiben und wie das Ganze Forschungssystem in den USA auch funktioniert also das ist wirklich also eine Unfall so ist es ein unfassbar gutes Gespräch was in meinen Augen ehrlicherweise nicht unbedingt zu viel immer an Tilo jung liegt den ich gar nicht so toll finde aber seine Gäste sind einfach sehr sehr gut und das Gespräch sollte ich also ich habe das.
[1:02:08] Was hat ganz ganz vielen irgendwie ausgelöstes ist hängt mir wirklich nach und der ist kann ich total empfehlen dann richtig gute Jobs in zweieinhalb drei Stunden irgendwie so aber es lohnt sich wirklich.Und dann noch drei Bücher einmal habe ich dachte ich die Pest von Albert Camu könnte ganz gut passen weil es da ja einfach.Dann geht mir gut in einem Ort bricht die Pest aus in einem kleinen Ort und was macht es mit dem Vertrauen von Menschen zueinander und wie reagieren die und wie reagiert eine eine kleine Gesellschaft in dem Fall die halt nicht so riesig ist da drauf und und was macht das mit den mit den Menschen und ja es war ein bisschen ARD die Decke der Zivilisation ist hauchdünnen oder wie das heißt dass das geht in die Richtung an ist bei mir ein bisschen her dass ich das gelesen habe aber in meiner Erinnerung passt es ganz ganz gut zu dem heute.Witzig dass du jetzt dass du das erwähnst der Fremde passt hatte ich auch perfekt an mich da geht’s euch nicht gelesen ehrlicherweise deswegen.
[1:03:12] Auch an dich um einen Mordfall und dann um das, na ja um die Wahrheitsfindung darum und auch die Selbstfindung um auf diesen Mordfall rum habe ich Gesellschaft als Urteil noch mal.Ja noch mal mitgebracht habe ich glaube ich schon ein paar mal empfohlen ich finde es letztlich nicht ganz so stark wie Rückkehr nach Reims ich kann diese französische Stadt nicht aussprechen aber jaja erimus eben französischer Soziologe in der Tradition von Bodyguard und das heißt doch, wenn im durchaus im Fokus auf aufmacht und er beschreibt ja wie es ist als Homosexuelle Personen aus der Provinz in die Stadt zu kommen und ja was die Gesellschaft mit dir macht und wie es ist Wein gesellschaftlichen Aufstieg hinzulegen und wie ja wie man dann aber auch nirgendwo mehr zugehört und ja genau wie wir die Gesellschaft quasi mit dir umgeht was dachte ich auch anschlussfähig ist nun nachdem wir schon noch heute einmal kurz über Carolin eben könnt gesprochen haben habe ich noch gegen den Hass von ihr würde ich noch empfehlen wollen was einfach.Ja geht um sehr konkrete Situationen in denen gehasst wird die sehr explizit und detailliert von ihr beschrieben werden und da manifestieren sich natürlich auch ganz verschiedene Ungleichheiten.
[1:04:38] Und ja also eben gelesen lohnt sich auf jeden Fall immer.Dass du das kann ich noch ergänzen hast du ihn ist wärst du noch was was du loswerden möchtest perfekt,
Ausstieg
[1:04:58] dann könnt ihr euch bei uns auf der Webseite auf zwischen zwei decken.de über unseren Podcast informieren und da und da findet ihr eigentlich immer immer alles was ihr wissen möchtet und wenn ihr uns etwas zu denen folgen wissen lassen möchtet könnt ihr da auch Kommentare verfassen die wir lesen können also wenn ihr darauf Lust habt ist das super und ansonsten findet ihr uns auch auf Facebook und hat zwischen zwei Decken auf Instagram und Twitter oder ehemals Twitter unter dem handy app Deckeln und auf Mastodon findet ihr uns unter.ZDF Podcast. Social genau und ja das ist das ist es für heute von unserer Seite danke fürs zuhören und wir hören uns in drei Wochen wieder macht.
[1:05:47] Music.
Quellen und so
Intro und Outro der Episode stammen aus dem Stück Maxixe von Agustin Barrios Mangore, eingespielt von Edson Lopes (CC-BY).
Das Umblättern zwischen den Teilen des Podcasts kommt hingegen von hoerspielbox.de.
Zwischen zwei Deckeln findest du auch im sozialen Medium deiner Wahl: Mastodon und Bluesky.
Der Beitrag 063 – „Epistemische Ungerechtigkeit“ von Miranda Fricker erschien zuerst auf Zwischen zwei Deckeln.


