
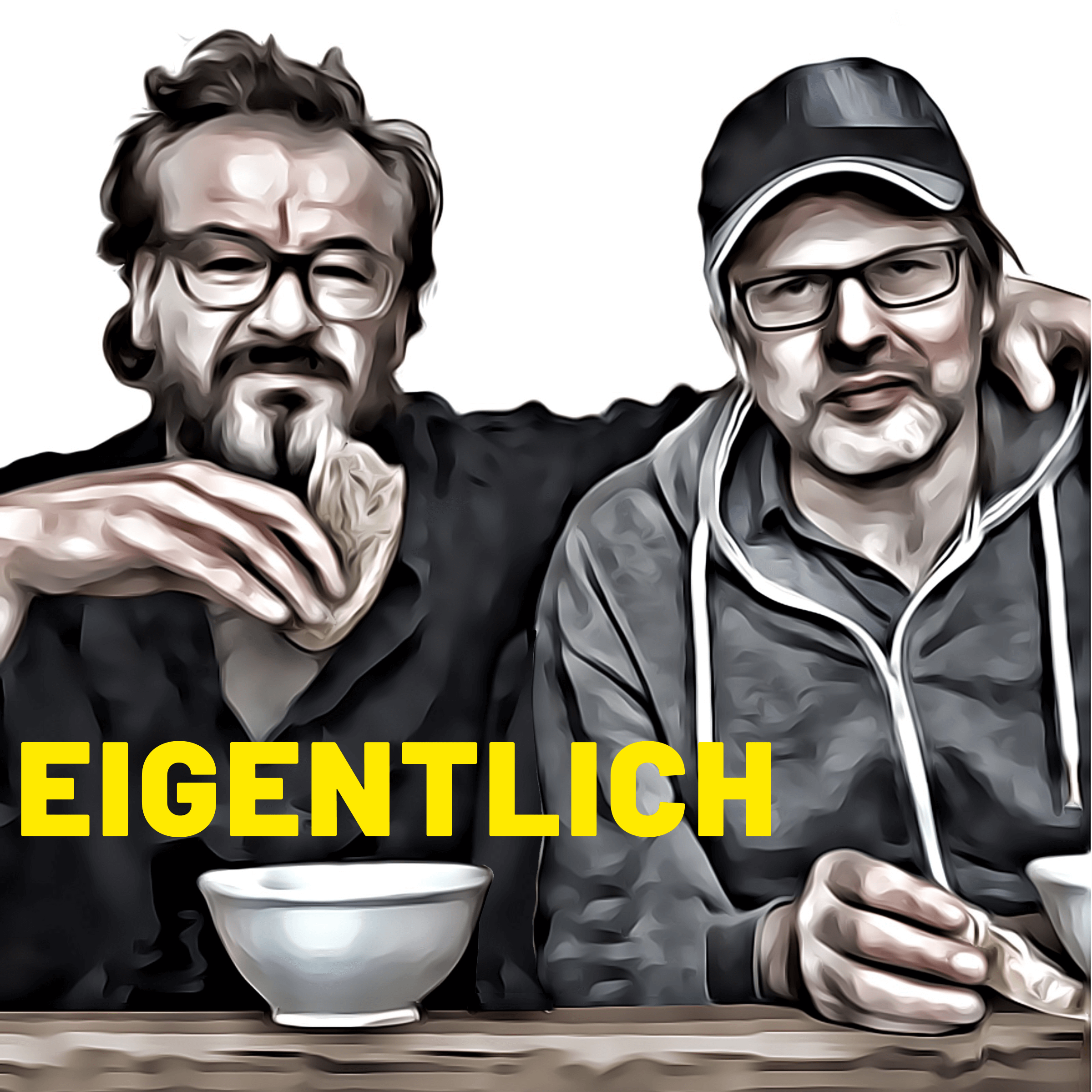
Eigentlich Podcast
Micz & Flo
Reden beim Laufen und laufend Reden - über Film, Technik und Psychotherapie
Episodes
Mentioned books

Feb 27, 2025 • 1h 53min
EGL072 Berlinale zeigt "Rocker" (1972): Klaus Lemke dreht wo die wilden Kerle wohnen
"Erleben heißt, dass man mehr auf's Maul kriegt als Küsse im Dunkeln." -- Klaus Lemke
Die Berlinale packt 2025 Klaus Lemkes *Rocker* (1972) in die Retrospektive. Ein Film, der so deutsch ist, wie sein Titel: Der Begriff „Rocker“ wurde hierzulande erfunden. In den USA spricht man von *Bikers*, von *Outlaw Motorcycle Gangs*. Aber in Hamburg, wo Lemkes Film spielt, sind es eben Rocker. Eine Szene, die sich in den 60ern unter dem Einfluss amerikanischer Bikerfilme und Motorradclubs formierte – und schnell ihre eigene Dynamik entwickelte. Hamburg und insbesondere St. Pauli waren das Zentrum, der Kiez das Revier. Keine Regeln, außer denen, die man sich selbst gab. Dass Lemke keinen klassischen Film drehte, sondern echte Kiezgrößen vor die Kamera stellte, macht *Rocker* zu etwas Besonderem. Keine Schauspieler, kein Drehbuch, keine inszenierte Härte. Wir besprechen den Film, direkt nachdem wir ihn auf der Berlinale gesehen haben. Wir entdecken Liebe und Schüchternheit und versuchen einen Zugang zum Film über Lemkes Zitate über Film zu finden. Ein Film aus einer Zeit, die längst vorbei ist. Und der Film? Dieser im Speziellen oder Film im Allgemeinen? Lemke sagt: UNSERE FILME SIND WIE GRABSTEINE.
Shownotes
Über den Regisseur Klaus Lemke
Das Klaus Lemke Prinzip | Filmfest München // FESTIVAL_STORIES
Im Interview: Klaus Lemke: Exakt seit letzten Sonntag finde ich Deutschland nicht mehr uncool" - SZ
Aus traurigem Anlass: am 7. Juli 2022 verstarb Klaus Lemke - REVOLVER
Der ewige Rebell: Zum Tod von Klaus Lemke - out takes
Abschied von Klaus Lemke – Ein Nachruf von Dominik Graf | deutsche-filmakademie.de
Klaus Lemke - Filmemacher im Gespräch mit München.tv-Chefredakteur Jörg van Hooven - Menschen in München | Upload: 30 Juni 2015 | http://www.muenchen.tv
Coole Coups - Hommage an den Filmemacher Klaus Lemke | BR2 Podcast | von Friedemann Beyer, Ausstrahlung am 9.7.2022
Kontext zu Lemke und Rocker
Listen von: "Die erfolgreichsten Filme in Deutschland"
Deutsche Film- und Fernsehgeschichte 1972 auf deutsches-filmhaus.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberhausener_Manifest
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuer_Deutscher_Film
https://www.dhm.de/zeughauskino/vorfuehrung/die-neue-muenchner-gruppe-12523/
https://cuts.podigee.io/313-neue-muenchner-gruppe
Lemkes Manifest von 2010 auf Malte Weldings Blog
Über den Film Rocker (1972)
Rocker (Klaus Lemke 1972) Film auf YouTube
Fotos vom Dreh für Rocker 1971 von Heinrich Klaffs
Website rocker-film.de
Rocker auf Wikipedia
'Can' in Klaus Lemke's Mein schoenes kurzes leben (1970)
Rocker im Spiegel Magazin, Ankündigung vom Mittwoch 2.2.1972 im Fernsehprogramm
Clip mit Manifest und Klaus Lemke auf dem Hamburger Filmfest am 30.9.2010, YouTube
Die Hamburg-Filme: Klaus Lemke im Gespräch mit Christoph Gröner auf dem FILMFEST MÜNCHEN 2014.
Klaus Lemkes Arbeit auf YouTube
YouTube Kanal mit Material von Lemke @Saltissima
Amore (Klaus Lemke 1978) Film auf YouTube
Brandstifter (Klaus Lemke BRD 1969)
Stadtwölfe (Klaus Lemke BRD 1982)
Paul (Klaus Lemke 1974)
Liebe, so schön wie Liebe (Klaus Lemke 1971)
Sylvie (Klaus Lemke)
Mitwirkende
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Klaus Lemke beginnt ein Interview ganz relaxed mit den Worten: „Also, meine Markenzeichen sind meine Mütze, meine Kurzsichtigkeit – ich sehe eigentlich nichts (…) – und das Dritte ist, dass ich zweimal am Tag onaniere.“
Wir hingegen haben’s nicht so leicht. Im Gegenteil, machen wir uns doch die Mühe unsere Quellen zu sammeln und in diesen Post zu packen. Zweimal täglich.
Ein Fact Checking vorneweg: Das Zitat von Donald Winnicott stammt nicht, wie gegen Ende der Episode behauptet, aus dem Jahr 1974. Der Psychoaanalytiker verstarb schon 1971. Die Jahreszahl entstammt der zitierten deutschen Veröffentlichung: Winnicott, D. W. (1974). Vom Spiel zur Kreativität. Klett-Cotta.
Im Folgenden unsere Notizen, Recherchen und Quellen. Zu mehr Elan langt es gerade nicht, die Zeit drängt, nur noch 48 Stunden bis Acapulco!
Zuerst allgemeines über die „filmhistorische“ Einordnung (vom Allgemeinen zum Speziellen): Der Neue Deutsche Film > Oberhausener Manifest 1962 > Neue Münchner Gruppe > München > Schwabing > Klaus Lemke
Danach die Zusammenfassung des Films Rocker, Der Soundtrack, Lemkes Manifest von 2010, Top 100 Kinofilme von Lemke und Zitate mit Quellen (nicht alle mit Quellenangaben, sorry.)
Lässigkeit und Revolte: Die Neue Münchner Gruppe und ihre dialektische Beziehung zum Oberhausener Manifest
Eine filmhistorische Neubewertung
In der Geschichtsschreibung des deutschen Nachkriegskinos markiert das Oberhausener Manifest vom 28. Februar 1962 einen kanonischen Wendepunkt. Doch während der „Neue Deutsche Film“ der Oberhausener zum etablierten Narrativ deutscher Filmgeschichte wurde, blieb eine ebenso bedeutsame, wenn auch weniger programmatische Strömung lange Zeit im filmhistorischen Halbdunkel: die Neue Münchner Gruppe. Diese lose Vereinigung junger Filmemacher, die sich in den Schwabinger Kneipen und Hinterhöfen formierte, entwickelte eine eigenständige Filmsprache, die heute als alternative Traditionslinie des deutschen Autorenfilms wiederentdeckt wird.
Das Oberhausener Manifest: Programmatischer Bruch und intellektueller Anspruch
„Der alte Film ist tot. Wir glauben an den neuen.“ Mit diesem apodiktischen Schlusssatz besiegelten 26 junge Filmemacher um Alexander Kluge, Edgar Reitz und Peter Schamoni im Februar 1962 die symbolische Grablegung des konventionellen deutschen Nachkriegskinos. Die Unterzeichner postulierten: „Der Zusammenbruch des konventionellen deutschen Films entzieht einer von uns abgelehnten Geisteshaltung endlich den wirtschaftlichen Boden. Dadurch hat der neue Film die Chance lebendig zu werden.“
Das Manifest formulierte einen dezidiert intellektuellen Anspruch auf „neue Freiheiten“ – Freiheit von branchenüblichen Konventionen, von kommerziellen Zwängen und der „Bevormundung durch Interessengruppen“. Die Oberhausener verstanden sich als künstlerische Avantgarde mit gesellschaftspolitischem Auftrag. Ihre programmatische Radikalität manifestierte sich in Filmen wie Kluges „Abschied von Gestern“ (1966) oder Schlöndorffs „Der junge Törleß“ (1966) – Werke, die formale Innovation mit gesellschaftskritischer Reflexion verbanden.
Die Neue Münchner Gruppe: Gegenentwurf mit Nonchalance
Während die Oberhausener ein explizit politisches Programm verfolgten, formierte sich Mitte der 1960er Jahre in München-Schwabing eine alternative Strömung junger Filmemacher, die sich durch eine andere Haltung definierte. Rudolf Thome, Klaus Lemke, Max Zihlmann, Roger Fritz, May Spils, Werner Enke und Martin Müller – überwiegend Mitte bis Ende 20 – entwickelten einen Gegenentwurf zum dogmatischen Ernst der Oberhausener.
Ihr inoffizielles Motto lautete, wie Marco Abel in seinem Buch „Mit Nonchalance am Abgrund“ herausarbeitet: „Papas Kino ist tot, es lebe Papas Kino“. Diese scheinbar paradoxe Formel verrät eine komplexere Haltung zum filmischen Erbe, als der radikale Bruch der Oberhausener suggerierte. Die Münchner Gruppe schöpfte bewusst aus den ästhetischen Ressourcen des Genrekinos – inspiriert vom amerikanischen Genrefilm und dem frühen Godard, besonders seinem Debüt „Außer Atem“ (1960).
Die Arbeitsmethode dieser informellen Kollaboration war bezeichnend: Bei ihren ersten Kurzfilmen arbeiteten sie kollektiv und rotierten die Positionen als Autoren und Regisseure. Sie gründeten eine eigene Produktionsfirma und entwickelten einen Stil, der spontane Improvisation über akribische Planung stellte. Diese Herangehensweise stand im deutlichen Kontrast zum intellektuell-akademischen Ansatz der Oberhausener.
„Ästhetische Linke“ versus „politische Linke“
In der Filmkritik der späten 1960er Jahre positionierte sich die Münchner Gruppe als „ästhetische Linke“ gegen eine „politische Linke“, die ihrer Ansicht nach Filme auf soziologische Inhalte reduzierte. Diese Unterscheidung markiert den fundamentalen Unterschied in der Filmkonzeption: Während die Oberhausener das Kino als Medium gesellschaftspolitischer Aufklärung verstanden, betrachtete die Münchner Gruppe das Kino primär als Kino – als eigenständige künstlerische Form und nicht als didaktisches Mittel zum Zweck.
Die deutsche Filmkritik ordnete die Münchner Gruppe oft vorschnell als unpolitisch oder gar rechtskonservativ ein. Diese Kategorisierung verkennt jedoch die subversive Dimension ihrer filmischen Praxis. Ihr Ansatz war weniger explizit intellektuell, aber keineswegs apolitisch – er war anders politisch. Die Befreiung des Körpers von gesellschaftlichen Zwängen, die in Filmen wie „Duell“ thematisiert wird, artikuliert eine tiefgreifende Kritik an der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft: Die „eingezwängten Körper“ der Westdeutschen, der „Kleidungszwang“ und die „unausgesprochene Schuld“ werden nicht diskursiv abgehandelt, sondern durch filmische Mittel erfahrbar gemacht.
Filmische Meilensteine und ästhetische Innovation
Mit dem Übergang zu Langfilmen ab 1968, beginnend mit Klaus Lemkes „48 Stunden bis Acapulco“, änderten sich die Produktionsbedingungen, was faktisch das Ende der intensiven kollektiven Zusammenarbeit bedeutete. Dennoch entstanden bemerkenswerte Werke, die heute als innovative Beiträge zur deutschen Filmgeschichte wiederentdeckt werden.
May Spils‘ „Zur Sache, Schätzchen“ (1968) wurde zum Kultfilm, der nicht nur Uschi Glas bekannt machte, sondern auch mit Wortschöpfungen wie „türlich“, „Dumpfbacke“ und „fummeln“ den deutschen Sprachgebrauch bereicherte. Rolf Thieles „Rote Sonne“ (1969) mit Uschi Obermaier präsentierte eine radikale Frauenkommune, in der männliche Liebhaber nach fünf Tagen umgebracht werden – ein proto-feministischer Ansatz, der der zweiten Feminismuswelle (ab 1968) vorausging.
Die rund 32 Filme der Münchner Gruppe – etwa zur Hälfte Kurzfilme – zeichnen sich durch eine „Nouvelle Vague-artige Inszenierung“ aus, die das amerikanische Genrekino mit Godards Stilmitteln verschmolz. Bemerkenswert ist die Darstellung weiblicher Figuren, die Klaus Lemke mit dem Bonmot „Frauen sind die besseren Männer“ charakterisierte – eine Position, die in der damaligen deutschen Filmlandschaft keineswegs selbstverständlich war.
Schwabinger Lebensgefühl als ästhetisches Prinzip
Die Münchner Gruppe transportierte in ihren Filmen das Schwabinger Lebensgefühl der 1960er Jahre – eine Mischung aus Hedonismus, südlichem Flair und der Ablehnung bürgerlicher Konventionen. Schwabing als kultureller Schmelztiegel beherbergte nicht nur die Mitglieder der Münchner Gruppe, sondern auch Persönlichkeiten wie Rainer Werner Fassbinder und Andreas Baader.
Diese Atmosphäre spiegelt sich in den Filmen durch eine charakteristische Nonchalance – jene Leichtigkeit und Lässigkeit, die Marco Abel als titelgebendes Merkmal hervorhebt. Im Gegensatz zum pädagogischen Impetus der Oberhausener setzten die Münchner auf eine unmittelbare, sinnliche Filmsprache, die den Alltag und das Filmische auf eine Stufe stellte.
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zum Oberhausener Manifest
Die Unterschiede zwischen beiden Filmströmungen sind beträchtlich: Die Münchner Gruppe vertrat keine explizit revolutionäre, gesellschaftspolitische Ideologie, kannte keine feste Gruppendefinition und verzichtete auf einen akademisch-intellektuellen, strengen Ansatz. Der bewusste Verzicht auf Perfektion und strikte Drehbücher verlieh ihren Filmen eine experimentellere, emotionalere und wildere Qualität als den Werken des Neuen Deutschen Films.
Dennoch existieren wesentliche Gemeinsamkeiten: Beide Gruppen strebten eine Verjüngung des westdeutschen Kinos an, wollten das etablierte Studio-System überwinden und folgten dem Vorbild der französischen Nouvelle Vague. Wie ihre französischen Vorbilder um Godard, Truffaut und Rohmer etablierten sie ein neues Autorenkino, in dem der Regisseur als maßgeblicher Künstler fungierte.
Nachleben und filmhistorische Neubewertung
Nach 1972 gingen die Mitglieder der Münchner Gruppe unterschiedliche Wege: Rudolf Thome zog nach Berlin, Klaus Lemke nach Hamburg, wo er mit „Rocker“ (1972) einen Meilenstein des deutschen Realismus schuf, Martin Müller wurde Tonmeister, während May Spils und Werner Enke nach drei weiteren Filmen ihre Karrieren beendeten.
Die filmhistorische Bedeutung der Münchner Gruppe wurde lange durch die Dominanz des Neuen Deutschen Films in den 1970er Jahren überstrahlt und von der akademischen Filmforschung vernachlässigt. Erst mit der Neuen Berliner Schule um Christian Petzold, Dominik Graf und Thomas Arslan erfuhr ihre Ästhetik eine Renaissance. Diese zeitgenössischen Filmemacher knüpfen bewusst an die vergessene Traditionslinie der Münchner Gruppe an, die „Kino als Kino begriff und nicht als Mittel zum Zweck“.
Fazit: Eine progressive Alternative
Die Neue Münchner Gruppe repräsentiert einen alternativen, progressiven Weg in der deutschen Filmgeschichte, der jenseits kanonischer Fixierungen wiederentdeckt werden muss. Ihre Filme demonstrieren, dass politische Relevanz nicht notwendigerweise an explizite Sozialkritik gebunden ist, sondern auch in der ästhetischen Form und der Haltung zum Medium selbst liegen kann.
Die Neubewertung dieser filmhistorischen Strömung erweitert unser Verständnis des deutschen Nachkriegskinos und seiner vielfältigen Erneuerungsbewegungen. Sie erinnert uns daran, dass die Geschichte des deutschen Films nicht als linearer Fortschritt oder als exklusiver Kanon verstanden werden sollte, sondern als komplexes Feld verschiedener ästhetischer und politischer Positionen, die miteinander in Dialog treten.
Die lässige Nonchalance der Münchner Filmemacher, ihr Vertrauen in die Kraft filmischer Bilder jenseits didaktischer Intentionen und ihre Verschmelzung von Genrekino und künstlerischem Anspruch – diese Charakteristika machen sie zu einer faszinierenden Alternative im deutschen Kino der 1960er Jahre, deren Wiederentdeckung längst überfällig war.
Zusammenfassung des Films „Rocker“ (Klaus Lemke 1972)
Gerd, ein Rocker, wird aus dem Gefängnis Fuhlsbüttel entlassen und von seinen Freunden enthusiastisch empfangen. Seine frühere Freundin Sonja, die inzwischen als Warenhaus-Verkäuferin arbeitet, will sich von ihm und der Rocker-Szene lösen, zumal sie während seiner Haft eine Beziehung mit dem Kleinkriminellen Uli Modschiedler begonnen hat. Gerd versucht, sie zurückzugewinnen, indem er mit einer alten Mercedes-Benz-Limousine zu ihrem Arbeitsplatz fährt, doch seine aggressive Art eskaliert die Situation. Ein geplantes Treffen mit Sonja wird durch einen brutalen Überfall vereitelt, bei dem Gerd von einer maskierten Bande niedergeschlagen, an einen Baum gefesselt und seine Gartenlaube in Brand gesetzt wird. Währenddessen stiehlt Uli in der Tiefgarage am Hamburger Millerntor einen weißen Mercedes-Benz Cabrio, den er für 4000 Mark an einen Zuhälter verkaufen will, doch bei der Probefahrt wird er hinterrücks bewusstlos geschlagen, und die Betrüger entwenden das Fahrzeug.
Uli gerät zunehmend in finanzielle Not und überfällt seine eigene Schwester zu Hause, um Geld aus einem Nachttisch zu stehlen. Sein 15-jähriger Bruder Mark beobachtet ihn dabei und folgt ihm, woraufhin Uli ihn zunächst abweisen will, sich dann aber mit ihm anfreundet. Die Brüder betrinken sich in einer Kneipe auf St. Pauli, während Uli Mark in „Männerrituale“ wie das Trinken von Kornschnaps und das Rauchen einführt. Zufällig entdeckt Uli später den gestohlenen Mercedes wieder, und die beiden schlafen betrunken in dem Wagen ein. Doch der Zuhälter und sein Komplize erkennen sie, zerren sie aus dem Auto und schlagen Uli mit einem Knüppel brutal zu Tode, während Mark hilflos zusehen muss. Verstört flieht er vom Tatort und wird am nächsten Morgen betrunken vor dem Supermarkt gefunden, in dem er seine Ausbildung macht. Nachdem ihn eine Verkäuferin weckt, rastet er aus, randaliert und wirft Waren aus den Regalen, bis die Polizei ihn schließlich nach Hause bringt.
Marks Schwester plant, ihn zu den Eltern nach Cuxhaven zu schicken, doch an einer Straßenbahnhaltestelle schläft er ein. Nach dem Aufwachen gerät er in einer Kneipe an Gerd und zwei Rocker-Kameraden, die sich dort zuvor mit Sonja getroffen hatten. Als Sonja erfährt, dass ihr Freund Uli tot ist, verlässt sie fassungslos die Szene. Unterdessen betrügt Gerd einen Drogenkunden, indem er ihm Marks Kleidung als vermeintliche Drogen für 4000 Mark verkauft, mit denen er sich ein umgebautes Chopper-Motorrad kauft. Er beschließt, Mark damit nach Cuxhaven zu bringen, doch in einer Fernfahrerkneipe an der B 73 provoziert er grundlos einen LKW-Fahrer, der daraufhin sein Motorrad überrollt. Wütend und verzweifelt bricht Gerd zusammen, und schließlich kehren er und Mark per Anhalter nach Hamburg zurück.
Zurück in Hamburg erkennt Mark die blonde Freundin eines der Männer, die seinen Bruder Uli getötet haben, und folgt ihr in ein Nachtlokal an der Großen Freiheit. Als er Gerd einweiht, organisiert dieser eine brutale Vergeltungsaktion, bei der seine Rocker-Gang Ulis Mörder zusammenschlägt. Doch Mark will seine eigene Rache und zerschlägt mit einer Eisenstange die Windschutzscheibe des Mercedes, bevor er flieht, als die Polizei eintrifft. Der Film endet mit einer Nahaufnahme von Marks lächelndem Gesicht, während der Filmtitel eingeblendet wird.
Soundtrack
Rolling Stones: Sister Morphine
Rolling Stones: Moonlight Mile
Santana: Jingo
Them: It’s All Over Now Baby Blue
Elvis Presley: King Creole
Led Zeppelin: Rock’n’Roll
Santana: Black Magic Woman
Rolling Stones: I Got The Blues
Papas Staatskino ist tot: Hamburger Manifest von Klaus Lemke – Protest gegen das Filmfest 2010
(Der folgende Text des Manifests stammt aus Malte Weldings Blog)
ICH FORDERE INNOVATION STATT SUBVENTION. ICH FORDERE DAS ENDE JEDWEDER FILMFÖRDERUNG AUS STEUERMITTELN. DER STAAT SOLL SEINE GRIFFELN AUS DEM FILM ENDLICH WIEDER RAUSNEHMEN.
13 JAHRE STAATSKINO UNTER ADOLF UND DIE LETZTEN 40 JAHRE STAATLICHER FILMFÖRDERUNG HABEN DAZU GEFÜHRT, DASS DER DEUTSCHE FILM SCHON IN DEN SIEBZIGERJAHREN AUF KLASSENFAHRT IN DER TOSKANA HÄNGENBLIEB; DASS AUS REGISSEUREN SOFT SKILLS-KASTRATEN UND AUS PRODUZENTEN VEREDELUNGSJUNKIES WURDEN.
WIR BAUEN DIE SCHÖNSTEN AUTOS.
WIR HABEN DIE SCHÖNSTEN FRAUEN.
ABER UNSERE FILME SIND WIE GRABSTEINE.
BRAV. BANAL. BEGÜTIGEND. GOETHEINSTITUT.
ABER FILM IST KEINE AUSSTERBENDE TIERART. FILM IST AUCH KEIN INTELLIGENZBESCHLEUNIGER. FILM MUSS NOCH NICHT MAL GUT SEIN.FILM MUSS NUR WIRKEN.
DAS TUT DER DEUTSCHE FILM SCHON LANGE NICHT MEHR.
RETTUNG KANN ALLEIN VON OMAS HÄUSCHEN KOMMEN, DAS MAN HEIMLICH BEI DER BANK BELEIHT. DENN NUR FÜR DAS EIGENE GELD LOHNT ES SICH NACHZUDENKEN – WENN ES IN GEFAHR IST. UND GELDBEIM FILM IST IMMER IN GEFAHR. OHNE DAS WIRDS NICHTS.
GELD VOM STAAT IST IMMER EIN TRITT GEGEN DIE EIGENE KREATIVITÄT. VOR EIN PAAR WOCHEN WURDE KLAMMHEIMLICH DIE ENGLISCHE FILMFÖRDERUNG EINGESTELLT – DIE EINZIG ERFOLGREICHE IN EUROPA. ABER EBEN AUCH VOLLKOMMEN UNNÖTIG. DER FÖRDERWAHN FÜHRTE DEN ENGLISCHEN FILM INS NIRVANA. ACH DIESE ENGLÄNDER! ES GIBT NOCH HELDEN. BEI UNS NUR EINEN: DOMINIK GRAF. WÜRDE MAN JEDE FILMFÖRDERUNG AUS STEUERMITTELN ÜBER NACHT EINSTELLEN – WIR WÄREN IN ZWEI JAHREN DAS KREATIVSTE FILMLAND IN EUROPA UND EINE ECHTE KONKURRENZ ZU HOLLYWOOD. WEITER SO WIE JETZT BLEIBEN WIR DIE TOPLANGWEILER WELTWEIT. DER DEUTSCHE FILM GEHÖRT ENDLICH BEFREIT AUS DEN GEFÄNGNISSEN DER FFA.
NO PAIN. NO SPAIN. LEMKE.
Klaus Lemkes Filme in den Top 100 der deutschen Kino-Charts
1979 Platz 34: Arabische Nächte
1979 Platz 50: Ein komischer Heiliger
1980 Platz 59: Flitterwochen
Zitate von Klaus Lemke
Lemke über Film allgemein
Das allerwesentlichste und erste über Film ist wenn man etwas spürt lange bevor man’s weiß.Wenn man also ein Gefühl bekommt, dieser Kerl wird sie verraten. Man hat keinen Grund dafür, aber man nimmt an, man glaubt das. Und sie wird den verteidigen, das spürt man.Und wie man dann enttäuscht wird oder bestätigt wird in seinem Gespür, das ist Kino.Das andere ist Theater. Leute stehen hin und sagen ich bin jetzt der und der und ich mache das und das.YouTube Upload: 30 Juni 2015, Position: 13:06 | muenchen.tv https://youtu.be/7YhadcX–ew
Lemke über Schauspieler:innen
(die kann ich leider nicht mehr zuordnen, kommen aber aus einer der Quellen, die ich hier gelistet habe. Alas, I lack the time)
Lemke über Iris Berben:
Damals war ich mit einer kleinen Schlampe aus Hamburg zusammen, die hieß Iris Berben (…) und ich dachte mir, die ist wirklich so arrogant und auch so blöd und so bescheuert eigentlich. Und die habe ich eigentlich auch so gehasst und war auch wirklich verliebt in die, dass ich dachte, ich muss unbedingt einen Film über sie machen. Und das war einer der ersten Filme, die ich gemacht habe.
Lemke über Cleo Kretschmer:
Und dann lief noch so ein Mädchen rum – ganz süß, ganz klein, mit dem hübschesten Po der damaligen Zeit. Ein sehr aggressives Mädchen, mit sehr viel Alkohol und auch allen anderen Dingen. Das passte mir sehr gut, mit ihr war ich dann auch sofort zusammen. Das war Cleo Kretschmer, und dann habe ich mit ihr Filme gedreht.
Cleo Kretschmer über die Anfangszeit mit Klaus Lemke
Ich durfte nie mit ans Set. Und ich war in der ganzen Zeit eigentlich ziemlich einsam, habe zu Hause gehockt und war eifersüchtig. (…) Dann habe ich so lange genervt, bis er gesagt hat: „Okay, wenn du ein Drehbuch schreibst, mache ich einen Film mit dir.“ Und er hat wie beim Pferdehandel eingeschlagen.BR2 Podcast 9.7.2022, Position 18:39
Lemke über den Film „Rocker“
Rocker geht darum, was wirkliche Liebe ist. Wirkliche Liebe ist nicht, dass man jemanden liebt. Wirkliche Liebe ist, dass man jemanden liebt, der es vielleicht gar nicht verdient. Wo man allen Grund hat den nicht zu lieben.YouTube Upload: 30 Juni 2015, Position: 26:00 | muenchen.tv https://youtu.be/7YhadcX–ew
Wir kamen nie mit der deutschen Sprache zurecht, weil Deutsch einfach beschissen klang – gegen all das, was wir immer hörten, und gegen die Musik der Rolling Stones. (…) Für mich kam das richtige Ding, als ich plötzlich richtige Jungs kennengelernt habe – ich meine, richtige Jungs aus St. Pauli, eben Rocker, die sich einen Dreck um uns geschert haben, die ihr Ding gemacht haben. Das war eine Offenbarung. Und allein, wie die redeten, war zum ersten Mal so, dass man das sozusagen der Sprache Mick Jaggers entgegenhalten konnte. Das war Arbeitssprache vom Feinsten. Jede Sache bedeutete drei verschiedene Dinge – das war ganz, ganz bombig, wie die redeten. (…) Und zum ersten Mal war ich stolz auf Deutsch.BR2 Podcast 9.7.2022, Position ca.14:00
Lemke über Baader, mit dem er in einer Münchner Kommune lebte
Baader war auch hier oben immer im „Bungalow“ drin. Wollte unbedingt zum Film.YouTube Upload: 30 Juni 2015, Position: 26:29 | muenchen.tv https://youtu.be/7YhadcX–ew
Baader mochten wir gerne (…) In diesem kleinen Türkendeutsch, in dem wir unsere ganze Filmgeschichte gelernt haben, saß Baader hinten. Und Baader hat sogar gelernt, Filme einzulegen und vorzuführen. Er hat sich manchmal nachts bestimmte Filme alleine angeschaut. Er war ein wirklicher Filmfanatiker.BR2 Podcast 9.7.2022
Aber Baader hatte so einen merkwürdigen Münchner Badischen Akzent. Und den haben wir nicht genommen eigentlich. Damals, als wir diese ersten Filme gedreht haben. (…)Und so ist Baader eigentlich notgedrungen, da er nicht zum Film kam, Terrorist geworden, um wirklich irgendwas zu machen im Leben.Und ich habe mit dem zusammengewohnt im selben Haus.Und die haben die ganze Zeit über Mädchen geredet, die sie nicht hatten.Und haben Karl Marx gelesen, den sie nicht verstanden.Und wir haben immer lustig Filmchen gemacht.Und einen habe ich auch über die gemacht, der heißt Brandstifter.YouTube Upload: 30 Juni 2015, Position: 26:29 | muenchen.tv https://youtu.be/7YhadcX–ew
Ich habe mich damals schon eigentlich mehr für die Opfer interessiert. Oder: ich hatte damals eigentlich mehr Gefühle für die Opfer als für die Täter. Denn die Täter hatten wirklich kein Gefühl für ihre Opfer. Das hat mich wirklich schockiert.YouTube Upload: 30 Juni 2015, Position: 29:00 | muenchen.tv https://youtu.be/7YhadcX–ew
Lemke über Berlin, München und Film
Filmfest München 2014, Die Hamburg-Filme: Klaus Lemke im Gespräch mit Christoph Gröner
Berlin ist etwas, was München eben nicht ist.Berlin ist eine wirkliche Großstadt.Eine Großstadt zeichnet sich dadurch aus, dass das persönliche Leben und das Leben der ganzen Stadt, nichts anderes ist als von einer Katastrophe sich in die nächst größere bedenkenlos zu retten. (…)Das geht immer so weiter.Das ist aber auch der einzige Weg (…)Es gibt nur einen Weg: nur nicht denken, dass der liebe Gott es richtet. Und nur nicht ein schlechtes Gewissen haben, sondern sofort noch eins drüber.\Und das ist auch die Dramaturgie aller großen Filme.Denn Film ist nichts anderes als in eine Situation reinkommen und irgendwie versuchen aus der wieder rauszukommen.Es gibt nur einen Weg aus einer Situation rauszukommen, in die nächst üblere.Und das durchstehen.\Die Sache mit dem Verzeihen des lieben Gottes ist toll in Bayern. Aber das hilft nicht mehr für ein modernes Leben.Ein modernes Leben ist kein Kreuzworträtsel, das sich am Schluss einfach zusammenfügt.(…)Wir sind auch mit nichts anderem konfrontiert, als dieser geballten Irrationalität eines Lebens, der wir nicht mehr beikommen. Nicht mehr beikommen. Jeder von uns.Amerikaner haben das längst kapiert. Und Berlin auch. Deswegen ist Berlin eine Großstadt. Aber München hat natürlich was anderes, hat München…Ich würde sagen, äh, die schönen Mädchen.(…)München ist eine Ganztagslüge, aber eine, die sich lohnt.
YouTube Upload 4. Juli 2014, , Position: 26:37 | FILMFEST MÜNCHEN 2014 https://youtu.be/JQOnOr1VReA
Unsortiert…
Hier noch ein paar transkribierte Zitate, denen ich nur die Quelle, aber nicht die Position zuordnen kann. Ich habe das nicht noch einmal nachgelegt:
Es geht darum im Film nicht wie man eine Kamera bewegt, sondern wie man den Zuschauer bewegt.\YouTube Upload: 30 Juni 2015 | muenchen.tv https://youtu.be/7YhadcX–ew
Man kann auf einer Hochschule nicht lernen, wie man etwas macht, dass der Zuschauer einsteigt, dass man ihn verführt und dass man ihn am Schluss entlässt.Und im Kopf ist immer noch ein bisschen der Film drin. Und dann geht sein wahres Leben wieder los und wie sich das vermischt. Und plötzlich hat man was erlebt, was vollkommen einmalig ist.\YouTube Upload: 30 Juni 2015 | muenchen.tv https://youtu.be/7YhadcX–ew
Das ist worum die ganze Welt geht,dass wir für kurze Momente plötzlicher Ekstase aus dem rauskommen, was wir nun leider sein müssen den ganzen Tag.YouTube Upload: 30 Juni 2015 | muenchen.tv https://youtu.be/7YhadcX–ew
Mit Film kann man länger verrückt sein als mit Drogen oder Alkohol.YouTube Upload: 30 Juni 2015 | muenchen.tv https://youtu.be/7YhadcX–ew
Egal, mit wem man einen Film macht – selbst jeder professionelle Schauspieler ist im Prinzip enttäuscht von dem, was er auf der Leinwand sieht. Weil es nicht er ist, sondern ich bin es. Ich mache nichts anderes, als mich in die Leute hineinzubeamen. Und letztendlich bin ich es, der da vor der Kamera spielt – durch diese Person hindurch.YouTube Upload: 30 Juni 2015 | muenchen.tv https://youtu.be/7YhadcX–ew
Was ich drehe, das sind Erfindungen, die ich mir morgens ausdenke und nachmittags realisiere. Aber ich realisiere sie nicht mit irgendwelchen Marionetten oder Schauspielern, die genau das machen, was ich sage. Sondern das, was meine Leute zu dem sagen, was ich drehen will, ist unvorhersehbar. Und wenn sie es nicht drehen wollen, dann drehe ich es auch nicht.YouTube Upload: 30 Juni 2015 | muenchen.tv https://youtu.be/7YhadcX–ew
Wenn man so authentisch Filme dreht, wie ich, gibt es einen Moment, wenn man lange genug durchhält, dreht sich der Film von selbst. Die Leute merken selbst, in welche Rolle sie da reinflutschen. Und je mehr sie das selbst merken, desto mehr kann ich wieder raus.YouTube Upload: 30 Juni 2015 | muenchen.tv https://youtu.be/7YhadcX–ew
Ich habe zuerst ihren wirklich großen und fabelhaften Busen gesehen, und in so einem Fall bin ich sowieso von vornherein begeistert. Wie bei Dolly Dollar – die hatte einen noch größeren Busen. Aber das war ein bayerisches Kind, und dieses Mal war es ein norddeutsches, diese Sara Lisa …, die Verkäuferin bei H&M war. Ich habe ziemlich lange auf ihren Busen geschaut, und wenn die Mädchen dann nicht nervös werden, taugen sie meistens auch was für’s Kino.\Gefragt über die Entdeckung von Saralisa Volm für den Film Finale (2006)YouTube Upload: 30 Juni 2015 | muenchen.tv https://youtu.be/7YhadcX–ew

Feb 13, 2025 • 1h 54min
EGL071 Nosferatu 2024 - Robert Eggers reaktionäres Remake
Ellen Hutter: „Professor, my dreams grow darker. Does evil come from within us, or from beyond?”
Eigentlich-Podcast diesmal im Sitzen ohne zu laufen. Chris und Flo konnten es kaum abwarten, über Robert Eggers' Nosferatu zu sprechen, also haben wir eine Remote-Sendung aufgenommen: Chris in Berkeley und Flo in Berlin, ein klassischer Podcast ganz ohne Schnaufen und Nebengeräusche. Robert Eggers hat ein Remake des über 100 Jahre alten Proto-Horrorfilms "Nosferatu" von Friedrich Murnau gedreht. Die Geschichte orientiert sich stark an Murnaus Original: Storylines, Figuren und Handlungsorte werden in Eggers Verfilmung auf Hochglanz poliert. Es wirkt fast so, als hätte Eggers Murnaus Film Bild für Bild durch die generative KI gejagt und dabei das Pacing heruntergeschraubt. Alles ist ein bisschen runder, brutaler, dunkler, langsamer. Mehr aber auch nicht, meint Flo. Die Erscheinung von Nosferatu hat im Original wesentlich mehr kinematographische Kraft als im Remake. In Eggers Nosferatu trägt Orlok einen lächerlichen Schnurrbart und hat eine Beule auf dem Kopf, von der man nicht weiß, ob sie die wegfliegende Schädeldecke oder eine Schmalzlocke darstellen soll. Chris hält dagegen, dass Eggers mit der Figur des Orloks und seiner Verbindung zu Ellen etwas Neues geschaffen hat: In jungen Jahren, in Einsamkeit und sexueller Verzückung, beschwört Ellen das Monster herauf. Dadurch entsteht eine starke Bindung, die dann auch ganz deterministisch den Tod für beide bedeutet. Diesen Aspekt hat noch keine Dracula- oder Nosferatu-Geschichte in der Schärfe erzählt. Wir gehen sogar so weit, die Figurenkonstellation nach den Theorien von Jacques Lacan zu interpretieren: Ellen richtet sich als begehrendes Subjekt auf das Unmögliche, verkörpert durch Graf Orlok, der als das Reale jenseits der symbolischen Ordnung steht. In dieser Konstellation spiegelt sich die fundamentale Spaltung des Subjekts zwischen gesellschaftlicher Ordnung (symbolisiert durch Ellens Ehe mit Thomas Hutter) und dem transgressiven Begehren nach dem Unmöglichen. Orlok fungiert als Objekt klein a, als unerreichbare Ursache des Begehrens, während Ellen in ihm zugleich eine gespenstische Spiegelung ihrer eigenen verbotenen Sehnsüchte erkennt. Die drei Register - das Symbolische (bürgerliche Ordnung), das Imaginäre (Ellens Fantasien) und das Reale (Orlok/Tod) - verschränken sich in einer Bewegung, die unweigerlich zum Tod führt. Ellens finale Selbstopferung kann als ultimative Erfüllung des Begehrens gesehen werden, in der sich das Subjekt im Moment der Vereinigung mit dem Unmöglichen selbst auslöscht - ganz im Sinne von Lacans These, dass die vollständige Erfüllung des Begehrens nur im Tod möglich ist. Das klingt soweit ganz gut, aber was uns an dem Film stört, ist der Determinismus, der der Handlung, den Figuren und allem zugrunde liegt. Er manifestiert sich in der absoluten Vorherbestimmung der Ereignisse, im Drehbuch, das wie eine Anleitung gesehen werden kann. Wie eine Turingmaschine durchläuft der Film diese deterministische Kette, in der die einzelnen Szenen Stück für Stück nach den vorher festgelegten Algorithmus durchexekutiert werden. Alles, was geschieht, ist bereits vorherbestimmt, und die Figuren können diesem Schicksal nicht entkommen. Besonders deutlich wird dies in der fatalistischen Opferrolle Ellens, die sich in ihr vorherbestimmtes Schicksal fügen muss, um die Gesellschaft zu retten. Hier kann man Eggers eine reaktionäre Haltung vorwerfen, da sie jegliche menschliche Handlungsfreiheit und Selbstbestimmung negiert und stattdessen eine höhere, unveränderliche Ordnung postuliert. In Zeiten des Klimawandels und des Demokratieverlusts wünschen wir uns eher eine Haltung, die sozialen Wandel und Handlungsfreiheit propagiert. Das finden wir in Eggers "Nosferatu" nicht.
Shownotes
Links zur Laufstrecke
EGL071 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
https://de.wikipedia.org/wiki/Nosferatu_%E2%80%93_Der_Untote
Robert Eggers – Wikipedia
Midsommar (2019) – Wikipedia
Ari Aster – Wikipedia
A24 (Unternehmen) – Wikipedia
The Witch (Film) – Wikipedia
Der Leuchtturm (2019) – Wikipedia
Willem Dafoe – Wikipedia
Lily-Rose Depp – Wikipedia
Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens – Wikipedia
Friedrich Wilhelm Murnau – Wikipedia
Nosferatu – Phantom der Nacht – Wikipedia
Werner Herzog – Wikipedia
Isabelle Adjani – Wikipedia
Klaus Kinski – Wikipedia
Bram Stoker – Wikipedia
Dracula (Roman) – Wikipedia
convex tv.
The Northman – Wikipedia
Hamlet – Wikipedia
Slavoj Žižek – Wikipedia
Bram Stoker’s Dracula – Wikipedia
Der Elefantenmensch – Wikipedia
David Lynch – Wikipedia
Vampir – Wikipedia
Zombie – Wikipedia
Vampirfledermäuse spenden untereinander Blut - Wissen - SZ.de
Johann Wilhelm Ritter – Wikipedia
Robert Eggers on Nosferatu
Hereditary – Das Vermächtnis – Wikipedia
Beau Is Afraid – Wikipedia
Oppenheimer (2023) – Wikipedia
Buffy – Der Vampir-Killer – Wikipedia
Europa (1991) – Wikipedia
dread – Wiktionary
Chronik eines angekündigten Todes – Wikipedia
Edge of Tomorrow – Wikipedia
Jacques Lacan – Wikipedia
Strukturalismus – Wikipedia
Poststrukturalismus – Wikipedia
Das Reale – Wikipedia
Spiegelstadium – Wikipedia
Das Imaginäre – Wikipedia
Das Symbolische – Wikipedia
Objekt klein a – Wikipedia
Mitwirkende
Chris Flor
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens (1922)
Der Film „Nosferatu“ von Murnau beginnt in der fiktiven deutschen Stadt Wisborg. Der Immobilienmakler Hutter wird von seinem Arbeitgeber Knock beauftragt, zum Graf Orlok nach Transsylvanien zu reisen, um einen Hausverkauf abzuwickeln. Hutter lässt seine junge Frau Ellen bei Freunden zurück und macht sich auf die Reise. In den Karpaten wird er von abergläubischen Einheimischen gewarnt und findet in einem Gasthaus ein Buch über Vampire.Im Schloss des Grafen wird Hutter zunächst gastfreundlich empfangen, bemerkt aber bald unheimliche Vorkommnisse.Als Orlok Hutters Medaillon mit einem Bild von Ellen sieht, ist er von ihr fasziniert. In der darauffolgenden Nacht wird Hutter von Orlok angegriffen, der sich als Vampir zu erkennen gibt.Parallel dazu spürt Ellen in Wisborg eine telepathische Verbindung zu den Ereignissen.Orlok macht sich mit Särgen voller Erde auf den Weg nach Wisborg, während Hutter verzweifelt versucht, vor ihm dort einzutreffen.Auf dem Schiff, das Orlok transportiert, sterben nach und nach alle Besatzungsmitglieder an der „Pest“. Das als Geisterschiff bezeichnete Schiff läuft in Wisborg ein, Ratten strömen von Bord und verbreiten die Seuche in der Stadt. Orlok bezieht das gegenüber von Hutters Haus gekaufte Gebäude und hat von dort die Stadt und Ellen in seiner Gewalt. Die Stadt verfällt in Chaos und Tod durch die Seuche.Ellen, die das Buch über Vampire gelesen hat, erkennt, dass nur eine reine Frau den Vampir besiegen kann, indem sie ihn bis zum ersten Hahnenschrei bei sich hält. Die Protagonistin opfert sich, um Orlok zu sich zu locken und ihn so in einen Zustand der Immobilität zu versetzen, bis die Morgensonne ihn auflöst. Auf diese Weise wird die Stadt gerettet, jedoch findet Ellen in den Armen ihres zurückgekehrten Mannes den Tod. Der Film verbindet auf geschickte Weise Elemente des deutschen Expressionismus mit der Vampir-Mythologie und schafft durch seine visuelle Gestaltung eine einzigartig unheimliche Atmosphäre, die den Film zu einem Meilenstein des Horror-Genres macht.
Nosferatu – Phantom der Nacht (1979)
In der Adaption von Herzog wird die Grundhandlung des Originals weitgehend beibehalten, jedoch mit einigen bemerkenswerten Änderungen und Erweiterungen versehen. Die Figur Jonathan Harker (nicht Hutter) reist in Herzog nicht von Wismar (nicht Wisborg), sondern von einer anderen Lokalität nach Transsylvanien. Herzog verwendet deutlich mehr Zeit auf die Reise selbst und die Darstellung der mystischen Natur. Die Darstellung des Dracula durch Klaus Kinski ist melancholischer und existentieller geprägt, was einen großen Unterschied zur raubtierhaften Darstellung in Murnaus Film darstellt. Die Rolle der Lucy, gespielt von Isabella Adjani, ist komplexer ausgearbeitet und repräsentiert nicht nur ein passives Opfer, sondern eine bewusst handelnde und selbstbestimmte Person. Eine signifikante Abweichung vom Original ist das Ende: Nachdem Dracula durch Lucys Opfer vernichtet ist, wird Harker selbst zum Vampir und reitet als neuer Nosferatu davon, was einen zyklischen Charakter der Geschichte suggeriert. Herzog fügt außerdem surreale Elemente hinzu, wie die Szenen mit den Ratten (20.000 echte Ratten wurden verwendet) und die alptraumhaften Sequenzen der pestverseuchten Stadt. Die Atmosphäre ist weniger expressionistisch als bei Murnau, sondern naturalistischer und romantischer, mit einem stärkeren Fokus auf existenzielle Themen und die tragische Dimension des Daseins als Vampir.
Bram Stokers „Dracula“ (1897)
Stoker konstruiert den Roman als komplexer Briefroman, der sich aus verschiedenen Txtsorten wie Tagebucheinträgen, Briefen und Zeitungsartikeln zusammensetzt.Diese narrative Struktur erlaubt es dem Autor, die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven zu erzählen und dabei sowohl die äußeren Ereignisse als auch die inneren Konflikte der Charaktere zu beleuchten.
Die Handlung des Romans setzt ein mit den Tagebucheinträgen des jungen Anwalts Jonathan Harker, der nach Transsylvanien reist, um einen Immobilienkauf in London abzuwickeln. Die geschäftliche Reise entwickelt sich zunehmend zu einem Albtraum, da sich Harker im Schloss zunächst höflich, dann jedoch zunehmend unheimlich behandelt sieht. Er erkennt, dass sein Gastgeber ein Vampir ist, der nachts in den Wänden kriecht und ihn faktisch gefangen hält.Dracula plant seine Übersiedlung nach London und lässt einen geschwächten Harker zurück, der nur knapp mit dem Leben davonkommt.In England verlagert sich die Handlung zunächst auf Lucy Westenra, die beste Freundin von Harkers Verlobter Mina Murray. Sie wird zum ersten Opfer des nach London übersiedelten Dracula und beginnt zu kränkeln. Trotz der Bemühungen ihrer drei Verehrer – Dr. John Seward, Arthur Holmwood und Quincey Morris – sowie des hinzugezogenen Experten Professor Abraham Van Helsing kann sie nicht gerettet werden. Selbst mehrere Bluttransfusionen können ihren Tod nicht verhindern. Lucy selbst wird zum Vampir und muss von der Gruppe nach traditioneller Art durch Pfählung und Enthauptung endgültig zur Ruhe gebettet werden.Nach Harkers Rückkehr wendet sich Dracula Mina zu, was den Roman in eine entscheidende Phase führt.Die Gruppe der Vampirjäger formiert sich unter der Führung Van Helsings, der sein umfangreiches Wissen über Vampire teilt. In dieser Phase des Romans manifestiert sich eine komplexe Dynamik zwischen modernem, wissenschaftlichem Denken und altem, folkloristischem Wissen.
Mina wird von Dracula gebissen und entwickelt eine telepathische Verbindung zu ihm, die für die Verfolgung der Gruppe genutzt werden kann.Diese Verbindung symbolisiert die unterschwellige erotische Spannung des Romans, die im Kontext der viktorianischen Moralvorstellungen als besonders brisant angesehen wird.Die finale Jagd führt die Gruppe zurück nach Transsylvanien, wo sie systematisch Draculas Verstecke und seine Kisten mit geweihter Erde zerstören. Im finalen Duell wird Dracula von Harker und Morris mit einem Messer durch das Herz und eine durchschnittene Kehle getötet, wobei Morris sein Leben lässt.Mina wird von ihrem vampirischen Zustand erlöst, was den Sieg der „zivilisierten“ westlichen Welt über die „barbarischen“ östlichen Mächte symbolisiert.
Der Roman ist von den Spannungen seiner Zeit durchdrungen, die sich in der Konfrontation zwischen Wissenschaft und Aberglauben, zwischen westlicher „Zivilisation“ und östlicher „Barbarei“, zwischen unterdrückter und entfesselter Sexualität äußern. Er verarbeitet koloniale Ängste ebenso wie die Furcht vor weiblicher Sexualität und dem Zusammenbruch der gesellschaftlichen Ordnung. Stoker bedient sich dabei verschiedener moderner Technologien, wie etwa der Schreibmaschine und dem Phonographen, welche von den Protagonisten im Kampf gegen die alten, übernatürlichen Bedrohungen eingesetzt werden.Zudem ist anzumerken, dass die christliche Symbolik eine zentrale Rolle im Roman einnimmt und mit Elementen der Volksmythologie verwoben wird.Der Roman gilt als Grundlage des modernen Vampir-Mythos und hat unzählige Adaptionen inspiriert, die jeweils eigene Schwerpunkte setzen und neue Interpretationen wagen.
Unterschiede zwischen Roman und Film
Die wesentlichen Unterschiede zwischen Stokers „Dracula“ und Murnaus „Nosferatu“ sind in erster Linie auf rechtliche Implikationen zurückzuführen. Da Murnau keine Rechte am Original besaß und Stokers Witwe Florence sich vehement gegen nicht autorisierte Adaptionen aussprach, musste die Geschichte substanziell modifiziert werden. Dies resultierte in einer kreativen Transformation des Materials, die paradoxerweise einen der einflussreichsten Horrorfilme hervorbrachte. Die auffälligsten Änderungen betreffen zunächst die Namen und Orte: Die Rollen der Hauptfiguren wurden entsprechend ihrer Herkunft bzw. ihrer Funktion angepasst (z. B. wurde Graf Dracula zu Graf Orlok, Jonathan Harker zu Thomas Hutter und Mina zu Ellen). Darüber hinaus wurde der Handlungsort von London nach Wisborg verlegt und die komplexe Romanhandlung von Stoker erheblich gestrafft. Die tragende Rolle von Van Helsing und der Gruppe der Vampirjäger wurde gestrichen, ebenso wie die Figur der Lucy und ihre Transformation zum Vampir.
Die Natur des Vampirs selbst wurde ebenfalls verändert. Während Stokers Dracula als aristokratischer, verführerischer Charakter dargestellt wird, der sich in verschiedene Gestalten verwandeln kann, manifestiert sich Murnaus Nosferatu als eine deutlich monströsere, rattenähnliche Kreatur. Diese Interpretation hat einen neuen Zweig der Vampir-Ästhetik geprägt und die Art der Vernichtung des Vampirs verändert. Im Roman wird Dracula durch Messer und Enthauptung getötet, in „Nosferatu“ wird er durch das Sonnenlicht aufgelöst, ein Element, das später zum Standard des Vampir-Genres wurde.
Die narrative Struktur erfährt grundlegende Veränderungen. Während der Roman durch verschiedene Dokumente, Briefe und Tagebucheinträge erzählt wird, nutzt Murnau die Möglichkeiten des Films für eine geradlinigere, jedoch visuell komplexere Erzählung. Zudem wird das wichtige Element des prophetischen Buches eingeführt, das den deterministischen Charakter der Geschichte unterstreicht – ein Element, das im Roman nicht existiert. Darüber hinaus wird die Rolle der weiblichen Hauptfigur neu interpretiert. Während sie im Roman eine aktive, aber dennoch den viktorianischen Moralvorstellungen entsprechende Figur ist, wird sie bei Murnau zur tragischen Erlöserfigur, die sich bewusst opfert. Diese christliche Symbolik ist im Film deutlich stärker ausgeprägt als im Roman.
Die Verbindung von Vampirismus und Seuche wird bei Murnau viel expliziter dargestellt. Während die „Unreinheit“ des Vampirs im Roman eher metaphorisch zu verstehen ist, bringt Nosferatu buchstäblich die Pest in die Stadt, was dem Film eine zusätzliche gesellschaftskritische Dimension verleiht.Diese erzwungenen Änderungen führten letztlich zu einer eigenständigen Interpretation des Vampir-Mythos, die in ihrer expressionistischen Bildsprache und symbolischen Tiefe neue Maßstäbe setzte. Trotz des Rechtsstreits und der versuchten Vernichtung aller Kopien überlebte der Film und wurde selbst zu einer einflussreichen Quelle für spätere Adaptionen.Die Unterschiede zum Roman veranschaulichen, wie kreative Einschränkungen zu künstlerischer Innovation führen können.

Jan 30, 2025 • 1h 18min
EGL070 Was ist eigentlich Systemische Therapie?
"Ein erster Schritt zur Systembildung besteht - für psychische Systeme ebenso wie für soziale Systeme - in der Reduktion auf Handlung." Niklas Luhmann in: Systemtheorie der Gesellschaft
Die systemische Therapie wird erst seit einigen Jahren als Psychotherapiemethode von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. In dieser Episode befassen wir uns mit den systemischen Ansätzen dieser Therapie und beleuchten, wie sie sich von anderen Therapieformen unterscheidet. Wir reden während des Gehens und stellen dabei exemplarisch einige typische Interventionen vor, erklären das Setting des Reflecting Teams und diskutieren, warum es für die Community der systemisch arbeitenden Therapeut:innen, Coaches und Supervisor:innen eine Herausforderung war, plötzlich Diagnosen stellen zu müssen und von Störungen zu sprechen. Die Geschichte der systemischen Therapie ist eng mit einem Paradigmenwechsel in der Psychotherapie verbunden. Sie führte weg von der rein individuellen Betrachtung psychischer Probleme hin zu einem Fokus auf soziale Kontexte und Beziehungen. Was einst als revolutionäre Idee begann, gilt heute für viele als unverzichtbarer Bestandteil der psychotherapeutischen Arbeit. Besonders die Erkenntnis, dass psychische Probleme oft in einem systemischen Zusammenhang stehen, hat dazu beigetragen, die Relevanz und Wirksamkeit dieses Ansatzes wissenschaftlich zu untermauern. Die systemische Therapie wurde 2018 für Erwachsene und 2024 für Kinder und Jugendliche in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen. Die inzwischen 70 Jahre alte Therapieform hat diesen Weg in den letzten 20 Jahren in einem Umfeld beschreiten müssen, das von den etablierten "Platzhirschen" – Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie und Psychoanalyse – dominiert wurde.
Shownotes
Walter-Benjamin-Platz in Charlottenburg
Systemische Therapie: neues Psychotherapie-Verfahren für Erwachsene, In: E-Magazin des GKV-Spitzenverbandes
Die Luhmannsche Systemtheorie
Münchhausen-Stellvertretersyndrom / MSBP Munchausen syndrome by proxy
Psychodynamische Behandlung von Zwangsstörungen (Leichsenring, Steinert, Weiß)
MiniMax-Interventionen von Manfred Prior
Zirkuläres Fragen, PDF Download
Reflecting Team, PDF Download
Diagnostik in der Systemischen Therapie, Hunger-Schoppe, C., Braus, N. (2024), Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-662-64728-8_8
Mitwirkende
Anja Ulrich
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Micz holt Anja Ulrich in ihrer Praxis in Berlin Charlottenburg ab, deren Hausnummer sich zauberhafterweise mit der Nummer dieser Episode deckt. Zufall? Anja Ulrich ist niedergelassene psychologische Psychotherapeutin für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie für Einzel- und Gruppenpsychotherapie. Aktuell befindet sie sich in der zusatzweiterbildung für die Analytische Psychotherapie. Schon 2008 machte sie die Weiterbildung in „Systemische Therapie und Beratung“ bei der Systemischen Gesellschaft in Berlin. Seit 2012 ist sie außerdem zertifizierte Fachberaterin für Psychotraumatologie und seit 2013 Mediatorin mit dem Schwerpunkt Familienmediation. Sie ist also seit über 15 Jahren mit systemischem Denken vertraut und als systemische Therapeutin zertifiziert.
Die Tour führt uns durch Charlottenburg, beginnend mit dem Walter-Benjamin-Platz und dem Point of (no) Return in der Damaschkestraße vor den Räumen der oben genannten Systemischen Gesellschaft.
Im Gespräch suchen und versuchen wir die Systemische Therapie zu beschreiben, auch in Abgrenzung zu anderen Verfahren. Wir beleuchten dabei konkrete Interventionen, wie das Zirkuläre Fragen, Parts Party, Reflecting Team oder Familienaufstellungen. Anfang und Ende bildet eine abstraktere Frage, die sich einige Therapierichtungen immer wieder einmal stellen: lässt sich so etwas individuelles wie Psychotherapie in Manuale pressen, die dann Gegenstand von Evidenzforschung sein können? Oder anders formuliert: welche Wirksamkeit der Psychotherapie fällt vom Tisch der Forschung, wenn man auf statistische Verfahren setzt, die auf Mittelwerte und Standardabweichung begründet sind? Umsomehr, wenn sich in besagter Evidenzforschung zeigt, dass schulenübegreifend die „therapeutische Allianz“, also die erlebte Qualität der Arbeitsbeziehung in der Psychotherapie, fast 40% der Erfolgswahrscheinlichkeit einer Psychotherapie begründet.
Auf dem Rückweg streifen wir auch die Deutsche Akademie für Psychoanalyse in der Kantstraße, vor deren Toren wir uns versprechen auch darüber noch mal zu sprechen. Laufend. Selbstredend.

Jan 16, 2025 • 1h 16min
EGL069 Roadmovies II: Zabriskie Point
ZABRISKIE POINT: THIS IS AN AREA OF ANCIENT LAKE BEDS DEPOSITED FIVE TO TEN MILLION YEARS AGO. THESE BEDS HAVE BEEN TILTED AND PUSHED UPWAR BY EARTH FORCES, AND ERODED BY WIND AND WATER.
Wir setzen unsere Reihe über Roadmovies fort und Flo präsentiert "Zabriskie Point" von Michelangelo Antonioni aus dem Jahr 1970. Doch zunächst erinnern wir uns an die grundlegenden Merkmale von Roadmovies, die wir auch in der letzten Episode behandelt haben: die episodische Erzählweise, die zahlreichen Stationen, die oft motorisierte Fortbewegung und vor allem die innere und äußere Reise der Figuren. Der Film "Zabriskie Point" erfüllt diese Merkmale und kann gleichzeitig als Teil der New-Hollywood-Bewegung gesehen werden. Flo betont, dass Antonionis Werk nicht nur ästhetisch beeindruckend ist, sondern auch eine komplexe politische Botschaft transportiert, die im Kontext der amerikanischen Gesellschaft der 1970er Jahre verankert ist. Als Vertreter der italienischen Nouvelle Vague entwickelt Antonioni in diesem Werk seine kontemplative Filmsprache weiter. Bereits Anfang der 1960er Jahre verwendet Antonioni in einer Trilogie über die Missstände der Moderne das Konzept der "Temps mort": Momente im Film, in denen scheinbar "nichts passiert", die Kamera nach dem Abgang der Figuren verweilt und leere Bildräume ohne narrative Funktion eingefangen werden. Mit diesen Mitteln ästhetisiert er die zwischenmenschlichen Entfremdungen der Bourgeoisie. "Zabriskie Point" beginnt mit einer aufgeregten Studentenversammlung, in der die Themen Rassismus, Identität und Widerstand unter den Aktivisten diskutiert werden. Mark, der Protagonist, wird aus dieser politischen Konfrontation in eine persönliche Reise gedrängt, die ihn schließlich mit dem Flugzeug in die Weiten der Wüste führt. Daria, eine weitere Hauptfigur, symbolisiert die Suche nach Freiheit in einem kapitalistischen System. Die beiden Figuren treffen sich am Zabriskie Point und gehen in der Wüste eine tiefe geistige und körperliche Verbindung ein. In spielerischer Leichtigkeit, getragen vor allem von seinen Hauptfiguren, zeigt Antonioni mit ästhetischer Wucht den Aufbruch einer neuen Generation gegen das Establishment. Am "totesten" Punkt der Erde, in der Wüste des Death Valley, entwickelt sich aus der Liebesgeschichte zwischen Daria und Mark eine explosive Kraft, die den territorialen Schlund des Kapitalismus sprengt. Der politische Widerstand wird als ästhetische Revolte gelebt. Ganz getragen von dieser explosiven Kraft des Films sind wir an der Ostkrone angekommen und sprechen am Rande der Autobahn A113 über Fossilismus und Petromaskulinität. Micz fragt sich, ob das Ende des Verbrennungsmotors auch das Ende des Genres Roadmovie bedeutet. Flo kann dem nicht ganz zustimmen, denn für ihn steht das Roadmovie vor allem für die Reise der Charaktere. Unter der Autobahnbrücke gegenüber von Holz-Possling endet auch unsere Episode mit dem Kommentar von Micz, dass er sich wohl den Film „vermaledeiterweise“ erst nach unserer Episode anschauen wird.
Shownotes
Links zur Laufstrecke
EGL069 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
Michelangelo Antonioni – Wikipedia
Zabriskie Point (Film) – Wikipedia
Road movie - Wikipedia
Easy Rider - Wikipedia
Nouvelle Vague – Wikipedia
Pier Paolo Pasolini – Wikipedia
Teorema – Geometrie der Liebe – Wikipedia
Jean-Luc Godard – Wikipedia
Die mit der Liebe spielen – Wikipedia
Die Nacht (1961) – Wikipedia
Liebe 1962 – Wikipedia
Amerikanische Kunst des 20. Jahrhunderts (Ausstellung) – Wikipedia
Monica Vitti – Wikipedia
Jeanne Moreau – Wikipedia
Marcello Mastroianni – Wikipedia
Alain Delon – Wikipedia
Jack Nicholson – Wikipedia
Rote Wüste – Wikipedia
Blow Up – Wikipedia
Beruf: Reporter – Wikipedia
Kontemplation – Wikipedia
Andrei Arsenjewitsch Tarkowski – Wikipedia
Slow cinema - Wikipedia
Cadrage (Film) – Wikipedia
Metro-Goldwyn-Mayer – Wikipedia
Kathleen Cleaver - Wikipedia
Black Panther Party – Wikipedia
Death-Valley-Nationalpark – Wikipedia
Bruce Goff – Wikipedia
Goff in der Wüste Regie: Heinz Emigholz | Filmgalerie 451
Apocalypse Now – Wikipedia
PDF-Download: The Art Cinema as a Mode of Film Practice
Antonioni: „Zabriskie Point“ und die Kritik der Zeit - FIRSTonline
Filmzentrale Rezension 1 (archive.org) Zabriskie Point
Filmzentrale Rezension 2 (archive.org) Zabriskie Point
Filmzentrale Rezension 3 (archive.org) Zabriskie Point
Medien Kunst Netz | Kunst und Kinematografie | Wüsten des Politischen
A Thousand Plateaus - Wikipedia
Furiosa: A Mad Max Saga – Wikipedia
Petromaskulinität – Wikipedia
Jacques Tati – Wikipedia
Mitwirkende
Florian Clauß
(Erzähler)
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
In Antonionis Œuvre manifestiert sich eine cineastische Exploration der Implikationen von Isolation und der persistenten Diskrepanz zwischen Mensch, Gesellschaft und Raum. Seine Werke thematisieren existenzielle Leere, Kommunikationslosigkeit und das psychologische Vakuum des modernen Menschen, ohne dabei auf laute Konflikte oder dramatische Höhepunkte zurückzugreifen. Stattdessen setzt er auf stille, langsame Szenen, die durch seine charakteristische Technik des Temps mort eingefangen werden. Obwohl in diesen narrativen Pausen scheinbar „nichts“ geschieht, beladen sie den Film mit Atmosphäre und symbolischer Kraft. Durch diese Bildgestaltung erhebt Antonioni Architektur, Landschaften oder leere Räume zu eigentlichen Protagonisten seiner Filme. Moderne Gebäude und karge, unberührte Orte werden zu Spiegeln der emotionalen Isolation seiner Figuren. Nicht selten verweilt die Kamera nach einer Handlungsszene noch einige Zeit auf einem leeren Raum, als würden die zurückgelassenen Orte die Bedeutung der Figuren weitertragen. In Il Deserto Rosso (1964) ist es die farblich verfremdete Industrielandschaft, die die psychische Zerrüttung der Protagonistin reflektiert, während in Blow-Up die brüchige Grenze zwischen Wahrnehmung und Realität erkundet wird, wobei das urbane London zur Bühne für innere Konflikte wird. Diese Motive finden auch Eingang in Zabriskie Point. Anstatt sich jedoch der europäisch-modernen Gesellschaft zuzuwenden, fokussiert sich Antonioni in diesem Fall auf Amerika – ein Land voller Kontraste zwischen Konsumrausch und Protestbewegungen, Freiheit und Repression, urbaner Hochtechnologie und scheinbar endlosen Wüstenlandschaften.
Das 1970 erschienene Werk „Zabriskie Point“ erfüllt die wesentliche Merkmale des Roadmovies: Die Reise bildet den zentralen Fokus, die Handlung entfaltet sich episodenhaft vorwiegend in der Weite der Landschaft und elementare Themen wie Flucht und die Suche nach Freiheit finden Ausdruck. Die Protagonisten Mark (gespielt vom Laien-Schauspieler Mark Frechette) und Daria (Daria Halprin) führen den Zuschauer auf parallelen Geschichten durch das Kalifornien der späten 1960er-Jahre. Der Film beginnt inmitten der Studentenbewegung: In einer lebhaften Diskussion an einer kalifornischen Universität, in der sogar Black-Panther-Mitglied Kathleen Cleaver eine Rolle innehat, werden Proteststrategien gegen das Establishment erörtert. Mark, der bereits desillusioniert ist, verlässt frustriert die Versammlung. Er ist gewillt zu kämpfen, jedoch nicht gewillt, die ideologische Leere zu tolerieren. In der Folge flieht er vor der Polizei, nachdem bei einer Demonstration ein Polizist erschossen wurde, und nimmt sich spontan ein Flugzeug, um in die Wüste zu entkommen. Daria verfolgt derweil einen gänzlich anderen Weg. Sie ist für einen Immobilienentwickler tätig, der skrupellos agiert und dessen nächstes Projekt die Ausbeutung der Wohlhabenden in der Wüste sein wird. Auf ihrer Fahrt durch die Mojave-Wüste gerät sie in surreale Begegnungen: Sie trifft auf verwahrloste Kinder, die von einem gescheiterten Meditations-Guru zurückgelassen wurden, und hält schließlich am mythologischen Zabriskie Point, wo sich die Schicksale von Mark und Daria kreuzen.
In Antonionis Werk nimmt die Wüste eine besondere Stellung ein. Der gewaltige Raum des Death Valleys steht in einem Gegensatz zur hektischen, kapitalistisch durchdrungenen Welt der Städte. In dieser Abgeschiedenheit können Mark und Daria dem Lärm der Zivilisation entkommen und für einen Moment die Freiheit des absoluten Ortes erfahren. In der legendären Liebesszene in der Wüste vereinen sich die beiden Protagonisten im Sand, und plötzlich erscheinen zahllose weitere Paare, die sich zu einer halluzinatorischen Massenorgie inmitten der weiten, zeitlosen Landschaft verbinden. Die Verschmelzung von Sand, Körpern und Himmel in dieser Sequenz symbolisiert die Sehnsucht nach kollektiver, utopischer Freiheit.
Die finale Explosionssequenz stellt Antonionis radikalste Kritik am Kapitalismus dar. Als Daria in der palastartigen Wüstenvilla ihres Arbeitgebers ankommt – komplett mit einem grotesk in der Wüste platzierten Swimmingpool – erreicht ihre Desillusionierung ihren Höhepunkt. In ihrer Imagination zerstört sie das Gebäude in einer atemberaubenden Explosion, die in exquisiter Zeitlupe gezeigt wird. Diese Sequenz stellt einen unvergesslichen Angriff auf die Symbole des Konsumismus dar, indem sie Fernseher, Bücher, Kleider- und Kühlschränke mit sämtlichen Inhalten durch die Luft katapultiert und in operatischer Schönheit zerbersten lässt. Antonioni lässt den Zuschauer an der Vernichtung des modernen Überflusses zu ergötzen.
Als „Zabriskie Point“ erschien, wurde er in den USA vernichtend kritisiert, als anti-amerikanisch und zu abstrakt abgetan. Mit dem Abstand der Jahrzehnte ist seine subversive Kraft jedoch deutlicher geworden und resoniert mit zeitgenössischer Kritik an Kapitalismus, ökologischer Zerstörung und sozialer Ungleichheit.In einer Ära des Klimawandels und globaler Proteste gegen systemische Ungerechtigkeit wirken die Themen des 50 Jahare alten Films geradezu prophetisch. Antonionis Vision der Wüste – als Ort des Widerstands und der Wiedergeburt – bietet eine kraftvolle Metapher für gesellschaftliche Erneuerung. Darias imaginierte Explosion wird nicht nur zur Ablehnung, sondern auch zu einem Akt der Hoffnung: dass aus den Trümmern etwas Besseres entstehen könnte. Michelangelo Antonionis „Zabriskie Point“ kann als ein Zeugnis für die andauernde Kraft des Kinos gesehen werden, als ein Werkzeug für Kritik und Selbstreflexion.

Jan 2, 2025 • 1h 20min
EGL068 Auch interessant auf dem 38c3
Congress-Walk mit Ali Hackalife
In dieser Folge trifft Flo den Programmierer, Künstler und Podcaster Ali Hackalife auf dem 38c3 in Hamburg. Der Chaos Communication Congress findet vom 27.12. bis 30.12. im Congress Center Hamburg (CCH) statt. Ali ist auch 2024 wieder dabei und Flo nutzt die Gelegenheit, um mit ihm eine Episode aufzunehmen. Ali produziert seit gut einem Jahr den Podcast "Auch interessant" und präsentiert darin eine große Themenvielfalt. Mit verschiedenen Gästen nimmt er Sendungen über Pilze, Segelfliegen, Hitlers Drogenkonsum, wie man einen Wingsuit fliegt, verschiedene Literaturrezensionen, Neuigkeiten aus der Tech-Welt und vieles mehr auf. Bevor wir "Reden beim Laufen", sitzen wir im 3. Stock des Kongresszentrums und sprechen über die Entwicklung der Kongresse in den letzten 10 Jahren. Ali erzählt, wie er zum Chaos kam und was er auf den Kongressen alles getrieben hat. Wir sprechen auch über einzelne Sendungen von "Auch interessant", die Flo besonders bemerkenswert fand. Darunter das Interview mit Norman Ohler, der in seinem Buch "Der totale Rausch" über die Rolle der Drogen im Dritten Reich und in der Biografie Hitlers berichtet. Dann verlassen wir den 38c3, um getreu dem Prinzip des Eigentlich Podcasts laufend zu reden und bewegen uns zum Alsterufer. Das eigentliche Thema soll Kochen sein und wir tauchen ein wenig in die Frühgeschichte des Menschen ein, um die evolutionäre und kulturgeschichtliche Rolle des Kochens zu beleuchten. Der Homo sapiens mit seinem hohen Kalorienverbrauch war auf gekochte Mahlzeiten angewiesen und soll auch zum Aussterben des Neandertalers beigetragen haben. Zurück in der Jetztzeit erzählt uns Ali von seiner Sehbehinderung und wie er "Kochen ohne Gucken" kann. Als wir wieder vor dem CCH stehen, stellt Ali fest, dass er keine der Notizen, die er sich vorher gemacht hat, angesprochen hat. Wir beenden die Folge mit der Aussicht, bei der nächsten Chaos-Veranstaltung eine neue Folge aufzunehmen. Viel Spaß beim Hören.
Shownotes
Links zur Laufroute
EGL068 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
auch-interessant.de
Benutzer:Ali Hackalife – Wikipedia
@hackalife.net on Bluesky
Hackalife · GitHub
Jugend hackt – Wikipedia
Querschläger (ricochet) - HackDash
Berlin 2015 – Jugend hackt
https://media.ccc.de/b/congress/2015
Politikunterricht – WRINT: Wer redet ist nicht tot
Willkommen - CERT - Chaos Emergency Response Team
Social Engineering (Sicherheit) – Wikipedia
1 Jahr – Statistiken, Geld und Transparenz | auch-interessant.de
Norman Ohler – Wikipedia
Joe Rogan Experience #2183 - Norman Ohler
Diogenes Verlag - Der Zauberberg, die ganze Geschichte
Der totale Rausch - Norman Ohler | Kiepenheuer & Witsch
Oxytocin – Wikipedia
Theo Morell – Wikipedia
Werner Heisenberg – Wikipedia
Traudl Junge – Wikipedia
Hotboxing – Wikipedia
Kapitel 1 - Die Bibel - song by Martin Luther, Rufus Beck | Spotify
Habakuk – Wikipedia
diplom designer malik aziz
Freak Show | Menschen! Technik! Sensationen!
Pilze mit Norman Glatzer | auch-interessant.de
Wingsuit fliegen mit Kalle | auch-interessant.de
Mission Kartoffel, Denkgeschwindigkeit, Tunnel | auch-interessant.de
Das Technikjahr 2024 [Live vom 38c3] mit Dr. Michael Seemann | auch-interessant.de
Gärtnern mit Felix Wilming (Felix Hobby Garten) | auch-interessant.de
Felix Hobby Garten
Igel-Stachelbart – Wikipedia
Der stärkste Stoff - Norman Ohler | Kiepenheuer & Witsch
Kochen – Wikipedia
Homo – Wikipedia
Archaischer Homo sapiens – Wikipedia
Neandertaler – Wikipedia
Feuer – Wikipedia
Joachim Ringelnatz – Wikipedia
David Graeber – Wikipedia
Anfänge | Klett-Cotta
Achromatopsie – Wikipedia
Vegetarismus – Wikipedia
Veganismus – Wikipedia
GitHub - Hackalife/Air-fryer: Documenting my Air-fryer experiments
Fritteuse – Wikipedia
Die Ernährungspyramide- BZfE
Der Ernährungskompass › Bas Kast
Apokryphen – Wikipedia
Mitwirkende
Ali Hackalife
(Gast)
YouTube (Channel)
Bluesky
Website
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Alis Bücherliste
Ohler, N. (2015) Der totale Rausch: Drogen im Dritten Reich. Berlin: Kiepenheuer & Witsch. (Hinweis: Dieses Buch ist auch unter dem Titel Blitzed: Drugs in the Third Reich in englischer Übersetzung erschienen.)
Ohler, N. (2023) Tripped: Wie LSD die Welt verändert hat. Berlin: Kiepenheuer & Witsch.
Kast, B. (2018) Der Ernährungskompass: Das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung. München: C. Bertelsmann Verlag.
Graeber, D. und Wengrow, D. (2021) The Dawn of Everything: A New History of Humanity. London: Allen Lane.
Sheldrake, M. (2020) Entangled Life: How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds and Shape Our Futures. London: Bodley Head.
Tsing, A.L. (2015) The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Die Evolution des Kochens: Von heißen Quellen zur molekularen Küche
Das Kochen ist eine der ältesten und wichtigsten Kulturtechniken der Menschheit. Neue archäologische Funde verändern jedoch unser Verständnis der Anfänge dieser fundamentalen kulturellen Praxis. Während bislang die Kontrolle des Feuers als Ausgangspunkt des Kochens galt, deuten Funde in der Olduvai-Schlucht in Tansania darauf hin, dass bereits vor 1,7 Millionen Jahren die Nutzung heißer Quellen zur Nahrungszubereitung erfolgte. Diese Phase wird in der Wissenschaft als „prefire stage of human evolution“ bezeichnet. Der bisher früheste direkte Beweis für das Kochen stammt aus der Fundstätte Gesher Benot Ya’aqov in Israel, wo Überreste von gekochtem Fisch entdeckt wurden, die etwa 780.000 Jahre alt sind. Diese wurden durch kontrolliertes Erhitzen zubereitet, und nicht, wie man bis dahin annahm, über offenem Feuer. Dies zeigt, dass bereits in dieser frühen Phase der menschlichen Evolution komplexe Methoden der Nahrungszubereitung entwickelt wurden.
Die Entwicklung des Kochens hatte signifikante Auswirkungen auf die menschliche Evolution, da durch das Erhitzen die Nahrung nicht nur verdaulicher, sondern auch haltbarer wurde. Dies wiederum führte zu bedeutenden anatomischen Anpassungen, wie der Verkleinerung des Verdauungstrakts, der Verfeinerung des Gebisses und – von besonderer Relevanz – der Vergrößerung des energieintensiven Gehirns. Diese Veränderungen begünstigten auch die Entwicklung der Sprache.Bereits vor der Erfindung der Töpferei entwickelten die Menschen eine Vielzahl unterschiedlicher Kochtechniken, darunter das Grillen über offenem Feuer, das Garen von Nahrung in heißer Asche, das Rösten auf erhitzten Steinen sowie die Nutzung natürlicher Gefäße wie Muschelschalen und Straußeneiern. Eine besonders interessante historische Methode war das Garen von Fleisch in Tierhäuten oder Tiermägen, eine Technik, die der griechische Geschichtsschreiber Herodot bei den Skythen beobachtete und die als Vorläufer heutiger Gerichte wie Haggis oder Saumagen gilt.
Die neolithische Revolution, die vor etwa 12.000 Jahren stattfand, markierte eine fundamentale Transformation in der Praxis des Kochens. Die Entwicklung der Töpferei ermöglichte erstmals das „Eintopf-Kochen“, eine Innovation, die nicht nur neue Geschmackserlebnisse schuf, sondern auch die soziale Struktur früher Gesellschaften prägte. Die systematische Kultivierung von Getreide sowie die Entwicklung von Mahltechniken führten zur Entstehung des Brotbackens, einer Kulturtechnik, die bis heute eine zentrale Rolle in vielen Gesellschaften spielt. Die Entstehung der frühen Hochkulturen war von einer Reihe bedeutender Innovationen geprägt. In Mesopotamien entstanden um 4.000 v. Chr. die ersten schriftlichen Kochrezepte auf Tontafeln, was einen bedeutenden Schritt in der Systematisierung und Weitergabe kulinarischen Wissens darstellte. Die Ägypter entwickelten komplexe Techniken der Bierbrauerei und Brotbackkunst, während in China das Dämpfen und Wok-Kochen perfektioniert wurde. Diese frühen regionalen Spezialisierungen bilden bis heute die Grundlage vieler kulinarischer Traditionen. Das europäische Mittelalter, das oft als rückständig betrachtet wird, brachte trotz dieses Rufes wichtige kulinarische Entwicklungen hervor. So wurden in den Klosterküchen Konservierungstechniken verfeinert und die Bierbraukunst weiterentwickelt. Ein weiterer bedeutender Aspekt, der die europäische Küche nachhaltig prägte, waren die Kreuzzüge, die zu einem verstärkten Gewürzhandel führten. Die Entstehung der Zunftküchen kann als Grundstein für die professionelle Gastronomie betrachtet werden. Eine der folgenreichsten Veränderungen in der Geschichte des Kochens war der „Columbian Exchange“ im 16. Jahrhundert. Der Austausch von Lebensmitteln zwischen der Alten und der Neuen Welt führte zu einer Revolution der globalen Küche. Kartoffeln, Tomaten und Mais veränderten die europäische Ernährung fundamental, während amerikanische Kulturen neue Nutztiere und Getreidesorten kennenlernten. Diese Entwicklung, die als „kulinarische Globalisierung“ bezeichnet werden kann, hat bis heute anhaltende Auswirkungen auf unsere Ernährungsgewohnheiten.
Die Industrielle Revolution markierte einen Wendepunkt in der Entwicklung der Kochtechniken. Als signifikante Meilensteine sind in diesem Zusammenhang die Erfindung des Gasherds im Jahr 1802 sowie des Elektroherds im Jahr 1892 zu nennen, welche eine beispiellose Transformation der Küchentechnik bewirkten. Die Entwicklung von Kühlschränken und Gefriertruhen ermöglichte eine völlig neue Form der Vorratshaltung. Mit der Erfindung der Konservendose und der Pasteurisierung wurden neue Wege der Haltbarmachung erschlossen. Das 20. Jahrhundert war geprägt von gegenläufigen Entwicklungen: Einerseits führte die Industrialisierung der Nahrungsmittelproduktion zur Entstehung von Convenience-Produkten und Fast Food, andererseits entwickelte sich als Gegenbewegung die Slow-Food-Bewegung. Die Mikrowelle (1946) und der Schnellkochtopf führten zu Veränderungen in der alltäglichen Küche, während gleichzeitig das Interesse an traditionellen Zubereitungsmethoden wuchs.Die gegenwärtige Situation ist durch neue Herausforderungen und Möglichkeiten für die Kochkunst geprägt. Einerseits wurde durch die Molekularküche wissenschaftliches Methodenwissen in die Gastronomie integriert, andererseits wird die Digitalisierung durch Smart Kitchen Technologies vorangetrieben. Zudem ist ein zunehmendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit und regionale Produkte zu verzeichnen. Zudem könnten neue Konservierungstechniken und alternative Proteinquellen, wie beispielsweise Insekten oder in vitro gezüchtetes Fleisch, die Zukunft des Kochens prägen.
Die Geschichte des Kochens ist nicht nur eine Geschichte der Nahrungszubereitung, sondern auch ein Spiegel der menschlichen Zivilisation. Von den ersten Versuchen der Nahrungsverarbeitung an heißen Quellen bis zur molekularen Gastronomie zeigt sich die enge Verflechtung von technologischem Fortschritt, kultureller Entwicklung und gesellschaftlichem Wandel. Das Kochen stellt demnach eine zentrale Kulturtechnik dar, die einer stetigen Weiterentwicklung und Neuinterpretation unterliegt, während sie zugleich tiefe kulturelle Traditionen bewahrt.In Anbetracht gegenwärtiger globaler Herausforderungen, wie Klimawandel, Ressourcenknappheit und wachsende Weltbevölkerung, könnte das Bewusstsein für die evolutionäre und kulturelle Signifikanz des Kochens entscheidende Impulse für zukunftsfähige Ernährungskonzepte liefern. Die historische Analyse des Kochens zeigt, dass kulinarische Innovationen häufig eine Reaktion auf gesellschaftliche Herausforderungen darstellen. Diese Erkenntnis ist auch für die Gegenwart von Relevanz.

Dec 19, 2024 • 36min
EGL067 Dummy Coil zähmt Jaguar Kralle: Out-of-Phase Wiring Diagram für Single Coil Pickups in Stromgitarre 6
"Du redest schon weiter -- ohne mich?" -- Florian Clauß (Min 27:35)
Wir zähmen die Krallen des Jaguars -- der reißerische Titel hat sich angeboten Denn in dieser Stromgitarren-Episode beschäftigen wir uns mit Brummen verzerrter Single Coil Pickups (PUs), Dummy Coils und Baseplates (in diesem Fall den Claws der Jaguar Pickups). Wenn wir diese drei Zutaten gut verrühren und eine Prise Out-of-Phase Switching dazugeben, bekommen wir den Jaguar gut in den Griff. Das Ergebnis ist eine Wildkatze, der wir bei Verzerrung eine Dummy Coil anlegen können, die sich beim cleanen Sound einfach entfernen lässt. Und diese können wir in der Phase umpolen, sodass sie für beide PUs angelegt werden kann, selbst wenn diese RWRP (Reverse Wound, Reverse Polarity) gewickelt sind. Generell sind Single Coil Tonabnehmer anfällig für Brummen. Das haben wir in anderen Stromgitarre-Episoden schon mehrfach erklärt. Die brummgeschützten Humbucker haben sich aber nicht komplett durchsetzen können, denn für viele ist die Anschlagdynamik und der Sound der Single-Coil Pickups der Sound, den sie haben wollen.
Shownotes
Link zur Laufstrecke
EGL067 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
Duncan Designed Jaguar Pickups, Analysis & Review - OffsetGuitars.com
What difference does a Jaguar’s pickup claw make?
Pickups orientation and claw placement
Interaktive Out-of-Phase-Schaltung zum Lernen
OMG Pickup Polarity and Phase (Jaguar)
Dummy Coils for Dummies - OffsetGuitars.com
Tipps & Tricks. Spulen. Schwingkreise. Sperrkreise. Primärempfänger, Sekundärempfänger, Zweikreiser
Der Exorzist (The Exorcist, 1973, Regie: William Friedkin)
Fender Jaguar auf Wikipedia
Fender Mustang auf Wikipedia
Mitwirkende
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Verwandte Episoden
EGL086 Pickup-Physik deiner E-Gitarre: Humbucking und Phasendrehung richtig planen (Stromgitarre 7)
Es beginnt mit dem Ende der Episode: das Foto, von dem Micz meinte, dass es ihn an das Poster von „The Exorcist“ erinnert findet ihr neben dem DVD Cover eingebunden. Uncanny!?
Und jetzt zum Ende des Anfangs: Beim laufend Reden versprach ich ein Wiring Diagram für zwei Jaguar Pickups mit Claw (Baseplate). Darin hilft eine Dummy Coil mit einem Out-of-Phase Switch das Brummen der Single Coil Tonabnehmer zu zähmen. Was eine Dummy Coil ist und was Out-of-Phase bedeutet, erkläre ich auch in diesem Blogpost. Und ich beginne mit der Bestandsaufnahme, was wir haben und was wir erreichen wollen:
Eine Stromgitarre mit zwei Jaguar Pickups und einen 3-Position Switch (middle position: beide PUs parallel)
Der cleane Sound ist der reine Jaguar Pickup Sound (keine Dummy Coil)
Verzerrt soll die Gitarre weniger brummen, als üblich es für Single Coils üblich ist
Dieses hum cancelling soll für alle drei Positionen funktionieren, also bridge, neck und beide parallel
Die beiden PUs sind RWRP (Reverse Wound, Reverse Polarity) gewickelt, also in der middle Position ist hum cancelling gegeben
Die Strat Copy
Das neue Pickguard
Der Jaguar Pickup eingesetzt
Fräsen der Löcher für die Pickups
Der Schiebeschalter für Dummy Coil und Pu 3-Pos Switching
Warum hat der Fender Jaguar Pickup eine Kralle (Claw)?
Anfang der 1960er kam die Fender Jaguar in die Welt und brachte zwei metallische „Krallen“ mit, die die beiden Toabnehmer seitlich und unten umklammern. Die Wicklung der Single-Coil-Pickups ist nichts besonderes und in ihrer Art denen der Stratocaster oder Telecaster ähnlich. Doch es gibt eben diesen einen, signifikanten Unterschieden. Die zusätzliche metallische, verchromte Abschirmung – die sogenannte Kralle – umgibt die Spulen seitlich und ist unten mit der als Baseplate verschraubt. Das macht den besonderen Ton aus:
Magnetische Fokussierung:Die Claw bündelt das Magnetfeld des Pickups. Das Magnetfeld wird durch das Metall „gebogen“ und anstatt an den Seiten weite Bögen bis zur Mitte zu schlagen, bilden sich an der Oberseite zwischen den Polen und der Kralle kleinere, konzentrierte Magnetfelder. Sie wirken in gewisser weise wie eine Linse, die den Klang durch die Fokussierung beeinflusst. Das Ergebnis ist ein straffer und klarer Ton, der besonders in den Höhen definiert bleibt.
Abschirmung des Brummens:Die Kralle ist geerdet und wird damit Teil der Abschirmung, schützt also vor elektromagnetische Interferenzen und Störgeräuschen. Wichtig: wer seine Pickups Out-of-Phase schalten will, muss die Erdung der Kralle von den Kabeln abtrennen. Dazu gleich mehr.
Klangformung:Die Kralle beeinflusst die Resonanzfrequenzen des Pickups und sorgt für den charakteristischen, leicht metallischen Klang der Jaguar. Der Twang, der in Surf-Rock und Indie-Musik so geschätzt wird.
Das macht die Pickups besonders. Aber was sie mit allen Single Coil Pickups gemein haben: sie brummen gerne, vor allem, wenn man mit Verzerrung spielt. Wie wir das zähmen können, das beschreibe ich hier. Unsere Zutaten: Dummy Coil und Out-of-Phase Switching.
Was ist eine Dummy Coil?
Im Deutschen manchmal auch als „Störspule“ beschrieben ist sie eine zusätzliche Spule, die verwendet wird, um Brummgeräusche (typisch für Single-Coil-Pickups) zu reduzieren, ohne den Klang der Gitarre wesentlich zu beeinflussen. Eine Dummy Coil hat kein Magnetfeld. Eine Dummy Coil braucht keine Poles (manche sagen jedoch: dann ist sie effektiver). Die Spule ohne Magnetfeld drumherum sollte ähnlich gewickelt sein wie der Pickup, dem sie zugeschaltet wird. Was dabei passiert:
Die Dummy Coil nimmt die gleichen elektromagnetischen Störungen auf wie die aktiven Pickups.
Da sie elektrisch entgegengesetzt verdrahtet ist, heben sich diese Störungen gegenseitig auf
Das eigentliche Signal der schwingenden Seite bleibt (fast!) unverändert erhalten.
In meinem Fall werde ich die Dummy Coil von unten an das Pickguard kleben. Da ich eine Strat Copy verwende, habe ich in der Mitte Platz, wo bei der Strat der RWRP Pickup ist.
Wozu eine Dummy Coil, wenn die Jaguar Pickups Reverse Wound, Reverse Polarity (RWRP) sind?
RWRP steht für „Reverse Wound, Reverse Polarity“ und beschreibt Pickups, die so gewickelt und magnetisiert sind, dass sie Brumm auslöschen, wenn sie zusammen verwendet werden.
Reverse Wound (umgekehrte Wicklung): Das Signal wird elektrisch umgekehrt.
Reverse Polarity (umgekehrte Polarität): Die magnetische Richtung ist entgegengesetzt.
In einer Jaguar sind die beiden Pickups häufig RWRP, wodurch sie im Parallelbetrieb (Standard) als humbucking-artig agieren und Brumm unterdrücken.
Die Dummy Coil kommt in der Middle Position, wenn beide Pickups aktiv sind, nicht zum Einsatz, sondern genau dann, wenn nur Bridge oder Neck aktiv sind. Dann kann die Dummy Coil zugeschaltet werden, um dem jeweiligen PU das Brummen abzuwürgen. Deshalb die Dummy Coil: wenn man verzerrt mit nur Neck oder Bridge Pickup spielt.
Was ist eine Out-of-Phase-Schaltung?
Eine Out-of-Phase-Schaltung (oder „außer Phase“) verändert die Polarität eines Pickups, sodass er im Gegensatz zu einem anderen Pickup schwingt. Statt dass sich die Schallsignale beider Pickups summieren, werden bestimmte Frequenzen ausgelöscht. Das Ergebnis ist ein Klang, in dem Teile der Mitten fehlen, etwas dünner, nasaler. Wer mehr Sounds aus der gleichen Gitarre kriegen möchte, der:die hat mit dieser Schaltung eine gute Erweiterung. Mehr als z.B. Pickups in Reihe statt parallel zu schalten.
Der 3-Position Switch für unsere Schaltung
Jetzt kommen wir zum eigentlichen Hack für dieses Wiring Diagram: die Dummy Coil mit Out-of-Phase-Switch.
Der 3-Position Switch kommt zweimal zum Einsatz: für die Out-of-Phase Schaltung der Dummy Coil und die Schaltung der beiden Pickups
Integration der Out-of-Phase-Schaltung mit drei Positionen für die Dummy Coil
Wiring Diagram mit Out-of-Phase 3-Pos Switch für Dummy Coil parallel zu 3-Pos Tele-Style Switch von 2 Pickups
Die Out-of-Phase-Schaltung wird hier mit einem DPDT-Schalter (in meinem Fall ein Schieberegler) realisiert, der die Polarität eines Pickups invertieren kann. In meinem Fall nehme ich einen Schalter mit drei Positionen, sodass ich die Mittelstellung als OFF Zustand nutzen kann. Dann ist die Dummy Coil nicht „aktiv“.
Die OFF-Position ist in zweierlei Hinsicht wichtig:
Wenn beide Pickups aktiv sind, ist hum bucking gegeben und die Dummy Coil sollte nicht zugeschaltet sein
Wenn die Gitarre ganz clean, ohne Verzerrung, gespielt wird, kann man die Dummy Coil abschalten, um den unveränderten PU Sound zu haben.
Denn eine Dummy Coil beeinflusst den Klang minimal. Nicht so stark, da sie kein magnetisches Feld erzeugt und nur Störungen aufnimmt, aber es macht einen kleinen Unterschied. Deshalb ist es gut sie abschalten zu können.
Zuschaltung der Dummy Coil beim Single Coil Betrieb mit Phase-Switching
Spielt man mit Verzerrung und möchte ein etwas saubereres, brummfreieres Signal, kann man die Dummy Coil zuschalten. Durch die Out-of-Phase Option lässt sich die Polarität umkehren, sodass die Dummy Coil beide Single Coils bedienen kann.
Wie man die Jaguar Pickups mit sich selbst auch Out-of-Phase schalten kann.
Ich mache hier nur einen kurzen Absatz zum Thema, sollte jemand noch diesen Schritt weiter gehen wollen, z.B. mit einem Push/Pull Switch am Tone Pot.
Es ist notwendig die Kralle von der Erdung zu trennen. Ähnlich wie bei dem klassischen Neck Pickup der Telecaster ist das Shielding (die Kralle) mit dem Kabel des Pickups, das an Masse angeschlossen wird, verlötet. Das muss getrennt werden. Die Kralle bekommt ein eigenes Kabel, das gegen Masse geht. Und die beiden Kabel, die aus dem Pickup kommen kann man dann durch einen Switch „umpolen“, um die Out-of-Phase-Schaltung umzusetzen.

Dec 5, 2024 • 1h 40min
EGL066 Roadmovies I: Civil War
JOEL: "Wait! Wait! I need a quote." PRESIDENT: "Don't .. Don't let them kill me.." JOEL: "Yeah, that will do." (CIVIL WAR 2024)
Mit dieser Episode starten wir eigentlich eine neue Podcast-Reihe: Roadmovies! Ein Genre, das uns schon immer fasziniert hat. Dem wollen wir näher auf die Spur kommen, doch zunächst stellen wir einige Filme dieses Genres der letzten 4 Dekaden vor. Roadmovies erzählen Geschichten von äußeren und inneren Reisen, an denen die Charaktere wachsen. Sie werden oft episodenhaft erzählt, die sich an den einzelnen Stationen der Reise orientieren. Roadmovies entwickelten sich als Subgenre des Westerns und legten den Grundstein für New Hollywood. Als ersten Vertreter der neuen Reihe "Roadmovies" hat sich Flo einen aktuellen Film ausgesucht: "Civil War" aus dem Jahr 2024 unter der Regie von Alex Garland. Flo stellt den Briten Alex Garland mit einigen Eckdaten vor: bekannt geworden als Autor, erste Verbindungen zum Film mit Danny Boyles "The Beach", der Garlands Buch verfilmte. Weitere Zusammenarbeit mit Boyle, u.a. "28 Days Later", für den Alex Garland das Drehbuch schrieb. Erste eigene Regiearbeit mit "Ex machina" (2015). Es folgten einige Spielfilme und mit "Devs" (2021) eine Serienproduktion, in der auch Schauspieler:innen mitwirkten, mit denen Garland immer wieder zusammenarbeitet. "Civil War" ist eine Mischung aus Roadmovie und Kriegsfilm. Im Mittelpunkt stehen zwei Kriegsfotografinnen, die eine altgedient, die andere ganz jung. Der Film spielt in Amerika in einer dystopischen nahen Zukunft, in der Bürgerkrieg herrscht. Wir erzählen den Film ausführlich nach. Flo geht dann auf die Geschichte der Fotografie während des Amerikanischen Bürgerkriegs von 1861 bis 1865 ein und zeigt die technischen und kulturellen Entwicklungen in der Fotografie und wie diese das Verständnis und die Darstellung des Krieges beeinflusst haben. Während wir die Kernthesen von Garlands Werk erkunden, denken wir darüber nach, wie die Hauptfiguren die moralischen Herausforderungen und ethischen Implikationen transportieren, die mit dem Festhalten und Präsentieren von Wahrheit und Realität verbunden sind. Verbunden sind wir auch mit unserem Track, der Laufstrecke, die uns von der Jannowitzbrücke bis zur Landsberger Allee durch den Volkspark Friedrichshain geführt hat. Wir haben auf diesem Weg einige unserer Vorgänger-Episoden gekreuzt und das entsprechend kommentiert.
Shownotes
Links zur Laufstrecke
EGL066 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
Roadmovie – Wikipedia
Road movie - Wikipedia
Civil War (2024) – Wikipedia
Easy Rider – Wikipedia
Beatnik - Wikipedia
Roger Corman – Wikipedia
Die wilden Engel – Wikipedia
Jack Kerouac - Wikipedia
On the Road - Wikipedia
Wilde Erdbeeren – Wikipedia
Jean-Luc Godard – Wikipedia
Elf Uhr nachts – Wikipedia
Bonnie und Clyde (Film) – Wikipedia
Duell (Film) – Wikipedia
Steven Spielberg – Wikipedia
Wim Wenders – Wikipedia
Alice in den Städten – Wikipedia
Falsche Bewegung – Wikipedia
Im Lauf der Zeit – Wikipedia
Paris, Texas – Wikipedia
Mad Max – Wikipedia
Wild at Heart – Die Geschichte von Sailor und Lula – Wikipedia
David Lynch – Wikipedia
Nicolas Cage – Wikipedia
Laura Dern – Wikipedia
Blue Velvet (Film) – Wikipedia
Gus Van Sant – Wikipedia
My Private Idaho – Wikipedia
River Phoenix – Wikipedia
Wir können nicht anders – Wikipedia
Detlev Buck – Wikipedia
Knockin’ on Heaven’s Door (Film) – Wikipedia
Old Joy – Wikipedia
Kelly Reichardt – Wikipedia
Thelma & Louise – Wikipedia
Brad Pitt – Wikipedia
Little Miss Sunshine – Wikipedia
Import Export – Wikipedia
Ulrich Seidl – Wikipedia
Mad Max: Fury Road – Wikipedia
Tschick (Film) – Wikipedia
Drive My Car (Film) – Wikipedia
Ryūsuke Hamaguchi – Wikipedia
Drive (2011) – Wikipedia
Death Proof – Todsicher – Wikipedia
Lola rennt – Wikipedia
Victoria (2015) – Wikipedia
New Hollywood - Wikipedia
Charlie Chaplin – Wikipedia
Tramp – Wikipedia
Wilder Westen – Wikipedia
Alex Garland – Wikipedia
Ex Machina (Film) – Wikipedia
Auslöschung (Film) – Wikipedia
Devs – Wikipedia
Dredd – Wikipedia
Kowloon Walled City – Wikipedia
Der Strand – Wikipedia
The Beach – Wikipedia
Leonardo DiCaprio – Wikipedia
28 Days Later – Wikipedia
Kirsten Dunst – Wikipedia
Jesse Plemons – Wikipedia
Breaking Bad – Wikipedia
Cailee Spaeny – Wikipedia
Alien: Romulus – Wikipedia
Station Eleven (Fernsehserie) – Wikipedia
Alex Garlands Foto-Philosophie: CIVIL WAR – Kritik & Analyse
Civil War (2024) | Film, Trailer, Kritik
Kriegsfotografie – Wikipedia
Children of Men – Wikipedia
Sezessionskrieg – Wikipedia
Daguerreotypie – Wikipedia
Gutenberg-Bibel – Wikipedia
Frühe Kriegsfotografie: Den Toten in die Augen sehen - DER SPIEGEL
Kriegsmaler – Wikipedia
Mathew B. Brady – Wikipedia
Susan Sontag – Wikipedia
Kodak Nr. 1 – Wikipedia
How Kodak invented the “snapshot”
Geschichte und Entwicklung der Fotografie – Wikipedia
The Kodak Camera - Engineering and Technology History Wiki
Kodak – Wikipedia
Friedrich Kittler – Wikipedia
[ISEA97] | ISEA Symposium Archives
[ISEA97] Presentations | ISEA Symposium Archives
etoy (Künstler) – Wikipedia
PDF-Download - Kittler Friedrich GrammophonFilm Typewriter
Aufschreibesystem – Wikipedia
Mitwirkende
Florian Clauß
(Erzähler)
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Verwandte Episoden
EGL081 28 Years Later – Heart of Kindness: Eine Befreiung aus der deterministischen Apokalypse
Roadmovies
Das Genre des Roadmovies stellt ein zentrales Subgenre des modernen Kinos dar, welches sowohl narrative als auch philosophische Elemente miteinander verknüpft. Historisch betrachtet, etablierten sich Roadmovies in den 1960er Jahren als Gegenbewegung zu den rigiden Konventionen des klassischen Hollywood-Kinos sowie als Ausdruck des gesellschaftlichen Wandels dieser Ära. Filme wie „Easy Rider“ (1969) fungierten als Symbol dieses Aufbruchs, indem sie die Suche nach Freiheit und Individualität in den Vordergrund stellten.
Roadmovies sind durch eine episodische Erzählweise, weite Landschaftsaufnahmen sowie die symbolische Bedeutung von Straßen und Fahrzeugen gekennzeichnet. Inhaltlich kreisen Roadmovies um Fragen der Selbstfindung, Gesellschaftskritik sowie den Wunsch nach einem Ausbruch aus normativen Strukturen. Die Generierung von Spannung erfolgt dabei häufig durch Zufallsbegegnungen sowie den Umgang der Protagonisten mit fremden und oft feindseligen Umwelten. Das Genre markiert nicht nur einen Wechsel der filmischen Ästhetik, sondern auch einen sozialen Kommentar, mit dem der sogenannte „American Dream“ hinterfragt und kritisch reflektiert wird.
Alex Garland und Civil War
Alex Garland hat sich in den vergangenen Jahren als eine der bedeutende Stimmen des modernen Kinos etabliert. Garland ist insbesondere für seine Filme „Ex Machina“ (2014) und „Annihilation“ (2018) bekannt, in denen er wiederholt Genregrenzen überschreitet und psychologische, philosophische sowie technologische Themen verwebt. Seine Werke loten die versteckten Abgründe der menschlichen Natur aus und zeichnen sich durch eine präzise visuelle Gestaltung sowie eine tiefgründige thematische Komplexität aus.
Mit „Civil War“ (2024) hat Garland einen weiteren bemerkenswerten Beitrag geleistet, indem er Elemente des Roadmovies mit denen des Kriegsfilms kombiniert. In seiner Herangehensweise bleibt Garland unkonventionell. Anstatt sich allein auf monumentale Schlachten oder militärische Strategien zu konzentrieren, integriert er die Dynamik eines Bürgerkrieges in die individuellen Erfahrungen von Leid und die Suche nach Identität. Diese Vorgehensweise verleiht dem Film „Civil War“ einen erzählerischen Reichtum, der sowohl universelle als auch persönliche Perspektiven in den Vordergrund rückt.
Der Film „Civil War“ spielt vor dem Hintergrund eines fiktiven Bürgerkriegs in den Vereinigten Staaten, wobei die Straßen des Landes sowohl Schauplatz als auch Metapher sind. Der Film folgt der Protagonistin Jessie, einer Kriegsfotografin, deren Reise sowohl geografisch als auch emotional geprägt ist. Während ihrer Odyssee durch die verschiedenen Konfliktzonen des Landes dokumentiert sie unermüdlich die Schrecken des Krieges, ohne dabei eine sichtbare politische oder moralische Position einzunehmen. Die Kamera fungiert für Jessie sowohl als Schutzschild als auch als Kompass.
Der dramaturgische Höhepunkt des Films entfaltet sich im Weißen Haus, wo die Grenzen zwischen Beobachtender und Akteurin verschwimmen. Die Szene vor dem Oval Office, in der Jessie den Tod ihrer Mentorin Lee und die Erschießung des Präsidenten fotografisch festhält, kann als eindringliches Beispiel für die Verschmelzung von Waffe und Kamera betrachtet werden. Diese Inszenierung wirft nicht nur die Frage auf, welche Rolle die Fotografie im Krieg spielt, sondern symbolisiert auch das „totale Aufgehen“ der Protagonistin in ihrer Profession. Dieser Aspekt zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Genre des Films.
Medien und Krieg im Diskurs
Ein wesentlicher Aspekt von „Civil War“ ist die Fokussierung auf das Thema Kriegsfotografie. Seit ihren ersten Einsätzen während des Amerikanischen Bürgerkriegs in den 1860er Jahren hat die Fotografie eine Schlüsselrolle bei der Dokumentation militärischer Konflikte eingenommen. Erstmals wurde die Kamera von Fotografen wie Mathew Brady eingesetzt, um das Grauen und die menschlichen Kosten des Krieges visuell festzuhalten. Die Bilder offenbarten der zivilen Bevölkerung ungeschönt die Brutalität des Konflikts und führten zu einer Reflexion über die ethischen Implikationen der Rolle der Medien in Kriegszeiten.
In ihrem wegweisenden Werk „Regarding the Pain of Others“ (2003) analysiert Susan Sontag die vielschichtige Wirkungskraft der Kriegsfotografie. Sontag postuliert, dass Bilder sowohl Mitleid erregen als auch abstumpfen können, da sie die Gewalt ästhetisieren und zugleich Distanz schaffen. Diese Ambivalenz findet sich auch in „Civil War“ wieder: Während Jessies Dokumentation zunächst als Akt der Wahrheitsfindung betrachtet werden kann, entwickelt sie sich zunehmend zu einem Mittel der Verstrickung in die Gewalt. Die Frage, ob eine Trennung zwischen aktivem und beobachtendem Handeln möglich ist, wird in der Figur der Jessie auf philosophischer sowie filmischer Ebene erörtert.
Die Analyse von Friedrich Kittler, einem einflussreichen Medientheoretiker des 20. Jahrhunderts, der sich mit den Technologien der Wahrnehmung und Aufschreibesysteme auseinandersetzt, kann einen Blickwinkel zur Interpretation von „Civil War“ bieten: Kittlers Konzept, dem zufolge Medien nicht nur Informationen übertragen, sondern auch die Art und Weise beeinflussen, wie wir die Realität wahrnehmen und selbst zu Handelnden werden, stellt ein wertvolles analytisches Werkzeug dar. Im Film „Civil War“ verschmelzen Kamera und Handlungsträger miteinander, sodass eine klare Trennung zwischen dokumentarischem Akt und gewaltsamer Interaktion nicht mehr möglich ist.
In seiner künstlerischen Praxis thematisiert Garland den hier beschriebenen Ansatz, indem er das Instrument der Kamera als zugleich beobachtenden und agierenden Akteur darstellt. Die Fotografien von Jessie sind nicht lediglich passive Dokumentationen, sondern vielmehr aktive Eingriffe in die Logik des Krieges. Die Kamera fungiert folglich als technologisches Medium, welches Macht definiert, indem es Entscheidungen darüber trifft, welche Elemente des Geschehens sichtbar und unsichtbar sind.
Mit „Civil War“ gelingt Alex Garland eine bemerkenswerte Synthese aus Roadmovie und Kriegsfilm. Der Film nutzt die visuellen und erzählerischen Elemente des Roadmovies, um eine Reise durch die emotionale und geografische Landschaft eines fiktiven Bürgerkriegs zu gestalten. Gleichzeitig werden existenzielle Fragen zur Rolle von Medien, Technologie und der Bilderproduktion im Kontext von Gewalt aufgeworfen.

Nov 21, 2024 • 55min
EGL065 Reform der Psychotherapie-Weiterbildung: Symptomverschiebung und Spaltung
"Die Einnahmen der Weiterbildungsstätten (...) decken die Kosten (...) nicht. Deshalb muss zusätzlich zur Leistungsvergütung eine Förderung gesetzlich geregelt werden." (Munz, Klein-Heßling, Seela In: 2/2023 Psychotherapeutenjournal S. 147ff)
Mit der Einführung der neuen Weiterbildungsordnung (WBO) im Jahr 2020 wurde ein Reformvorhaben angestoßen, das die Weiterbildung in Deutschland an veränderte Versorgungsbedarfe anpassen und zugleich die Qualität und Einheitlichkeit der Ausbildung verbessern soll. Doch war und ist die Finanzierung nicht geklärt. Das hat einen besonders dramatischen Einfluss auf den Bereich der Psychotherapie. Zu wenige Ausbildungsstätten beantragen die Befugnis nach der neuen Weiterbildungsordnung, um Psychotherapeut:innen auszubilden. Dies liegt vor allem daran, dass die entstehenden Kosten sich für Institute nicht rechnen. Die neue Regelung orientiert sich an der ärztlichen Ausbildung in Kliniken, die ärztliche Kandidat:innen in Weiterbildung mit einem tarifgebundenen Gehalt anstellen und entsprechenden Behandlungsräume versorgen können. Das lässt sich auf die psychologischen Psychotherapeut:innen nicht so einfach ummünzen. Diese nach Tarif anzustellen und individuelle Behandlungsräume anzumieten ist nach der WBO die Vorgabe (und sicherlich eine großartige Idee), aber Institute sind anders aufgestellt als Kliniken und können das nicht finanzieren. Somit ist die Finanzierungslücke nicht gelöst, sondern verschoben. Wir sprechen in der Psychotherapie von einer Symptomverschiebung. Während wir im Prenzlauer Berg Park beim Laufen reden und laufend reden, reflektieren wir die Hintergründe und möglichen Folgen der neuen WBO.
Shownotes
Link/s zur Laufstrecke
EGL065 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
Gleichstellung von Psychologischen mit ärztlichen Psychotherapeuten durch zwei Sozialgerichtsurteile bestätigt | Psychotherapeutenkammer Berlin
Bund, Länder und Kommunen | 24 x Deutschland | bpb.de
2019: Deutscher Bundestag - Bundestag reformiert die Ausbildung der Psychotherapeuten
Die neue Weiterbildung von Psychotherapeut*innen: Grundlagen, Chancen und Herausforderungen. In: 2/2023 Psychotherapeutenjournal
Dokumente und Regelungen der Weiterbildung, die nach dem Psychotherapeutengesetz vom 15. November 2019 (BGBl. I S. 1604), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) | Psychotherapeutenkammer Berlin
Neue Weiterbildungsordnung von 2021 | Ärztekammer Berlin
LdN402 Psychotherapeut:innen-Nachwuchs in der Warteschleife, Waffenlieferungen an Israel, Kürzungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk (Stefan Niggemeier, Übermedien), Russlands Krieg gegen Deutschland, Klimaschutz durch neue StVO, Social Leasing von E-Autos, Rechtsextremismus an Schulen, Feedback Dänemarks Migrationspolitik – Lage der Nation
Volkspark Prenzlauer Berg
Das gespaltene Subjekt nach Lacan
Mitwirkende
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Der höchste Hügel im Volkspark Prenzlauer Berg ist nicht, wie von mir behauptet, 92 m hoch, sondern „an seiner höchsten Stelle (genannt: ‚Pappelplateau‘) 90,9 m ü. NHN[1] hoch“ — weiß Wikipedia. Schlimmer noch: der Hügel auf dem ich das sagte „heißt zwar ‚Hohes Plateau‘ und auf einer steinernen Markierung steht, er sei ‚die höchste Erhebung in Prenzlauer Berg‘, was aber ungenau ist. Denn nach Vermessungen in den 1990er Jahren ist er nur 89 m hoch“. So ist das mit den Fakten, wenn man beim Laufen redet. Wir geben uns aber große Mühe.
In dieser Episode geht es um die neue Weiterbildungsordnung (WBO), eingeführt 2020, und speziell die Auswirkungen auf die Weiterbildung für die ambulante Psychotherapie. Ziel der WBO sei es, die Qualität der Weiterbildung zu erhöhen und die Vereinheitlichung zwischen ärztlicher und psychologischer Ausbildung zu fördern. Doch die Umsetzung bringt für Psychotherapeut:innen in Weiterbildung (PiW) erhebliche Herausforderungen mit sich, die sich bei den ärztlichen und psychologischen Ausbildungswegen teils deutlich unterscheiden.
Insofern sind wir im Volkspark Prenzlauer Berg an einem passenden Ort, dessen beide Hügel vielleicht ja für die betroffenen Psycholog:innen und Ärzt:innen stehen könnten. Oder für die Psychodynamik des gespaltenen Subjekts nach Lacan, der eine Hügel gepflegt und begehbar, der andere verwildert und … naja, eben das hier: der Andere in uns.
Symptomverschiebung: Finanzierungslücke nicht gelöst nur verschoben
Die Weiterbildung zur ambulanten Psychotherapie ist besonders für psychologische PiW mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Im Gegensatz zu angestellten ärztlichen Weiterbildungsassistent:innen können die Praxen und Institute für die Psycholog:innen die Kosten für eine tarifgebundene Anstellung nicht tragen. Diese Realität untergräbt ein Ziel der neuen WBO: die Ausbildung psychologischer Psychotherapeut:innen war teuer und die gesetzlich notwendige Tätigkeit in Psychiatrischen und therapeutischen Institutionen wurde früher oft nur symbolisch entlohnt. Es handelte sich also um eine kostspielige und prekäre Ausbildung.
Dies sollte im Sinne der werdenden Psychotherapeut:innen durch die Festanstellung gelöst werden. Doch in der Praxis verschiebt sich die Finanzierungslücke nur. Praxen und Institute können die Kosten nicht stemmen. Wo soll das Geld herkommen? Früher, nach der alten WBO, konnten die PiAs (Psychotherapeut:innen in Ausbildung) auf eine bessere Zukunft hoffen und die aufgenommen Kredite waren eine Form von unternehmerischen Risiko. Diese mögliche Zukunft gibt es für Institute nicht. Die Weiterbildungsinstitute können kein unternehmerisches Risiko aufnehmen, weil sie auch in der Zukunft keine zusätzlichen Einnahmen haben werden. Was bleibt ist die Unterdeckung für jede:n Kandidat:in.
Entsteht eine Kluft zwischen ärztlicher und psychologischer Weiterbildung?
Nach der neuen Weiterbildungsordnung (WBO) könnten sich die Strukturen von psychologischen und ärztlichen Weiterbildungen weiter voneinander entfernen, was auf verschiedene rechtliche, organisatorische und berufspolitische Unterschiede zurückzuführen ist. Obwohl psychologische Psychotherapeut:innen und Fachärzt:innen für Psychiatrie und Psychotherapie formal gleichgestellt sind, bestehen Unterschiede, die eine vollständige Angleichung in der Praxis erschweren.
Spaltung: die Wege der Psycholog:innen und Ärzt:innen trennen sich
Die neue WBO ist noch ganz frisch und wird langsam ausgerollt. Aber es zeigt sich, dass die Weiterbildung strukturell eine Trennung von psychologischen Psychotherapeut:innen und Ärzt:innen bewirken könnte. Obwohl psychologische Psychotherapeut:innen und Fachärzt:innen für Psychiatrie und Psychotherapie formal gleichgestellt sind, bestehen Unterschiede, die eine vollständige Angleichung in der Praxis erschweren.
Institutionelle Trennung: Psychologische Weiterbildungen werden primär von universitären oder freien Ausbildungsinstituten organisiert, während die ärztliche Weiterbildung in Kliniken, Ambulanzen und teilweise in Lehrpraxen erfolgt. Diese institutionelle Trennung könnte durch die neue WBO zementiert werden, da die jeweiligen Organisationen für ihre Berufsgruppen spezifische Anforderungen und Curricula entwickeln.
Ambulante Weiterbildung: Ärztliche Weiterbildungsassistent:innen für Psychotherapie absolvieren ambulante Weiterbildungsanteile nach der neuen WBO zwingend in Praxen unter Supervision von Fachärzt:innen. Psychologische PiW hingegen sind meist auf psychotherapeutische Ambulanzen oder spezielle Ausbildungsinstitute angewiesen. Dieser Unterschied spiegelt die getrennten Versorgungsstrukturen wider.
Die neue WBO hat also das Potenzial, die Schere zwischen psychologischen und ärztlichen Weiterbildungsstrukturen zu vergrößern. Trotz formaler Gleichstellung bleiben Unterschiede in der Kompetenzverteilung und den Versorgungsstrukturen bestehen. Eine stärkere Integration – etwa durch gemeinsame Weiterbildungsmodelle oder abgestimmte ambulante Ausbildungsstrukturen – könnte langfristig die Trennung abbauen.
Mit diesen Gedanken verlassen wir die beiden Hügel im Park und beenden diese Episode im nahegelegenen Fennpfuhlpark. Es ist dunkel geworden.

Nov 7, 2024 • 1h 13min
EGL064 Durch den dunklen Wald: Eine Reise in die Tiefen von Hänsel und Gretel
„knuper, knuper, kneischen! wer knupert an meinem Häuschen!“
Diese Märchenfolge von Eigentlich Podcast möchten wir direkt am eigenen Leib erfahren und begeben uns in den tiefen finsteren Grunewald, während wir zu den künstlich generierten Stimmen mit amerikanischem Akzent lauschen, die uns das Märchen von "Hänsel und Gretel" vorlesen. Im Dunkeln und ganz ohne Taschenlampe analysieren wir das Märchen aus verschiedenen Blickwinkeln und arbeiten die "Glutkerne" des Märchens heraus, die von rituellem Kannibalismus, Hungersnöten und Kindesvertreibungen handeln. Wir loben die kooperativen Geschwister als Helden der Geschichte, finden Analogien zwischen der Hexe und der Mutter und fragen uns, warum die Hexe ihren Kalorienbedarf mit Menschenfleisch decken möchte, wenn doch das Lebkuchenhaus mehr als ausreichend die Energie liefern sollte. Flo stellt noch seine astronomische Deutung von Hänsel und Gretel vor: Hans versteht sich ganz in der Navigation nach den Sternen und weiß, wo er den Fixstern findet und sich dann an den Sternbilden orientieren kann (Kinder finden das erste Mal nach Hause zurück, weil sie zuvor den Weg mit weißen Steinchen markiert haben). Er macht aber schlechte Erfahrungen, wenn er sich an flüchtigen Himmelsereignissen orientieren möchte, wie Sternschnuppen (Beim zweiten Mal, als Hänsel und Gretel in den dunklen Wald geführt werden, markieren sie den Weg mit Brotkrumen, die die Vögel verspeisen). Wir bemühen uns um eine tiefenpsychologische Interpretation der sexuellen Aspekte des Märchens wie der Backofen als invertierter Mutterleib oder das "Fingerchen" von Hans, das nicht größer werden will. Am Ende und kurz vor der Avus kommen wir noch auf das Filmgenre "Coming-of-Age" zu sprechen, das, wie auch bei Hänsel und Gretel, Geschichten erzählt, die von dem Übergang von der Kindheit zum Erwachsensein handeln.
Shownotes
Links zur Laufstrecke
EGL064 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
https://de.wikipedia.org/wiki/Hänsel_und_Gretel
https://de.wikisource.org/wiki/Hänsel_und_Gretel_(1812)
https://de.wikisource.org/wiki/H%C3%A4nsel_und_Grethel_(1857)
https://de.wikisource.org/wiki/Kinder-_und_Haus-M%C3%A4rchen_Band_3_(1856)/Anmerkungen#15
https://de.wikipedia.org/wiki/Grimms_M%C3%A4rchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Grimm
https://de.wikipedia.org/wiki/Jacob_Grimm
https://de.wikisource.org/wiki/Rothk%C3%A4ppchen_(1812)
https://de.wikisource.org/wiki/Sneewittchen_(Schneewei%C3%9Fchen)_(1812)
https://platform.openai.com/docs/guides/text-to-speech/overview
https://izi.br.de/deutsch/publikation/televizion/29_2016_1/Wilkes_Was_Maerchen_zur_psychischen_Gesundheit.pdf
https://www.stern.de/familie/maerchen--was-steckt-hinter-dem-maerchen-haensel-und-gretel--8616894.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/verarbeitung-von-grauenhaften-menschheitserfahrungen-100.html
https://www.srf.ch/audio/reflexe/was-maerchen-wirklich-erzaehlen?id=10250802
https://www.youtube.com/watch?v=2JidaOO2Fds
https://www.newgrounds.com/portal/view/515322
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedhof_Grunewald-Forst
https://de.wikipedia.org/wiki/Struwwelpeter
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hoffmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Bechstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Astronomie
https://de.wikipedia.org/wiki/Tycho_Brahe
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler
https://de.wikipedia.org/wiki/Zodiak
https://de.wikipedia.org/wiki/Kannibalismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Inzest
https://de.wikipedia.org/wiki/Batzen
https://de.wikipedia.org/wiki/Gretel_%26_H%C3%A4nsel
https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Moers
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_13%C2%BD_Leben_des_K%C3%A4pt%E2%80%99n_Blaub%C3%A4r
https://www.ardmediathek.de/video/br-retro/die-wahrheit-ueber-haensel-und-gretel/br/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzg1OWQwNTg3LTZiZGYtNDQ5Ni05MmY4LTU3MzJlNmE2YTFiNg
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Traxler
https://en.wikipedia.org/wiki/Coming_of_age
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_coming-of-age_stories
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferris_macht_blau
https://de.wikipedia.org/wiki/The_Breakfast_Club
https://de.wikipedia.org/wiki/My_Private_Idaho
https://de.wikipedia.org/wiki/Kids_(Film)
Gummo – Wikipedia
Ghost World – Wikipedia
Call Me by Your Name – Wikipedia
Aftersun (2022) – Wikipedia
Mitwirkende
Florian Clauß
(Erzähler)
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Das Märchen „Hänsel und Gretel“ der Brüder Grimm gehört zu den bekanntesten und verbreitesten Erzählungen der europäischen Volksliteratur. Seine Ursprünge reichen weit in die Vergangenheit zurück und spiegeln uralte menschliche Erfahrungen und Ängste wider. Die Geschichte der beiden Geschwister, die von ihren Eltern im Wald ausgesetzt werden und sich gegen eine kannibalistische Hexe behaupten müssen, hat über Jahrhunderte hinweg Generationen von Zuhörern und Lesern in ihren Bann gezogen. Dabei ist es gerade die Vielschichtigkeit des Märchens, die es für Interpretationen so ergiebig macht und seine anhaltende Relevanz erklärt.
Ein zentrales Motiv des Märchens ist der Konflikt zwischen Hunger und Überfluss, der sich durch die Erzählung zieht. Die extreme Armut der Holzhackerfamilie zu Beginn steht in krassem Gegensatz zum verlockenden Überfluss des Lebkuchenhauses. Dieser Kontrast spiegelt historische Realitäten wider, insbesondere die Erfahrungen von Hungersnöten, die zur Entstehungszeit des Märchens keine Seltenheit waren. Die kannibalistische Hexe kann in diesem Kontext als Personifizierung der existenziellen Bedrohung durch den Hunger verstanden werden. Gleichzeitig lässt sich das Motiv des Kannibalismus als Ausdruck eines „Glutkerns“ interpretieren, wie ihn der Literaturwissenschaftler Michael Maar beschreibt – ein traumatisches Ereignis aus der Menschheitsgeschichte, das im Märchen verarbeitet und durch die fantastische Erzählung abgemildert wird.
Die Figur der Hexe ist besonders vielschichtig und lädt zu verschiedenen Deutungen ein. In psychoanalytischer Perspektive kann sie als Verkörperung der „bösen Mutter“ oder als Aspekt der ambivalenten Mutterfigur gesehen werden. Feministisch orientierte Interpretationen sehen in ihr ein verzerrtes Bild weiblicher Macht, das patriarchale Ängste widerspiegelt. Kulturhistorisch betrachtet, lässt sich die Hexenfigur mit der Geschichte der Hexenverfolgungen in Verbindung bringen, die zur Entstehungszeit des Märchens noch präsent war. Die Überwindung der Hexe durch die Kinder, insbesondere durch Gretel, die am Ende zur aktiven Retterin wird, kann als Emanzipationsgeschichte gelesen werden.
Die Entwicklung der Kinder im Verlauf der Geschichte macht „Hänsel und Gretel“ zu einem klassischen Beispiel für ein Coming-of-Age-Narrativ. Die Protagonisten durchlaufen einen Reifeprozess, in dem sie lernen, Gefahren einzuschätzen, kreative Lösungen zu finden und selbstständig zu handeln. Dieser Aspekt macht das Märchen auch für die heutige Zeit relevant, da es grundlegende Fragen der Identitätsfindung und des Erwachsenwerdens behandelt. Die gegenseitige Unterstützung der Geschwister unterstreicht dabei die Bedeutung von Solidarität und familiärem Zusammenhalt in Krisensituationen.
Aus einer mem-theoretischen Perspektive lässt sich der anhaltende Erfolg von „Hänsel und Gretel“ durch die Kombination einprägsamer Motive erklären. Das Lebkuchenhaus, die Brotkrümelspur oder der vorgestreckte Knochen sind bildhafte Elemente, die sich leicht merken und weitergeben lassen. Sie funktionieren als kulturelle Replikatoren, die zur Verbreitung und Langlebigkeit des Märchens beitragen. Gleichzeitig ermöglicht die Struktur des Märchens lokale Anpassungen und Variationen, was seine Verbreitung in verschiedenen kulturellen Kontexten begünstigt.
In der pädagogischen und therapeutischen Praxis bietet „Hänsel und Gretel“ vielfältige Anknüpfungspunkte. Die Geschichte kann als Ausgangspunkt dienen, um mit Kindern über den Umgang mit Fremden, die Bewältigung von Ängsten oder ethische Fragen zu sprechen. In der Psychotherapie, insbesondere im Psychodrama, werden Elemente des Märchens genutzt, um Zugang zu unbewussten Konflikten zu finden und Lösungsansätze zu entwickeln. Die archetypischen Figuren und Situationen des Märchens bieten einen Resonanzraum für individuelle Erfahrungen und können so zur Verarbeitung persönlicher Themen beitragen.

Oct 24, 2024 • 1h 13min
EGL063 Psychosen, UFOs, Archetypen: C.G. Jung über Außerirdische und das kollektive Unbewusste
"Ich bin ein Empiriker, der sich innerhalb der ihm gesetzten erkenntnistheoretischen Grenzen hält." C.G. Jung, 1985
Drei Jahre vor seinem Tod veröffentlichte Carl Gustav Jung 1958 ein kleines Büchlein über UFOs: "Ein moderner Mythus". Jung war zu diesem Zeitpunkt über 80 Jahre alt. Man könnte also vom Spätwerk des Schweizer Arztes und Psychoanalytikers sprechen, dem wir diese Episode widmen. Aus der Vogelperspektive betrachtet, befasst sich dieses Buch mit dem UFO-Phänomen aus einer psychologischen Perspektive und stellt die Frage, ob es sich bei den Sichtungen um reale Objekte oder symbolische Projektionen des kollektiven Unbewussten handelt. Doch wir wählen den Weg durch das Unterholz und folgen einer Spur von Zitaten über fliegende Untertassen, Archetypen, atomare Bedrohung, Parapsychologie und kollektive Visionen, um schließlich bei einem Gedankengebäude anzukommen, das – wie ein Vexierbild – je nach Blickwinkel naturwissenschaftliches Forschungsinstitut oder okkulter Tempel sein könnte. C.G. Jung erscheint als gespaltenes Selbst: In ihm leben naturwissenschaftliche Ansprüche und metaphysische Überzeugungen konfliktfrei zusammen, ohne den Widerspruch auszulösen, den viele Leser:innen bei der Lektüre verspüren müssten. Und vielleicht ist es ja wirklich das Spätwerk Jungs, in dem er die UFOs als Korrektiv nutzt, das sein Konzept der Archetypen zukunftsfähig macht?
Mitwirkende
Micz Flor
(Erzähler)
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Verwandte Episoden
EGL080 Chaosmagie und Psychotherapie: wissenschaftlicher Anspruch trifft magische Wirkmacht
Unsere Tour führt uns an einem Herbstabend aus dem beleuchteten Charlottenburg über den Halensee bis in die Dunkelheit des Grunewald. Ein passendes Gegensatzpaar zu unserem Gespräch, das vom hellen Schein der Vernunft bin in die unergründlichen Schatten des Unbewussten reicht. Für Flo jedoch beginnt die Tour im Dunkeln. Er weiß nicht, was Micz vorbereitet hat und startet gewissermaßen im Grunewald. Gegenstand der Episode sind Carl Gustav Jungs Texte über UFO-Sichtungen, erstmals 1958 als Broschüre bei Rascher in Zürich erschienen. Die Seitenzahlen der Zitate stammen allerdings aus der Veröffentlichung Geheimnisvolles am Horizont (Von Ufos und Außerirdischen) von 1992, die Micz für diese Episode durchgearbeitet hat (s.a. Literaturverzeichnis).
Die Folge beginnt mit einer Reihe von Zitaten, zu denen Flo seine Reaktionen schildert, ohne die Quellen zu kennen. Für alle anderen, die wissen, worum es geht, sind hier die Zitate aus der Episode noch einmal mit Quellenangaben aufgeführt.
C.G. Jung zwischen den Welten der Naturwissenschaft und Metaphysik
Anders als in der Episode, möchte ich hier eine Fußnote vornean stellen, die die Bühne für alle weiteren Überlegungen darstellt:
(Fußnote:) “Es ist ein geläufiges und durch nichts gerechtfertigtes Mißverständnis bei naturwissenschaftlich Gebildeten, daß ich die psychischen Hintergründe als «metaphysische» verstehe, während umgekehrt mir die Theologen vorwerfen, daß ich die Metaphysik «psychologisiere». Beide treffen daneben. Ich bin ein Empiriker, der sich innerhalb der ihm gesetzten erkenntnistheoretischen Grenzen hält.”(Jung, 1958/1992, S. 33)
Jung stellt sich also als falsch verstanden dar – sowohl von Naturwissenschaftler:innen, als auch Theolog:innen. Er sei Empiriker ist seine Antwort an beide Parteien. Wer geneigt ist ihn deshalb einem eher naturwissenschaftlichen Denken zuzuordnen, wird unweigerlich beim Lesen des Büchleins über Mutmaßungen, Erfahrungen und Feststellungen stolpern, die so gar nicht naturwissenschaftlich anmuten, sondern der Astrologie, Parapsychologie und spiritistischen Sitzungen entstammen. Jung bleibt uns in dieser Schrift eine Antwort schuldig, auf wessen Grund er sein Gedankengebäude errichtet hat. Mit dem obigen Zitat sagt er uns weder wo er sich sieht, noch erfahren wir, wo er sich nicht verortet. Es bleibt unklar, ob er sich zwischen diesen Welten, in der Schnittmenge beider oder an einem ganz anderen, dritten Ort sieht.
Jung verbindet die UFO-Sichtungen mit dem Beginn des Wassermannzeitalters (Age of Aquarius)
Im ersten Zitat (nicht das erste aus dem Buch, aber aus dramaturgischen Gründen in der Episode nach vorne gezogen) erfahren wir, dass der vorliegende Text scheinbar nicht nur Beruf, sondern auch Berufung des analytischen Psychologen berührt. Mit schwerem Herzen stellt er uns seine Theorien zum Phänomen der UFO-Sichtungen vor. Er hofft vermeiden zu können, dass Menschen “unvorbereitet von den Ereignissen überrascht werden und ahnungslos deren Unfaßbarkeit ausgeliefert sind”.
“Es wäre leichtsinnig von mir, meinem Leser verheimlichen zu wollen, daß dergleichen Überlegungen nicht nur äußerst unpopulär sind, sondern sich sogar in bedrohlichster Nähe jener wolkigen Phantasmas bewegen, die das Gehirn von Zeichendeutern und Weltverbesserern beschatten. Ich muß das Risiko auf mich nehmen und meinen mühsam erkämpften Ruf der Wahrhaftigkeit, der Vertrauenswürdigkeit und der wissenschaftlichen Urteilsfähigkeit aufs Spiel setzen. Es geschieht dies, wie ich meinen Lesern versichern kann, nicht leichten Herzens. Ich bin, aufrichtig gesagt, bekümmert um das Los derer, die unvorbereitet von den Ereignissen überrascht werden und ahnungslos deren Unfaßbarkeit ausgeliefert sind.”(Jung, 1958/1992, S. 10)
Eine erste Fährte hinein in Jungs Gedankengebäude einer Psychodynamik, die individuelles und kollektives Unbewusstes kennt, erfahren wir schon vorher im Buch (siehe folgendes Zitat). Das Phänomen soll nicht “im Subjektiven befangen” bleiben. Wir werden also Jungs Konzept der Archetypen im Verlauf besser kennenlernen.
“Es ist schwierig, die Tragweite zeitgenössischer Ereignisse richtig einzuschätzen, und die Gefahr, daß das Urteil im Subjektiven befangen bleibt, ist groß. Ich bin mir daher des Wagnisses bewußt, wenn ich mich anschicke, denen, die mich geduldig anhören wollen, meine Auffassung von gewissen zeitgenössischen Ereignissen, die mir bedeutend erscheinen, mitzuteilen. Es handelt sich um jene Kunde, die uns von allen Ecken der Erde erreicht, jenes Gerücht von runden Körpern, die unsere Tropo- wie Stratosphäre durchstreifen, genannt «saucers, Teller, soucoupes, disks und Ufos» (Unidentified Flying Objects).”(Jung, 1958/1992, S. 9)
Auf der gleichen Seite beginnt Jung Verbindungen zwischen Sternen, UFOs und Jesus zu schaffen. So würden wir uns “am Ende eines Platonischen Monats und zu Anfang des nachfolgenden” befinden. Gemeint ist der Übergang vom Zeitalters des Sternzeichen “Pisces”, dessen Beginn mit der Geburt von Jesus zusammenfalle, und dem kommenden Zeitalter des Wassermanns (“Age of Aquarius”). Damals sahen die Menschen den Stern über Bethlehem. Jetzt sehen Menschen auf der ganzen Welt UFOs. Jung suggeriert, dass die UFO-Sichtungen sich als ähnlich bedeutsam herausstellen könnten, wie das Christentum.
Diese Annahme erlaubt ihm im aufgespannten Netz von Sternzeichen, Jesus’ Geburt und UFO-Sichtungen seine Archetypen im Himmel wie auf Erden zu verankern. Denn – so Jung – “Veränderungen in der Konstellation der psychischen Dominanten, der Archetypen, der «Götter», welche säkulare Wandlungen der kollektiven Psyche verursachen”
Jung erklärt damit, dass Archetypen nicht festgeschrieben sind, sondern sich (mit dem Wandel der Mythen und Symbole) wandeln können. Das stellt gewissermaßen eine Fortführung des Gleichen in neuem (besser: wandelndem) Gewand dar. So erlegt er zwei Fliegen in einem Streich: nur so kann er die Erscheinung der UFOs durch Kollektivvisionen erklären. Und zweitens sichert er so in diesem Spätwerk seiner Theorie der Archetypen eine Zukunft, da deren Wandlung somit auch zukünftige Technologien und Dingen umfassen und beinhalten (hier z.B. fliegende Untertassen).
“Es ist keine Anmaßung, die mich treibt, sondern mein ärztliches Gewissen, das mir rät, meine Pflicht zu erfüllen, um die Wenigen, denen ich mich vernehmbar machen kann, vorzubereiten, daß der Menschheit Ereignisse warten, welche dem Ende eines Äon entsprechen. Wie wir schon aus der altägyptischen Geschichte wissen, sind es psychische Wandlungsphänomene, die jeweils am Ende eines Platonischen Monats und zu Anfang des nachfolgenden auftreten. Es sind, wie es scheint, Veränderungen in der Konstellation der psychischen Dominanten, der Archetypen, der «Götter», welche säkulare Wandlungen der kollektiven Psyche verursachen oder begleiten. Diese Wandlung hat innerhalb geschichtlicher Tradition angehoben und ihre Spuren hinterlassen, zunächst im Übergang des Stierzeitalters zu dem des Aries [Widder], sodann vom Zeitalter des Aries zu dem der Pisces [Fische], dessen Anfang mit der Entstehung des Christentums zusammenfällt. Wir nähern uns jetzt der großen Veränderung, die mir dem Eintritt des Frühlingspunktes in Aquarius [Wassermann] erwartet werden darf.”(Jung, 1958/1992, S. 9f.)
Die “Wandlungen der kollektiven Psyche”, die mit Archetypen und auch individuellen Unbewussten Inhalten in Verbindung stehen, formuliert er auch noch an andere Stelle:
“Es liegt hier wohl ein Beispiel von Modifikation älterer Tradition durch neueren Erkenntniszuwachs vor, also einer Beeinflussung urtümlicher Verbildlichung durch rezente Erwerbungen des Bewußtseins, wie die in moderner Zeit häufigen Ersetzungen der Tiere und Monstren durch Automobile und Flugzeuge in Träumen.”(Jung, 1958/1992, S. 43)
UFOs Mitte des 20ten Jahunderts
Wann wurden die ersten UFOs gesichtet und als solche benannt? Kann es sein, dass Lebewesen von der Venus oder Mars aufgrund der Atombomben Angst vor den Terrestrier:innen bekamen?
“Den Auftakt zu den Ufos bildeten die in den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges gemachten Beobachtungen geheimnisvoller Geschosse über Schweden, deren Erfindung man den Russen zuschob, und die Berichte über «Foo fighters», das heißt Lichter, welche die alliierten Bomber über Deutschland begleiteten (foo = feu). Darauf folgten dann die abenteuerlichen Beobachtungen von «flying saucers» in USA. Die Unmöglichkeit, eine irdische Basis für die Ufos zu finden und ihre physikalischen Eigenschaften zu erklären, führte dann bald zur Vermutung eines extraterretrischen Ursprungs.”(Jung, 1958/1992, S. 14–15)
“Die neueren atomischen Explosionen auf der Erde – so wird vermutet – hätten die Aufmerksamkeit dieser so viel weiter fortgeschrittenen Mars- oder Venusbewohner erregt und Besorgnisse hinsichtlich möglicher Kettenreaktionen und der damit verbundenen Zerstörung der Erde wachgerufen. Da eine derartige Möglichkeit auch eine katastrophale Bedrohung unserer Nachbarplaneten bedeuten würde, so sähen sich deren Bewohner veranlaßt, die Entwicklung der Dinge auf der Erde sorgfältig zu beobachten, in voller Erkenntnis der ungeheuren Gefahr, welche unsere täppischen Nuklearversuche verursachen könnten.”(Jung, 1958/1992, S. 22)
UFOs sind die Projektion unbewusster, kollektiver Inhalte
“Wenn der Archetypus durch die Zeitumstände und die psychische Gesamtlage eine zusätzliche energetische Ladung erhält, so kann er aus angedeuteten Gründen nicht direkt ins Bewußtsein integriert werden. Er wird vielmehr dazu gezwungen, sich indirekt in Form einer spontanen Projektion zu manifestieren. Das projizierte Bild erscheint dann als ein von der individuellen Psyche und deren Beschaffenheit unabhängiges, scheinbar physisches Faktum: die runde Ganzheit des Mandalas wird zu einem von intelligenten Wesen gesteuerten Weltraumfahrzeug.”(Jung, 1958/1992, S. 41)
“Beim Individuum kommen derartige Erscheinungen, wie abnorme Überzeugungen, Visionen, Illusionen usw., ebenfalls nur dann vor, wenn es psychisch dissoziiert ist, das heißt wenn eine Spaltung zwischen der Bewußtseinseinstellung und den dazu entgegengesetzten Inhalten des Unbewußten eingetreten ist. Weil das Bewußtsein um ebendiese Inhalte nicht weiß und deshalb mit einer anscheinend ausweglosen Situation konfrontiert ist, so können die fremdartigen Inhalte nicht direkt und bewußt integriert werden, sondern suchen sich indirekt auszudrücken, indem sie unerwartete und zunächst unerklärliche Meinungen, Überzeugungen, Illusionen und Visionen erzeugen. Es werden ungewöhnliche Naturereignisse, wie Meteore, Kometen, Blutregen, ein Kalb mit zwei Köpfen und sonstige Mißgeburten, im Sinne drohender Ereignisse gedeutet, oder es werden «Zeichen am Himmel» gesehen.”(Jung, 1958/1992, S. 20)
“Dazu kommen noch jene Fälle, wo dieselbe kollektive Ursache die nämlichen oder wenigstens ähnliche psychische Wirkungen hervorbringt, das heißt gleichartige Deutungen oder visionäre Bilder gerade bei den Leuten, die am wenigsten auf solche Erscheinungen vorbereitet oder daran zu glauben geneigt sind. Dieser Umstand ist es dann wiederum, welcher den Augenzeugenberichten eine besondere Glaubwürdigkeit verleiht: man pflegt ja gerne hervorzuheben, daß der oder jener Zeuge besonders unverdächtig sei, weil er sich nie durch lebhafte Phantasie oder Leichtgläubigkeit hervorgetan, sondern im Gegenteil sich stets durch ein kühles Urteil und durch kritische Vernunft ausgezeichnet habe. Gerade in solchen Fällen muß das Unbewußte zu besonders drastischen Maßnahmen greifen, um seine Inhalte wahrnehmbar zu machen. Dies geschieht am eindringlichsten durch Projektion, das heißt Hinausverlegen in ein Objekt, an dem dann das erscheint, was zuvor das Geheimnis des Unbewußten war.”(Jung, 1958/1992, S. 21)
“Persönliche Verdrängungen und Unbewußtheiten offenbaren sich an der nächsten Umgebung, dem Verwandten- und Bekanntenkreis. Kollektive Inhalte dagegen, wie zum Beispiel religiöse, weltanschauliche und politisch-soziale Konflikte, erwählen sich entsprechende Projektionsträger, wie die Freimaurer, Jesuiten. Juden, Kapitalisten. Bolschewisten, Imperialisten usw. In der Bedrohlichkeit der heurigen Weltsituation, wo man einzusehen anfängt, daß es ums Ganze gehen könnte, greift die projektionsschafiende Phantasie über den Bereich irdischer Organisationen und Mächte hinaus in den Himmel, das heißt in den kosmischen Raum der Gestirne, wo einstmals die Schicksalsherrscher, die Götter, in den Planeten ihren Sitz hatten.”(Jung, 1958/1992, S. 21)
Zitate von C.G. Jung über Archetypen und das kollektive Unbewusste
“Die Inhalte des persönlichen Unbewussten sind in der Hauptsache die sogenannten gefühlsbetonten Komplexe, welche die persönliche Intimität des seelischen Lebens ausmachen. Die Inhalte des kollektiven Unbewussten dagegen sind die sogenannten Archetypen.”(Jung, 1934/2018, S. 8)
“Seit der Entdeckung des empirischen Unbewußten ist die Psyche, und was in ihr geschieht, eine Naturtatsache und nicht mehr eine willkürliche Meinung, was sie wohl wäre, wenn sie ihre Manifestation der Absicht eines bodenlosen Bewußtseins verdankte. Das Bewußtsein mit seiner kaleidoskopischen Beweglichkeit ruht aber, wie wir dank der Entdeckung des Unbewußten wissen, auf der sozusagen statischen oder wenigstens hochkonservativen Grundlage der Instinkte und deren spezifischen Formen, den Archetypen.”(Jung, 1958/1992, S. 56)
“Es ist unumgänglich, die Produkte des (kollektiven) Unbewußten, das heißt die Bilder, die einen unverkennbar mythologischen Charakter aufweisen, in ihren symbolgeschichtlichen Zusammenhang einzureihen, denn sie bilden die Sprache der angeborenen Psyche und ihrer Struktur und sind keineswegs, was ihre Anlage anbetrifft, individuelle Erwerbungen.”(Jung, 1958/1992, S. 44)
“Wo immer es sich um archetypische Gestaltungen handelt, führen personalistische Erklärungsversuche in die Irre. (…) Die symbolgeschichtliche («amplifizierende») Behandlung ergibt ein Resultat, das zunächst wie eine Rückübersetzung in primitive Sprache anmutet.”(Jung, 1958/1992, S. 44)
Fußnote: ” Ich muß hier den Leser bitten, dem landläufigen Mißverständnis, daß diese Hintergründe «metaphysisch» seien, nicht Raum zu geben. Diese Auffassung ist eine grobe Fahrlässigkeit, die sich auch akademische Geister zuschulden kommen lassen. Es handelt sich vielmehr um Instinkte, die nicht nur das äußerliche Verhalten, sondern auch die psychische Struktur beeinflussen. Die Psyche ist keine willkürliche Phantasie, sondern eine biologische Tatsache, welche den Lebensgesetzen unterworfen ist.”(Jung, 1958/1992, S. 56)
Das Rationale als Gegenspieler des Unbewussten / Archetypen
” Diese Welt der Hinrergründe erweist sich als Gegenspieler des Bewußtseins, welches vermöge seiner Beweglichkeit (Lernfahigkeit) öfters in Gefahr steht, seine Wurzeln zu verlieren. Infolge dieser Erfahrung haben die Menschen seit unvordenklichen Zeiten sich genötigt gesehen, Riten auszufuhren, welche den Zweck haben, die Mitarbeit des Unbewußten zu sichern. In einer primitiven Welt wird keine Rechnung ohne den Wirt gemacht; man erinnert sich stets der Götter, der Geister, des Fatums und der magischen Eigenschaften von Ort und Zeit, in der richtigen Erkenntnis, daß der alleinige Wille des Menschen nur den Bruchteil einer ganzheitlichen Situation darstellt. Das Handeln des ursprünglichen Menschen hat einen Ganzheitscharakter, von dem sich der Zivilisierte als von einer überflüssigen Belastung freizumachen versucht. Es scheint auch ohne sie zu gehen.”(Jung, 1958/1992, S. 56–57)
“Nur Bruchteile eines Promilles der Bevölkerung lassen sich durch Überlegungen belehren. Alles andere besteht aus der Suggestivkraft der Anschaulichkeit.”(Jung, 1958/1992, S. 55)
“Vermehrte Kenntnis des Unbewußten bedeutet soviel wie erweiterte Lebenserfahrung und größere Bewußtheit und beschert uns daher anscheinend neue, ethische Entscheidung fordernde Situationen. Diese waren zwar immer schon vorhanden, wurden aber intellektuell und moralisch weniger scharf erfaßt und oft nicht ohne Absicht im Zwielicht gelassen. (…) Ich habe in meiner langen Erfahrung keine Situation angetroffen, die mir eine Verleugnung der ethischen Prinzipien oder auch nur einen Zweifel in dieser Hinsicht nahegelegt hätte; im Gegenteil haben sich mit zunehmender Erfahrung und Erkenntnis das ethische Problem verschärft und die moralische Verantwortlichkeit gesteigert. Es ist mir klargeworden, daß im Gegensatz zur allgemeinen Auffassung das Unbewußtsein keine Entschuldigung darstellt, sondern vielmehr ein Vergehen ist in des Wortes eigentlicher Bedeutung.”(Jung, 1958/1992, S. 68–69)
Parapsychologie, Empirie und Wissenschaft
“Abgesehen von Kollektivvisionen gibt es aber auch Fälle, wo eine bis mehrere Personen etwas sehen, das physisch nicht vorhanden ist. So war ich einmal bei einer spiritistischen Sitzung zugegen, wo von den anwesen- den fünf Beobachtern vier einen kleinen mondartigen Körper über dem Abdomen des Mediums schweben sahen und mir als dem fünften, der nichts sah, genau die Stelle bezeichneten, wo er zu sehen war. Es war ihnen schlechterdings unbegreiflich, daß ich nichts dergleichen sehen konnte.” S.14
“… es gibt parapsychologische Erfahrungen, die heutzutage nicht mehr unter den Tisch gewischt werden können, sondern bei der Beurteilung psychischer Vorgänge mitberücksichtigt werden müssen.”(Jung, 1958/1992, S. 40)
Natur und Speculative Fiction
“Es erscheint ein rundes «metallenes Gebilde», das als «fliegende Spinne» charakterisiert wird. Dieser Beschreibung entspricht das Ufo, Was die Bezeichnung als «Spinne» betrifft, so ist an die Hypothese zu erinnern, daß die Ufos eine Art von Insekten seien, die von einem anderen Planeten stammen und ein metallisch glänzendes Gehäuse besitzen. Eine Analogie dazu wären die ebenfalls metallisch aussehenden Chitinpanzer unserer Käfer. Jedes Ufo sei ein einzelnes Tier. Bei der Lektüre der zahlreichen Berichte ist, wie ich gestehen muß, mir selber auch der Gedanke gekommen, daß das eigentümliche Verhalten der Ufos am ehesten an das gewisser Insekten erinnere. Und wenn man schon über eine solche Annahme spekulieren will, so besteht die Möglichkeit, daß unter entsprechenden Lebensbedingungen die Natur auch imstande wäre, ihr «Wissen» noch in anderer Richtung als derjenigen der physiologischen Lichterzeugung und dergleichen mehr zu betätigen, zum Beispiel in Autigravitation. Unsere technische Phantasie hinkt ja sowieso öfters derjenigen der Natur nach. Alle Dinge unserer Erfahrung unterliegen der Gravitation bis auf die eine große Ausnahme, die Psyche. Sie ist sogar die Erfahrung der Gewichtlosigkeit selber. Das psychische «Objekt» und die Gravitation sind unseres Wissens inkommensurabel. Sie scheinen prinzipiell verschieden zu sein. Die Psyche repräsentiert den einzigen uns bekannten Gegensatz zur Gravitation. Sie ist eine Antigravitation im eigentlichen Sinne des Wortes. Wir können zur Bestätigung dieser Überlegung auch die Erfahrungen der Parapsychologie heranziehen, wie zum Beispiel die Lévitation und andere, Zeit und Raum relativierende, psychische Phänomene, die nur noch von Unwissenden geleugnet werden.(Jung, 1958/1992, S. 62–63)
Literaturverzeichnis
Jung, C. G. (1992). Geheimnisvolles am Horizont (Von Ufos und Außerirdischen). Olten und Freiburg, Walter-Verlag. (Original work published 1958)
Jung, C. G. (2018). Über die Archetypen des kollektiven Unbewussten. In L. Jung (Hrsg.), Archetypen: Urbilder und Wirkkräfte des kollektiven Unbewussten (S. 8–54). Patmos Verlag. (Original work published 1934)


