
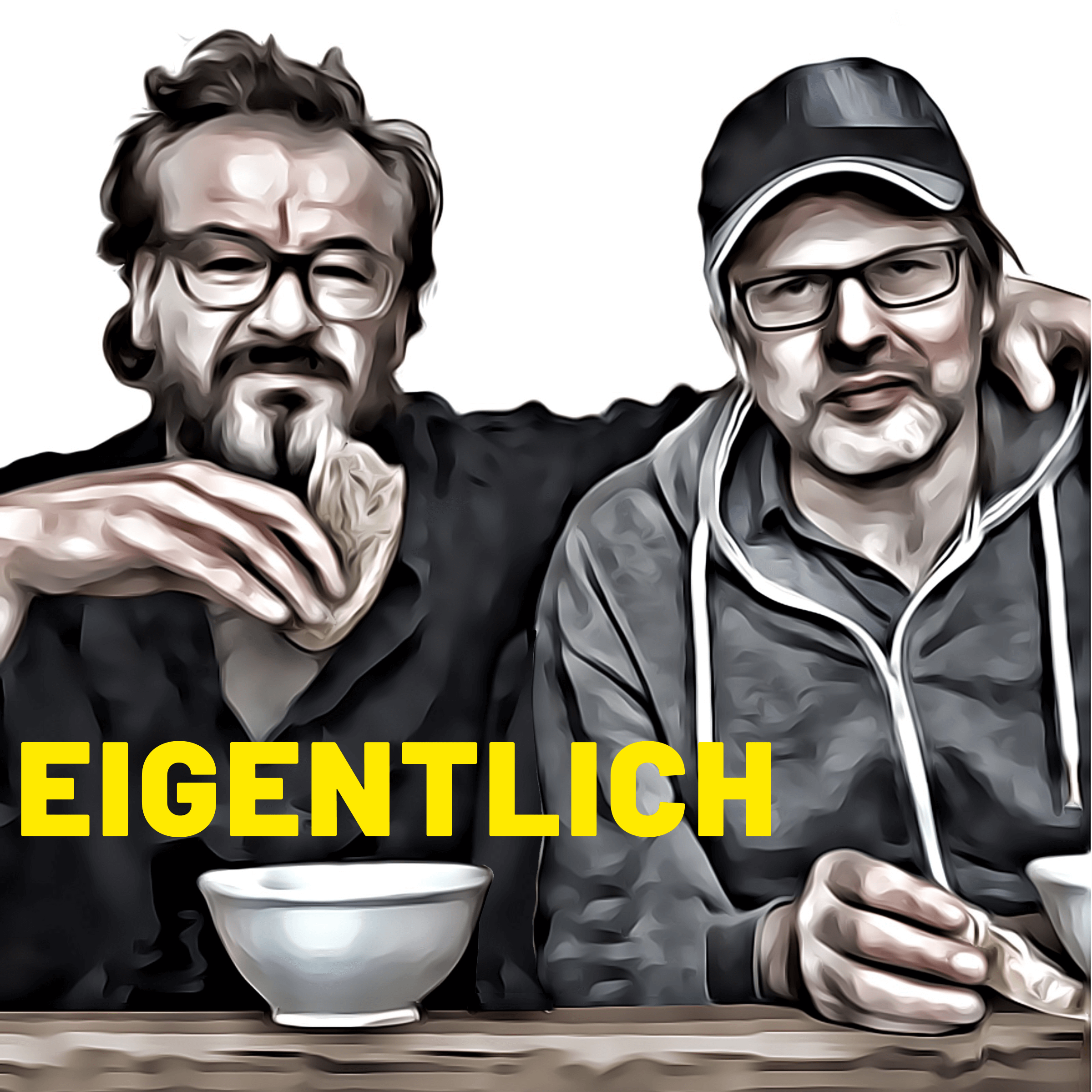
Eigentlich Podcast
Micz & Flo
Reden beim Laufen und laufend Reden - über Film, Technik und Psychotherapie
Episodes
Mentioned books

Jul 17, 2025 • 35min
EGL082 Zombies in Psychoanalyse: Jenseits des Lustprinzips
Der Podcast taucht tief in die psychoanalytische Betrachtung von Zombies ein. Die unheimliche Faszination für Untote spiegelt unsere inneren Konflikte wider. Mit Freuds Theorien wird deutlich, dass Zombies symbolisch für Verdrängtes stehen. Melanie Kleins Konzepte verdeutlichen die kindlichen Konflikte zwischen guten und bösen Teilobjekten. Die ambivalenten Kräfte im Verhältnis zur Mutter werden ebenso beleuchtet und deren Einfluss auf männliches Verhalten analysiert. Letztendlich zeigen Lacans Ideen, wie Zombies unsere ungeordneten Wünsche repräsentieren.

Jul 3, 2025 • 1h 57min
EGL081 28 Years Later - Heart of Kindness: Eine Befreiung aus der deterministischen Apokalypse
"The idea of the father taking a 12-year-old boy to the mainland 28 days after the infection is insane. Nobody would do that. But 28 years after the infection, clearly it's okay." - Danny Boyle
28 Years Later – wir sind schon alle ganz aufgeregt, den Film endlich im Kino sehen zu können, seit mindestens 28 Tagen, wenn nicht sogar Wochen. Der Trailer des Films, spektakulär mit den treibenden Rhythmen des Gedichts "Boots" von Rudyard Kipling vertont, hat uns schon vor Monaten in freudige Schockstarre versetzt. Eigentlich war ein Kinogang von Flo und Micz geplant, der aber spontan aus Gründen nicht stattfinden konnte. Flo hat dann eine Woche später den Film "28 Years Later" mit seinem Sohn Luc im Kino gesehen. Vorher haben die beiden ihre Erwartungen an den Film als Einstieg in diese Episode aufgenommen, um dann zu prüfen, wie sich diese eingelöst haben. tl;dr: Es ist wie erwartet, aber doch ganz anders. So ist auch der Konsens der Kritiken zum Film. Danny Boyle und Alex Garland haben ein Kunstwerk geschaffen, das in der Ästhetik und in der Geschichte überzeugt. Das erste Drittel des Films löst alles ein, was wir von der Fortsetzung erwarten: Eine kleine militarisierte Gemeinschaft hat sich behaglich nach der Apokalypse ohne Strom und sonstige zivilisatorische Errungenschaften auf einer kleinen Insel im schottischen Gezeitenland eingerichtet. Zu den Initiationsritualen gehört, dass die Jungen der Gemeinschaft mit ihren Vätern auf das Festland ziehen, um den ersten Todesschuss auf einen Infizierten zu praktizieren. So zieht auch Spike mit seinem Vater Jamie los. Wir als Zuschauer bekommen eine Ahnung, welche Blüten das Virus nach 28 Jahren treiben kann. Es kommt dann, wie es kommen muss: Die beiden fliehen vor den schnellen Infizierten, schaffen es nicht mehr rechtzeitig zur Ebbe auf die Insel und müssen auf dem Dachboden eines verlassenen Hauses nächtigen. Dort sieht Spike ein verheißungsvolles Feuer, das der Vater als das Werk eines verrückten Doktors abtut. In einer spektakulären Nachtszene, gejagt von einem Alpha-Zombie, erreichen sie gerade so wieder das Dorf. Spike hat das Ritual bestanden und wird von der Gemeinschaft mit Bier und Liedern gefeiert. Doch er ist nicht zufrieden. Er möchte seiner todkranken Mutter helfen, die in der Dorfgemeinschaft nicht die richtige medizinische Versorgung bekommt. So zieht Spike heimlich mit seiner Mutter wieder aufs Festland los und erlebt auf dieser Reise seine wahrhaftige Initiation. Danny Boyle lässt sich in seinen Filmen nicht so richtig auf ein Genre festlegen und schafft ein ganz eigenes Werk aus verschiedenen filmischen Materialien. 28 Years Later verspricht eigentlich einen Horrorfilm, entwickelt sich aber zu einem Coming-of-Age-Roadmovie. Wir begegnen der Figur Dr. Kelson, der seine eigene künstlerische Form gefunden hat, mit den Auswüchsen der Katastrophe umzugehen, und dabei eine neue Menschlichkeit schafft, die sich aus der deterministischen Apokalypse befreien kann: Memento mori, im Tod sind alle gleich – dies kann sehr kitschig wirken, aber durch die ständigen Brüche im Filmstil können wir die Botschaft annehmen. Micz, der den Film nicht gesehen hat, ließ sich vom aufwühlenden Gesprächsfluss von Flo mitreißen und war am Ende der Episode ganz verschwitzt.
Shownotes
Links zur Laufstrecke
EGL081 | Wanderung | Komoot
Berlin-Friedrichshain – Wikipedia
Boxhagener Platz – Wikipedia
Links zur Episode
28 Years Later – Wikipedia
Danny Boyle – Wikipedia
Alex Garland – Wikipedia
28 Days Later – Wikipedia
28 Weeks Later – Wikipedia
Boots (poem) - Wikipedia – Wikipedia
Rudyard Kipling – Wikipedia
28 Years Later | Interview with Danny Boyle & Alex Garland | EOH TV
Zweiter Burenkrieg – Wikipedia
Immersion (Film) – Wikipedia
Warfare (Film) – Wikipedia
George A. Romero – Wikipedia
Lucio Fulci – Wikipedia
Sunshine (2007) – Wikipedia
28 Years Later: The Bone Temple - Wikipedia – Wikipedia
A Clockwork Orange (film) - Wikipedia – Wikipedia
Coming-of-age story - Wikipedia – Wikipedia
Road movie - Wikipedia – Wikipedia
Das Fest (Film) – Wikipedia
Anthony Dod Mantle – Wikipedia
Bullet Time – Wikipedia
John Woo – Wikipedia
St.-Crispins-Tag-Rede – Wikipedia
Abide with Me - Wikipedia – Wikipedia
Blair Witch Project – Wikipedia
Spinal Tap – Wikipedia
Black Summer (TV series) - Wikipedia – Wikipedia
Ralph Fiennes – Wikipedia
Jan Švankmajer – Wikipedia
Katakomben von Paris – Wikipedia
Cimetière du Montparnasse – Wikipedia
Serge Gainsbourg – Wikipedia
Agnès Varda – Wikipedia
Jean-Paul Sartre – Wikipedia
Simone de Beauvoir – Wikipedia
Jane Birkin – Wikipedia
Fondation Cartier – Wikipedia
Ron Mueck – Wikipedia
Adaptive Radiation – Wikipedia
Herz der Finsternis – Wikipedia
The Last of Us – Wikipedia
Psychogeographie – Wikipedia
Die Klapperschlange – Wikipedia
World War Z – Wikipedia
#248 - 28 Years Later (Live in Berlin) - CUTS - Der kritische Film-Podcast
Dawn of the Dead (2004) – Wikipedia
Zombie (Film) – Wikipedia
Zombie 2 – Wikipedia
Die Nacht der lebenden Toten – Wikipedia
Dario Argento – Wikipedia
Tom Savini – Wikipedia
Der Zombie Survival Guide – Wikipedia
Das schwarze Loch – Wikipedia
Mitwirkende
Florian Clauß
(Erzähler)
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Luc
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Verwandte Episoden
EGL038 Dogma 95: Das Fest - wie Authentizität auf der Leinwand sehr real wirken kann…EGL066 Roadmovies I: Civil WarEGL076 Abide with Me: Entstehung, Bedeutung und Vermächtnis von H. F. Lytes bekanntester HymneEGL082 Zombies in Psychoanalyse: Jenseits des Lustprinzips
Von der Apokalypse zur Normalität
Als Jim (Cillian Murphy) 2002 in Danny Boyles „28 Days Later“ auf der verlassenen Westminster Bridge erwacht, prägt sich ein Bild in das kollektive Gedächtnis des Kinos ein, das prophetischer nicht hätte sein können. Was damals als radikale Neuerfindung des Zombie-Genres galt, wurde während der COVID-19-Pandemie zur gespenstischen Realität: leere Straßen, zusammengebrochene Institutionen, die Fragilität der Zivilisation. Nun, 23 Jahre später, kehren Boyle und sein langjähriger Kollaborateur Alex Garland mit „28 Years Later“ zurück – nicht nur zu ihrem Genre-definierenden Werk, sondern zu den fundamentalen Fragen über Gesellschaft, Überleben und Menschlichkeit in Zeiten der Krise.
Die Evolution eines Genres
Die „28“-Reihe markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des Zombie-Films. Während George Romeros klassische Untoten-Trilogie das Genre begründete und über Jahrzehnte definierte, unternahmen Boyle und Garland 2002 einen radikalen Bruch mit etablierten Konventionen. Ihre „Infizierten“ waren keine wiederbelebten Toten, sondern von einem Rage-Virus befallene Menschen – schnell, brutal, getrieben von purer Wut. Diese Neuinterpretation war mehr als eine ästhetische Entscheidung; sie reflektierte die Ängste einer beschleunigten, vernetzten Welt, in der Bedrohungen sich viral ausbreiten.
Der Kameramann Anthony Dod Mantle, bekannt durch seine Arbeit mit Thomas Vinterbergs Dogma-Film „Das Fest“, brachte eine rohe, dokumentarische Ästhetik ein, die den Film aus den Konventionen des Horrorgenres löste. Die auf digitalen Kameras gedrehten, körnigen Bilder vermittelten eine Unmittelbarkeit und Authentizität, die das Publikum direkt in das Chaos katapultierte. Diese stilistische Entscheidung war radikal – Cillian Murphy erschien in Weitaufnahmen teilweise nur als „zwei Farbquadrate“, wie Boyle es rückblickend beschreibt.
„28 Years Later“: Rückkehr in eine veränderte Welt
Nach über zwei Jahrzehnten nehmen Boyle und Garland mit „28 Years Later“ den 28er-Zyklus wieder auf, dem Auftakt einer geplanten neuen Trilogie. Der Film, der am 19.6 in den deutschen Kinos startete, verspricht keine bloße Wiederholung bewährter Formeln, sondern eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Transformationen der vergangenen Jahre.Die Handlung setzt auf Holy Island ein, einer Gezeiteninsel vor der englischen Küste, wo eine isolierte Gemeinschaft überlebt hat. Der zwölfjährige Spike lebt hier mit seinen Eltern Jamie und Isla in einer Gesellschaft, die sich radikal verändert hat. Bei Ebbe unternehmen bewaffnete Gruppen Expeditionen aufs Festland, um die noch immer präsenten Infizierten zu jagen – eine Routine, die zur grausamen Normalität geworden ist.
Coming-of-Age in der Apokalypse
Im Zentrum steht Spikes Initiationsgeschichte, die Boyle und Garland als verstörende Perversion traditioneller Übergangsriten inszenieren. Der aggressive Vater Jamie, brillant verkörpert von Aaron Taylor-Johnson, praktiziert eine Form „schwarzer Pädagogik“, indem er seinen traumatisierten Sohn zur Zombie-Jagd zwingt. „Schau nicht weg, Spike. Das soll dir eine Lehre sein“, befiehlt er, während sie Infizierte töten – eine Szene, die den Verlust kindlicher Unschuld in einer Welt ohne Gnade zeigt.
Die Evolution der Infizierten
Eine der faszinierendsten Entwicklungen des Films ist die Diversifizierung der Infizierten über 28 Jahre. Garland und Boyle präsentieren verschiedene Typen: die „Slowlows“, schwerfällige, fast mitleiderregende Kreaturen; die klassischen rasenden Infizierten; und die „Alpha-Zombies“, besonders aggressive Exemplare, die in Rudeln jagen. Diese Evolution macht die Infizierten weniger zu hirnlosen Monstern als zu einer Art degenerierter Parallelgesellschaft – eine Entscheidung, die die Grenze zwischen „uns“ und „ihnen“ bewusst verwischt.
Dr. Kelson und die Kunst des Memento Mori
Eine der eindrucksvollsten Figuren ist Dr. Kelson, gespielt von Ralph Fiennes, ein auf dem Festland lebender Arzt, der über die Jahre monumentale Kunstwerke aus menschlichen Überresten erschaffen hat. Seine Knochentürme und Schädelskulpturen fungieren als makabres Memento Mori – eine Mahnung an die Vergänglichkeit, die tief in der europäischen Kulturgeschichte verwurzelt ist.
Diese Darstellung greift auf eine lange Tradition zurück, von mittelalterlichen Beinhäusern wie dem Sedlec-Ossarium in Tschechien bis zu den Pariser Katakomben. Doch während historische Ossuarien meist gemeinschaftliche, religiös legitimierte Projekte waren, erscheint Kelsons Werk als einsame Obsession eines Überlebenden – ein individueller Versuch, dem Massensterben Sinn zu verleihen. Die Ambivalenz dieser Figur – zwischen Wahnsinn und Weisheit, zwischen Künstler und Totenpriester – spiegelt die Unmöglichkeit wider, in einer post-apokalyptischen Welt angemessene Formen des Gedenkens zu finden.
Zeitdiagnose und gesellschaftliche Regression
„28 Years Later“ ist mehr als ein Zombie-Film – es ist eine beißende Kritik an aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Die isolierte Inselgemeinschaft mit faschistoiden Anklänge liest sich als düstere Post-Brexit-Allegorie. Die Gemeinschaft hat sich abgeschottet, pflegt einen aggressiven Tribalismus und erzieht ihre Kinder zu Kriegern.
Besonders die Szene, in der Kinder geschlechtsspezifisch ausgebildet werden – Jungen lernen Bogenschießen, Mädchen andere Fertigkeiten – wirkt wie ein Kommentar zur Rückkehr traditioneller Geschlechterrollen. Der Film wird untermalt von Rudyard Kiplings Gedicht „Boots“ (1903), dessen repetitiver Rhythmus die Monotonie militärischen Drills evoziert, sowie Ausschnitten aus Laurence Oliviers „Henry V.“ – Verweise auf ein glorifiziertes, militaristisches Geschichtsbild.
Die Figur des schwedischen Soldaten Erik, der bereut, dem Militär beigetreten zu sein, um „etwas Sinnvolles“ zu tun, spricht direkt aktuelle Debatten über Remilitarisierung und „Kriegstüchtigkeit“ in Europa an. Seine Geschichte warnt vor der Romantisierung militärischer Lösungen für gesellschaftliche Probleme.
Ästhetische Innovationen und Kritikpunkte
Visuell knüpft „28 Years Later“ an die Innovationen des Originals an, ohne sie bloß zu kopieren. Anthony Dod Mantle kehrt als Kameramann zurück und entwickelt neue visuelle Strategien. Besonders beeindruckend sind die „Bullet-Time“-ähnlichen Effekte bei Kampfszenen, die mit einem Setup aus bis zu zehn iPhones realisiert wurden – Boyle nennt es scherzhaft „poor man’s bullet time“. Diese Momente, in denen Pfeile das Filmmaterial zu „zerschießen“ scheinen, schaffen eine neue Form der Immersion.
Allerdings neigt der Film laut Kritikern auch zu „entsetzlichem Kitsch“, besonders in den symbolüberladenen Memento-Mori-Szenen. Die Mischung verschiedener Genre-Ästhetiken – von Mittelalter-Epos über Monty Python bis Performance-Theater – wird als „Diskurs-Kollage“ kritisiert, die keine kohärente Vision entwickelt. Der Film wirke „so ratlos wie wir alle“, was einerseits ehrlich, andererseits unbefriedigend sei.
Die Trilogie als Zeitkapsel
Betrachtet man die „28“-Reihe als Ganzes, offenbart sich eine faszinierende Chronologie gesellschaftlicher Ängste. „28 Days Later“ (2002) reflektierte post-9/11-Paranoia und die Angst vor plötzlichen, unkontrollierbaren Bedrohungen. „28 Weeks Later“ (2007) thematisierte militärische Besatzung und die Illusion von Sicherheit – deutliche Parallelen zum Irak-Krieg. „28 Years Later“ (2025) konfrontiert uns nun mit den Langzeitfolgen von Krisen: transgenerationales Trauma, gesellschaftliche Regression und die Normalisierung des Ausnahmezustands.
Interview-Einblicke: Boyle und Garland über ihre Vision
In Interviews betonen beide Kreative, wie sehr die COVID-19-Pandemie ihre Herangehensweise beeinflusst hat. „Die Erfahrung war stark“, sagt Boyle. „Am Anfang ist man sehr vorsichtig und nach einiger Zeit wird man mit der Situation etwas entspannter.“ Diese Normalisierung des Unnormalen ist zentral für „28 Years Later“ – was in den ersten Filmen undenkbar war (ein Vater nimmt seinen 12-jährigen Sohn zur Zombie-Jagd mit), ist nach 28 Jahren zur akzeptierten Routine geworden.
Garland fügt hinzu, dass die Infizierten selbst eine Evolution durchgemacht haben: „Sie haben gelernt mit der Situation umzugehen, um nicht zu verhungern. Sie jagen in Rudeln.“ Diese Anpassung macht sie paradoxerweise menschlicher und bedrohlicher zugleich.
Besonders aufschlussreich ist Garlands Kommentar zur gesellschaftlichen Rückwärtsgewandtheit: „Es gibt eine Tendenz zurückzublicken, was aber nur mit cherrypicked memories und Gedächtnisverlust einhergeht.“ Der Film kritisiere die „Make things great again“-Mentalität der letzten Jahre, die selektive Geschichtsschreibung und die Unfähigkeit, sich eine progressive Zukunft vorzustellen.
Ein notwendiger Film zur richtigen Zeit?
„28 Years Later“ ist kein perfekter Film. Die Kritik an seiner fragmentarischen Struktur, dem überladenen Diskurs und dem unbefriedigenden Cliffhanger-Ende ist berechtigt. Als eigenständiges Werk mag er enttäuschen, als Teil einer größeren Erzählung und als Zeitdiagnose jedoch ist er hochrelevant.
Der Film stellt die richtigen Fragen: Wie verändert langanhaltende Krise eine Gesellschaft? Welche Formen nimmt Initiation an, wenn traditionelle Strukturen kollabieren? Wie gedenken wir der Toten, wenn die Normalität selbst tot ist? Dass er keine eindeutigen Antworten liefert, mag frustrierend sein, spiegelt aber ehrlich unsere eigene Orientierungslosigkeit in Zeiten multipler Krisen wider.
Die wahre Stärke der „28“-Trilogie liegt in ihrer Fähigkeit, den Zombie-Film als Vehikel für gesellschaftliche Reflexion zu nutzen. Wie schon George Romero wussten Boyle und Garland: Die wahren Monster sind nicht die Infizierten, sondern die Systeme, die sie hervorbringen – seien es nun Tierversuchslabore, militärische Strukturen oder tribalistisch Gemeinschaften, die ihre eigenen Kinder brutalisieren.
In einer Zeit, in der Pandemien, Klimakrise und gesellschaftliche Polarisierung unsere Normalität definieren, erscheint „28 Years Later“ weniger als Unterhaltung denn als notwendige Konfrontation mit unseren kollektiven Ängsten. Der Film mag keine Lösungen bieten, aber er zwingt uns, genau hinzuschauen – auch wenn wir, wie der junge Spike, am liebsten wegschauen würden.

Jun 19, 2025 • 1h 6min
EGL080 Chaosmagie und Psychotherapie: wissenschaftlicher Anspruch trifft magische Wirkmacht
"... chaos magic has no history. Every culture and generation rewrites the eternal verities of magic in terms of its own symbolism and idiosyncrasies; only the underlying practical techniques of magic really matter." -- Peter J. Carroll in Liber Null
Diesen zweiten Teil der Episode über Wissenschaft, Evidenz, C. G. Jung und "Das Rote Buch" beginnen wir mit einem Ausflug in die Magie. Zuerst hören wir noch einmal einen Auszug aus dem zauberhaften Roman "Jonathan Strange & Mr. Norrell". Damit hatten wir auch den ersten Teil abgeschlossen. Und dann stolpern wir hinein in die sogenannte Chaosmagie, eine magische Praxisform, die in den späten 1970er-Jahren entstand. Der Übergang ist so holprig, dass Flo anfangs vermutet, Peter Carroll sei ein weiterer Charakter des Romans. Vielmehr hat Peter J. Carroll mit den Werken "Liber Null" und "Psychonaut" eine theoretische und praktische Grundlage für eine neue Praxis der Magie formuliert, die heute als Chaosmagie bezeichnet wird. Carrolls Ansatz betont den pragmatischen Umgang mit magischen Techniken und versucht, diese von überlieferten rituellen und symbolischen Systemen zu lösen. Und – deshalb kommt die Chaosmagie in dieser Folge vor – er beansprucht ein empirisch orientiertes Vorgehen, das die Wirksamkeit von Praktiken anhand subjektiver Erfahrung überprüft. Wir befinden uns also mitten in der Frage: Was ist Wissenschaft? Und drehen jetzt das Rad noch einmal weiter: Ist Magie Wissenschaft? Wir drehen das Rad dann noch ein Stück weiter und erreichen so wieder die Praxen der Psychotherapeut:innen, beziehungsweise die psychotherapeutische Praxis – insbesondere Körperarbeit und Atemtechniken.
Shownotes
Link zur Laufstrecke
Eigentlich Podcast
Links zur Episode
Chaosmagie auf Wikipedia
The Men Who Stare at Goats auf Rotten Tomaties
Peter J. Carroll auf Wikipedia
Austin Osman Spare auf Wikipedia
Liber Null von Peter J. Carroll auf archive.org
Liber Null & Psychonaut von Peter J. Carroll auf archive.org
Ort der Kraft oder magischer Ort
Liste von Psychotherapie- und Selbsterfahrungsmethoden
Inception (2010) - Opening The Safe Scene - YouTube
Arthur C. Clarke's three laws
The Feynman Lectures on Physics (1963) > Vol I: The Relation of Physics to Other Sciences > 3-6 Psychology
The History of Chaos Magic, Psychogeography & Psychedelics in Magic | Julian Vayne - YouTube
Talking Chaos Magic and Breathwork with Dave Lee – Rune Soup
Mitwirkende
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Verwandte Episoden
EGL063 Psychosen, UFOs, Archetypen: C.G. Jung über Außerirdische und das kollektive UnbewussteEGL078 Das Rote Buch: C.G. Jung als Religionsstifter oder Wissenschaftler?EGL084 Sigmund Freud: seine „Outsider“ Biographie im Filmessay
Wer die Folge 78 noch nicht gehört hat, sollte das vielleicht tun. Da bilden wir den Boden für diese Episode. Wir sprechen über C.G. Jung, sein Jahrzehnte nach dem Tod veröffentlichtes Buch „Das Rote Buch“, über Spiritualität, Wissenschaft und Psychotherapie. In dieser zweiten Folge machen wir einen bewussten Schritt raus aus der Comfort Zone der Wissenschaft, über das Ziel hinaus und hinein in die Magie. Ganz speziell eben die Chaosmagie, deren Begründer ist Peter J. Carroll mit den Publikationen „Liber Null“ und „Psychonaut“. (Meine Zitate beziehe ich aus der Fassung „Liber Null and Psychonaut“ (Weiser Books, Newburyport, 2022), die mir als E-Book vorliegt, weshalb ich keine Seitenzahlen angebe, sondern die jeweiligen Kapitel.)
Eine Zusammenfassung seines Denkens liefert uns Peter J. Carroll gleich in den ersten Zeilen der Einleitung. Magische Fähigkeiten ergeben sich demnach aus veränderten Bewusstseinszuständen, die sich in der „Realität“ entwickeln lassen und keiner symbolischen Abstraktionen bedürfen:
Magic is an intensely practical, personal, experimental art. Two major themes run through this book: that altered states of consciousness are the key to unlocking one’s magical abilities; and that these abilities can be developed without any symbolic system except reality itself.
— Peter J. Carroll In: „Liber Null and Psychonaut“, Kapitel: „Introduction“ (Weiser Books, Newburyport, 2022)
Wir verlassen in diesem zweiten Teil über C.G. Jung und „Das Rote Buch“ also die Wissenschaft durch Jungs metaphysische Hintertürchen in eben diesem roten Buch. Anstatt die Regler am Mischpult alle von null auf den richtigen Wert zu schieben, stellen wir jetzt erst mal alles auf zehn und regeln dann runter. Steigen wir also in die Magie ein. Peter J. Carrolls „Liber Null“ verfolgt einen anderen Zugang als Jung, doch es entsteht eine strukturelle Nähe. Auch „Liber Null“ ist eine Sammlung von Texten, die keine dogmatische Lehre etablieren wollen. Stattdessen formuliert Carroll eine methodische Praxis, in der Magie als Technik der Aufmerksamkeitslenkung begriffen wird.
„Mind and Matter“ bei Jung und Carroll
Wie ähnlich sich die Weltbilder von C.G. Jung und Peter J. Carroll (Chaosmagie) sind, möchte ich mit zwei Zitaten illustrieren. Gehen wir gleich mal ans Eingemachte, „straight to the heart of the matter“, wie Carroll schreibt. Sein Wortwitz versteht sich erst beim zweiten Lesen, „the matter“, die Materie. Die Frage nach dem Universum und dem Bewusstsein darin und Allem:
If we proceed straight to the heart of the matter and ask of magic what is the nature of consciousness and the universe and everything, we get this answer: they are spontaneous, magical, and chaotic phenomena. The force which initiates and moves the universe, and the force which lies at the center of consciousness, is whimsical and arbitrary, creating and destroying for no purpose beyond amusing itself.
— Peter J. Carroll In: „Psychonaut“, Kapitel „Chaos: The Secret of the Universe“
Das Wesen des Bewusstseins, des Universums und von allem, so Carroll, bestehe aus den gleichen spontanen, magischen und chaotischen Phänomenen. Wir stellen erst mal C.G. Jungs Gedanken in dieser Frage daneben:
And so psychical events are realities. (…) Because the psyche, if you understand it as a phenomenon that takes place in so-called living bodies, is a quality of matter, as our bodies consist of matter. We discover that this matter has another aspect, namely, a psychic aspect.
— C.G. Jung In: „Jung on elementary psychology. A discussion Between C.G. Jung and Richard I. Evans (1976, P. 93)
Jung versteht psychische Ereignisse als als eine Eigenschaft der Materie. Zwar ist die Psyche ein Phänomen, das sich in sogenannten lebenden Körpern vollzieht, da diese Körper aber aus Materie bestehen, schlussfolgert Jung, dass diese Materie noch einen weiteren Aspekt hat, nämlich einen psychischen Aspekt.
Diese beiden Konzeptionen liegen nicht weit auseinander und ich möchte das auch gerne so stehen lassen, denn es geht mir nicht darum das Universum zu erklären. Vielmehr geht es mir darum die Verwandschaft spezieller Schulen magischen und psychotherapeutischen Denkens (ausgehend von C.G. Jung) zu illustrieren.
Jung und Carroll leiten aus den eben zitierten Gedanken über die Beschaffenheit der Welt als Ganzes verwandte, wenn auch unterschiedliche Annahmen ab. Jung baut so eine Brücke aus dem Individuum, dem individuellen Unbewussten hin zum kollektiven Unbewussten und den Archetypen. Er geht gewissermaßen den Weg vom Individuum in das Universum.
Carroll geht den umgekehrten Weg. Der Grund unter allem sei das Chaos. Und dieses bleibe unergründbar, auch wenn wir alle aus diesem Chaos entstanden, quasi „gemacht“, sind, weil die Prozesse unseres Verstandes so gebaut sind, dass wir immer nach Kausalitäten suchen, also Ursache und Wirkung:
Now it is very difficult to imagine events arising spontaneously without prior cause, even though this happens every time one exerts one’s will. For this reason, it has seemed preferable to call the root of these phenomena chaos. It is impossible for us to understand chaos, because the understanding part of ourselves is built out of matter, which mainly obeys the statistical form of causality. Indeed, all our rational thinking is structured on the hypothesis that one thing causes another. It follows then that our thinking will never be able to appreciate the nature of consciousness or the universe as a whole because these are spontaneous, magical, and chaotic by nature.
— Peter J. Carroll In: „Psychonaut“, Kapitel: „Chaos: The Secret of the Universe“
Chaos und Magie und Chaosmagie
Doch wenn alles aus dem unergründbaren Chaos entstanden sei, den wir nicht verstehen können, ließe sich dann ableiten, dass Chaos, Magie und Bewusstsein das gleiche sein könnten? Carroll schlängelt sich entlang der Materie in unserem Hirn, in dem es chaotisch zugeht und in dem aber auch Zustände verändert werden können:
Might it not be that consciousness, magic, and chaos are the same thing? Consciousness is able to make things happen spontaneously without prior cause. This usually happens within the brain, where that part of consciousness we designate “will” tickles the nerves to make certain thoughts and actions occur. (ebd.)
Und wenn die Materie im Gehirn vom Bewusstsein (Consciousness) verändert werden kann, wo ziehen wir dann die Grenze? Wenn es das außerhalb des Körpers tut, wird es als Magie bezeichnet. Im Umkehrschluss benennt hier Carroll die Essenz der Definition von Magie:
Occasionally, consciousness is able to make things happen spontaneously outside the body when it performs magic. Any act of will is magic. (ebd.)
Diese Definition ist nicht leicht zu übersetzen. „Jeder Akt des Willens ist Magie“, es ist eine Willenshandlung, die folglich eine Willenskraft beinhaltet. Wir können also mit dem Bewusstsein in die Welt wirken. Und das Gegenteil ist auch der Fall:
Conversely, any act of conscious perception is also magic; an occurrence in nervous matter is spontaneously perceived in consciousness. Sometimes that perception can occur directly without the use of the senses, as in clairvoyance. (ebd.)
„Clairvoyance“ lässt sich als „Hellsehen“ übersetzen, also die Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen, die außerhalb der normalen Sinneswahrnehmung liegen. Jetzt haben wir also eine Definition von Magie und ein Feld, in dem sie wirkt (dem unergründlichen Chaos).
Die Magie ist für Carroll gewissermaßen die Grenze und Verbindung zwischen Chaos und uns Menschen. Das Chaos ist unergründbar, ungerichtet und folgt keinen Gesetzen, keiner Kausalität und keinem Sinn. Die Menschen und ihr Denken sind dem immanenten Wunsch unterworfen Ursachen für Wirkungen zu finden, diese Ordnung herzustellen. Der Mensch will immer etwas (vergleiche Nietzsche, Schopenhauer, Freud) und die Magie ist aus dieser Blickrichtung ein Willensakt, der etwas gezielt bewirken will.
Auf der anderen Seite steht das Chaos. Und die Chaosforschung (höre dazu den ersten Teil, Folge 78) lehrt uns in Kausalität gefangenen Wesen, dass es wenig Ursache bedarf (Schmetterling), um viel zu bewirken (Hurricane). Von Seiten des Chaos ist die Magie ein Impuls, eine Energie, eine Bewegung (alles natürlich Begriffe, die wir als in Kausalität gefangene Wesen benutzen, aber die es im Chaos nicht gibt).
Oder hier noch mal in den Worten von Carroll:
Magic is the science and art of causing change to occur in conformity with will.
— Peter J. Carroll In: „Liber Null“, Kapitel: „Liber MMM“
Veränderung durch Willenskraft, dass ist die Essenz. Carroll hat eine „whatever works“ Einstellung zu magischen Praktiken. Rituale, Symbole, Orden und andere höheren Strukturen sind nicht notwendig, bzw. müssen immer wieder neu beweisen, dass sie notwendig sind, um Magie zu betreiben. Carroll hat einen wissenschaftlichen Anspruch an magische Praktiken. Magische Novizen sollen sich deshalb einen Block zulegen und darin aufschreiben, was sie tun und mit welchem Ergebnis. Und Ergebnisse sollen auch mit anderen geteilt werden, um festzustellen, ob die Praktiken die beschriebenen Effekte wirklich erwirken. Mit diesen Anforderungen an die magische Praxis sind wir nicht weit weg vom Doppelblindverfahren medizinischer Evidenzforschung.
A magical diary is the magician’s most essential and powerful tool. It should be large enough to allow a full page for each day. Students should record the time, duration, and degree of success of any practice undertaken. They should make notes about environmental factors conducive (or otherwise) to the work.
— Peter J. Carroll In: „Liber Null“, Kapitel „Liber MMM“
Die Magie zu ergründen, bzw. die eigenen magischen Fähigkeiten zu entdecken und entwickeln, ist also ein fortwährendes Experiment. Es gibt jedoch notwendige Fähigkeiten, die sich trainieren lassen, um diesen experimentellen Pfad effektiv zu verfolgen:
This course is an exercise in the disciplines of magical trance, a form of mind control having similarities to yoga, personal metamorphosis, and the basic techniques of magic. Success with these techniques is a prerequisite for any real progress with the initiate syllabus. (ebd.)
Wer sich mit Achtsamkeit, Atemübungen und Körperarbeit in der Psychotherapie beschäftigt hat, dem könnten die folgenden Konzepte bekannt vorkommen (beim Lesen des folgenden Textauszugs bitte das Wort Magie wie von magischer Hand streichen):
To work magic effectively, the ability to concentrate the attention must be built up until the mind can enter a trancelike condition. This is accomplished in a number of stages: absolute motionlessness of the body, regulation of the breathing, stopping of thoughts, and magical trances (concentration on objects, concentration on sound, and concentration on mental images).
MotionlessnessArrange the body in any comfortable position and try to remain in that position for as long as possible. Try not to blink or move the tongue or fingers or any part of the body at all. Do not let the mind run away on long trains of thought but rather observe oneself passively. What appeared to be a comfortable position may become agonizing with time, but persist! Set aside some time each day for this practice and take advantage of any opportunity of inactivity which may arise.
Record the results in the magical diary. One should not be satisfied with less than five minutes. When fifteen have been achieved, proceed to regulation of the breathing.
BreathingStay as motionless as possible and begin to deliberately make the breathing slower and deeper. The aim is to use the entire capacity of the lungs but without any undue muscular effort or strain. The lungs may be held full after inhalation for a few moments, or empty after exhalation for a few moments to lengthen the cycle. The important thing is that the mind should direct its complete attention to the breath cycle. When this can be done for thirty minutes, proceed to “not-thinking.”
Not-ThinkingThe exercises of motionlessness and breathing may improve health, but they have no other intrinsic value aside from being a preparation for not-thinking, the beginnings of the magical trance condition. While motionless and breathing deeply, begin to withdraw the mind from any thoughts which arise. The attempt to do this inevitably reveals the mind to be a raging tempest of activity. Only the greatest determination can win even a few seconds of mental silence, but even this is quite a triumph. Aim for complete vigilance over the arising of thoughts and try to lengthen the periods of total quiescence.
Like the physical motionlessness, this mental motionlessness should be practiced at set times and also whenever a period of inactivity presents itself. The results should be recorded in your diary. (ebd.)
In Kombination der Annahme der Chaosmagie, dass das Geistige – verstanden als Gedankenprozesse in neuronalen Strukturen – nicht nur innerhalb des Körpers, sondern ebenso außerhalb desselben materielle Wirkungen hervorrufen kann, und der Annahme, dass eine bestimmte körperliche Verfasstheit für die magische Wirksamkeit von Magier\:innen notwendig, wenn auch nicht hinreichend ist, ergibt sich eine nachvollziehbare Argumentationslinie: Die Sorge um geistige und körperliche Gesundheit ist integraler Bestandteil magischer Praxis oder zumindest ein zentrales Anliegen derselben.
In dieser Perspektive positioniert sich Magie deutlich gegen ein medizinisch-psychiatrisches Paradigma, das den Menschen vorrangig als zu reparierende Funktionsinstanz innerhalb eines sozialen Systems behandelt. Stattdessen wird eine Form der Selbstsorge und Selbstermächtigung betont, die mentale Selbstverteidigung ebenso einschließt wie körperliche Fürsorge durch milde, natürliche Mittel. So heißt es bei Peter J. Carroll:
Magic is opposed to a psychiatry and medicine designed to patch up the damaged automaton and plug it back into the system. Instead, it would rather that individuals learn to handle their own mental self-defense and treat their bodies with gentler remedies such as herbs.— Peter J. Carroll, in: Psychonaut, Kapitel: „New Aeon Magic“
Wir sind also auf dem Weg von der Magie in die Psychosomatik und Psychotherapie.
Magie und Psychotherapie
Der Begriff „Magie“ ist der Psychotherapie keineswegs fremd. So etwa beim Konzept des „sicheren Ortes“: ein imaginierter innerer Rückzugsraum, der im Rahmen der Psychotherapie entwickelt wird und in belastenden Situationen Stabilität und Schutz bieten kann. Dieser Ansatz findet in verschiedenen therapeutischen Verfahren Anwendung, unter anderem bei der Traumatherapie. Verwandt sind der „Ort der Kraft“, der Schutz und innere Stärke gibt. Es sind gewissermaßen magische Orte, imaginiert, geistig und im Geiste besucht – und wirksam. Wer sich tiefer mit solchen Konzepten beschäftigen möchte, findet eine Vielzahl weiterführender Ansätze auf der Wikipedia-Seite „Liste von Psychotherapie- und Selbsterfahrungsmethoden“ (Link in den Shownotes).
Geneigte Leser:innen mögen sich fragen: worauf wollen die den jetzt hinaus? Unsere Exit-Stragie für die Parabel von Wissenschaft, Magie und Psychotherapie beginnen wir mit einem Zitat des britischen Mathematikers, Physikers und Science-Fiction-Schriftstellers Arthur C. Clarke. In einem kurzen Satz verbindet Clarke die scheinbar beziehungslosen Begriffe Magie und Technik sehr elegant und einleuchtend: Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
— Arthur C. Clarke In: „Hazards of Prophecy: The Failure of Imagination“ 1962
Der Begriff “advanced technology” ist eng mit einem wissenschaftlich geprägten Weltbild verknüpft und lässt sich in diesem Kontext am treffendsten mit “fortschrittliche” übersetzen. Es impliziert eine Bewegung in Richtung Zukunft. Semantisch verwandte Ausdrücke wie “accelerate the progress”, “move forward” oder “raise to a higher rank” verdeutlichen den inhärenten Fortschrittsgedanken. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Wortherkunft zunächst eine gegenteilige Richtung andeutet: Das lateinische “ab ante” bedeutet wörtlich von vorn oder “aus dem Vorher”, was eher eine Rück- als eine Vorwärtsbewegung nahelegt. Dennoch ist anzunehmen, dass Arthur C. Clarke mit der Verwendung des Begriffs “advanced technology” tatsächlich auf den Aspekt des Fortschritts abzielt, der der technologischen Entwicklung eingeschrieben ist.
Demnach erscheint eine Technologie, sobald sie einen bestimmten Entwicklungsstand überschritten hat, aus der Außenperspektive als Magie. Ihre bloße Existenz setzt jedoch einen kulturellen Kontext voraus, in dem sie nicht als magisch, sondern als technisch und rational erklärbar gilt. In der Kultur, in der die jeweilige Technologie entstanden ist, wird sie als solche erkannt und eingeordnet. (Wie aktuelle Entwicklungen im Bereich der großen Sprachmodelle diese klare Unterscheidung zwischen Technologie und Magie zunehmend herausfordern, soll an dieser Stelle lediglich angedeutet werden.)
Was Clarkes Satz so geschmackvoll macht ist die Verwandlung statischer Begriffe in einen dynamischen Prozess. Greifen wir mal hoch ins Regal und sagen, dass wir semantisch eine Form der Heisenbergschen Unschärferelation beobachten: Begriffe lassen sich nicht gleichzeitig eindeutig definieren und in ihrer Bedeutungsverschiebung begreifen.
In dieser Episode geht es nicht um Technik und Magie, sondern um Wissenschaft, Psychotherapie und Magie. Doch können wir Clarkes Satz problemlos weiter fassen, verallgemeinern, wenn wir sagen:
Jede unerklärliche Technik oder Praxis, die wiederholbare Veränderung bewirkt, erscheint wie Magie.
Mit dem wissenschaftlichen Blick und dieser Erkenntnis im Rücken, schauen wir noch einmal frisch auf die vorangegangenen Gedanken. Wenn wir evidenzbasierte psychotherapeutische Methoden mit Magie „alignen“ wollen, schauen wir zuerst auf die vordergründigen Definitionen der jeweiligen Begriffe. Arthur C. Clarke illustriert mit einfacher Eleganz, dass sich das Dinge sich verwandeln können und zwar nur weil sich die Definition der Begriffe sich wandeln. In seinem Statement wird aus Magie Technik, wenn die Fähigkeit gegeben ist, diese zu erkennen und zu erfassen. Landläufig würde man vielleicht sagen: wenn die Zeit reif ist.
It used to be said that magic was what we had before science was properly organized. It now seems that magic is where science is actually heading.
— Peter J. Carroll In: „Psychonaut“, Kapitel: „Introduction“
Das lasse ich mal so stehen. Und ich schließe diesen Post mit einem Zitat, dass mir (völlig anonymisiert) letzte Woche ein:e Patient:in mit in die Sitzung gebracht hat. Zufall??!. Es passt einfach so gut hier her:
Next, we consider the science of psychology. Incidentally, psychoanalysis is not a science: it is at best a medical process, and perhaps even more like witch-doctoring. It has a theory as to what causes disease—lots of different “spirits,” etc. The witch doctor has a theory that a disease like malaria is caused by a spirit which comes into the air; it is not cured by shaking a snake over it, but quinine does help malaria. So, if you are sick, I would advise that you go to the witch doctor because he is the man in the tribe who knows the most about the disease; on the other hand, his knowledge is not science.
— The Feynman Lectures on Physics (1963) > Vol I: The Relation of Physics to Other Sciences > 3-6 Psychology
Abschließend ein paar Gedanken zum Titelbild für diese Episode. Im Titel sollte „Chaosmagie“ vorkommen, so viel war klar, aber — wie in der Episode deutlich wird — sind wir keine Magier. Wir schauen von außen auf die magische Praxis, die in dieser Episode einen zentralen Platz hat und gleichzeitig aber nur ein Teil der Geschichte ist. Um das Coverbild zu erstellen, haben wir die KI bemüht und uns in den Vorgaben an dem Look & Feel anderer Bilder im Podcast-Universum orientiert, die sich mit Chaosmagie beschäftigen, bzw. in denen Menschen sprechen, die Chaosmagie praktizieren oder praktiziert haben. Die Chaosmagie ist nicht nur für Magier, sondern wird auch von Hexen und anderen praktiziert, weshalb wir den Menschen, der auf dem Titelbild abgebildet ist in Diversität auch androgyn gestalten wollten.

Jun 5, 2025 • 1h 35min
EGL079 Gedenkstätte Hohenschönhausen - eine Führung mit dem Zeitzeugen Hendrik Voigtländer
"Wenn ich jetzt rauskomme, da steht bestimmt jemand hinter der Tür und schlägt dir ins Gesicht. Konspirative Operation, Zersetzung des Menschen, es geht darum, dich zu brechen." Hendrik Voigtländer (Min 57:01)
Ali Hackalife vom Podcast "Auch-interessant" ist wieder in Berlin. Wir nutzen die Gelegenheit unsere Reihe zu historischen Orten fortzusetzen und besuchen die Gedenkstätte Hohenschönhausen. Hohenschönhausen war das zentrale Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit. Von 1951 bis 1989 war die Anstalt Haftort für zahlreiche meist politische Gefangene, die dort oft monatelang in Untersuchungshaft verbrachten. Wir haben eine Führung gebucht und werden von Hendrik Voigtländer über das Gelände geführt. Er ist einer der Zeitzeugen, die neben den Historiker*innen Führungen im Auftrag der Gedenkstätte anbieten. Hendrik hat wegen eines Fluchtversuches im November 1988 in Hohenschönhausen gesessen, bevor er von der BRD freigekauft wurde. Hendrik berichtet von den Haftbedingungen und Foltermethoden der Stasi. Er schildert eindringlich den Alltag und die Zersetzung, die im Januar 1976 in Kraft getretenen Richtlinie Nr. 1/76 offiziell von der Stasi als Methode zum Umgang mit Nicht-Linientreuen Staatsbürger*innen verabschiedet wurde. Leider ist die Tonqualität nicht immer optimal, aber wir haben in der Postproduktion alles gegeben, um das Beste rauszuholen. Wir hoffen, dass trotz der Tonqualität die großartige und eindrucksvolle Führung von Hendrik ansatzweise so rüberkommt, wie wir sie vor Ort erlebt haben.
Shownotes
Links zur Laufstrecke
EGL079 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
Auch-interessant.de | Ein Podcast von Ali Hackalife
Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen – Wikipedia
Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen: Führungen
Entrismus – Wikipedia
Talking about the World – with John Roderick | Auch-interessant.de
Krokodil im Nacken – Wikipedia
Klaus Kordon – Wikipedia
Zersetzung (Ministerium für Staatssicherheit) – Wikipedia
Stasi Tactics – Zersetzung | Max Hertzberg
Walter Ulbricht – Wikipedia
Goodbye DDR (Hörbuch-Download): Guido Knopp, Victor M. Stern, SAGA Egmont: Amazon.de: Bücher
Deutsche Demokratische Republik – Wikipedia
Erich Mielke – Wikipedia
Ministerium für Staatssicherheit – Wikipedia
Stasimuseum – Wikipedia
Gaslighting – Wikipedia
Sozialismus – Wikipedia
Gregor Gysi – Wikipedia
Werner Teske – Wikipedia
Nahschuss – Wikipedia
Josef Stalin – Wikipedia
Erika Riemann – Wikipedia
Schachnovelle – Wikipedia
Folter – Wikipedia
Dirk Zingler – Wikipedia
Wolfgang Vogel (Rechtsanwalt) – Wikipedia
Feature | Fluchtweg übers Bruderland – die bulgarisch-türkische Grenze | MDR.DE
Buch "Grenzschicksale - Als das Grüne Band noch grau war" - Grünes Band Sachsen-Anhalt
Brocken-Benno – Wikipedia
Gefangenensammeltransportwagen der Deutschen Reichsbahn – Wikipedia
Mitwirkende
Hendrik Voigtländer
(Führer und Zeitzeuge)
Ali Hackalife
YouTube (Channel)
Bluesky
Website
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen: Erinnerungsort sowjetischer und DDR Repression
Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen steht exemplarisch für die doppelte Diktaturerfahrung auf deutschem Boden im 20. Jahrhundert. Als authentischer Ort politischer Verfolgung unter sowjetischer Besatzung und SED-Herrschaft verkörpert sie die Kontinuitäten und Brüche kommunistischer Repressionspraxis zwischen 1945 und 1989.
Die sowjetische Phase (1945-1951) und der Übergang zur DDR-Kontrolle (1951)
Nach Kriegsende 1945 richtete der sowjetische Geheimdienst NKWD im Keller der ehemaligen Großküche der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt in Berlin-Hohenschönhausen ein Untersuchungsgefängnis ein. Diese als „Speziallager Nr. 3“ bezeichnete Einrichtung diente zunächst der Internierung von NS-Funktionären, entwickelte sich jedoch rasch zu einem Instrument politischer Säuberung. Hier wurden zunehmend Sozialdemokraten, bürgerliche Demokraten und vermeintliche „Klassenfeinde“ inhaftiert. Die Haftbedingungen in dieser frühen Phase waren von extremer Härte geprägt. Die Gefangenen vegetierten in überfüllten, fensterlosen Kellerzellen ohne sanitäre Einrichtungen. Systematische Unterernährung, Schlafentzug und physische Gewalt prägten den Haftalltag. Die Sterblichkeitsrate lag nach Schätzungen bei etwa 20 Prozent. Besonders perfide war das System der nächtlichen Verhöre, bei denen die Häftlinge durch psychischen Druck zu Geständnissen gezwungen wurden.Mit der Übergabe des Gefängnisses an das neu gegründete Ministerium für Staatssicherheit (MfS) im Jahr 1951 begann eine neue Phase der institutionellen Verfestigung. Die Stasi nutzte die bestehenden Strukturen und erweiterte sie systematisch. Zwischen 1951 und 1960 entstand auf dem Gelände ein moderner Gefängniskomplex mit über 200 Zellen und 100 Vernehmungsräumen, der als zentrale Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit fungierte.
Die Stasi-Ära: Perfektionierung psychologischer Zersetzung
Die bauliche Gestaltung des Gefängnisses folgte einem ausgeklügelten System totaler Kontrolle. Das „U-Boot“ genannte Kellergefängnis verfügte über ein komplexes Ampelsystem, das jeglichen Kontakt zwischen Gefangenen verhindern sollte. Die Zellen waren schallisoliert, die Gänge mit Teppichen ausgelegt, um die akustische Orientierung zu erschweren. Diese „Architektur der Einsamkeit“ zielte auf die vollständige Desorientierung und Isolation der Häftlinge.Die Staatssicherheit entwickelte in Hohenschönhausen ein ausgefeiltes System psychologischer Verhörmethoden, das in der Forschung als „operative Psychologie“ bezeichnet wird. Im Gegensatz zur physischen Folter der sowjetischen Phase setzte die Stasi auf subtilere Methoden der Persönlichkeitszersetzung. Dazu gehörten:
Systematische Desinformation über Angehörige
Inszenierung von Scheinprozessen
Einsatz von Zelleninformanten („Zellenspitzel“)
Wechsel zwischen Drohungen und Versprechungen
Erzwingung belastender Aussagen gegen Dritte
Häftlingsgruppen und Haftgründe
Die Mehrheit der in Hohenschönhausen Inhaftierten gehörte zur politischen Opposition der DDR. Dazu zählten Mitglieder von Widerstandsgruppen, Fluchthelfer, kritische Intellektuelle und Künstler. Prominente Häftlinge wie der Schriftsteller Jürgen Fuchs, die Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld oder die Künstlerin Bärbel Bohley prägten das kollektive Gedächtnis des Ortes. Eine zahlenmäßig bedeutende Gruppe bildeten gescheiterte Flüchtlinge und Ausreiseantragsteller. Die Kriminalisierung des Verlassens der DDR als „ungesetzlicher Grenzübertritt“ führte zu massenhaften Inhaftierungen. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Inhaftierung westlicher Staatsbürger, die als Faustpfand im Kalten Krieg dienten. Die Fälle von entführten oder unter Vorwänden verhafteten Westdeutschen und Westberlinern illustrieren die internationale Dimension der Staatssicherheit.
Die Transformation zum Erinnerungsort
Die friedliche Revolution 1989 führte zur Auflösung der Staatssicherheit und zur Öffnung ihrer Gefängnisse. Am 14. Dezember 1989 besetzten Bürgerrechtler das Gelände in Hohenschönhausen und verhinderten die Vernichtung von Akten. Die Initiative ehemaliger Häftlinge war entscheidend für die Sicherung des Ortes als Gedänkstätte.Berlin-Hohenschönhausen verkörpert paradigmatisch die Herausforderungen deutscher Erinnerungskultur nach 1989. Als authentischer Ort kommunistischer Repression bewahrt sie nicht nur materielle Zeugnisse politischer Verfolgung, sondern fungiert als lebendiger Lernort demokratischer Bildung.

May 22, 2025 • 1h 20min
EGL078 Das Rote Buch: C.G. Jung als Religionsstifter oder Wissenschaftler?
"Deine Stimme, den seltensten Wohllaut, wird man vernehmen im Gestammel des Ungeordneten, des Weggeworfenen und des als wertlos Verdammten." -- C.G. Jung: "Das Rote Buch" Liber Novus, Kapitel 8 "Gottes Empfängnis"
Zwischen Empirie und Vision, Wissenschaft und Glauben. Wir nehmen uns der Frage an: Wie unterscheidet sich klassische empirische Forschung von C.G. Jungs Ansatz einer "neuen empirischen Psychologie"? Jung verstand unter Empirie nicht nur die systematische Beobachtung äußerer Phänomene, sondern auch die methodische Erkundung innerer Erlebniswelten. Für viele überschreitet er spätestens da die Grenzen der Wissenschaft, indem er subjektive Überzeugungen in seine Methodik mit einschließt. Seine Psychologie basiert auf der Überzeugung, dass solche subjektiven Erfahrungen, insbesondere Träume, Imaginationen und archetypische Bilder, wissenschaftlich ernst genommen und erforscht werden können. Im Zentrum dieser Auseinandersetzung steht *Das Rote Buch*, eine Art psychologisches Tagebuch und zugleich ein symbolisch verdichteter Erfahrungsraum, in dem Jung seine eigenen inneren Bilder und psychischen Prozesse dokumentierte und interpretierte. Die über zehn Jahre dauernde Entstehung des Buches werden auch beschrieben als eine Zeit, in der Jung fast schon psychotische Phasen hatte und regressiv mit Holzklötzen seiner Kindheit spielte. Schwer erschüttert von der Trennung Freuds, öffnete er seine tiefenpsychologische Theorie symbolischen, mythologischen und spirituellen Dimensionen. Ist das noch Wissenschaft? Tune in an find out (what we think).
Shownotes
Links zur Laufstrecke
Eigentlich Podcast EGL078 Tour
Links zur Folge
Carl Gustav Jung - Wikipedia
C.G. Jung-Institut Zürich
Sternstunde Philosphie - Das Rote Buch von C.G. Jung YouTube
Jungs Methode der aktiven Imagination erklärt
Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie : Buch 1, Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie, Husserl, Edmund
Alien: Covenant, Film 2017, Regie: Ridley Scott
Contact, Film 1997, Regie: Robert Zemeckis
Die Empirie des Übersinnlichen (Hauke Heidenreich) C. G. Jungs Konzept des kollektiven Unbewussten als Umdeutung Kants zwischen Okkultismus, Religion und Parapsychologie
Placebo auf Wikipedia
Chaosforschung
Buch: Das Rote Buch von C.G. Jung (Abschnitt auf Wikipedia)
Jonathan Strange & Mr. Norrell, Susanna Clarke, 2004
Chaosforschung: Chaos im Kopf?: Die nichtlineare Dynamik kann helfen, epileptische Anfälle vorherzusagen und das Erregerzentrum zu lokalisieren
Mitwirkende
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Verwandte Episoden
EGL080 Chaosmagie und Psychotherapie: wissenschaftlicher Anspruch trifft magische WirkmachtEGL082 Zombies in Psychoanalyse: Jenseits des LustprinzipsEGL084 Sigmund Freud: seine „Outsider“ Biographie im Filmessay
Unsere Tour führt uns durch das Wuhletal in Berlin. Der Blick auf die Karte zeigt den schmalen Korridor der Natur, den wir mitten in der Stadt ablaufen. Das Erleben passt zur Folge: was wir Erleben, wie etwas scheint und was daran wirklich ist. Wir sprechen ja wieder über C.G. Jung, der sich an der Schnittstelle von Wissenschaft und Symbolik, von klinischer Psychologie und spiritueller Erfahrung bewegt. Ganz speziell werden wir in dieser Folge auch eine Passage aus dem „Das Rote Buch“ vorlesen. Wir sind beides: wohlwollend und kritisch. Kurzum: wir werden es niemandem recht machen.
Im Zentrum Jungs „neuer empirischen Psychologie“ steht die These, dass das Subjekt selbst – mit all seinen inneren Bildern, Affekten und Bedeutungszuschreibungen – nicht als Störgröße, sondern als Ursprung jeder Erkenntnis begriffen werden muss. Ausgehend von Jungs Biografie, insbesondere seiner Kindheitserfahrungen und der Trennung von Freud, untersucht dieser Essay das Rote Buch als ein paradigmatisches Werk individueller Empirie. Zugleich wird eine kritische Reflexion der klassischen wissenschaftlichen Methodologie geboten und gefragt, inwiefern Phänomene wie Placeboeffekte, archetypische Bilder oder chaotische Selbstorganisation eine Erweiterung unseres empirischen Selbstverständnisses notwendig machen.
Die klassische Wissenschaft versteht sich als objektiv, messbar und wiederholbar – ihre Verfahren beruhen auf einer möglichst großen Distanz zwischen Erkenntnissubjekt und -objekt. In der Psychologie allerdings stößt dieses Paradigma an seine Grenzen. Denn hier ist der Mensch nicht nur Beobachter, sondern auch Träger, Produzent und Medium der untersuchten Phänomene. C.G. Jung nahm diese Spannung ernst – und schlug einen radikal subjektiven Weg ein, den er dennoch als empirisch verstand.
Bereits in seiner Kindheit hatte Jung intensive innere Erlebnisse: Halluzinationen, Visionen, symbolische Bilder. Besonders prägend war die Szene auf dem Münsterplatz in Basel, in der ihm ein blasphemischer Gedanke erschien – und er diesen schließlich als göttlich inspiriert akzeptierte. Daraus leitete er eine persönliche Religiosität ab, die jenseits von Dogma und Institution lag: die direkte, psychische Erfahrung des Numinosen. Die Kirche, so sein Fazit nach der enttäuschenden Erstkommunion, sei für ihn „ein Ort des Todes“.
Zwischen 1914 und 1930 entstand das Rote Buch, ein visuelles und textuelles Monument der Selbstbeobachtung. Nach der Trennung von Freud, die Jung in eine tiefe Krise stürzte, begann er, seine Träume, Imaginationen und inneren Stimmen systematisch zu erkunden – und festzuhalten. Die Technik der aktiven Imagination, bei der das Unbewusste in einen Dialog mit dem Ich tritt, bildete das methodische Zentrum dieser Arbeit. Was sich hier zeigt, ist eine radikale, persönliche, aber dennoch strukturierte Form empirischer Erkenntnis.
Jungs Theorie des kollektiven Unbewussten, gespeist aus Mythen, Märchen und Archetypen, stellt die klassische Vorstellung individueller Erfahrung infrage. Auch in der klinischen Praxis – z.B. im Umgang mit Psychosen oder der Deutung von Symbolen – zeigt sich: Die Sprache der Seele ist keine lineare, sondern eine poetisch-symbolische. Das bedeutet auch: Psychische Symptome sind nicht bloß Störungen, sondern Träger von Bedeutung – und damit Teil einer subjektiven Sinnökonomie.
Wir machen einen kurzen Ausflug in sie Chaosforschung, die gezeigt hat, dass deterministische Systeme selbst bei minimalen Abweichungen unvorhersehbare Verläufe zeigen. Ursache und Wirkung müssen nicht so genau miteinander verknüpft sein, um von Naturwissenschaft sprechen zu können. Der Schmetterlingseffekt – entdeckt von Edward Lorenz – zeigt: Kleinste Ursachen können enorme Wirkungen haben. Die Chaosforschung ist auch der Neurophysiologie nahe, siehe das Beispiel zu Epilepsie in den Shownotes.
Wie durch ein Fenster öffnet sich zum Schluss noch ein literarischer Ausblick mit Jonathan Strange & Mr. Norrell auf den zweiten Teil der Episode. Die Episode endet nämlich ungeplant am höchsten Punkt der Tour.

May 8, 2025 • 1h 28min
EGL077 Auch interessant im Regierungsviertel
Ein Spaziergang mit Ali Hackalife durch die historische Mitte von Berlin.
Zum 2. Mal ist Ali Hackalife als Gast bei Eigentlich-Podcast. Ali betreibt den wunderbaren Podcast auch-interessant mit vielen spannenden Gästen und Themen. Das letzte Mal haben wir uns beim 38c3 in Hamburg getroffen. Diesmal ist Ali in Berlin und wir haben uns in der Friedrichsstraße zu einem gemeinsamen Rundgang durch das Regierungsviertel verabredet. Ali erzählt von seiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Linken zur Corona-Hochzeit: von den Herausforderungen im politischen System, den Bedenken gegenüber digitalen Technologien und der Desillusionierung durch parteipolitische Dynamiken, die oft wichtiger erscheinen als die Themen selbst. Wir sprechen auch über die historische und kulturelle Dimension der Denkmäler und Gebäude, die uns auf unserem Weg begegnen: Reichstag, Brandenburger Tor und Siegessäule. Ein zentrales Thema ist auch die Deutungshoheit über historische Orte und ihre künstlerischen Repräsentationen, wie etwa die Verhüllung des Reichstags durch Christo. Aber auch in dieser Frage gehen wir viel weiter in die Geschichte zurück, bis in die Jungsteinzeit. Ali ist gerade aus England zurück und hat viel über Stonehenge zu erzählen. In den 50er Jahren wurde Stonehenge komplett umgestaltet und in eine Form gebracht, die nach heutigem Stand der Wissenschaft nicht der ursprünglichen kulturellen Praxis entspricht. Am Beispiel des Denkmals für die ermordeten Juden Europas diskutieren wir auch die Frage, inwieweit historische Stätten und Denkmäler persönliches oder kollektives Gedächtnis stiften können. Es ist also ein Potpourri an Themen, das durch Orte und Geschichte führt, und Ali glänzt wie immer mit Detailwissen und Anekdoten. Viel Spaß beim Hören.
Shownotes
Links zur Laufstrecke
EGL077 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
Auch-interessant.de | Ein Podcast von Ali Hackalife
Denkende Maschinen: Ali Hackalife im Gespräch mit Dr. Christian Schröter : Hackalife, Ali: Amazon.de: Bücher
Denkende Maschinen - Hörbuch, ungekürzt
Regierungsviertel (Berlin) – Wikipedia
Reichstagsgebäude – Wikipedia
COVID-19-Pandemie – Wikipedia
iPhone 12 Pro – Wikipedia
Politikwissenschaft – Wikipedia
Verteilungsgerechtigkeit – Wikipedia
Corona-Warn-App – Wikipedia
Paul-Löbe-Haus – Wikipedia
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus – Wikipedia
Jakob Maria Mierscheid – Wikipedia
Tresor (Club) – Wikipedia
Französische Botschaft in Berlin – Wikipedia
Politische Immunität – Wikipedia
Brandenburger Tor – Wikipedia
Pariser Platz – Wikipedia
Raum der Stille
Die Linke – Wikipedia
Figura (Bürostuhl) – Wikipedia
Sturm auf den Reichstag – Wikipedia
Peter Altmaier – Wikipedia
Gregor Gysi im Gespräch mit Peter Altmaier - YouTube
Platz der Republik (Berlin) – Wikipedia
Siegessäule (Berlin) – Wikipedia
Otto von Bismarck – Wikipedia
Deutsche Einigungskriege – Wikipedia
Deutsch-Dänischer Krieg – Wikipedia
Deutsch-Französischer Krieg – Wikipedia
Welthauptstadt Germania – Wikipedia
Albert Speer – Wikipedia
Nord-Süd-Achse (Berlin) – Wikipedia
Große Halle – Wikipedia
Maschsee – Wikipedia
Marie-Elisabeth Lüders – Wikipedia
Paul Löbe – Wikipedia
Bundeskanzleramt (Deutschland) – Wikipedia
Verhüllter Reichstag – Wikipedia
Christo und Jeanne-Claude – Wikipedia
Reichskanzlei – Wikipedia
Hauptstadtbeschluss – Wikipedia
England – mit Christian Gürnth | Auch-interessant.de
Tate Gallery of Modern Art – Wikipedia
Anish Kapoor – Wikipedia
Marsyas (sculpture) - Wikipedia – Wikipedia
The Unilever Series: Anish Kapoor: Marsyas | Tate Modern
Anish Kapoor: Marsyas
Tate Modern to host the first ever Flux-Olympiad and other unique events as part of UBS Openings: The Long Weekend – Press Release | Tate
Drückjagd – Wikipedia
sich etwas durch die Lappen gehen lassen – Wiktionary
Geschichte Berlins – Wikipedia
Berlin-Neukölln – Wikipedia
Stonehenge – Wikipedia
Jungsteinzeit – Wikipedia
Sarsen – Wikipedia
Megalith – Wikipedia
Himmelsscheibe von Nebra – Wikipedia
v. u. Z. – Wikipedia
Pyramide (Bauwerk) – Wikipedia
Windmill Hill culture - Wikipedia – Wikipedia
Großsteingrab – Wikipedia
Woodhenge – Wikipedia
Glockenbecherkultur – Wikipedia
Reverse Engineering – Wikipedia
Experimentelle Archäologie – Wikipedia
Ägyptologie – Wikipedia
Merlin – Wikipedia
Stonehenge Free Festival – Wikipedia
Stonehenge-Monument mit Farbpulver beworfen - Festnahmen - Kulturnachrichten - Kultur - WDR
Schlacht um Berlin – Wikipedia
Sowjetisches Ehrenmal (Tiergarten) – Wikipedia
Guido Knopp – Wikipedia
Joseph Goebbels – Wikipedia
Theo Morell – Wikipedia
Traudl Junge – Wikipedia
EGL058 The Zone of Interest Teil 1: Der Holocaust und die Täter – Eigentlich-Podcast
Weimar – Wikipedia
Denkmal für die ermordeten Juden Europas – Wikipedia
Shahak Shapira – Wikipedia
Spreebogenpark – Wikipedia
Deutscher Bundestag - Betriebskindertagesstätte
Mitwirkende
Ali Hackalife
(Gasterzähler)
YouTube (Channel)
Bluesky
Website
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Berlins historische Wahrzeichen: Zwischen preußischer Vergangenheit und demokratischer Gegenwart
In der Mitte Berlins, wo sich heute das Regierungsviertel der Bundesrepublik Deutschland erstreckt, verdichtet sich die wechselvolle Geschichte einer Stadt und eines Landes auf einzigartige Weise. Die monumentalen Bauwerke und Denkmäler, die diesen Raum prägen, sind nicht nur architektonische Meisterwerke, sondern auch steinerne Zeugen deutscher Geschichte – vom Aufstieg Preußens über die Reichsgründung, zwei Weltkriege und die Teilung bis hin zur Wiedervereinigung und demokratischen Gegenwart. Eine Betrachtung dieser Wahrzeichen offenbart die komplexen Schichten der Berliner und deutschen Identität.
Die Siegessäule: Monument preußischer Machtentfaltung
Die Berliner Siegessäule, heute ein unverkennbares Symbol der Stadt, trägt in ihrer Geschichte die Spuren preußischer Machtpolitik und nationalsozialistischer Stadtplanung. Ursprünglich wurde das Monument 1873 auf dem damaligen Königsplatz (heute Platz der Republik) vor dem Reichstagsgebäude errichtet. Die Säule entstand als Denkmal für die drei siegreichen Kriege, die unter der Führung Preußens zur deutschen Einigung führten: den Deutsch-Dänischen Krieg von 1864, den Deutsch-Österreichischen Krieg von 1866 und den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71.
Die symbolische Bedeutung des Monuments ist vielschichtig: Das Bauwerk verkörpert den preußischen Militarismus und die Durchsetzung der kleindeutschen Lösung unter preußischer Führung. Die vergoldete, 8,3 Meter hohe Viktoria an der Spitze – im Volksmund liebevoll „Goldelse“ genannt – blickt triumphierend in den Himmel. Besonders bemerkenswert: Die Säule ist mit dem Metall von 16 erbeuteten dänischen, 35 österreichischen und 75 französischen Kanonen verziert, die zu vergoldeten Reliefs verarbeitet wurden – ein materialisierter Triumph über die besiegten Gegner.
Die heutige Position der Siegessäule ist das Ergebnis nationalsozialistischer Stadtplanung. Im Rahmen von Albert Speers megalomanischen „Germania“-Plänen wurde das Monument 1938/39 an seinen heutigen Standort am Großen Stern versetzt. Bei dieser Verlegung erhöhte man die Säule durch ein zusätzliches Segment von ursprünglich 50,7 auf 66,9 Meter – ein Eingriff, der die imperiale Symbolik des Monuments noch verstärkte. Die Säule wurde Teil der monumentalen Ost-West-Achse (heute Straße des 17. Juni), die als Paradestrecke und Machtdemonstration des NS-Regimes dienen sollte.
Die drei Einigungskriege: Preußens Weg zur Reichsgründung
Die Kriege, denen die Siegessäule gewidmet ist, markieren entscheidende Etappen auf dem Weg zur deutschen Einigung unter preußischer Führung. Der Deutsch-Dänische Krieg von 1864 entbrannte um die Zugehörigkeit der Herzogtümer Schleswig und Holstein. Preußen und Österreich kämpften gemeinsam gegen Dänemark und sicherten sich die Kontrolle über diese strategisch wichtigen Gebiete.
Nur zwei Jahre später, 1866, kam es zum Deutsch-Österreichischen Krieg, in dem Preußen gegen seinen ehemaligen Verbündeten antrat. Die Schlacht bei Königgrätz am 3. Juli 1866 brachte die Entscheidung zugunsten Preußens und beendete die österreichische Vorherrschaft im Deutschen Bund. Dieser Sieg ebnete den Weg für die preußische Dominanz in Deutschland und führte zur Gründung des Norddeutschen Bundes.
Der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71 vervollständigte schließlich den preußischen Einigungsprozess. Nach dem Sieg über Frankreich wurde am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles das Deutsche Kaiserreich proklamiert – mit dem preußischen König Wilhelm I. als deutschem Kaiser. Diese „Einigung von oben“ unter preußischer Führung prägte die politische Kultur des neuen Reiches nachhaltig.
Preußische Geschichte: Vom Königreich zur europäischen Großmacht
Die Geschichte Preußens, die in Berlins Architektur und Denkmälern allgegenwärtig ist, begann mit der Krönung Friedrichs III. von Brandenburg zum „König in Preußen“ am 18. Januar 1701 in Königsberg. Als Friedrich I. begründete er die preußische Monarchie, die in den folgenden zwei Jahrhunderten zur bestimmenden Macht in Mitteleuropa aufsteigen sollte.
Unter Friedrich II., genannt „der Große“ (1740-1786), erlebte Preußen seinen Aufstieg zur europäischen Großmacht. Durch militärische Erfolge wie die Eroberung Schlesiens im Österreichischen Erbfolgekrieg und durch innere Reformen wie die Förderung der Aufklärung, des Handels und der Landwirtschaft formte Friedrich ein modernes Staatswesen. Seine Bauten in Berlin und Potsdam – allen voran Schloss Sanssouci – zeugen bis heute von dieser Blütezeit.
Die napoleonische Ära brachte 1806 mit der vernichtenden Niederlage bei Jena und Auerstedt einen dramatischen Einschnitt. Doch die anschließende Reformzeit unter Staatsmännern wie Freiherr vom Stein und Wilhelm von Humboldt legte den Grundstein für die Modernisierung Preußens. Die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, die Bildungsreform und die Bauernbefreiung schufen die Voraussetzungen für den späteren Wiederaufstieg.
Die Ära Otto von Bismarcks (1862-1890) markierte schließlich den Höhepunkt preußischer Machtentfaltung. Als Ministerpräsident und später als Reichskanzler orchestrierte er die deutsche Einigung unter preußischer Führung. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Sturz der Monarchie 1918 verlor Preußen zwar seine Vormachtstellung, blieb aber als größtes Land der Weimarer Republik politisch bedeutsam. Die formelle Auflösung Preußens erfolgte erst 1947 durch den Alliierten Kontrollrat – ein symbolischer Schlussstrich unter eine Staatsidee, die Deutschland über Jahrhunderte geprägt hatte.
Berlin: Von der mittelalterlichen Doppelstadt zur Metropole
Die Geschichte Berlins beginnt lange vor dem Aufstieg Preußens. Die mittelalterliche Doppelstadt Berlin-Cölln, erstmals 1237 bzw. 1244 urkundlich erwähnt, entstand an einer günstigen Furt über die Spree. Im Jahr 1432 schlossen sich beide Städte zur „Berliner Union“ zusammen – ein erster Schritt zur Vereinigung, die 1709 mit der Gründung der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Berlin offiziell vollzogen wurde.
Mit der Krönung Friedrichs I. zum König in Preußen 1701 begann Berlins Aufstieg zur preußischen Hauptstadt. Die Stadt erfuhr unter den preußischen Herrschern eine umfassende bauliche Prägung. Friedrich Wilhelm I., der „Soldatenkönig“, erweiterte die Stadtmauern und schuf mit der Friedrichstadt ein neues Stadtviertel. Friedrich der Große ließ repräsentative Bauten wie das Forum Fridericianum (heute Bebelplatz) errichten und förderte die Ansiedlung von Handwerkern und Künstlern.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Berlin zur Industriemetropole. Die Bevölkerung wuchs explosionsartig von rund 170.000 Einwohnern im Jahr 1800 auf über 2 Millionen um 1900. Mit dem Groß-Berlin-Gesetz von 1920 entstand schließlich durch die Eingemeindung umliegender Städte und Dörfer die moderne Bezirksstruktur – ein administrativer Meilenstein, der Berlin zur flächenmäßig zweitgrößten Stadt Europas machte.
NS-Zeit und Stadtplanung: Speers „Germania“ und die Umgestaltung Berlins
Die nationalsozialistische Herrschaft hinterließ tiefe Spuren im Stadtbild Berlins. Albert Speer, Hitlers Architekt und späterer Rüstungsminister, entwickelte ab 1937 gigantomanische Pläne für die Umgestaltung Berlins zur „Welthauptstadt Germania“. Im Zentrum dieser Planungen stand eine monumentale Nord-Süd-Achse, die von einem 117 Meter hohen Triumphbogen im Süden bis zu einer 290 Meter hohen „Großen Halle“ im Norden reichen sollte.
Während die meisten Elemente von „Germania“ Planungen blieben, wurde die Ost-West-Achse, die heutige Straße des 17. Juni, teilweise verwirklicht. Die Verlegung der Siegessäule vom Königsplatz zum Großen Stern war Teil dieser Umgestaltung. Nach dem Reichstagsbrand am 27. Februar 1933, den die Nationalsozialisten als Vorwand für die Aushebelung demokratischer Grundrechte nutzten, tagte das Parlament nicht mehr im Reichstagsgebäude. Stattdessen wurde die Neue Reichskanzlei zum eigentlichen Machtzentrum des NS-Regimes.
Die „Germania“-Pläne offenbaren den totalitären Charakter des NS-Regimes: Architektur sollte hier nicht menschlichen Bedürfnissen dienen, sondern Macht demonstrieren und einschüchtern. Die wenigen realisierten Bauten wie das Reichsluftfahrtministerium (heute Bundesfinanzministerium) zeugen von diesem Anspruch. Die vollständige Umsetzung der Pläne hätte die historisch gewachsene Stadt weitgehend zerstört – ein Schicksal, das Berlin durch die Bombardierungen des Zweiten Weltkriegs dann auf andere, tragische Weise erlitt.
Das Reichstagsgebäude: Vom Kaiserreich zur Demokratie
Kein anderes Gebäude in Berlin verkörpert die Höhen und Tiefen deutscher Geschichte so eindrucksvoll wie das Reichstagsgebäude. Erbaut zwischen 1884 und 1894 nach Plänen des Architekten Paul Wallot, war es ursprünglich als Sitz des Reichstags des Deutschen Kaiserreichs konzipiert. Die berühmte Inschrift „Dem Deutschen Volke“ wurde erst 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, angebracht – ein spätes Zugeständnis an die demokratische Idee.
Am 9. November 1918, als der Erste Weltkrieg verloren war und die Monarchie zusammenbrach, verkündete Philipp Scheidemann vom Balkon des Reichstags die Republik. Während der Weimarer Zeit diente das Gebäude als parlamentarisches Zentrum, bis der Reichstagsbrand am 27. Februar 1933 den Nationalsozialisten als willkommener Vorwand für die Errichtung ihrer Diktatur diente. In der NS-Zeit tagte das gleichgeschaltete Parlament nicht mehr im Reichstag, sondern in der Krolloper.
Im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, wurde das Gebäude 1945 zum Schauplatz eines der ikonischsten Momente des 20. Jahrhunderts: Sowjetische Soldaten hissten die rote Fahne auf dem Dach – ein Bild, das zum Symbol für das Ende des Dritten Reiches wurde. Während der deutschen Teilung lag der Reichstag im britischen Sektor West-Berlins, nur wenige Meter von der Berliner Mauer entfernt. In den 1960er Jahren notdürftig renoviert, diente er für Ausstellungen und gelegentliche Sitzungen des Bundestags, ohne jedoch seine volle parlamentarische Funktion wiederzuerlangen.
Nach der Wiedervereinigung 1990 beschloss der Deutsche Bundestag, seinen Sitz von Bonn nach Berlin zu verlegen. Der britische Architekt Norman Foster wurde mit der umfassenden Renovierung des Reichstags beauftragt, die von 1995 bis 1999 dauerte. Das markanteste Element des erneuerten Gebäudes ist die gläserne Kuppel, die Besuchern einen Rundblick über die Stadt ermöglicht und gleichzeitig den Plenarsaal von oben einsehbar macht – ein bewusstes Symbol für die Transparenz der demokratischen Institutionen.
Die Reichstagsverhüllung: Kunstprojekt mit historischer Dimension
Bevor der Reichstag zum Sitz des Deutschen Bundestags umgebaut wurde, fand dort im Sommer 1995 eines der spektakulärsten Kunstprojekte des 20. Jahrhunderts statt: die Verhüllung des Reichstagsgebäudes durch die Künstler Christo und Jeanne-Claude. Die Idee entstand bereits 1971 bei einem Berlin-Besuch Christos, doch der Weg zur Realisierung war lang und steinig.
Nach mehreren abgelehnten Anfragen in den 1970er und 1980er Jahren und intensiver Lobby-Arbeit kam es am 25. Februar 1994 zu einer historischen Debatte im Deutschen Bundestag. Mit 292 zu 223 Stimmen – in einer fraktionsübergreifenden Abstimmung nach persönlicher Überzeugung – erteilten die Abgeordneten ihre Zustimmung zu dem Kunstprojekt.
Die Umsetzung erforderte jahrelange technische Studien, Windtests und statische Berechnungen. Für die Verhüllung wurden 100.000 Quadratmeter feuerfestes Polypropylengewebe und 15,6 Kilometer blaue Seile verwendet. Über 90 professionelle Kletterer und 120 Monteure arbeiteten vom 17. bis 24. Juni 1995 an der Installation. Das Kunstwerk war für 14 Tage, vom 24. Juni bis 7. Juli 1995, zu sehen und zog über 5 Millionen Besucher an.
Die Reichstagsverhüllung wurde vollständig durch den Verkauf von Christos Vorstudien und Kunstwerken finanziert – ohne Sponsoren oder öffentliche Gelder. Diese finanzielle Unabhängigkeit war den Künstlern wichtig, um ihre künstlerische Freiheit zu wahren.
Die Wirkung des Projekts ging weit über das Ästhetische hinaus. Die Verhüllung transformierte das historisch belastete Gebäude vorübergehend in ein abstraktes Kunstwerk und schuf Raum für neue Assoziationen. Paradoxerweise betonte die Verhüllung die Architektur, indem sie sie dem direkten Blick entzog. Das Projekt gilt heute als Meilenstein der Kunst im öffentlichen Ra und als Symbol für das wiedervereinigte Berlin.
Der befriedete Bezirk: Demokratische Sicherheitszone
Um das Reichstagsgebäude und die umliegenden Parlamentsgebäude erstreckt sich heute ein besonderer Bereich, der offiziell als „befriedeter Bezirk“ bezeichnet wird – im Volksmund oft „Bannmeile“ genannt. Dieser Bezirk umfasst neben dem Reichstagsgebäude auch das Paul-Löbe-Haus und das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus und wird im Norden etwa durch die Spree, im Osten durch die Wilhelmstraße, im Süden durch die Dorotheenstraße und im Westen durch die Scheidemannstraße und den Platz der Republik begrenzt.
Die Einrichtung dieses besonderen Bezirks dient dem Schutz der parlamentarischen Arbeit und hat historische Gründe: In der Weimarer Republik hatten Demonstrationen vor dem Reichstag wiederholt Druck auf die Abgeordneten ausgeübt. Das „Gesetz über befriedete Bezirke für Verfassungsorgane des Bundes“ regelt heute die Bestimmungen für diesen Bereich, in dem Demonstrationen und öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel grundsätzlich verboten sind. Ausnahmegenehmigungen können durch den Bundestagspräsidenten oder die Bundestagspräsidentin erteilt werden.
Neben dem Demonstrationsverbot gelten im befriedeten Bezirk weitere Beschränkungen, etwa für Foto-, Film- und Fernsehaufnahmen in bestimmten Bereichen, ein verschärftes Waffenverbot sowie die Erlaubnis für strenge Zugangskontrollen. Diese Maßnahmen dienen der Sicherheit der Verfassungsorgane und sollen die ungestörte Funktionsfähigkeit der Demokratie gewährleisten.
Das Brandenburger Tor: Vom Friedenstor zum Symbol der Einheit
Das Brandenburger Tor, 1788-1791 von Carl Gotthard Langhans im frühklassizistischen Stil erbaut, hat im Laufe seiner Geschichte einen bemerkenswerten Bedeutungswandel erfahren. Ursprünglich als Friedenstor konzipiert – die von Johann Gottfried Schadow geschaffene Quadriga trägt die Friedensgöttin Eirene –, wurde es später zum Symbol nationaler Identität und militärischer Triumphe. Nach dem Sieg über Napoleon 1814 wurde die von den Franzosen entwendete Quadriga zurückgebracht und mit dem Eisernen Kreuz und dem preußischen Adler ergänzt – ein Symbol des Triumphes über Frankreich.
Während der deutschen Teilung stand das Brandenburger Tor unmittelbar an der Berliner Mauer im sowjetischen Sektor und war für den normalen Verkehr gesperrt. Es wurde zum Symbol der schmerzlichen Trennung Deutschlands. Die Bilder vom 9. November 1989, als tausende Menschen auf der Mauer am Brandenburger Tor die Öffnung der Grenzen feierten, gingen um die Welt. Heute verbindet die Straße des 17. Juni – benannt nach dem Volksaufstand in der DDR 1953 – das Brandenburger Tor mit der Siegessäule und schafft so eine symbolische Achse, die verschiedene Epochen deutscher Geschichte verbindet.
Berlins Wahrzeichen als Spiegel deutscher Geschichte
Die historischen Wahrzeichen im Berliner Regierungsviertel erzählen die vielschichtige Geschichte einer Stadt und eines Landes. Von der preußischen Machtentfaltung über die Katastrophen des 20. Jahrhunderts bis zur demokratischen Gegenwart spiegeln sie die Brüche und Kontinuitäten deutscher Geschichte wider. In ihrer heutigen Nutzung und Symbolik sind sie nicht nur Erinnerungsorte, sondern auch lebendige Bestandteile einer demokratischen Kultur.
Die Transformation des Reichstagsgebäudes vom Symbol kaiserlicher und später nationalsozialistischer Macht zum transparenten Sitz eines demokratischen Parlaments steht exemplarisch für den Wandel, den Deutschland durchlaufen hat. Die gläserne Kuppel, die Besuchern einen Blick auf die Arbeit der Abgeordneten ermöglicht, verkörpert das Ideal einer offenen, bürgernahen Demokratie.
Berlins historische Wahrzeichen sind somit mehr als nur touristische Attraktionen – sie sind steinerne Zeugen einer komplexen Vergangenheit und zugleich Symbole für die Hoffnungen und Werte der Gegenwart. In ihrer Vielschichtigkeit fordern sie uns auf, Geschichte kritisch zu reflektieren und die Errungenschaften der Demokratie zu bewahren.
Stonehenge: Neues Licht auf ein altes Rätsel
Moderne Forschungsmethoden enthüllen die Geheimnisse eines der berühmtesten prähistorischen Monumente der Welt
Seit Jahrhunderten fasziniert Stonehenge Gelehrte und Laien gleichermaßen. Doch erst in den letzten Jahrzehnten haben revolutionäre wissenschaftliche Methoden begonnen, die Geheimnisse dieses enigmatischen Monuments zu lüften. Die gewaltigen Steinkreise auf der Salisbury-Ebene in Südengland erzählen heute eine weitaus komplexere Geschichte, als wir je vermutet hätten.
Die Revolution der archäologischen Methoden
Die wissenschaftliche Erforschung von Stonehenge begann im frühen 20. Jahrhundert mit konventionellen Ausgrabungen. Doch erst die Einführung moderner Technologien hat unser Verständnis grundlegend verändert. „Die Radiokarbondatierung war ein Wendepunkt“, erklärt Professor Mike Parker Pearson von der University College London. „Sie hat uns ermöglicht, die chronologische Entwicklung von Stonehenge präzise zu rekonstruieren und die Hauptbauphase auf etwa 3000-2000 v. Chr. zu datieren.“
Heute ermöglichen nicht-invasive Prospektionsmethoden wie Bodenradar, Magnetometrie und LIDAR Einblicke, ohne das Monument zu beschädigen. Das Stonehenge Hidden Landscapes Project hat mit diesen Techniken ein komplexes System aus bis zu 20 Schächten rund um Durrington Walls entdeckt – eine Sensation, die zeigt, wie viel noch unter der Oberfläche verborgen liegt.
Petrographische Untersuchungen haben einen der faszinierendsten Aspekte von Stonehenge enthüllt: Die kleineren „Blausteine“ stammen aus den Preseli-Bergen in Wales, etwa 250 Kilometer entfernt. „Die logistische Leistung, diese tonnenschweren Steine über solche Distanzen zu transportieren, ist beeindruckend“, sagt Dr. Richard Bevins vom National Museum of Wales. „Neueste Forschungen deuten sogar darauf hin, dass einige dieser Steine ursprünglich zu einem Steinkreis in Wales gehörten, der demontiert und nach Stonehenge transportiert wurde.“
Bioarchäologische Methoden liefern weitere Puzzleteile. Isotopenanalysen an menschlichen und tierischen Überresten geben Aufschluss über Ernährungsgewohnheiten und Migrationsmuster. Die Analyse alter DNA hat gezeigt, dass um 2500 v. Chr. – zeitgleich mit der Hauptbauphase von Stonehenge – ein signifikanter Bevölkerungsaustausch in Großbritannien stattfand, als kontinentale Gruppen der Glockenbecherkultur einwanderten.
Die sakrale Landschaft – mehr als nur ein Steinkreis
Eine der wichtigsten Erkenntnisse der modernen Forschung ist, dass Stonehenge nicht isoliert betrachtet werden darf. „Wir müssen Stonehenge als Teil einer komplexen rituellen Landschaft verstehen“, betont Dr. Susan Greaney von English Heritage. „Es war ein Element in einem ausgeklügelten System von Monumenten, die über Jahrhunderte entstanden sind.“
Die früheste Nutzung des Areals reicht bis etwa 8500 v. Chr. zurück, lange vor der Errichtung der berühmten Steinkreise. Die Hauptbauphase mit den massiven Sarsensteinen erfolgte um 2500 v. Chr. Zu dieser Zeit war die Landschaft bereits mit zahlreichen anderen Monumenten übersät: Grabhügeln, Prozessionswegen, Holzkreisen und dem nahegelegenen Siedlungskomplex von Durrington Walls.
Besonders aufschlussreich ist die duale Organisation dieser Landschaft. „Durrington Walls scheint als ‚Land der Lebenden‘ fungiert zu haben, mit Häusern und Hinweisen auf Feste und Zeremonien“, erklärt Professor Parker Pearson. „Stonehenge hingegen war das ‚Land der Toten‘, ein Ort für Bestattungen und Ahnenverehrung.“ Beide Bereiche waren durch rituelle Prozessionswege verbunden, die teilweise dem Lauf des Flusses Avon folgten.
Diese integrierte rituelle Landschaft funktionierte als komplexes System mit jahreszeitlichen Ritualen. Die präzise Ausrichtung von Stonehenge auf die Sonnenwenden – insbesondere die Wintersonnenwende – deutet auf einen ausgeklügelten Kalender hin, der kosmische Zyklen mit menschlichen Aktivitäten verband.
Rituale und Funktionen – ein kosmisches Theater
Die Frage nach der Funktion von Stonehenge hat Generationen von Forschern beschäftigt. Heute wissen wir, dass das Monument mehrere Funktionen erfüllte. Die präzise astronomische Ausrichtung ist unbestreitbar: Die Hauptachse ist exakt auf den Sonnenaufgang zur Sommersonnenwende und den Sonnenuntergang zur Wintersonnenwende ausgerichtet.
„Die Analyse von Tierknochen zeigt, dass die Hauptaktivitäten im Winter stattfanden, besonders zur Wintersonnenwende“, erläutert Dr. Jane Evans von der University of Leicester. „Dies deutet auf große Feierlichkeiten hin, zu denen Menschen aus ganz Großbritannien zusammenkamen.“
Stonehenge diente auch als Bestattungsort. Archäologen haben die Überreste von 150-240 Individuen gefunden, die meisten kremiert. Die Isotopen- und DNA-Analysen dieser Überreste deuten darauf hin, dass es sich um eine Elite handelte, die aus verschiedenen Regionen Britanniens stammte.
Interessanterweise gibt es Hinweise auf eine Verbindung zu Heilungsritualen. „Die überdurchschnittliche Zahl von Bestatteten mit Verletzungen könnte darauf hindeuten, dass Stonehenge als Ort der Heilung angesehen wurde“, erklärt Dr. Timothy Darvill von der Bournemouth University. „Einige der Blausteine aus Wales wurden möglicherweise wegen ihrer vermeintlichen heilenden Eigenschaften transportiert.“
Stonehenge erfüllte auch eine wichtige soziale Funktion. Der Bau erforderte die Koordination tausender Menschen und etwa 30.000 Arbeitstage – eine enorme Leistung für eine Gesellschaft mit schätzungsweise 200.000-300.000 Einwohnern in ganz Großbritannien. „Die Organisation eines solchen Projekts setzte komplexe soziale Strukturen voraus“, betont Dr. Colin Richards von der University of Manchester. „Der Bau selbst war vermutlich ebenso wichtig wie das fertige Monument – er schuf Gemeinschaft und stärkte soziale Bindungen.“
Die Gesellschaft hinter dem Monument
Wer waren die Menschen, die Stonehenge errichteten? Die archäologischen Befunde zeichnen das Bild einer komplexen Gesellschaft im Übergang von der Jungsteinzeit zur Bronzezeit. Die Region Wessex war mit etwa 10-20 Menschen pro Quadratkilometer relativ dicht besiedelt. Die Menschen lebten in kleinen Siedlungen mit 3-5 Häusern und etwa 20-50 Personen.
Die monumentale Phase von Stonehenge fällt zeitlich mit der Ausbreitung der Glockenbecherkultur zusammen, die um 2500 v. Chr. von Kontinentaleuropa nach Großbritannien kam. Diese Kultur ist durch charakteristische glockenförmige Keramikgefäße, frühe Metallurgie und standardisierte Bestattungssitten gekennzeichnet.
Ab etwa 2200 v. Chr. entwickelte sich im südlichen England die Wessex-Kultur, die zur frühen Bronzezeit gehört. Sie ist bekannt für reiche Grabbeigaben, internationale Handelskontakte und fortgeschrittene Metallurgie. Ein herausragendes Beispiel ist das Grab von Bush Barrow, in dem ein Häuptling mit goldenen Artefakten und einer kunstvollen „Sonnenscheibe“ bestattet wurde.
DNA-Analysen haben ein überraschendes Bild geliefert: Um 2500 v. Chr. wurde die neolithische Bevölkerung Großbritanniens weitgehend durch kontinentale Einwanderer ersetzt. „Diese demographische Veränderung fällt genau mit der Hauptbauphase von Stonehenge zusammen“, erklärt Dr. Ian Barnes vom Natural History Museum London. „Es ist verlockend, einen Zusammenhang zu vermuten, obwohl wir nicht wissen, ob dieser Bevölkerungsaustausch friedlich oder gewaltsam verlief.“
Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug etwa 30-35 Jahre. Die Ernährung basierte auf Getreide, Fleisch und gesammelten Nahrungsmitteln. Isotopenanalysen zeigen, dass zu bestimmten Zeiten, besonders zur Wintersonnenwende, bis zu 4.000 Menschen bei Durrington Walls zusammenkamen – vermutlich für große Feste und Zeremonien.
Religion und Kosmologie
Die religiösen Vorstellungen der Menschen von Stonehenge können nur indirekt erschlossen werden. „Reverse Engineering in der Archäologie bedeutet, von materiellen Hinterlassenschaften auf immaterielle Konzepte zu schließen“, erklärt Professor Timothy Insoll von der University of Exeter. „Bei prähistorischen Gesellschaften ohne Schrift ist dies besonders herausfordernd.“
Dennoch lassen sich einige Grundzüge rekonstruieren. Die Religion der Glockenbecherkultur und der Wessex-Kultur scheint stark von dualistischen Konzepten geprägt gewesen zu sein: Leben und Tod, Tag und Nacht, Sommer und Winter. Die kosmologische Bedeutung von Stonehenge mit seiner präzisen astronomischen Ausrichtung deutet auf eine enge Verbindung zwischen Himmelsbeobachtung und religiösen Vorstellungen hin.
„Die zyklische Ausrichtung neolithischer Heiligtümer ist ein weltweites Phänomen“, betont Dr. Clive Ruggles, Experte für Archäoastronomie. „Diese Monumente dienten als Vermittler zwischen kosmischen Zyklen und menschlichen Bedürfnissen. Sie waren gleichzeitig Kalender, Versammlungsorte und heilige Stätten.“
Ein ausgeprägter Ahnenkult scheint eine zentrale Rolle gespielt zu haben. Die Bestattungen in und um Stonehenge, oft mit standardisierten Beigaben und rotem Ocker, deuten auf komplexe Jenseitsvorstellungen hin. Die Grabhügeltradition der Wessex-Kultur mit wiederholten rituellen Handlungen an Gräbern verstärkt diesen Eindruck.
Wasser spielte ebenfalls eine wichtige rituelle Rolle, wie die Nähe zum Fluss Avon und Deponierungen von Artefakten in Gewässern zeigen. Mit der Zeit scheint die Religion hierarchischer geworden zu sein, parallel zur zunehmenden sozialen Stratifizierung in der Wessex-Kultur.
Kriegerische Auseinandersetzungen und gesellschaftlicher Wandel
Obwohl die Hauptnutzungszeit von Stonehenge oft als friedliche Periode dargestellt wird, gibt es Hinweise auf Konflikte. Der „Stonehenge Archer“, ein Mann, der um 2300 v. Chr. durch drei Pfeilspitzen getötet wurde, deutet auf gewaltsame Auseinandersetzungen hin.
Die massive demographische Veränderung um 2500-2200 v. Chr., die durch DNA-Analysen belegt ist, könnte ebenfalls nicht völlig friedlich verlaufen sein. Ab der mittleren Bronzezeit (ca. 1500 v. Chr.) gibt es deutlichere Anzeichen für eine zunehmende Militarisierung: Waffen werden häufiger in Grabbeigaben gefunden, und Schädelverletzungen nehmen zu.
„Viele prähistorische Konflikte könnten ritualisiert gewesen sein“, gibt Dr. Richard Osgood, Archäologe beim UK Ministry of Defence, zu bedenken. „Die Grenze zwischen Krieg und Ritual war vermutlich fließend.“
Stonehenge heute – ein konstruiertes Monument?
Ein wenig bekannter Aspekt von Stonehenge ist, dass sein heutiges Erscheinungsbild teilweise das Ergebnis moderner Eingriffe ist. Zwischen 1958 und 1959 wurden umfangreiche Restaurierungs- und Stabilisierungsarbeiten durchgeführt. Mehrere umgefallene Megalithen wurden wieder aufgerichtet und mit Betonfundamenten gesichert. Der Trilithon 6/7 wurde komplett rekonstruiert, mehrere Blausteine neu positioniert.
„Die Dokumentation war nach heutigen Maßstäben unzureichend“, kritisiert Dr. Heather Sebire von English Heritage. „Viele archäologische Kontexte gingen verloren. Das ikonische Bild von Stonehenge, das wir heute kennen, ist teilweise ein Produkt dieser Nachkriegsrestaurierung.“
Diese Erfahrungen haben die archäologische Praxis nachhaltig beeinflusst und zu strengeren konservatorischen Prinzipien geführt. Stonehenge steht damit in einer Reihe mit anderen berühmten archäologischen Stätten, die erhebliche Umgestaltungen erfahren haben – von Arthur Evans‘ Betonrekonstruktionen in Knossos bis zu den komplett neu aufgebauten Abschnitten der Chinesischen Mauer.
Ein komplexes Erbe
Die moderne Forschung hat unser Verständnis von Stonehenge revolutioniert. Was einst als isoliertes Monument betrachtet wurde, erscheint heute als Knotenpunkt in einem komplexen Netzwerk ritueller Landschaften. Die Menschen, die es errichteten, waren keine primitiven Barbaren, sondern Mitglieder einer hochentwickelten Gesellschaft mit beeindruckenden astronomischen Kenntnissen, logistischen Fähigkeiten und komplexen religiösen Vorstellungen.
Stonehenge verkörpert die Fähigkeit prähistorischer Gesellschaften, Gemeinschaftsprojekte von monumentalem Ausmaß zu realisieren. Es zeigt, wie Menschen vor mehr als 4.500 Jahren kosmische Zyklen mit ihrem Alltagsleben verbanden und eine Brücke zwischen Himmel und Erde, Leben und Tod, Vergangenheit und Zukunft schufen.
Die Erforschung von Stonehenge ist noch lange nicht abgeschlossen. Mit jeder neuen Technologie und jedem neuen Ansatz werden weitere Facetten dieses außergewöhnlichen Monuments enthüllt. Wie Professor Mike Parker Pearson es ausdrückt: „Stonehenge ist nicht ein Rätsel, das gelöst werden muss, sondern ein komplexes Erbe, das wir immer besser verstehen lernen.“

Apr 24, 2025 • 54min
EGL076 Abide with Me: Entstehung, Bedeutung und Vermächtnis von H. F. Lytes bekanntester Hymne
In Erinnerung an C.W.
In dieser Episode befassen wir uns mit dem schottisch-irischen anglikanischen Geistlichen, Dichter und Hymnenschreiber Henry Francis Lyte (1793–1847). Micz hat dieses Thema gewählt, weil er für die Beerdigung einer Kollegin und guten Freundin mit anderen „Abide with Me“ singt und einstudiert. (Ab ca. Minute 39 singt Micz die erste Strophe von „Abide with Me“ und interpretiert Text und Melodie.) Wir arbeiten uns anfangs durch viele Daten, Fakten und Zitate zum Leben, Glauben und Schaffen von Lyte. Dass Micz mit dieser Fülle an Fakten seine Emotionen der Trauer und Melancholie verdrängt, entdeckt Flo – der alte Psychotherapeut – bevor Micz draufkommt (ca. Minute 34, den Abwehrmechanismus könnten wir als Intellektualisierung oder Sublimierung benennen). Henry Francis Lyte wurde besonders bekannt durch seine Hymne „Abide with Me“, die er kurz vor seinem Tod 1847 verfasste. Lytes Kindheit war von familiären Umbrüchen und frühen Trennungen überschattet. Nach der Trennung seiner Eltern verließen diese ihn, und er lebte ab dem neunten Lebensjahr als Waise. Bereits in jungen Jahren begann Lyte, Gedichte zu schreiben, und zeigte außergewöhnliche sprachliche und geistige Begabung. Nach seinem Theologiestudium in Dublin und Cambridge trat Lyte in den kirchlichen Dienst ein und wirkte in mehreren Gemeinden, zuletzt über zwei Jahrzehnte lang in Brixham, Devon. Ein prägendes spirituelles Erlebnis am Sterbebett eines Mitbruders führte zu einer Vertiefung seines Glaubens und prägte seine spätere Theologie. Gesundheitlich war Lyte seit jungen Jahren angeschlagen. Seine Tuberkulose zwang ihn immer wieder zu Aufenthalten in wärmerem Klima – unter anderem in Südfrankreich und Italien. Er starb 1847 in Nizza, zuvor hatte er die letzte Version und Anmerkungen zu „Abide with Me“ nach England geschickt. Die Hymne vereint Lytes persönliche Glaubensgewissheit mit dem Wunsch göttlicher Nähe im Angesicht des Todes. Die Hymne wurde überkonfessionell bekannt, bei königlichen und staatlichen Trauerfeiern sowie Sportveranstaltungen gesungen und gehört bis heute zu den meistgeschätzten Kirchenliedern im englischsprachigen Raum. Schließlich finden wir noch zwei popkulturelle Referenzen, die von Lyte inspiriert scheinen: „Help“ von den Beatles und „Hey Hey, My My (Into the Black)“ von Neil Young.
Shownotes
Links zur Laufstrecke
EGL076 | Wanderung | Komoot
Lausitzer Platz Emmaus-Ölberg-Gemeinde Kirche
Lausitzer Platz Emmaus-Ölberg-Gemeinde Kirche: Herr bleibe bei uns denn es will abend werden
Drohnenflug Video um die und in der Kirche (Warnung: > 300MB)
Video 5 Min. über die Gemeinde auf WELT von 2019
Henry Francis Lyte, 1793-1847
The poetical works of the Rev. H. F. Lyte von John Appleyard 1907
"Henry Francis Lyte (1793-1847) - his life and times" by Evelyne Miller
Henry Francis Lyte im Dictionary of Ulster Biography
Oxford Dictionary of National Biography, 2004
"Abide with Me" Informationen
"Abide with me" auf Poets' Corner
Illustriertes Buch mit Text "Abide with me" 1878
Remains of the late Rev. Henry Francis Lyte, M.A., incumbent of Lower Brixham, Devon ; with a prefatory memoir von 1850
"Hymn Story: Abide With Me" By Clayton Kraby
Bibeltexte / Lukas 24
Lukas 24 in der Lutherbibel 1912
Übersetzungen Lukas 24,29 (Bleibe bei uns)
"Better to burn out than to fade away" Zitat
Kurt Cobain’s Suicide Note
"Hey Hey, My My (Into the Black)" Neil Young mit Zitat
Highlander Kurgan Church Scene - I Have Something To Say
Andere Melodien der Hymne
Dame Clara Butt - Abide with me (S. Liddle) 1922 or 1924
"Morecambe", Frederick C. Atkinson, 1870
"Penitentia", Edward Dearle, 1874
Noten: "Penitentia", Edward Dearle, 1874
"Woodlands", Walter Greatorex, 1916
Misc
Drowning by Numbers
Zauberberg Hörspiel
Noten für Abide with Me (Sopran und Alt) in Eb-Dur als PDF
Noten für Abide with Me (Tenor und Bass) in Eb-Dur als PDF
Rev Henry Francis Lyte (1793-1847) - Find a Grave Memorial
Mitwirkende
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Verwandte Episoden
EGL081 28 Years Later – Heart of Kindness: Eine Befreiung aus der deterministischen Apokalypse
Wir beginnen unsere Tour am Lausitzer Platz, direkt vor der Kirche der Emmaus-Ölberg-Gemeinde. Über dem Eingang entdecken wir die Inschrift: „Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden.“ Sie lehnt sich an eine Stelle aus dem Lukasevangelium an – Kapitel 24, Vers 29 –, in der zwei Jünger den auferstandenen Jesus bitten, bei ihnen zu bleiben, weil der Tag sich dem Ende neigt. In der englischen King James Version lautet der Satz: „Abide with us: for it is toward evening, and the day is far spent.“ Diese Worte sind nicht nur Teil einer biblischen Erzählung, sondern auch die direkte Inspiration für das bekannte Kirchenlied „Abide with Me“, das wir in dieser Episode besprechen.
Der original Notensatz der Melodie von Henry Francis Lyte aus dem Jahr 1847 zu seiner Hymne „Abide with Me“. Quelle: Henry Francis Lyte (1793-1847) – his life and times“ by Evelyne Miller
Die frühe Familiengeschichte von Henry Francis Lyte ist von Verlusten und dem Gefühl des Verlassenseins geprägt. Schon in jungen Jahren musste Lyte erleben, wie sich seine Eltern trennten und aus seinem Leben verschwanden. Auch seine Geschwister verlor er aus den Augen: Der eine ging vermutlich mit dem Vater fort, der andere starb gemeinsam mit der Mutter in England, ohne dass Henry je erfuhr, was mit ihnen geschehen war. Zurück blieb ein neunjähriger Junge – allein, ohne finanzielle Mittel, ohne Familie.
„(…) he abandoned his family and went to live in Jersey. Henry’s brother, Thomas, may have gone with him, or, he may have stayed at school in Enniskillen. Either way, there is no record of him from this point on. Anna Maria and her son George went back to England where, after a short time, both died and Henry never knew what had happened to them. He found himself, at the age of nine, alone and without any means of support.“
„Henry Francis Lyte (1793-1847) – his life and times“ von Eveline Miller
Eine zweite, prägende Stelle in Lytes Biographie, betrifft eine spirituelle Erfahrung etwa um 1816 oder 1817 – also zu Beginn seiner geistlichen Laufbahn. Lyte pflegte eine enge Freundschaft mit einem schwer kranken Mitgeistlichen oder Bekannten, der im Sterben lag. Der Name dieses Mannes wird in vielen Quellen nicht überliefert; mal wird er als „dying clergyman“, mal als „friend in ministry“ bezeichnet. Das Oxford Dictionary of National Biography benennt diese Person als „Abraham Swanne“., Doch entscheidend ist nicht der Name, sondern die Wirkung, die diese Begegnung auf Lyte hatte: Am Sterbebett dieses Freundes durchlebte er eine spirituelle Erschütterung, die sein ganzes Denken veränderte. Er selbst schrieb später, dass sich ihm in diesem Moment die Bedeutung von Jesu Leiden und Auferstehung zum ersten Mal wirklich erschlossen habe. Er habe, so unterschiedliche Quellen, danach begonnen auch intensiver zu predigen und sich mehr mit Erlösungstheologie auseinanderzusetzen.
„It was while at Marazion that Lyte underwent a spiritual experience at the deathbed of a neighbouring clergyman, Abraham Swanne. Lyte claimed that this encounter altered his whole view of life: he emerged with a deeper faith, and preached with a new vitality.“Oxford Dictionary of National Biography, 2004
Download Noten als PDF
Download der Noten mit der mehrstimmigen Melodie von William Henry Monk (1861):
Noten für Abide with Me (Sopran und Alt) in Eb-Dur als PDF
Noten für Abide with Me (Tenor und Bass) in Eb-Dur als PDF
Beginnend in der Zeit nach der Sterbebegleitung 1816/17 und bis zu seinem Tod 1847 litt Henry Francis Lyte an einer chronischen Lungenerkrankung, vermutlich Tuberkulose – jener Krankheit, an der 1921 auch John Keats gestorben ist, Autor des unvollendeten Gedichts Hyperion (siehe auch unsere gleichnamige Folge über Dan Simmons‘ Roman „Hyperion“). Trotz seiner schweren gesundheitlichen Beeinträchtigung blieb Lyte seiner Berufung treu: Er predigte weiterhin regelmäßig und war seelsorgerlich tätig. Auf ärztlichen Rat, zur Erholung ein milderes Klima aufzusuchen, unternahm er regelmäßig Reisen nach Europa, insbesondere in die Schweiz und an die südfranzösische Küste, in der Hoffnung.
Den Sommer 1847 verbrachte Lyte in Berry Head, wo er – geschwächt und inspiriert – sein bekanntestes Kirchenlied Abide with Me schrieb. Am 1. Oktober 1847 verließ er England erneut Richtung Süden. Bevor er abreiste, ließ er eine Kopie von Text und Musik bei seiner Tochter zurück, nahm jedoch das Original zur weiteren Überarbeitung mit sich. Aus Avignon schickte er schließlich das fertige Manuskript heimwärts – wohl wissend, dass er höchstwahrscheinlich nie mehr heimkehren würde.
Als er Nizza erreichte, verschlechterte sich sein Zustand drastisch. Am 20. November 1847 starb Henry Francis Lyte im Alter von 54 Jahren im Hôtel de Angleterre. In seinen letzten Stunden war Reverend Manning, der spätere Erzbischof von Westminster, an seiner Seite, der zufälligerweise im gleichen Hotel wohnte. Zwei Tage später wurde Lyte auf dem englischen Friedhof der Holy Trinity Church in Nizza beigesetzt.
„A volume of Remains, consisting of poems, sermons, and letters, was published in 1850. It included Abide with me, which was first sung (to his own tune) at his memorial service in Brixham in 1847.“The Dictionary of Ulster Biography
Pop-Kultur
In der Episode versucht Micz rauszuarbeiten, dass „Abide with Me“ mit dem prägnant dissonanten „Help“ vielleicht Inspiration für „Help!“ von den Beatles gewesen ist. Zweifelsohne eine steile These, aber verbindet beide Lieder doch die tiefe, existenzielle Sehnsucht nach Beistand in Zeiten innerer Not. Während Lytes Kirchenlied Gott als verlässliche Zuflucht im Angesicht von Krankheit und Tod anruft, artikuliert John Lennon in „Help!“ ein persönliches, fast verzweifeltes Rufen nach Halt und Orientierung in einer sich verändernden Welt. Beide Werke spiegeln den Wunsch nach Trost und eine Rückbesinnung auf etwas Größeres wider, wenn das eigene Ich ins Wanken gerät.
Als zweite gewagte Inspiration für die Pop-Kultur zaubert Micz das Zitat von Lyte aus dem Hut: „Better to wear out than to rust out“. Übersetzt in das 20te Jahrhundert liest es sich wie Neil Youngs Zeile „It’s better to burn out than to fade away“ aus ‘Hey Hey, My My (Into The Black)’, die später Kurt Cobain in seinem Abschiedsbrief zitierte. So hat es Lyte über Umwege wieder in die Kirche geschafft, denn in der ikonischen Kirchenszene aus „Highlander“ ruft „the“ Kurgan der Gemeinde zu: „I’ve got something to say: It’s better to burn out than to fade away“. Was Flo von diesen steilen Thesen hält? Listen and learn.

Apr 10, 2025 • 1h 1min
EGL075 Verbreitung der Gemeinwohl-Methode
Gemeinsam gestalten wir Wandel
Wieder eine Gast-Folge von Eigentlich-Podcast: Flo hat Rolf Behringer getroffen, Geschäftsführer des Vereins Solare Zukunft. Wir haben die Episode Anfang des Jahres aufgenommen und waren noch zum einen in euphorischer Stimmung direkt nach dem 38c3 zum anderen im Ungewissen, was da uns das Jahr bescheren wird. Wir sind uns aber einig, dass wir eine gesellschaftliche Resilienz aufbauen müssen, um demokratische Strukturen zu stärken. Hierfür setzt Rolf in seiner Projekt-Tätigkeit die Gemeinwohl-Methode ein. Rolf erläutert, wie diese Methode darauf abzielt, den Austausch und die Zusammenarbeit in der Zivilgesellschaft zu fördern. Dabei wird unter anderem die Auswahl zufälliger Bürgerinnen und Bürger strategisch eingesetzt, um repräsentative Ergebnisse zu erzielen und eine breitere Akzeptanz der Entscheidungen zu erreichen. Wir sprechen über die Herausforderungen, die es in der Gesellschaft gibt, wenn es um Klimawandel und Energiewende geht, und wie wichtig es ist, unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen, um die Akzeptanz zu steigern. Wir sind diesmal wieder in Kreuzberg unterwegs und trauen uns im Dunkeln in den Görlitzer Park, obwohl selbst Rolf als Freiburger weiß, dass dies ein NoGo-Area ist.
Shownotes
Links zur Laufstrecke
EGL075 | Wanderung | Komoot
Görlitzer Park – Wikipedia
Links zur Episode
Energiebildung ganz praktisch! - Solare Zukunft Webseite
Kochen mit der Sonne - ökobuch Verlag GmbH
Solarkocher – Wikipedia
Balkon-Photovoltaik-Anlagen - ökobuch Verlag GmbH
Balkonkraftwerk – Wikipedia
Solarmodul – Wikipedia
FahrradKino / FahrradDsico - Solare Zukunft Webseite
Energie – Wikipedia
Wattstunde – Wikipedia
Energiewende – Wikipedia
Gemeinwohl – Wikipedia
Die Gemeinwohl-Methode als PDF (Download)
Bürger*innen-Gutachten mit Planungszelle - Vortrag von Wolfgang Scheffler
BGP
Klimaratschule
Meeting Democracy
Auf einen Blick – Meeting Democracy
Mitwirkende
Rolf Behringer
(Erzähler)
Solare Zukunft
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Verwandte Episoden
EGL091 Sind wir in der solaren Zukunft angekommen? Ein Spaziergang durch die Solarstadt Freiburg mit Rolf Behringer
Demokratische Resilienz für den Klimaschutz: Die Gemeinwohl-Methode als Werkzeug für nachhaltige Veränderung
Rolf Behringer und das Fahrradkino: Erneuerbare Energie erlebbar machen
In einer Zeit, in der der Klimawandel immer spürbarer wird und lokale Lösungsansätze zunehmend an Bedeutung gewinnen, setzt sich Rolf Behringer mit innovativen Konzepten für einen nachhaltigen Gesellschaftswandel ein. Als treibende Kraft hinter dem Verein „Solare Zukunft e.V.“ hat er es sich zur Aufgabe gemacht, regenerative Energien und nachhaltige Lebensweisen in der Region zu fördern und gleichzeitig demokratische Prozesse zu stärken. Rolf, der ursprünglich aus dem Bereich der erneuerbaren Energien kommt, erkannte früh, dass technologische Lösungen allein nicht ausreichen, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Vielmehr braucht es ein Umdenken in der Gesellschaft und neue Formen der Beteiligung, um wirklich nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Mit seinem Verein „Solare Zukunft“ hat er in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte ins Leben gerufen, die sowohl das Bewusstsein für Klimaschutz schärfen als auch konkrete Handlungsoptionen aufzeigen. Die Bandbreite reicht von Solarprojekten über Energieberatungen bis hin zu Umweltbildungsmaßnahmen, die besonders Kinder und Jugendliche ansprechen.
Eines der kreativsten und gleichzeitig symbolträchtigsten Projekte ist das sogenannte „Fahrradkino“, das Behringer mit seinem Team entwickelt hat. Das Konzept ist ebenso einfach wie wirkungsvoll: Mehrere Fahrräder werden mit Generatoren ausgestattet und so miteinander verbunden, dass die durch das Treten erzeugte Energie gesammelt und für den Betrieb eines Filmprojektors genutzt werden kann. Die Zuschauer:innen produzieren also selbst den Strom, den sie für ihre Unterhaltung benötigen. Während der Filmvorführungen wechseln sich die Teilnehmenden auf den Fahrrädern ab, wodurch ein Gemeinschaftserlebnis entsteht, das weit über das passive Konsumieren von Filmen hinausgeht. „Es geht darum, Energie erfahrbar zu machen“, erklärt Behringer in seinen Vorträgen. „Die Menschen spüren am eigenen Körper, wie viel Kraft es braucht, um Strom zu erzeugen, und entwickeln dadurch ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem Energieverbrauch.“ Das Fahrradkino kommt bei Schulveranstaltungen, Stadtfesten und Umweltaktionstagen zum Einsatz und verbindet auf spielerische Weise die Themen Energieerzeugung, körperliche Aktivität und Gemeinschaftssinn.
Die Gemeinwohl-Methode: Ein Werkzeug für demokratische Resilienz
Doch wie können wir als Gesellschaft insgesamt mehr Demokratie leben und eine demokratische Resilienz aufbauen, die uns hilft, den vielfältigen Krisen unserer Zeit zu begegnen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Rolf schon lange und ist vor einiger Zeit auf die sogenannte Gemeinwohl-Methode gekommen, um demokratische Strukturen in der Gesellschaft zu stärken. In einer Zeit, in der Demokratien weltweit unter Druck stehen und polarisierende Kräfte zunehmen, braucht es neue Ansätze, um gemeinsame Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Die demokratische Resilienz einer Gesellschaft zeigt sich nicht nur in stabilen Institutionen, sondern vor allem in der Fähigkeit, konstruktiv mit Konflikten umzugehen und trotz unterschiedlicher Interessen zu gemeinwohlorientierten Entscheidungen zu gelangen. Genau hier setzt die Gemeinwohl-Methode an, die Rolf in den letzten Jahren intensiv weiterentwickelt und in verschiedenen Kontexten erprobt hat.
Die Gemeinwohl-Methode basiert auf dem Prinzip der deliberativen Demokratie und stellt einen strukturierten Prozess dar, bei dem eine zufällig ausgewählte, repräsentative Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern zu einem bestimmten Thema berät und Empfehlungen erarbeitet. Anders als bei herkömmlichen Beteiligungsverfahren steht dabei nicht die lauteste Stimme im Vordergrund, sondern die kollektive Weisheit einer vielfältigen Gruppe. Der Prozess beginnt mit der Auswahl der Teilnehmenden, wobei auf eine möglichst gute Abbildung der Bevölkerung nach Kriterien wie Alter, Geschlecht, Bildungsstand und kulturellem Hintergrund geachtet wird. In einem nächsten Schritt werden die Teilnehmenden umfassend über das zu behandelnde Thema informiert, wobei verschiedene Expertenmeinungen zu Wort kommen und unterschiedliche Perspektiven beleuchtet werden. Anschließend folgt eine intensive und kurze Beratungsphase, in der die Gruppe in moderierten Kleingruppen und im Plenum diskutiert, Argumente abwägt, priortisiert und clustert und schließlich zu gemeinsamen Empfehlungen gelangt. Diese Empfehlungen werden dokumentiert und an die zuständigen Entscheidungsträger weitergeleitet, wobei eine transparente Rückmeldung über den Umgang mit den Vorschlägen ein wichtiger Bestandteil des Prozesses ist.
Die Stärke der Gemeinwohl-Methode liegt in ihrer Fähigkeit, die Kluft zwischen Bürgerschaft und politischen Entscheidungsträgern zu überbrücken und komplexe Themen aus der Perspektive des Gemeinwohls zu betrachten. Durch den intensiven Austausch und die gemeinsame Erarbeitung von Lösungen entstehen oftmals innovative Ansätze, die in herkömmlichen politischen Prozessen übersehen werden. Zudem fördert die Methode das gegenseitige Verständnis und die Wertschätzung unterschiedlicher Perspektiven, was in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung von unschätzbarem Wert ist. „Es geht nicht darum, dass alle einer Meinung sind“, betont Behringer, „sondern darum, dass alle gehört werden und gemeinsam nach Lösungen suchen, die das Wohl aller im Blick haben.“ Die Gemeinwohl-Methode stärkt somit nicht nur die demokratische Kultur, sondern trägt auch dazu bei, qualitativ hochwertige und breit akzeptierte Entscheidungen zu treffen – gerade bei kontroversen Themen wie dem Klimaschutz, wo unterschiedliche Interessen und Wertvorstellungen aufeinandertreffen.
Klimarat Schule: Demokratie und Klimaschutz im Bildungssystem verankern
Ein besonders gelungenes Beispiel für die Anwendung der Gemeinwohl-Methode ist der „Klimarat Schule“, den Rolf zusammen mit engagierten Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern an mehreren Schulen in der Region und darüber hinaus initiiert hat. Das Projekt greift die Grundprinzipien der Gemeinwohl-Methode auf und passt sie an den schulischen Kontext an. Für den Klimarat werden per Losverfahren Schülerinnen und Schüler verschiedener Jahrgangsstufen ausgewählt, ergänzt durch Vertreterinnen und Vertreter des Lehrerkollegiums.
Ziel ist es, den CO2-Fußabdruck der Schule zu ermitteln und Maßnahmen zu erarbeiten, um diesen so gering wie möglich zu halten. Da sich die Schülerinnen und Schüler bereits intensiv mit den Themen auseinandergesetzt haben, können die Expert:innen aus der Schülerschaft kommen und Beiträge zu verschiedenen Handlungsoptionen liefern, z.B. von energetischen Sanierungsmaßnahmen über die Umstellung der Schulverpflegung bis hin zur klimafreundlichen Gestaltung des Schulwegs. In moderierten Workshops erarbeitet der Klimarat dann konkrete Vorschläge, wie die Schule klimafreundlicher gestaltet werden kann und welche Maßnahmen vorrangig umgesetzt werden sollten. Die Schülerinnen und Schüler erleben, dass sie selbst etwas bewirken können und dass demokratische Prozesse in kurzer Zeit zu greifbaren Ergebnissen führen. Diese Erfahrung stärkt nicht nur ihr Umweltbewusstsein, sondern auch ihr Vertrauen in demokratische Entscheidungsprozesse und ihre Fähigkeit zur aktiven Mitgestaltung.
Die Erfolge an den Schulen sind teilweise beeindruckend. An einer Schule konnte beispeilsweise der Energieverbrauch innerhalb eines Jahres um 15 Prozent gesenkt werden, was nicht nur der Umwelt zugutekommt, sondern auch erhebliche Kosteneinsparungen mit sich bringt. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die mit dem Fahrrad zur Schule kommen, hat sich deutlich erhöht, nachdem der Klimarat die Installation zusätzlicher Fahrradständer und die Einrichtung sicherer Radwege initiiert hat.
Besonders bemerkenswert ist die Veränderung in der Schulkultur: Klimaschutz ist nicht länger ein abstraktes Thema, das lediglich im Unterricht behandelt wird, sondern Teil des alltäglichen Schullebens. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ein Bewusstsein für ihren ökologischen Fußabdruck und setzen sich aktiv für eine nachhaltige Lebensweise ein – eine Haltung, die sie auch in ihr familiäres und soziales Umfeld tragen und so als Multiplikatoren wirken.
Die Gemeinwohl-Methode, wie sie im Klimarat Schule praktiziert wird, hat das Potenzial, weit über den schulischen Kontext hinaus Wirkung zu entfalten. Sie bietet ein Modell für eine partizipative Demokratie, die auf Dialog, gegenseitigem Respekt und der gemeinsamen Suche nach Lösungen basiert. In einer Zeit, in der der Klimawandel eine der größten Herausforderungen für die Menschheit darstellt und gleichzeitig demokratische Strukturen unter Druck geraten, brauchen wir genau solche Ansätze, die das Gemeinwohl in den Mittelpunkt stellen und die kollektive Intelligenz einer vielfältigen Gesellschaft nutzen. Rolf Behringer und sein Verein „Solare Zukunft“ zeigen mit ihren Projekten, dass lokales Handeln einen Unterschied machen kann und dass die Transformation zu einer klimafreundlichen Gesellschaft Hand in Hand gehen muss mit der Stärkung demokratischer Prozesse. Das Fahrradkino als anschauliches Beispiel für nachhaltigen Energiekonsum, die Gemeinwohl-Methode als Werkzeug für demokratische Entscheidungsfindung und der Klimarat Schule als praktische Anwendung dieser Prinzipien – sie alle tragen dazu bei, eine Kultur der Nachhaltigkeit und der demokratischen Teilhabe zu fördern, die für die Bewältigung der Klimakrise unerlässlich ist.

Mar 27, 2025 • 1h 1min
EGL074 Leon Theremin: Wie der russische Physiker elektronische Musik und Spionage-Technik revolutionierte
Thinker, Cellist, Soldier, Spy: Lev Termen
Wir beginnen diese Episode im Synthesizer-Museum Berlin und verquatschen uns eine halbe Stunde mit den Veranstalter:innen. Unbedingt hingehen und ansehen! Dann geht’s auf die Straße. Eigentlich kennt jede:r das Theremin – ein Instrument, das man spielt, ohne es zu berühren. Dahinter steckt der Erfinder Lev Termen und seine Geschichte als musikalischer Physiker, Spion, verliebt in die USA und Gefangener in Russland. 1919 baute er das Theremin, 1925 entwickelte er Russlands erstes Fernsehgerät. In den späten 1920ern reiste er durch Europa und die USA, zeigte seine Erfindungen. In den USA lebte er 11 Jahre, ließ sich scheiden, heiratete erneut und erfand das erste elektronische Rhythmusinstrument, das Rhythmicon. Die Weltwirtschaftskrise traf ihn schwer, ebenso Patentklagen, Steuerhinterziehung und seine Unfähigkeit als Geschäftsmann. Das Theremin wurde von anderen Instrumenten verdrängt. 1938 ließ sich Termen durch den KGB aus den USA schmuggeln. Zurück in der Sowjetunion landete er im Gulag. In dieser Zeit arbeitete er als Verurteilter und Gefangener für den Geheimdienst. 1945 baute er ein passives Abhörgerät, versteckt in einer hölzernen Nachbildung des Siegels der Vereinigten Staaten. 1945 wurde es als Geschenk an den US-Botschafter überreicht und blieb bis 1952 unentdeckt. Später kam Termen frei, arbeitete am Konservatorium in Moskau. In den USA dachte man, er sei seit Jahrzehnten tot, bis er nach dem Mauerfall wieder auftauchte – auch, um seine große Liebe von 1938 zu finden.
Shownotes
Links zur Laufstrecke
EGL074 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
Lev Termen aka Leon Theremin auf Wikipedia
Die Wanze von Termen: Das Ding auf Wikipedia
Leon Theremin: a Genius Inventor, a Spy, a Prisoner
Erfindungen von Lev Termen
Leon Theremin - is he the inventor of the television?
Termenvox – das klassische Theremin (1919–1920)
Alarmanlagen, die auf dem Theremineffekt beruhen (1920er Jahre)
Terpsiton – Plattform, um Tanz in Töne umzuwandeln (1932)
Theremincello – ein elektronisches Cello ohne Saiten (ca. 1930)
Rhythmicon – eine Art früher Drumcomputer (1932)
Leon Theremin’s Rhythmicon played by Andrei Smirnov | Loop
Das Theremin (Videos)
Leon Theremin plays "Deep Night" (1930)
MUSIC: Professor Theremin of Leningrad demonstrates music making invention.
The theremin - A short introduction to a unique instrument auf YouTube
Ennio Morricone - The Ecstasy of Gold - Theremin & Voice
Leon Theremin playing his own instrument
SFUK 2023 - From Leon Theremin to Bob Moog
Clara Rockmore: Virtuosin auf dem Theremin
Carolina Eyck: Theremin professional, German-Sorbian musician and composer
Hitchcock Film mit Theremin: Spellbound (1945)
Synthesizermuseum am Kottbusser Tor Berlin
Synthesizermuseum Home Page
Endai Hüdl bei Cremant Ding Dong - Taut mich auf wenn's wieder geil ist
Der Endai, der führt uns durch's Synthesizer Museum
Berliner Synthesizer Museum: Klangmaschinen im zweiten Stock | taz
Das Synthesizer Museum Berlin öffnet - KEYBOARDS
Micz als 'getting up every morning' im West-Berlin am Kotti 2008
Mitwirkende
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Noch einmal möchten wir uns für die kongeniale Einleitung zum Theremin im Synthesizer Museum am Kotti bedanken. Und wie persönlich versprochen, lieber Endai, hier die Nachreichung über den Hitchcock Film, in dem das Instrument vorkommt. Es handelt sich um Alfred Hitchcocks Spellbound (1945), für den der Komponist Miklós Rózsa das Instrument einsetzte, um die psychologische Spannung und die inneren Konflikte der Protagonisten musikalisch zu untermalen. Das sirenenhafte Theremin-Motiv und der surreale Sound des Instruments verstärkt die Traumsequenzen des Films, der sich, so Wikipedia, als einer der ersten filmisch mit der Psychoanalyse auseinandersetzte.
Thinker, Cellist, Soldier, Spy: Lev Termen
Episodentitel müssen immer deskriptiv sein. Sonst findet sie keine Suchmaschine, sonst klickt niemand darauf. Deshalb habe ich meinen schöneren Titel ins Episodenbild gebrannt und hier als Zwischenüberschrift genommen.
Lev Thermens Leben ist fast deckungsgleich mit dem 20ten Jahrhundert. Geboren 1896 in Sankt Petersburg, gestorben 1993 in Moskau und dazwischen auf der ganzen Welt als Pionier der Elektrotechnik und elektronischen Musik gefeiert, dann verschollen und schließlich in einer Männer WG in Moskau verstorben, war Leon Theremin ein Mann zwischen den Welten der Musik, der Wissenschaft und der Spionage-Technik.
Geboren in eine Familie mit französischen und deutschen Wurzeln, zeigte er früh eine Begabung für beides: Er studierte Cello am Sankt Petersburger Konservatorium und Physik an der Universität seiner Heimatstadt. Als junger Forscher leitete er ab 1919 das physikalisch-technische Institut in Petrograd und arbeitete mit dem Moskauer Institut für Musikwissenschaften zusammen. In dieser Zeit, genauer gesagt 1919/20, erfand er das Theremin, zunächst noch „Ätherophon“ genannt. Zwei Jahre später präsentierte er es in Moskau – eine Premiere, die so viel Aufsehen erregte, dass er 1921 persönlich zu Lenin in den Kreml gebeten wurde. Theremins Erfindung war eine Sensation für die Musik, geboren jedoch aus seiner elektrotechnischen Wissenschaft. Das Prinzip seines Instruments beruhte auf der Erforschung von Messgeräten für Dichte und Distanzen. Diese sensiblen Geäte, basierend auf Kondensator und Schwingrkreistechnik, reagierten äußerst sensibel auf Veränderungen im Feld, also der näheren Umgebung. Thermen musste dort also die Technik so verfeinern, dass seine Anwesenheit nicht die Messung verfälschte. Im Theremin machte er das Gegenteil: die Veränderung des Feldes durch Nähe und Bewegung bewirkten Tonhöhe, Vibrato und Lautstärke des Instruments.
Mit seiner „Geistermusik“ traf er den okkulten Nerv der 1920er Jahre und „verzauberte“ bald die ganze Welt. 1927 begann er eine internationale Tournee, die ihn ein Jahr später nach New York führte – eine Stadt, die er zu seinem neuen Zuhause machte. Dort arbeitete er eng mit der Musikerin Clara Rockmore zusammen, die das Theremin mit ihren virtuosen Darbietungen und technischen Anregungen weiterentwickelte. Das Instrument wurde in den USA patentiert, RCA übernahm die Produktion, und Leon (oder Leo, wie er sich nun nannte) Theremin baute sich eine neue Existenz auf. In seinem futuristischen Studio beeindruckte er die New Yorker High Society mit technischen Spielereien, während das Theremin parallel zum experimentellen Konzertinstrument avancierte. Dort sorgte es in einem Fall für körperliche Übelkeit des Publikums, durch die wuchtigen, tiefen Frequenzen, die kein akustisches Instrument in der Intensität herstellen konnte.
Durch die Weltwirtschaftskrise gebeutelt, seine eigene betriebswirtschafliche Unfähigkeit benachteiligt und eine Patentklage gehindert, sah sich Theremin gezwungen das Land zu verlassen. Inzwischen hatte er sich scheiden lassen und war mit Lavinia Williams verheiratet, die er nach 1938 nicht mehr wiedersehen würde. In diesem Jahr verschwand Leon Theremin aus New York unter mysteriösen Umständen, angeblich mit Hilfe des KGB. Zurück in der Sowjetunion wurde er verhaftet, offiziell wegen „antisowjetischer Propaganda“, und zu zehn Jahren Arbeitslager verurteilt. Zunächst verschlug es ihn in den Gulag nach Sibirien, doch schon bald fand er sich an einem anderen, ebenso geheimen Ort wieder: einer Moskauer Akademie für gefangene Wissenschaftler. Statt Musik zu machen, entwickelte er nun Flugzeugtechnik – später, nach der Auflösung der Akademie, wandte er sich der Spionage zu. Seine Erfindung „Das Ding“, eine raffinierte Wanze, die in der Dienstwohnung des US-Botschafters George F. Kennan installiert wurde, bescherte ihm 1952 den Stalinpreis Erster Klasse. Das Gefängnis durfte er nun verlassen, entschied sich jedoch, vorerst in vertrauter Umgebung weiterzuarbeiten – für den sowjetischen Geheimdienst, der seine außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten weiterhin zu schätzen wusste.
1964 tauchte Leon Theremin plötzlich wieder auf – ein Mann, den niemand mehr kannte. Innerhalb wie außerhalb der Sowjetunion war sein Name in Vergessenheit geraten, seine Geschichte ausgelöscht. Der KGB hatte ihm all seine Titel und Auszeichnungen aberkannt, alle Dokumente vernichtet. Selbst das physikalische Institut in Sankt Petersburg, an dem er einst seine bahnbrechende Erfindung gemacht hatte, behauptete noch in den 1990ern, nie von ihm gehört zu haben. Doch Theremin begann, sich sein Terrain zurückzuerobern. Er wurde Direktor der Abteilung für akustische Forschung am Moskauer Konservatorium, später wechselte er an die Physikalische Fakultät der Universität. Mitte der 60er-Jahre arbeitete er wieder mit Ingenieuren und Musikern im Studio für elektronische Musik des Skrjabin-Museums – ein Neubeginn nach Jahrzehnten im Schatten.
Parallel dazu widmete sich Theremin erneut seinen Erfindungen. Am Moskauer Konservatorium entwickelte er weiterführende Varianten seines berühmten Instruments, experimentierte mit neuen Klängen und Technologien. Nebenbei entstanden mehrere Terpsitone – eine tanzgesteuerte Variante des Theremins – sowie ein elektronisches Cello. Er, der einst mit bloßen Händen Musik formte, versuchte sich wieder Gehör zu verschaffen. Doch die Welt hatte sich weitergedreht.
Aus westlicher Sicht seiner Kolleg:innen und Vertrauten, galt er lange Zeit als längst verstorben – ein Phantom, das 1938 spurlos verschwand. Erst in den 1990er Jahren rückte er wieder ins Licht der Öffentlichkeit. 1990, kurz vor dem Zerfall der Sowjetunion, trat er in die KPdSU ein – ein Antrag, der ihm zuvor aus wechselnden Gründen verwehrt worden war. Nun aber wurde er international gewürdigt, reiste zu Ehrungen und Vorführungen seines legendären Instruments. Am 3. November 1993 starb er in Moskau im Alter von 97 Jahren – der „sowjetische Faust“, wie ihn Biograf Bulat Galejew nannte, ein Mann zwischen Wissenschaft und Magie, dessen Erbe noch immer in der Luft liegt.

Mar 13, 2025 • 1h 21min
EGL073 Chinesische Filme auf der Berlinale 2025: Living the Land, The Botanist und Girls on Wire
Familie, Wandel und Verletzlichkeit: Die leisen Stimmen im chinesischen Arthouse-Kino.
Februar ist Berlinale Zeit und Micz hat schon letzte Episode mit dem "Rocker"-Review vorgelegt. Jetzt zieht Flo nach und setzt seine vor zwei Jahren begonnene Reihe zu chinesischen Filmen auf der Berlinale fort. Dieses Jahr hat er sich "Living the land" und "Girls on wire" im Wettbewerb und "The Botanist" in der Sektion Generation angeschaut. Wir steigen gleich mit der fundamentalen Frage ein, inwieweit chinesische Filmemacher:innen unter den Bedingungen eines autokratischen Systems kritische Inhalte transportieren können. Wir wollen anhand dieser Filme untersuchen, ob, wie Micz am Anfang in den Raum stellt, westliche Rezensierende versuchen, Kritik zu finden, wenn Filme in autokratischen Systemen entstehen, die auch Zensur betreiben. Flo sieht in den übergreifenden Themen der Filme durchaus Themen, die auch in China kritisiert werden. Und damit auch eine erlaubte Kritik formulieren, die die chinesische Gesellschaft beschäftigt. In den Filmen "Living the Land" und "The Botanist" stehen Kinder im Mittelpunkt der Erzählung, die bei der Großmutter aufwachsen, weil ihre Eltern als Wanderarbeiter:innen die meiste Zeit abwesend sind. Wanderarbeiter:innen stellen in China die größte Binnenmigration der Welt dar. Viele Kinder wachsen bei Verwandten auf oder werden allein gelassen, weil ihre Eltern sie nicht mitnehmen können. Das von Mao Zedong eingeführte Meldesystem "Hukou" untersagt es chinesischen Bürger:innen, in einem anderen Teil des Landes Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen, als dort, wo man gemeldet ist. Da die Wanderarbeiter:innen nicht an einem festen Ort bleiben, können sie ihre Kinder nicht mitnehmen, da diese sonst keine Schulausbildung erhalten würden. Allen drei Filmen ist gemeinsam, dass die Familie als Ort der Identität und der Verletzlichkeit erfahren wird. Trotz des immensen Fortschritts in China ist die Familie nach wie vor ein starkes Band, das gerade auf dem Land die Perspektiven der nachwachsenden Generation maßgeblich bestimmt. Besonders deutlich wird dies in dem Film "Girls on Wire", den Micz und Flo gemeinsam gesehen haben. Der Film erzählt die düstere Geschichte zweier Cousinen, die zwischen Drogen, Familie und Filmindustrie gefangen sind. Die Figuren sind stark und verletzlich zugleich. Die Stellung der Frau in der chinesischen Gesellschaft, die Armut der Landbevölkerung, die Folgen der Ein-Kind-Politik, die zerrütteten Familienverhältnisse der Wanderarbeiter - diese Themen werden in der kleinen Auswahl chinesischer Filme auf der Berlinale angesprochen. Flo betont, dass diese Filme auch in China zum Arthouse-Genre gehören und nicht von einem chinesischen Massenpublikum gesehen werden. Obwohl diese Filme nur ein kleines Publikum erreichen, bieten sie uns einen wertvollen Einblick in die chinesische Gesellschaft.
Shownotes
Lauftrack
EGL073 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
Großer Bunkerberg – Wikipedia
| Berlinale | - Sheng xi zhi di | Living the Land
Living the Land – Wikipedia
Internationale Filmfestspiele Berlin 2025 – Wikipedia
Living the Land im Berlinale-Wettbewerb: fokussiertes Mehrgenerationenporträt aus China | rbb24
„Living the Land“ von Huo Meng: Vor der großen Landflucht | taz.de
Jeff Wall – Wikipedia
Die durch die Hölle gehen – Wikipedia
Ein-Kind-Politik – Wikipedia
Mao Zedong – Wikipedia
Großer Sprung nach vorn – Wikipedia
Große Chinesische Hungersnot – Wikipedia
Art College 1994 – Wikipedia
Mingong – Wikipedia
Hukou – Wikipedia
Shenzhen – Wikipedia
Chongqing – Wikipedia
Binnenmigration in China: Kann die städtische Integration gelingen? | China | bpb.de
Tian’anmen-Massaker – Wikipedia
Deepseek
| Berlinale | - Zhi Wu Xue Jia | The Botanist | Der Botaniker
Westchina – Wikipedia
Han (Ethnie) – Wikipedia
Ne Zha 2 – Wikipedia
Schillerpromenade – Wikipedia
Vivian Qu – Wikipedia
Feuerwerk am helllichten Tage – Wikipedia
Diao Yinan – Wikipedia
Oriental Movie Metropolis - Wikipedia
Mitwirkende
Florian Clauß
(Erzähler)
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Verwandte Episoden
EGL022 Chinesische Filme auf der Berlinale 2023: The Shadowless Tower, Tomorrow Is a Long Time und Art Collage 1994
Subtile Kritik im Schatten der Zensur: Neue Stimmen des chinesischen Kinos
Die Berlinale 2024 bot einen aufschlussreichen Einblick, wie chinesische Filmemacher:innen unter den Bedingungen staatlicher Kontrolle arbeiten. In einem System, das selbst die Äußerungen seiner Bürger:innen im Ausland überwacht, haben sich raffinierte Wege der indirekten Kritik entwickelt. Statt frontaler Systemkritik nutzen Künstler:innen gesellschaftlich akzeptierte Diskurse: Die Umweltbewegung findet Gehör, der Stadt-Land-Konflikt wird offen diskutiert, und auch die Folgen der mittlerweile gelockerten Ein-Kind-Politik – eine alternde Gesellschaft und der demographische Männerüberschuss auf dem Land – können thematisiert werden.
Besonders das Schicksal der Wanderarbeiter:innen und ihrer zurückgelassenen Kinder zieht sich wie ein roter Faden durch das aktuelle chinesische Kino. Die dadurch entstehenden familiären Zerrüttungen, bei denen Kinder ihre Eltern kaum kennen oder ganz allein aufwachsen müssen, spiegeln sich in zwei der drei vorgestellten Filme wider.
„Living the Land“ – Ein Meisterwerk des neuen chinesischen Kinos
Huo Mengs mit dem Silbernen Bären ausgezeichnetes Gesellschaftsporträt spielt 1991 in einem chinesischen Dorf, zu einer Zeit, als China am Beginn seines wirtschaftlichen Aufstiegs stand. Der Film folgt dem 10-jährigen Chuang durch ein Jahr voller Umbrüche. Seine Eltern arbeiten in der Boom-Stadt Shenzhen, während er bei Verwandten lebt – eine Konstellation, die heute Millionen chinesischer Kinder betrifft.
Zwischen Tradition und Moderne
Die Geschichte beginnt symbolträchtig mit der Umbettung eines hingerichteten Vorfahren und entwickelt sich entlang der vier Jahreszeiten. In präzise komponierten Bildern, die an impressionistische Gemälde erinnern, entfaltet sich ein komplexes Familiengeflecht: Die junge Tante Xiuying, deren ungewollte Schwangerschaft in eine Zwangsheirat mündet, der geistig behinderte Cousin Jihua und die Urgroßmutter als traditionelles Familienoberhaupt.
Der Film besticht durch seine authentische Darstellung des Landlebens. In langen, ungeschnittenen Einstellungen dokumentiert er die Weizenernte, Familienfeste und den verzweifelten Versuch der Modernisierung durch den Kauf eines Traktors. Die erdige Farbpalette und die distanzierte Kameraführung unterstreichen den dokumentarischen Charakter.
Gesellschaftlicher Wendepunkt
Wie der Regisseur auf der Berlinale-Pressekonferenz betonte, geht es ihm um die Verknüpfung des massiven Wandels mit intimen Momenten. Der Film zeigt den Zusammenprall zwischen technischem Fortschritt und tausendjähriger Agrartradition. Besonders beeindruckt die Darstellung der Frauenrollen, deren Resilienz und harte Arbeit das Überleben der Familie sichern.
Symbolische Tiefe und visuelle Kraft
Die Farbkodierung des Films arbeitet gezielt mit Weiß für Tod und Begräbnisse sowie Rot für Blut und Hochzeiten. Besonders eindrücklich sind die Szenen, in denen diese Symbolik zusammenfließt – etwa wenn Blut im Wasser zu sehen ist. Der Film entwickelt dabei eine fast physische Präsenz: Man meint, die kühle Herbstluft zu spüren, wenn Feuerwerk gezündet wird oder Holz verbrennt.
Das abrupte Ende mit dem im Matsch festgefahrenen Traktor wird zum vieldeutigen Symbol für eine Gesellschaft im Umbruch. Der Film schließt damit einen Bogen, der mit der Ausgrabung des hingerichteten Urgroßvaters begann und über surreale Momente – wie nach dem Tod des geistig behinderten Sohnes – bis zur Andeutung der kommenden Landflucht führt.
„The Botanist“ – Poetische Annäherung an eine verschwindende Welt
Das Regiedebüt von Jing Yi verlegt seine Geschichte in das Xinjiang-Tal und erzählt von der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen dem kasachischen Jungen Arsin und dem han-chinesischen Mädchen Meiyu. Wie in „Living the Land“ steht auch hier ein Kind von Wanderarbeitern im Zentrum, das bei seiner Großmutter aufwächst.
Zwischen Realität und Poesie
Die Geschichte wird als Erinnerung von Arsins Onkel Bek erzählt, der nach Unruhen aus Beijing aufs Land flüchten musste. Der Film entwickelt eine traumähnliche Erzählweise, in der surreale Elemente wie ein Pferde-Poet die realistische Handlung durchbrechen. Die Sprachbarriere zwischen den Hauptfiguren wird durch gemeinsames Spielen und Erkunden überwunden.
Kritische Stimmen
Während die Bildgestaltung und die Dokumentation der unterrepräsentierten kasachischen Kultur gelobt werden, kritisieren viele Stimmen die fehlende narrative Struktur. Anders als seinem großen Vorbild Bi Gan gelingt es dem Regisseur nicht, eine hypnotische Wirkung zu erzeugen. Die angestrebte Naturverbundenheit des Protagonisten wirkt oft konstruiert, die Verbindung zur Botanik bleibt oberflächlich.
„Girls on Wire“ – Familiendrama im modernen China
Vivian Qus Film verwebt geschickt verschiedene Genres zu einer Aussage über die Position junger Frauen in der chinesischen Gesellschaft. Die Geschichte der Cousinen Tian Tian und Fang Di, die wie Schwestern aufwuchsen und durch dramatische Umstände wieder zusammengeführt werden, entwickelt sich von einem Familiendrama zu einem spannungsgeladenen Thriller.
Komplexe Charakterstudie
Fang Di arbeitet als Stuntfrau in einem Filmstudio und unterstützt ihre Familie finanziell, während Tian Tian sich in den Fängen der Drogenmafia wiederfindet. Ihre erste Begegnung wird symbolträchtig auf den Tag der Hongkong-Übergabe datiert. Der Film nutzt die „Drähte“ des Titels als durchgängige Metapher für die Fremdbestimmung seiner Protagonistinnen.
Zwischen den Genres
Die Regisseurin balanciert geschickt zwischen verschiedenen Tonlagen: Comic-Relief-Szenen im Filmstudio lockern die dramatische Grundstimmung auf. Dennoch kritisieren viele Rezensenten die unausgewogene Mischung aus Melodrama, Comedy und drastischer Gewalt. Die schauspielerischen Leistungen von Wen Qi und Liu Haocun werden durchweg gelobt, können aber nicht über strukturelle Schwächen hinwegtäuschen.
Neue Wege der Gesellschaftskritik
Die drei Filme zeigen exemplarisch, wie das chinesische Kino kritische Themen verhandelt, ohne mit der Zensur in Konflikt zu geraten. Ob durch historische Distanz wie in „Living the Land“, poetische Verfremdung wie in „The Botanist“ oder Genre-Hybridisierung wie in „Girls on Wire“ – alle finden ihre eigene Sprache für die Darstellung gesellschaftlicher Missstände. Dabei gelingt es besonders Huo Meng, aus den Beschränkungen künstlerische Kraft zu gewinnen und ein wahrhaft großes Gesellschaftsporträt zu schaffen.
Die Filme dokumentieren zudem den rasanten Wandel der chinesischen Gesellschaft und seine sozialen Kosten. Sie erinnern daran, dass hinter den beeindruckenden Wirtschaftszahlen menschliche Schicksale stehen – besonders die der zurückgelassenen Kinder, deren Geschichten hier stellvertretend für Millionen erzählt werden.


