
 Eigentlich Podcast
Eigentlich Podcast EGL075 Verbreitung der Gemeinwohl-Methode
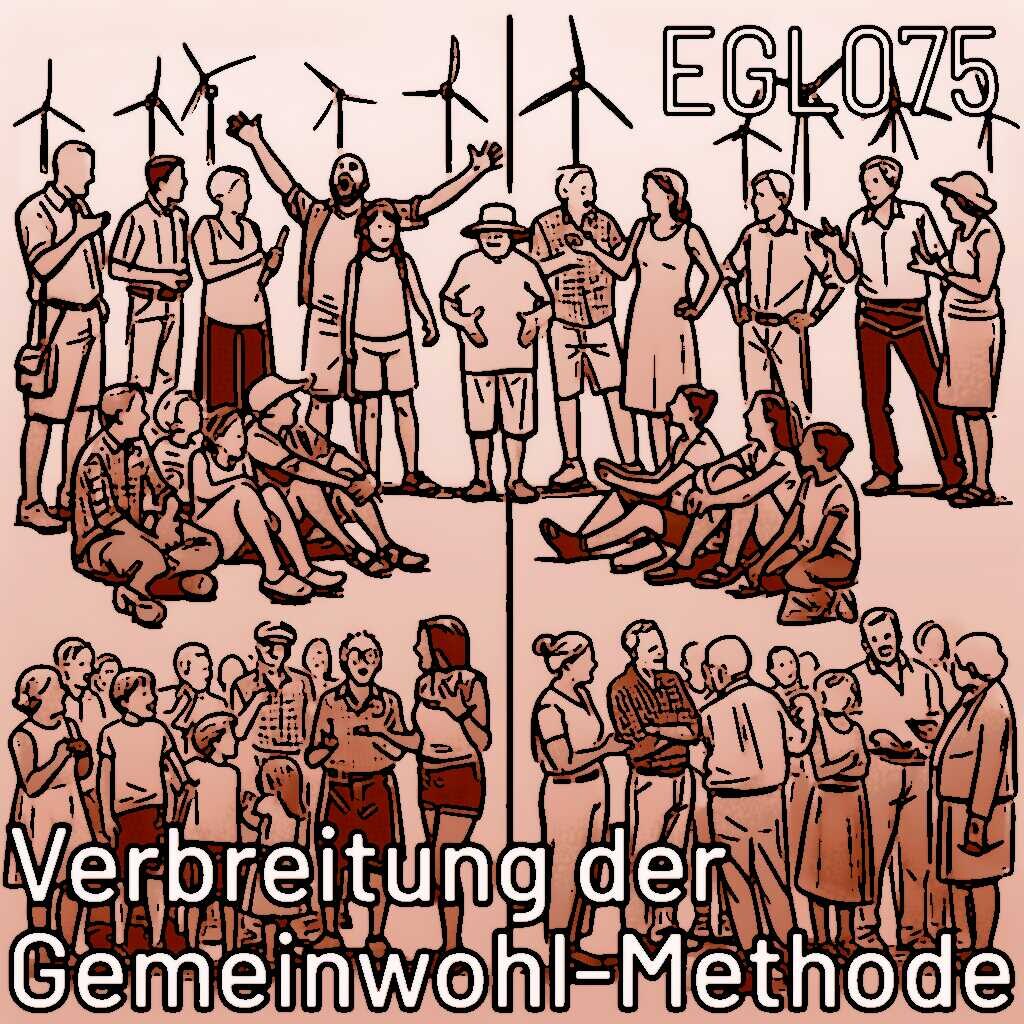 Gemeinsam gestalten wir Wandel
Gemeinsam gestalten wir Wandel
Wieder eine Gast-Folge von Eigentlich-Podcast: Flo hat Rolf Behringer getroffen, Geschäftsführer des Vereins Solare Zukunft. Wir haben die Episode Anfang des Jahres aufgenommen und waren noch zum einen in euphorischer Stimmung direkt nach dem 38c3 zum anderen im Ungewissen, was da uns das Jahr bescheren wird. Wir sind uns aber einig, dass wir eine gesellschaftliche Resilienz aufbauen müssen, um demokratische Strukturen zu stärken. Hierfür setzt Rolf in seiner Projekt-Tätigkeit die Gemeinwohl-Methode ein. Rolf erläutert, wie diese Methode darauf abzielt, den Austausch und die Zusammenarbeit in der Zivilgesellschaft zu fördern. Dabei wird unter anderem die Auswahl zufälliger Bürgerinnen und Bürger strategisch eingesetzt, um repräsentative Ergebnisse zu erzielen und eine breitere Akzeptanz der Entscheidungen zu erreichen. Wir sprechen über die Herausforderungen, die es in der Gesellschaft gibt, wenn es um Klimawandel und Energiewende geht, und wie wichtig es ist, unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen, um die Akzeptanz zu steigern. Wir sind diesmal wieder in Kreuzberg unterwegs und trauen uns im Dunkeln in den Görlitzer Park, obwohl selbst Rolf als Freiburger weiß, dass dies ein NoGo-Area ist.
Shownotes
- Links zur Laufstrecke
- EGL075 | Wanderung | Komoot
- Görlitzer Park – Wikipedia
- Links zur Episode
- Energiebildung ganz praktisch! - Solare Zukunft Webseite
- Kochen mit der Sonne - ökobuch Verlag GmbH
- Solarkocher – Wikipedia
- Balkon-Photovoltaik-Anlagen - ökobuch Verlag GmbH
- Balkonkraftwerk – Wikipedia
- Solarmodul – Wikipedia
- FahrradKino / FahrradDsico - Solare Zukunft Webseite
- Energie – Wikipedia
- Wattstunde – Wikipedia
- Energiewende – Wikipedia
- Gemeinwohl – Wikipedia
- Die Gemeinwohl-Methode als PDF (Download)
- Bürger*innen-Gutachten mit Planungszelle - Vortrag von Wolfgang Scheffler
- BGP
- Klimaratschule
- Meeting Democracy
- Auf einen Blick – Meeting Democracy
Mitwirkende
- Rolf Behringer (Erzähler)
- Florian Clauß
Verwandte Episoden
Demokratische Resilienz für den Klimaschutz: Die Gemeinwohl-Methode als Werkzeug für nachhaltige Veränderung
Rolf Behringer und das Fahrradkino: Erneuerbare Energie erlebbar machen
In einer Zeit, in der der Klimawandel immer spürbarer wird und lokale Lösungsansätze zunehmend an Bedeutung gewinnen, setzt sich Rolf Behringer mit innovativen Konzepten für einen nachhaltigen Gesellschaftswandel ein. Als treibende Kraft hinter dem Verein „Solare Zukunft e.V.“ hat er es sich zur Aufgabe gemacht, regenerative Energien und nachhaltige Lebensweisen in der Region zu fördern und gleichzeitig demokratische Prozesse zu stärken. Rolf, der ursprünglich aus dem Bereich der erneuerbaren Energien kommt, erkannte früh, dass technologische Lösungen allein nicht ausreichen, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Vielmehr braucht es ein Umdenken in der Gesellschaft und neue Formen der Beteiligung, um wirklich nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Mit seinem Verein „Solare Zukunft“ hat er in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte ins Leben gerufen, die sowohl das Bewusstsein für Klimaschutz schärfen als auch konkrete Handlungsoptionen aufzeigen. Die Bandbreite reicht von Solarprojekten über Energieberatungen bis hin zu Umweltbildungsmaßnahmen, die besonders Kinder und Jugendliche ansprechen.
Eines der kreativsten und gleichzeitig symbolträchtigsten Projekte ist das sogenannte „Fahrradkino“, das Behringer mit seinem Team entwickelt hat. Das Konzept ist ebenso einfach wie wirkungsvoll: Mehrere Fahrräder werden mit Generatoren ausgestattet und so miteinander verbunden, dass die durch das Treten erzeugte Energie gesammelt und für den Betrieb eines Filmprojektors genutzt werden kann. Die Zuschauer:innen produzieren also selbst den Strom, den sie für ihre Unterhaltung benötigen. Während der Filmvorführungen wechseln sich die Teilnehmenden auf den Fahrrädern ab, wodurch ein Gemeinschaftserlebnis entsteht, das weit über das passive Konsumieren von Filmen hinausgeht. „Es geht darum, Energie erfahrbar zu machen“, erklärt Behringer in seinen Vorträgen. „Die Menschen spüren am eigenen Körper, wie viel Kraft es braucht, um Strom zu erzeugen, und entwickeln dadurch ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem Energieverbrauch.“ Das Fahrradkino kommt bei Schulveranstaltungen, Stadtfesten und Umweltaktionstagen zum Einsatz und verbindet auf spielerische Weise die Themen Energieerzeugung, körperliche Aktivität und Gemeinschaftssinn.
Die Gemeinwohl-Methode: Ein Werkzeug für demokratische Resilienz
Doch wie können wir als Gesellschaft insgesamt mehr Demokratie leben und eine demokratische Resilienz aufbauen, die uns hilft, den vielfältigen Krisen unserer Zeit zu begegnen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Rolf schon lange und ist vor einiger Zeit auf die sogenannte Gemeinwohl-Methode gekommen, um demokratische Strukturen in der Gesellschaft zu stärken. In einer Zeit, in der Demokratien weltweit unter Druck stehen und polarisierende Kräfte zunehmen, braucht es neue Ansätze, um gemeinsame Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Die demokratische Resilienz einer Gesellschaft zeigt sich nicht nur in stabilen Institutionen, sondern vor allem in der Fähigkeit, konstruktiv mit Konflikten umzugehen und trotz unterschiedlicher Interessen zu gemeinwohlorientierten Entscheidungen zu gelangen. Genau hier setzt die Gemeinwohl-Methode an, die Rolf in den letzten Jahren intensiv weiterentwickelt und in verschiedenen Kontexten erprobt hat.
Die Gemeinwohl-Methode basiert auf dem Prinzip der deliberativen Demokratie und stellt einen strukturierten Prozess dar, bei dem eine zufällig ausgewählte, repräsentative Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern zu einem bestimmten Thema berät und Empfehlungen erarbeitet. Anders als bei herkömmlichen Beteiligungsverfahren steht dabei nicht die lauteste Stimme im Vordergrund, sondern die kollektive Weisheit einer vielfältigen Gruppe. Der Prozess beginnt mit der Auswahl der Teilnehmenden, wobei auf eine möglichst gute Abbildung der Bevölkerung nach Kriterien wie Alter, Geschlecht, Bildungsstand und kulturellem Hintergrund geachtet wird. In einem nächsten Schritt werden die Teilnehmenden umfassend über das zu behandelnde Thema informiert, wobei verschiedene Expertenmeinungen zu Wort kommen und unterschiedliche Perspektiven beleuchtet werden. Anschließend folgt eine intensive und kurze Beratungsphase, in der die Gruppe in moderierten Kleingruppen und im Plenum diskutiert, Argumente abwägt, priortisiert und clustert und schließlich zu gemeinsamen Empfehlungen gelangt. Diese Empfehlungen werden dokumentiert und an die zuständigen Entscheidungsträger weitergeleitet, wobei eine transparente Rückmeldung über den Umgang mit den Vorschlägen ein wichtiger Bestandteil des Prozesses ist.
Die Stärke der Gemeinwohl-Methode liegt in ihrer Fähigkeit, die Kluft zwischen Bürgerschaft und politischen Entscheidungsträgern zu überbrücken und komplexe Themen aus der Perspektive des Gemeinwohls zu betrachten. Durch den intensiven Austausch und die gemeinsame Erarbeitung von Lösungen entstehen oftmals innovative Ansätze, die in herkömmlichen politischen Prozessen übersehen werden. Zudem fördert die Methode das gegenseitige Verständnis und die Wertschätzung unterschiedlicher Perspektiven, was in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung von unschätzbarem Wert ist. „Es geht nicht darum, dass alle einer Meinung sind“, betont Behringer, „sondern darum, dass alle gehört werden und gemeinsam nach Lösungen suchen, die das Wohl aller im Blick haben.“ Die Gemeinwohl-Methode stärkt somit nicht nur die demokratische Kultur, sondern trägt auch dazu bei, qualitativ hochwertige und breit akzeptierte Entscheidungen zu treffen – gerade bei kontroversen Themen wie dem Klimaschutz, wo unterschiedliche Interessen und Wertvorstellungen aufeinandertreffen.
Klimarat Schule: Demokratie und Klimaschutz im Bildungssystem verankern
Ein besonders gelungenes Beispiel für die Anwendung der Gemeinwohl-Methode ist der „Klimarat Schule“, den Rolf zusammen mit engagierten Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern an mehreren Schulen in der Region und darüber hinaus initiiert hat. Das Projekt greift die Grundprinzipien der Gemeinwohl-Methode auf und passt sie an den schulischen Kontext an. Für den Klimarat werden per Losverfahren Schülerinnen und Schüler verschiedener Jahrgangsstufen ausgewählt, ergänzt durch Vertreterinnen und Vertreter des Lehrerkollegiums.
Ziel ist es, den CO2-Fußabdruck der Schule zu ermitteln und Maßnahmen zu erarbeiten, um diesen so gering wie möglich zu halten. Da sich die Schülerinnen und Schüler bereits intensiv mit den Themen auseinandergesetzt haben, können die Expert:innen aus der Schülerschaft kommen und Beiträge zu verschiedenen Handlungsoptionen liefern, z.B. von energetischen Sanierungsmaßnahmen über die Umstellung der Schulverpflegung bis hin zur klimafreundlichen Gestaltung des Schulwegs. In moderierten Workshops erarbeitet der Klimarat dann konkrete Vorschläge, wie die Schule klimafreundlicher gestaltet werden kann und welche Maßnahmen vorrangig umgesetzt werden sollten. Die Schülerinnen und Schüler erleben, dass sie selbst etwas bewirken können und dass demokratische Prozesse in kurzer Zeit zu greifbaren Ergebnissen führen. Diese Erfahrung stärkt nicht nur ihr Umweltbewusstsein, sondern auch ihr Vertrauen in demokratische Entscheidungsprozesse und ihre Fähigkeit zur aktiven Mitgestaltung.
Die Erfolge an den Schulen sind teilweise beeindruckend. An einer Schule konnte beispeilsweise der Energieverbrauch innerhalb eines Jahres um 15 Prozent gesenkt werden, was nicht nur der Umwelt zugutekommt, sondern auch erhebliche Kosteneinsparungen mit sich bringt. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die mit dem Fahrrad zur Schule kommen, hat sich deutlich erhöht, nachdem der Klimarat die Installation zusätzlicher Fahrradständer und die Einrichtung sicherer Radwege initiiert hat.
Besonders bemerkenswert ist die Veränderung in der Schulkultur: Klimaschutz ist nicht länger ein abstraktes Thema, das lediglich im Unterricht behandelt wird, sondern Teil des alltäglichen Schullebens. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ein Bewusstsein für ihren ökologischen Fußabdruck und setzen sich aktiv für eine nachhaltige Lebensweise ein – eine Haltung, die sie auch in ihr familiäres und soziales Umfeld tragen und so als Multiplikatoren wirken.
Die Gemeinwohl-Methode, wie sie im Klimarat Schule praktiziert wird, hat das Potenzial, weit über den schulischen Kontext hinaus Wirkung zu entfalten. Sie bietet ein Modell für eine partizipative Demokratie, die auf Dialog, gegenseitigem Respekt und der gemeinsamen Suche nach Lösungen basiert. In einer Zeit, in der der Klimawandel eine der größten Herausforderungen für die Menschheit darstellt und gleichzeitig demokratische Strukturen unter Druck geraten, brauchen wir genau solche Ansätze, die das Gemeinwohl in den Mittelpunkt stellen und die kollektive Intelligenz einer vielfältigen Gesellschaft nutzen. Rolf Behringer und sein Verein „Solare Zukunft“ zeigen mit ihren Projekten, dass lokales Handeln einen Unterschied machen kann und dass die Transformation zu einer klimafreundlichen Gesellschaft Hand in Hand gehen muss mit der Stärkung demokratischer Prozesse. Das Fahrradkino als anschauliches Beispiel für nachhaltigen Energiekonsum, die Gemeinwohl-Methode als Werkzeug für demokratische Entscheidungsfindung und der Klimarat Schule als praktische Anwendung dieser Prinzipien – sie alle tragen dazu bei, eine Kultur der Nachhaltigkeit und der demokratischen Teilhabe zu fördern, die für die Bewältigung der Klimakrise unerlässlich ist.




