
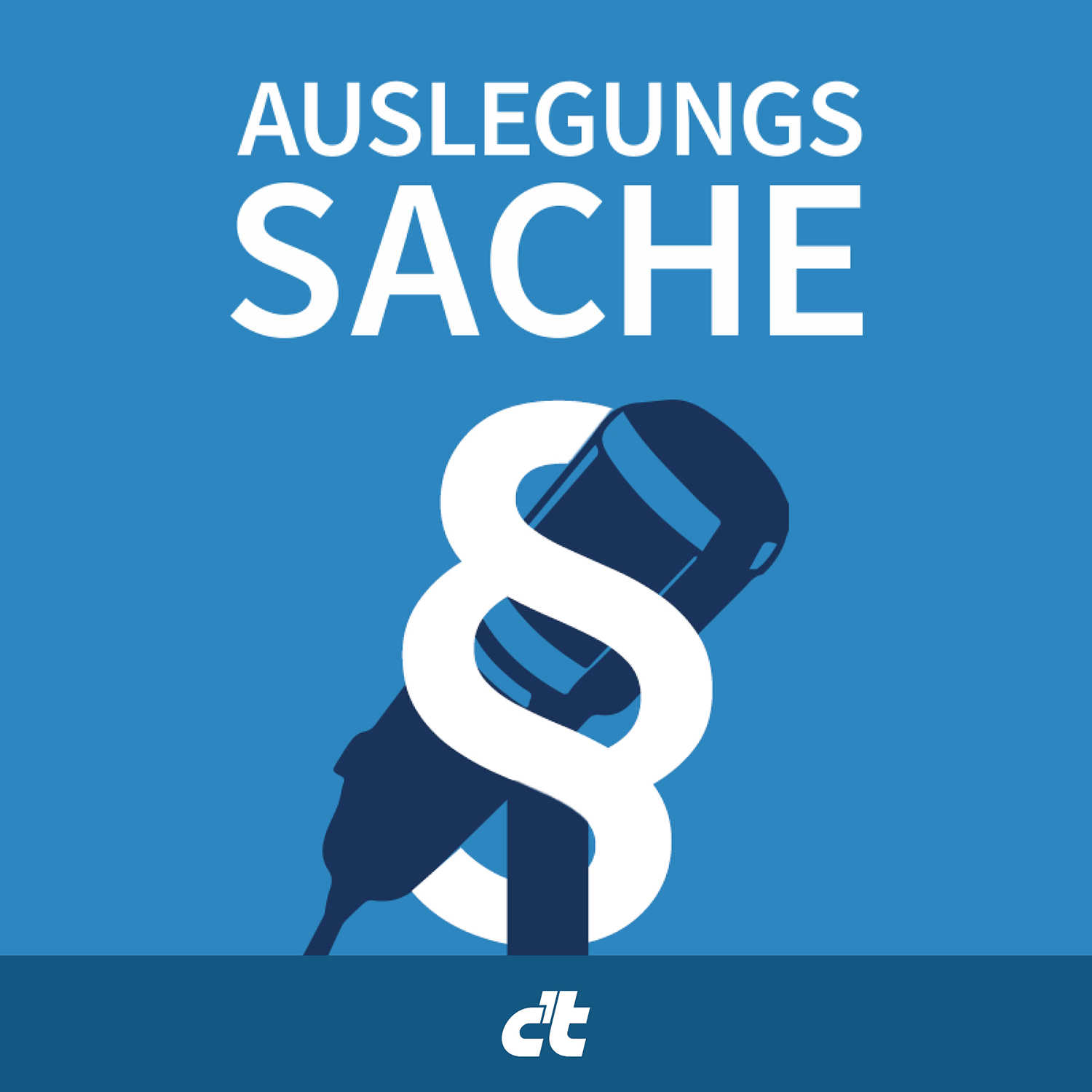
Auslegungssache – der c't-Datenschutz-Podcast
c't Magazin
Sie möchten beim Thema Datenschutz auf dem Laufenden bleiben, aber keine seitenlange Literatur wälzen? Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an unser Juristen-Redakteurs-Duo.
Alle 14 Tage bespricht c't-Redakteur Holger Bleich mit Joerg Heidrich aktuelle Entwicklungen rund um den Datenschutz. Joerg ist beim c't-Mutterschiff Heise Medien als Justiziar für das Thema zuständig und hat täglich mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu tun. Wechselnde Gäste ergänzen das Duo.
Mehr Infos gibts unter https://heise.de/-4571821
Alle 14 Tage bespricht c't-Redakteur Holger Bleich mit Joerg Heidrich aktuelle Entwicklungen rund um den Datenschutz. Joerg ist beim c't-Mutterschiff Heise Medien als Justiziar für das Thema zuständig und hat täglich mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu tun. Wechselnde Gäste ergänzen das Duo.
Mehr Infos gibts unter https://heise.de/-4571821
Episodes
Mentioned books

Jan 23, 2026 • 1h 12min
Datenschutz vor Gericht
Mit Kristin Benedikt, Holger Bleich und Joerg Heidrich
Informationen der französischen Datenschutzbehörde zum Bußgeld vom 13.1.2026 gegen Free Mobile und Free (Bußgeld der Woche).

Jan 9, 2026 • 1h 7min
Auf digitaler Spurensuche
Mit Joanna Lang-Recht, Holger Bleich und Joerg Heidrich
In Episode 150 des c't-Datenschutz-Podcasts geht es um IT-Forensik, insbesondere die digitale Spurensicherung nach Cyberangriffen und bei Verdachtsfällen im Unternehmen. Redakteur Holger Bleich und heise-Verlagsjustiziar Joerg Heidrich haben dazu Joanna Lang-Recht eingeladen. Sie leitet den Bereich Forensik bei der Intersoft Consulting Services AG und bringt einen ungewöhnlichen Werdegang mit: Nach einem Germanistikstudium wechselte sie zur IT-Security und erwarb zahlreiche Zertifizierungen im Bereich Forensik.
Joanna beschreibt IT-Forensik als klassische Spurensuche, nur eben komplett digital. Ermittelt wird auf Laptops, Smartphones, Servern oder in ganzen IT-Landschaften. Ziel sei es, sauber zu rekonstruieren: Wer ist eingedrungen, welche Daten sind betroffen und wie groß ist der Schaden. Ihr Team identifiziert Spuren, sichert sie möglichst gerichtsfest und wertet sie neutral aus.
Den größten Teil ihrer Einsätze machen laut Joanna Ransomware-Angriffe aus. Mehr als die Hälfte aller Vorfälle drehen sich um erpresste Unternehmen, deren Systeme verschlüsselt wurden. Feiertage gelten dabei als Hochrisikophase: IT-Abteilungen sind dünn besetzt, Angriffe werden später bemerkt, Schäden wachsen.
Ein heikles Thema ist das Zahlen von Lösegeld. Viele Unternehmen verhandeln tatsächlich mit den Erpressern, oft aus purer Not, weil Backups fehlen oder unbrauchbar sind. Joanna schildert, dass diese kriminellen Gruppen professionell auftreten: mit eigenen Chatportalen, Support-Strukturen und einer Art Notrufsystem. Wer zahlt, erhält in der Regel auch funktionierende Entschlüsselungsschlüssel, sonst würde das kriminelle Geschäftsmodell zusammenbrechen.
Neben externen Angriffen bearbeiten Forensik-Teams auch interne Fälle in Unternehmen: Verdacht auf Datendiebstahl durch Mitarbeitende, Wirtschaftsspionage oder Arbeitszeitbetrug. Hier sei besondere Vorsicht gefragt, erzählt Joanna. Untersuchungen müssen eng am konkreten Verdacht bleiben, um nicht unnötig in private Daten einzudringen. Bring-your-own-Device-Modelle erschweren solche Ermittlungen erheblich und machen sie manchmal sogar unmöglich.
Im Spannungsfeld zwischen Aufklärung und Datenschutz betont Joanna die Zusammenarbeit mit den Datenschutz-Aufsichtsbehörden der Länder. Meldungen zu Sicherheitsvorfällen laufen demnach meist pragmatisch ab, Nachfragen bleiben sachlich. Betroffenenrechte spielen Joanna bei der Spurensuche eine Rolle, bremsen die Ermittlungen aber selten, solange die Datensicherung gut begründet ist. Vor jeder Analyse prüfe das Team, ob ein berechtigtes Interesse gemäß DSGVO vorliege und ob Privatnutzung der Geräte erlaubt war. Bei unklaren Situationen lehne man Aufträge ab.

Dec 12, 2025 • 1h 38min
Jahresrückblick 2025: Datenschutz unter Beschuss
Mit Anna Cardillo, Holger Bleich und Joerg Heidrich
In der letzten Episode des Jahres 2025 blicken Holger und Joerg auf zwölf turbulente Monate zurück. Mit dabei ist wieder einmal Rechtsanwältin Anna Cardillo. Anna ist Partnerin in der Berliner Kanzlei MYLE. Sie berät Unternehmen und Behörden im Bereich Datenschutz und Informationssicherheit.
Zu Beginn diskutieren die drei einen aktuellen "Paukenschlag": Der gemeinsame Beschluss von Bundeskanzler und Länderchefs zur Staatsmodernisierung enthält weitreichende Pläne zur Verschlankung der Datenschutz-Durchsetzung. Die Pflicht zur Benennung betrieblicher Datenschutzbeauftragter soll wegfallen. Anna kritisiert das scharf: Die Anforderungen der DSGVO blieben ja bestehen, nur fehle dann die Person, die sich darum kümmert. Von Entbürokratisierung zu sprechen, sei irreführend.
Beim Blick auf das Datenschutzabkommen mit den USA sind sich die drei einig: Die Lage bleibt brisant. Zwar hat ein US-Gericht im Mai entschieden, dass dass zwei Mitglieder der US-Datenschutz- und Freiheitsrechtekommission PCLOB (Privacy and Civil Liberties Oversight Board) rechtswidrig durch den amtierenden Präsidenten Donald Trump entlassen wurden. Doch die Ankündigung Trumps, dem Datenschutzabkommen de facto komplett die Grundlage zu entziehen, schwebt wie ein Damoklesschwert über den EU-US-Datentransfers. Anna rät Unternehmen dringend, sich auf Alternativen vorzubereiten.
Das Jahr brachte auch saftige Bußgelder: TikTok kassierte in Irland 530 Millionen Euro wegen Datentransfers nach China, Vodafone in Deutschland 45 Millionen Euro wegen Sicherheitslücken und mangelnder Kontrolle von Vertriebspartnern. Die Runde sieht darin ein wichtiges Signal, dass Unternehmen ihre Dienstleister sorgfältiger überwachen müssen.
Große Sorgen bereitet den Diskutanten die aktuelle Rechtsprechung zur Haftung von Plattformen. Das EuGH-Urteil im Fall "Russmedia" deutet darauf hin, dass Forenbetreiber und Social-Media-Plattformen künftig Inhalte schon vor der Veröffentlichung prüfen müssen, um nicht sofort für Datenschutzverstöße haftbar zu sein. Dies könnte das Ende des bewährten "Providerprivilegs" bedeuten, bei dem Plattformen erst ab Kenntnis einer Rechtsverletzung haften, und faktisch zu einer umfassenden Überwachungspflicht durch Upload-Filter führen.
Zum Abschluss diskutiert das Trio das sogenannte "Omnibus-Paket" der EU, das weitreichende Änderungen an der DSGVO und anderen Digitalgesetzen vorsieht. Während Joerg durchaus pragmatische Erleichterungen erkennt, befürchtet Holger eine Aufweichung des Datenschutzes zugunsten der Industrie, etwa beim Training von KI-Modellen mit Nutzerdaten. Am Ende fällt das Fazit der Runde fällt eher pessimistisch aus: Der Datenschutz stehe vor schwierigen Zeiten.

Nov 28, 2025 • 1h 8min
Informationsfreiheit für alle
Henry Krasemann, Referatsleiter beim ULD und Experte für Informationsfreiheit, erklärt, wie wichtig Transparenz für die Demokratie ist. Er diskutiert den deutschen Flickenteppich der Informationsfreiheitsgesetze und die langsame Umsetzung in einigen Bundesländern. Der Zugang zu amtlichen Informationen ist für alle Bürger möglich, unabhängig von persönlichen Daten. Zum Vergleich nennt er Schweden, wo Informationen schneller und proaktiver bereitgestellt werden. Henry betont die Herausforderungen und Chancen, die mit Transparenz einhergehen.

13 snips
Nov 14, 2025 • 1h 9min
Ein Bus durch den Regel-Dschungel
Falk Steiner, ein erfahrener Journalist mit Fokus auf Digitalpolitik, spricht über das digitale Omnibusgesetz und die geplanten Änderungen zur DSGVO. Er erläutert die politischen Motivationen hinter der Konsolidierung von EU-Digitalregeln und die Herausforderungen für Unternehmen bei der Umsetzung. Die Diskussion deckt wichtige Themen wie Datenschutzfolgenabschätzungen, Meldepflichten und die Anpassung von Gesundheitsdaten an neue Regelungen ab. Zudem wird untersucht, wie Datenschutzskandale die Gesetzgebung beeinflussen können.

Oct 31, 2025 • 1h 8min
Wieviel Macht den Daten?
Mit Prof. Hannah Ruschemeier, Holger Bleich und Joerg Heidrich
Keynote Prof. Hannah Ruschemeier zum DatenTag der Stiftung Datenschutz am 16. September 2025

Oct 17, 2025 • 1h 15min
Social Media im Würgegriff der EU?
Mit Dr. Thomas Schwenke, Holger Bleich und Joerg Heidrich
In Episode 145 des c't-Datenschutz-Podcasts nehmen die Holger und Joerg die Regulierung von Social-Media-Plattformen unter die Lupe. Als Gast haben sie sich den Rechtsanwalt und Social-Media-Experten Dr. Thomas Schwenke eingeladen. Thomas, der gerade ein Buch zum Thema "Recht für Online-Marketing und KI" veröffentlicht hat, erklärt gleich zu Beginn: Der Begriff "Social Media" sei überholt. Plattformen wie TikTok oder Instagram entwickelten sich immer mehr zu "algorithmischen Medien", bei denen der passive Konsum von Inhalten im Vordergrund stehe,und nicht mehr der soziale Austausch.
Hauptthema der Diskussion ist die Regulierungswelle der EU, die mit Gesetzen wie dem Digital Services Act (DSA) und dem Digital Markets Act (DMA) versucht, die Macht der Tech-Konzerne zu begrenzen. Ein aktuelles Beispiel ist die neue Verordnung zur Transparenz politischer Werbung (TT-Verordnung). Sie schränkt das gezielte Ausspielen von Werbung, das sogenannte Microtargeting, stark ein. Die Reaktion der Konzerne ließ nicht lange auf sich warten: Sowohl Meta als auch Google kündigten an, wegen der neuen, komplexen Regeln künftig keine politische Werbung mehr in der EU schalten zu wollen.
Die Experten sind sich uneins, wie wirksam diese vielen EU-Gesetze wirklich sind. Während Holger argumentiert, dass die EU die Konzerne durchaus zum Handeln zwingt – etwa bei der Einholung von Einwilligungen oder der Anpassung ihrer Bezahlmodelle –, bleiben Thomas und Joerg skeptisch. Sie kritisieren, dass viele Nutzer mit den komplexen Einwilligungs-Bannern überfordert seien und dass das Geschäftsmodell des Trackings im Kern unangetastet bleibe.
Besonders ernüchternd fällt die Bilanz bei den viel beworbenen Schadensersatzklagen gegen Meta aus. Holger zitiert Zahlen, die der ehemalige baden-württembergische Datenschutzbeauftragte Stefan Brink in einem anderen Podcast teilte: Von rund 2200 Klagen wegen der Business Tools von Meta wurden 70 Prozent komplett zugunsten des Konzerns entschieden. In 97 Prozent der Fälle lag der zugesprochene Schadensersatz bei maximal 500 Euro. Die medienwirksamen Urteile mit hohen Schadensersatzzahlungen seien absolute Ausnahmen.
Ein Urteil des Landgerichts München I stützt diese skeptische Sicht. Das Gericht wies die Klage eines Nutzers ab, der wegen der Übermittlung seiner Daten in die USA Schadensersatz forderte. Die Richter argumentierten, wer einen globalen US-Dienst wie Facebook wissentlich nutze, müsse mit einem Datentransfer rechnen. Sich später darüber zu beschweren, sei widersprüchliches Verhalten. Das Fazit der Runde: Der Kampf gegen die Datenkraken ist zäh und die Erfolge sind oft kleiner, als es den Anschein hat.

27 snips
Oct 3, 2025 • 1h 10min
Wege aus der US-Abhängigkeit
Peter Siering, Leiter für Systeme und Sicherheit bei c't und Open-Source-Experte, erklärt, wie europäische Alternativen zu US-Cloud-Diensten implementiert werden können. Er diskutiert Nextcloud als Ersatz für Microsoft 365 und nennt spezifische Konfigurations- und Umstiegstipps. Zudem wird das Thema digitale Souveränität beleuchtet, insbesondere die Risiken der US-Abhängigkeit. Siering bietet Einsteiger-Tipps für Linux und spricht über datenschutzfreundliche Messenger- und E-Mail-Alternativen.

Sep 19, 2025 • 1h 9min
Drei Urteile, viele Fragezeichen
Mit Prof. Alexander Golland, Holger Bleich und Joerg Heidrich
Holger und Joerg widmen sich diemal gemeinsam mit Professor Dr. Alexander Golland drei wichtigen Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, alle drei aus dem laufenden Monat September. Alexander, Professor für Wirtschaftsrecht an der FH Aachen, ordnet die teils verwirrenden Urteile ein und erklärt deren praktische Auswirkungen.
Im Mittelpunkt steht zunächst die Klage des französischen Abgeordneten Philippe Latombe gegen den Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission zum EU-US-Datentransfer, dem wiederum das EU-US Data Privacy Framework zugrunde liegt. Latombe wollte den Beschluss für nichtig erklären lassen. Das Europäische Gericht (EuG) wies die Klage ab, damit bleibt er vorerst als Rechtsgrundlage bestehen. Alexander ordnet das Verfahren ein und erläutert, warum das Gericht nur prüfte, ob die Kommission 2023 bei Erlass des Beschlusses korrekt handelte, nicht aber die heutige Situation unter veränderten politischen Vorzeichen bewertete.
Besonders praxisrelevant ist das SRB-Urteil des EuGH zur Pseudonymisierung. Die zentrale Frage: Sind pseudonymisierte Daten für Empfänger, die selbst (ohne Dritte) keinen Personenbezug herstellen können, anonym, oder bleiben sie personenbezogen? Der EuGH bestätigt in dem Revisionsverfahren zwar den sogenannten "subjektiven Ansatz" – es kommt auf die Möglichkeiten des Empfängers an –, lässt aber entscheidende Detailfragen offen. Alexander kritisiert die fehlende Rechtssicherheit: Unternehmen wissen weiterhin nicht genau, ob sie für solche Datenübermittlungen Auftragsverarbeitungsverträge benötigen. Die Richter machten wenig Vorgaben und verwiesen auf die Einzelfallprüfung. "Steine statt Brot", resümiert Alexander.
Fall drei dreht sich um den immateriellen Schadenersatz. Ein Bewerber hatte gegen die Quirin Privatbank geklagt, weil sensible Angaben versehentlich an einen Dritten gingen. Der EuGH bestätigte: Auch Ärger oder Schamgefühle können ein Schaden im Sinne der DSGVO sein. Ein Nachweis bleibt aber schwierig. Beim Thema Unterlassung urteilten die Richter restriktiv: Einen originären Unterlassungsanspruch sieht die DSGVO nicht vor. Allerdings könne das nationale Recht solche Ansprüche zulassen, hierzulande beispielsweise über das Wettbewerbsrecht. Für die Praxis bedeutet das: Betroffene müssen künftig eher auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht zurückgreifen.
Die Diskutanten zeigen sich ein wenig frustriert über die mangelnde Klarheit der Urteile. Statt eindeutiger Vorgaben liefern die Gerichte oft nur die klassische Juristen-Antwort: "Es kommt darauf an." Für Unternehmen und Betroffene bedeutet das weiterhin erhebliche Rechtsunsicherheit bei alltäglichen Datenverarbeitungen.

19 snips
Sep 5, 2025 • 1h 18min
Der Data Act - Daten für alle?
Carolin Loy, Bereichsleiterin für Digitalwirtschaft und Rechtsfragen künstlicher Intelligenz beim Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht, teilt ihre Expertise über den kommenden Data Act der EU. Sie warnt vor den massiven Herausforderungen für Unternehmen, die sich auf diese neue Verordnung vorbereiten müssen. Loy erklärt, wie der Data Act Nutzern Zugang zu wichtigen Daten verschafft und die komplexe Unterscheidung zwischen personenbezogenen und nicht-personenbezogenen Daten thematisiert. Zudem diskutiert sie die bedeutenden Implikationen für den Wettbewerb und erforderliche Anpassungen in bestehenden Verträgen.


