
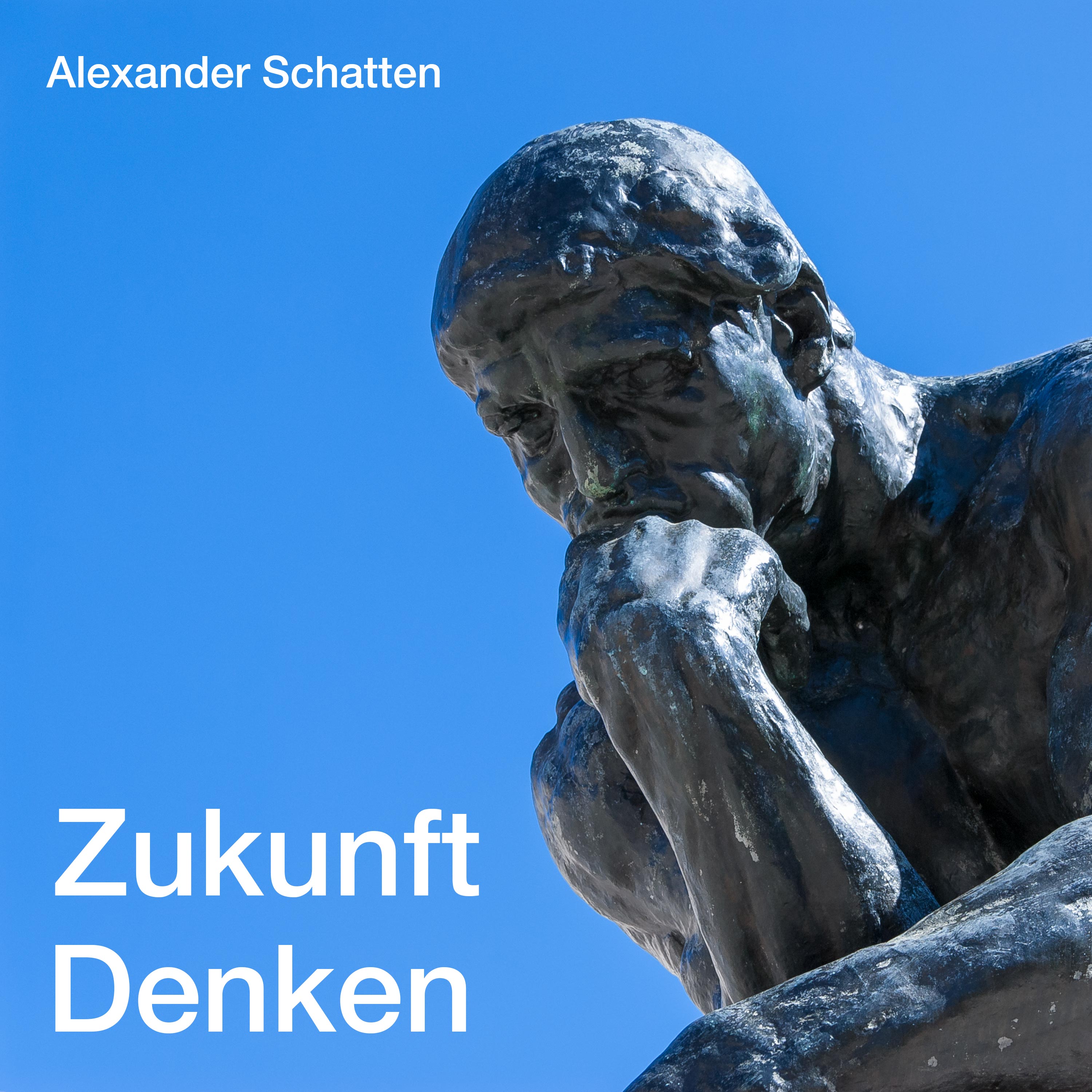
Zukunft Denken – Podcast
Alexander Schatten
Woher kommen wir, wo stehen wir und wie finden wir unsere Zukunft wieder?
Episodes
Mentioned books

Apr 2, 2020 • 59min
022 – Biodiversität und komplexe Wechselwirkungen – Gespräch mit Prof. Franz Essl
Wir stecken in einer globalen Biodiversitäts-Krise. Diese Tatsache scheint durch den Fokus auf das natürlich ebenfalls kritische Thema des Klimawandels etwas aus dem Blick zu geraten.
In dieser Episode führe ich ein Gespräch mit Prof. Franz Essl, Ökologe (und Biodiversitätsforscher) an der Universität Wien:
Zunächst steht Biodiversität selbst im Zentrum des Gespräches: was versteht man darunter, wie hat sich dieser Begriff entwickelt.
Aus der letzten Frage heraus ergibt sich ein zweites wesentliches Themenfeld: Biodiversität steht in komplexer Interaktion mit anderen globalen Phänomenen und Problemen wie der Klimakrise, Wissenschaft, Landnutzung, Landwirtschaft und vielen anderen.
Damit kommen wir zu grundsätzlichere systemische Fragen in natürlichen Systemen und warum diese besondere und sehr schwierig handzuhabende Eigenschaften, wie z.B. Tipping Points und zeigen.
Am Ende diskutieren wir ethische Aspekte und im besonderen die Frage der Verantwortung von Wissenschaft und Wissenschaftern, beziehungsweise die Rolle jedes Einzelnen im Umgang mit derartig existentiellen Fragen unserer Zeit.
Dieses Gespräch ist auch darum von großem Interesse für mich, weil es zahlreiche Anknüpfungspunkte zu Themen früherer Episoden gibt, die durch die Expertise von Prof. Essl erweitert und vertieft werden können. Dazu zählen:
Episode 10: Der Begriff der Komplexität, Denken in Systemen, komplexe Ursachen und Wirkungszusammenhänge, Skaleneffekte
Episode 3: Das Ozonloch als ein anderes prominentes Beispiel unerwarteter Konsequenzen, wenn wir in großem Ausmaß mit den globalen Systemen interagieren, aber auch eines, wo wir vergleichsweise schnell zu politischen und ökonomischen Handlungsoptionen gelangt sind.
Episode 7, 8: Wird »alles« besser, wie manche Autoren heute behaupten, oder laufen wir in kaum mehr kontrollierbare existentielle Risiken?
Episode 21: Nicht zuletzt möchte ich auf die unmittelbar vorherige Episode #21 hinweisen. In dieser Episode beschäftige ich mich mit der Frage des Naturbegriffes und der Rolle des Menschen in der Natur
Referenzen
Prof. Franz Essl, Univ. Wien
Univ. Wien. Conservation Biology, Vegetation Ecology and Landscape Ecology
Video: »Die Menschheit steht an einem Wendepunkt«, Medienportal der Univ. Wien, Video
Biodiversitätsrat Österreich
Frühere Episoden:
Episode 3: Das Ozonloch, oder: unerwartete Konsequenzen
Episode 7: Alles wird besser... oder nicht? Teil 1
Episode 8: Alles wird besser... oder nicht? Teil 2
Episode 10: Komplizierte Komplexität
Episode 21: Der Begriff der Natur
Weitere Referenzen
Alexandra Occasio-Cortez asks former Exxon Scientists on climate change denial (YouTube Video)

Mar 16, 2020 • 24min
021 – Der Begriff der Natur – oder: Leben im Anthropozän
Ich möchte mit dieser Episode anregen – vielleicht auch ein wenig provozierend – über Begriffe nachzudenken:
Natur
Umwelt
Umweltschutz
Umwelt und Wirtschaft
Anthropozän
In welcher Form wir diese Begriffe interpretieren, stellt sich als fundamentale Weichenstellung heraus, wie wir mit unserer Zukunft umgehen.
»Ich habe mich oft gefragt: 'Was sagte der letzte Bewohner der Osterinsel, der gerade dabei war, die letzte Palme zu fällen?' Schrie er wie moderne Holzfäller: 'Wir brauchen keine Bäume, sondern Arbeitsplätze!'? Oder sagte er: 'Die Technik wird unsere Probleme schon lösen, keine Angst, wir werden einen Ersatz für das Holz finden'? Oder vielleicht: 'Wir haben keinen Beweis, dass es nicht an anderen Stellen auf der Osterinsel noch Palmen gibt, wir brauchen mehr Forschung, der Vorschlag, das Abholzen zu verbieten, ist voreilig und reine Angstmacherei'?«, Jared Diamond
Es macht auf sehr anschauliche Weise deutlich, wie sehr wir als Individuen auf die Probleme fokussiert sein können, die aus unserem Job, unserer Rolle in der Gesellschaft oder Wirtschaft entspringen. So fokussiert, dass wir völlig übersehen, dass wir durch den immer angestrengteren Versuch, unser Unternehmen, unsere Familie, unseren Staat aufrecht zu erhalten gerade die dafür notwendigen Fundamente zerstören.
In dieser Episode werden wir von Alexander von Humboldt hören: »Alles ist Wechselwirkung« und über das Verhältnis von Wirtschaft und Natur:
»Naturmenschen und Menschen früher Zivilisationen lebten in der Vorstellung einer geradezu grenzenlosen Fläche. [...] Es gab immer einen anderen Platz, den man aufsuchen konnte, wenn die Dinge zu schwierig wurden; entweder weil die Umwelt oder die sozialen Strukturen im bisherigen Lebensraum zerstört wurden. […] Besonders Ökonomen sind größtenteils gescheitert mit den Konsequenzen dieses Übergangs von einer offenen zu einer geschlossenen Welt zurechtzukommen.«, Kenneth Boulding
Was ist dieses – von Boulding, McLuhan und anderen eingeführte – »Spaceship Earth« (Raumschiff Erde), und wie kann es uns diese Idee weiterhelfen?
Die Erde photographiert von der Apollo 8 Mission (1968)
Dann ist der Begriff der »Umwelt« an der Reihe. Macht dieser Begriff (und die traditionelle Umweltbewegung) heute überhaupt noch Sinn, oder verstellte er den Blick auf die Tatsache, dass wir in ein neues Erdzeitalter, das Anthropozän eingetreten sind und damit völlig neu über unser Verhältnis zur Welt nachzudenken haben?
»Wir waren immer verrückt, aber wir hatten nicht die Fähigkeiten die Welt zu zerstören. Jetzt haben wir sie.«, Nassim Taleb
Was wir angerichtet haben, fällt auf uns zurück. Niemand wird uns dabei helfen.
»Die Natur ist nicht länger am Steuer des Planeten, wir sind es. Es liegt in unserer Hand, was passieren wird.«, Mark Lynas
Was folgt aus dieser Aussage? Zunächst die Erkenntnis, dass ich in dieser Episode viele Türen öffne, viele Fragen aufwerfe und hoffe, zum Nachdenken und zur Diskussion anzuregen. In späteren Folgen, werde ich versuchen, verschiedene dieser Themen wieder aufzunehmen, auch in Gesprächen mit Gästen.
Referenzen
Jared Diamond, Kollaps, Warum Gesellschaften überleben oder untergehen, Fischer (2012)
Andrea Wulf, Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur, C. Bertelsmann (2016)
Kenneth E. Boulding, The Economics of the Coming Spaceship Earth; In H. Jarrett (ed.) 1966. Environmental Quality in a Growing Economy, pp. 3-14. Baltimore, MD: Resources for the Future/Johns Hopkins University Press.
US Botschafter Adlai Stevenson bei einer UN-Ansprache im Jahr 1965 {Chris C. Park, The Environment, Psychology Press (2001)}
Buckminster Fuller, Operating Manual for Spaceship Earth
Club of Rom 1972: Grenzen des Wachstums
The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene, Colin N. Waters et al., 8. Jan 2016
Nassim Taleb, Skin in the Game, Penguin (2018)
Klaus Kornwachs, Philosophie der Technik, C.H.Beck Wissen (2013)
Lars Fischer, Geoengineering – haben wir überhaupt noch eine Wahl?, SciLogs (2010)
Mark Lynas, The God Species: How Humand Really Can Save the Planet

Mar 2, 2020 • 1h 15min
020 – Offene Systeme – Teil 2: Gespräch mit Lukas Lang und Christoph Derndorfer
Dies ist der zweite, und wichtigere Teil zum Thema »Offene vs. geschlossene Systeme« und deren Auswirkungen auf Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Ich formuliere zunächst die These, dass wir in einer Zeit leben, wo versucht wird, wirtschaftliche und politische Macht auch durch Daten und geschlossene Systeme zu erreichen. Daraus könnte der Schluss folgen, dass wir zahlreiche dieser Probleme durch offene Systeme (Software, Daten, Hardware, Transparenz) lösen können.
Stimmt das?
Im Gespräch mit Christoph Derndorfer und Lukas lang diskutieren wir Themen wie:
Offenheit in der Wissenschaft: steckt die Wissenschaft in einer Krise mangelnder Reproduzierbarkeit?
Open Source
Open Data
Open Hardware
Sind Algorithmen »neutral« und »apolitisch«?
Hilft Transparenz dem politischen Prozess?
Gibt es konkrete ökonomische Vorteile offene Systeme einzusetzen?
Verstehen wir überhaupt noch, wie die Systeme, die wesentliche Bereiche unserer Gesellschaft steuern, funktionieren? Was ist hier die geopolitische Dimension?
Und zum Abschluss stelle ich die Frage (aus dem Vortrag von Hannah Fry »ausgeborgt«):
Angenommen, ein Bekannter von Euch steht vor Gericht: wäre es euch lieber, das Urteil wird von einem menschlichen Richter oder einem Algorithmus (»KI«) gesprochen?
Wie würden Sie entscheiden?
Referenzen
Lukas Lang
persönliche Website: https://lukaslang.github.io
Twitter: https://twitter.com/lukaslang
Christoph Derndorfer
persönliche Website: https://derndorfer.eu/
Twitter: https://www.twitter.com/random_musings
Fachliche Referenzen
Teil 1 dieses Themas: siehe Episode 19
Website der LVA "Free and Open Technologies"
Studie zur Reproduzierbarkeit in der Informatik: Collberg, C. et al (2014), “Measuring Reproducibility in Computer Systems Research”
Adressdaten-Beispiel aus Dänemark: GovLab (2016), "Denmark's Open Address Data Set"
Facebook und das »Oversight Bord«
Hannah Fry, Should Computers Run the World?
Byung Chul-Han, Im Schwarm
Lawrence Lessig, Against Transparency
Online Kurs »Elements of AI«

Feb 17, 2020 • 16min
019 – Offene Systeme – Teil 1
Diese Episode weicht wieder etwas von den bisherigen ab. Sie ist so etwas wie eine »Brückenepisode«. Ich baue hier eine thematische Brücke über eine Reihe vergangener Episoden auf. Der thematische Faden ist »was bedeutet Offenheit in Wissenschaft, Technik und Politik/Gesellschaft«?
Ich blicke zurück auf die Episoden 2, 12, 11, 6 und 18 und bringe die Aspekte, die sich auf Offenheit beziehen in einen Zusammenhang:
Wissenschaftlicher Fortschritt und Kommunikation
ein Konflikt zwischen Ökonomie und Wissenschaft?
Ethische Fragen: wie können wir als Gesellschaft entscheiden?
Empirie und Kritik
Ergebnisoffenheit von Forschung
Zusammenspiel von Disziplinen
Erkenntnis und Demokratie
Diese Folge ist auch ein Teaser für die nächste Episode, in der ich mit zwei Experten dieses Thema diskutieren werde.
»Wer steuert Wissenschaft und Technologie in einer Demokratie, wenn die Menschen nicht die geringste Ahnung davon haben. […] Wissenschaft ist mehr als gesammeltes Wissen; es ist eine Art und Weise zu denken. Eine Art, skeptisch das Universum zu befragen – aber immer mit dem Bewusstsein der menschlichen Fehlbarkeit.«, Carl Sagan
Referenzen
Karl-Heinz Göttert, Als die Natur noch sprach
Carl Sagan, The Demon-Haunted World
Andere Episoden
Episode 2: Was wissen wir
Episode 12: Wie wir die Zukunft entdeckt und wieder verloren haben
Episode 11: Ethik, warum wir Wissenschaft nicht den Wissenschaftern überlassen sollten
Episode 6: Messen, was messbar ist?
Episode 18: Gespräch mit Andreas Windisch: Physik, Fortschritt oder Stagnation

Jan 30, 2020 • 1h 29min
018 – Gespräch mit Andreas Windisch: Physik, Fortschritt oder Stagnation
Schon in der ersten Episode habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich mit dem Format des Podcasts noch experimentieren möchte. Mit dieser Episode beginne ich neben Vorträgen/Monologen erstmals auch Gespräche in den Podcast einzuführen.
Die Monolog-Episoden (wie bisher) wird es auch in der Zukunft geben, vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen.
Die konkrete Idee ist, Themen in Form von Monologen einzuführen, dann aber mit Gesprächen zu vertiefen oder verbreitern, je nachdem, sowie meine Aussagen einer kritischen Prüfung zu unterziehen.
In dieser ersten Gesprächs-Episode steht mir Dr. Andreas Windisch zur Seite, ein hervorragender Physiker und Mathematiker. Wir greifen ein Thema auf, dass ich in den Episoden 15, 16 und 17 eingeführt habe: erleben wir Fortschritt oder Stagnation?
Mit Andreas tauchen wir jetzt hier am Beispiel der Physik tiefer ein und diskutieren die Aspekte, die ich in den vorigen Episoden versucht habe einzuführen.
Wir sprechen über die wesentlichen Fortschritte der Physik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und was sich danach verändert hat, den Zusammenhang zwischen Mathematik, Theorie und Experiment. Anhand einiger Beispiele diskutieren wir die enormen Aufwänden, mit denen moderne Experimente in der Physik verbunden sind, und welche Konsequenz das für Wissenschaft und Technik hat.
Nicht zuletzt greifen wir die Frage auf, ob wir es nun mit einer Stagnation zu tun haben und was die Ursachen sein könnten, die auch über die Physik hinaus wirken. Was ist die Rolle der Gesellschaft, der Wissenschaft und wer entscheidet, in welche Richtung sich Forschung entwickelt.
Herzlichen Dank an Dr. Andreas Windisch für dieses Gespräch!
Referenzen
Dr. Andreas Windisch
LinkedIn
Email
Silicon Austria Labs
Fachliche Referenzen: es gibt für diese Episode keine neuen fachlichen Referenzen, wir beziehen uns auf Themen und Referenzen, die in den folgenden Episoden eingeführt wurden
Episode 15: Innovation oder Fortschritt?
Episode 16: Innovation und Fortschritt oder Stagnation?
Episode 17: Kooperation

Jan 19, 2020 • 18min
017 – Kooperation
Essen oder gegessen werden – wir bereiten unsere Kinder, jungen Erwachsenen und Studenten auf eine Welt des Wettbewerbes vor. Homo Homini Lupus im modernen Gewande.
Aber passt dies überhaupt zu den Problemen der heutigen Zeit? Ist diese Ideologie die richtige um tatsächlich Fortschritt zu erzielen?
»Marx: alle Sinne reduzieren sich auf das Haben. Solidarität wird ersetzt durch egoistische Konkurrenz und Macht.«, Michael Quante
Zwei Seiten einer Medaille als Kontext: »Die Tragödie des Menschen und der Allmende«.
Eineseits sprechen wir, nach Arnold Gehlen, über den Mensch als Mängelwesen, das aber über die Fähigkeit der Kooperation zur dominierenden Spezies des Planeten geworden ist, andererseits Garrett Hardin, tragedy of the commons – wo das bisherige Ende dieser Kooperation zu erkennen war. Natürliche Ressourcen werden bis zum Kollaps zerstört.
Kooperation in modernem Gewande, nicht Wettbewerb, hat in der Vergangenheit zu enormen Leistungen verholfen, denken wir an die Mondlandung, das Manhatten Projekt, den Umgang mit SARS, AIDS oder dem Ozonloch.
Aber dort, wo es heute am wichtigsten ist, zum Beispiel dem Klimawandel, kommen wir nicht voran.
Wie kann eine kooperative Nutzung wesentlicher Ressourcen in der Zukunft aussehen? Welche Rolle spielen moderne Technologien wie die künstliche Intelligenz?
Andere Episoden:
Episode #3: Unerwartete Konsequenzen, das Ozonloch
Episode #6: Messen was messbar ist
Episode #16: Innovation und Fortschritt oder Stagnation
Referenzen
Michael Quante, Das philosophische Radio, WDR5, 3.1.2020
Der Mensch als Mängelwesen, NZZ 24.01.2004
Klaus Kornwachs, Philosophie der Technik (C.H.Beck Wissen) (2013)
Teller und Oppenheimer, Das Ende der Welt?
Nassim Taleb, Skin in the Game (2018)
Keith Carlisle, Rebecca L. Gruby, Polycentric Systems of Governance: A Theoretical Model for the Commons, The Policy Studies Journal, Vol. 00, No. 00, 2017
Seven principles of resilience, Stockholm Resilience Centre

Jan 3, 2020 • 39min
016 – Innovation und Fortschritt oder Stagnation?
»Überhaupt hat der Fortschritt das an sich, daß er viel größer ausschaut, als er wirklich ist.«, Johann Nestroy
In der vorigen Episode habe ich versucht das Zusammenspiel von Innovation und Fortschritt unter die Lupe zu nehmen. Ziel war es zum Nachdenken und vor allem auch zum Widerspruch anzuregen. Ich freue mich auch weiterhin über Anregungen und Kommentare.
In dieser Episode gehe ich einen – etwas spekulativen – Schritt oder Frage weiter. Scheitern wir vielleicht nicht nur daran zwischen Innovation und Fortschritt zu unterscheiden, sondern ist das Problem vielleicht wesentlich tiefer liegend: leben wir in einem Zeitalter der Stagnation, wo zwar viel Lärm gemacht wird, sich tatsächlich aber recht wenig bewegt?
Ein Blick zurück. Philipp Blom beschreibt die tatsächlich enormen Umwälzungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Als bemerkenswertes Beispiel greife ich die Neurasthenie heraus, die zeigt, als wie schnell und überwältigend diese Entwicklungen wahrgenommen wurden. Blom zitiert einen George Miller Beard, Art der Zeit:
»Es gibt eine große Familie von funktionellen nervösen Störungen, die unter den hinter verschlossenen Türen arbeitende Klassen der zivilisierten Länder immer häufiger werden. In diesem Land beträgt die Anzahl der Menschen, die an dieser Krankheit leiden, Hunderttausende«
In der Tat ist auch objektiv eine enorme Entwicklung in Wissenschaft, Technik und Gesellschaft zwischen 1900 und 1960 zu beobachten.
In einem Gespräch kommen Peter Thiel, Eric Weinstein zu der Erkenntnis, dass wir in einem Zeitalter der Stagnation (seit den 1970er Jahren) leben; mit wenigen Ausnahmen (vor allem Informationstechnologie uns Software). Stagnation in der Wissenschaft, der Technologie aber auch kaum Wirtschaftswachstum. Volatität wird als Dynamik missverstanden.
Der absolut überwiegende Teil der wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen auch der heutigen Zeit wurden vor den 1970er Jahren gelegt.
Haben wir ein Problem in der Wissenschaft (ist es ein fundamentales Erkenntnisproblem, oder eines der wissenschaftlichen Praxis)? in der Umsetzung in die Technologie? In unseren Organisationen?
»Wir leben in einer Art von intellektuellen Truman-Show, wo alles um uns herum falsch ist und etwas super-aufregendes passieren wird.«, Eric Weinstein
Thiel und Weinstein sind nicht die einzigen, die derartige Ideen vertreten: Artikel von Frank Schirrmacher und David Graeber sowie ökonomische Aspekte durch Robert Gordon: keine nennenswerte Zunahme an Produktivität, Innovation und Wachstum in den letzten Jahrzehnten.
Zuletzt werfen wir einen Blick auf die sehr interessanten Beobachtungen der Physikerin Sabine Hossenfelder, die ähnliche Beobachtungen aus der Innensicht der modernen (theoretischen) Physik macht.
»Meine Generation ist bemerkenswert erfolglos – in mehr als 30 Jahren ist es uns nicht gelungen, die Grundlagen der Physik zu verbessern«
Aber so erfolglos können wir gar nicht sein, dass wir die Lautstärke des Marketings nicht ständig aufdrehen.
Stimmt es also, dass wir – entgegen dem lautstarken Marketing – tatsächlich eher in einer Welt der wissenschaftlichen und technologischen Stagnation leben?
Und falls das so ist: warum ist das für unsere Gesellschaft und Zukunft von größter Bedeutung!?
Wie immer: schicken Sie mir Ihre Meinungen, Kritikpunkte, Ergänzungen, z.B. über Twitter, und über dieses Feedback-Formular.
Referenzen
Philipp Blom, Der taumelnde Kontinent: Europa 1900–1914 (2011)
The Portal: Eric Weinstein, Peter Thiel (im besonderen die ersten 30–40 Minuten)
David Graeber im Gespräch mit Peter Thiel, Where did the future go?
Frank Schirrmacher, Neil Armstrongs Epoche: Das Drama einer Enttäuschung (FAZ) (ca. 2012)
Klaus Kornwachs, Philosophie der Technik (C.H.Beck Wissen) (2013)
Antibiotika: Das Wundermittel wirkt nicht mehr, ZEIT Online
Missing Link: Der 3D-Drucker, oder: die industrielle Revolution, die nicht stattfand
David Graeber, Bürokratie, Die Utopie der Regeln (2017)
Robert Gordon, The death of innovation, the end of growth (TED-Talk)
Sabine Hossenfelder, Lost in Math
Konrad Paul Liessmann, Dienst ohne Vorschrift – 200 Jahre nach seinem Tod wäre Immanuel Kant, einer der größten Denker der Moderne, chancenlos, sich im heutigen Wissenschaftsbetrieb durchzusetzen. Der Standard, 6. Februar 2004
Edward Snowden, Permanent Record (2019)
Tim Jackson, Prosperity without Growth (2009, 2016)

Dec 17, 2019 • 33min
015 – Innovation oder Fortschritt?
Wir sprechen in der Öffentlichkeit, in der Wissenschaft, der Industrie ständig von Innovation, so als wäre Innovation per se sinnvoll und wichtig für unsere Gesellschaft, aber stimmt das? Was ist überhaupt Innovation? Und was ist der Unterschied oder Zusammenhang zwischen Innovation und Fortschritt?
Warum sprechen wir davon in letzter Zeit immer weniger von Fortschritt? Es gab mehr als ein Anzeichen in der Vergangenheit, dass Innovation und Fortschritt nicht immer Hand in Hand gehen müssen, und in der heutigen Zeit und damit auch in der nahen Zukunft ist die Situation noch komplizierter geworden.
»Mit dem 18. und 19. Jahrhundert wird der Begriff des Fortschritts fester Bestandteil des europäischen Weltbildes.«, Klaus Kornwachs
Wir hat sich der Fortschrittsbegriff des 19. Jahrhunderts immer mehr auf Innovation reduziert?
Wir werfen einen Blick in die Vergangenheit, unter anderem auf den »Atommoment« der Physiker, den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki und stellen uns die Frage, ob wir heute nicht einen »Atommoment« der Informatik erleben.
War das alles unvorhersehbar?
Was hat die Technikkritik der Nachkriegszeit bewirkt, denken wir etwa an Günther Anders:
»Wir sind die Herren der Apokalypse, das Unendliche sind wir. Alle Wechselfälle der (bisherigen) Geschichte werden angesichts der neuen Möglichkeiten zur reinen “Vorgeschichte”«
Es herrscht nach dem zweiten Weltkrieg wohl eher das Motte »Machen was machbar ist«. Seit damals scheinen wir die Frage nach dem Fortschritt immer weniger zu stellen und heute werden wir mit Innovationen auf allen Ebenen überflutet.
»In den letzten vierzig Jahren hat sich das Pro-Kopf-Einkommen der US-Amerikaner mehr als verdoppelt. Bedeutet dies, dass wir mehr glückliche Menschen haben? Keineswegs. Noch deutlicher ist des in Japan, wo sich das Pro-Kopf-Einkommen in den letzten vierzig Jahren verfünffacht hat, wieder: mit keinem messbaren Zuwachs an individuellem Glück«, Barry Schwartz
Also doch eher Ablenkung und Nebelkerzen um uns von den tatsächlichen Problemen der Zeit abzulenken?
»Wir verwechseln systematisch Innovation mit Fortschritt«, Harald Welzer
Es mangelt nicht an Herausforderungen. Sollten wir »Innovation« nicht eher als Ablenkung begreifen, ad acta legen und uns dem Begriff des Fortschrittes wieder annähern um die Probleme der Zeit handhaben zu können?
Referenzen
Richard von Schirach, Die Nacht der Physiker, Rowohlt (2012)
Armin Hermann, Die Jahrhundertwissenschaft, Werner Heisenberg und die Geschichte der Atomphysik, Rowohlt (1977)
Klaus Kornwachs, Philosophie der Technik (C.H.Beck Wissen) (2013)
Ludwig Fahrbach, How the growth of science ends theory change, Synthese (2011) 180: 139.
Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen Buch 1 und 2, Beck (2010)
Edward Snowden, Permanent Record, Macmillan (2019)
Atul Gawande, What matters in the end?, On Being Podcast
Sabine Hossenfelder, Lost in Math (2018)
Barry Schwartz, The Paradox of Choice, HarperCollins (2016)
Der Philosophische Stammtisch: Schöne neue digitale Welt? (mit Precht, Welzer & Gentinetta) (2018)
Shoshanna Zuboff, Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus (2018)
Rushkoff, Douglas. Present Shock: When Everything Happens Now, Penguin Publishing Group (2014)
Thomas Bauer, Die Vereindeutigung der Welt, Reclam (2018)

24 snips
Nov 26, 2019 • 27min
014 - (Pseudo)wissenschaft? Welcher Aussage können wir trauen? Teil 2
Im zweiten Teil wird untersucht, was Pseudowissenschaft von etablierter Wissenschaft unterscheidet und warum dies so wichtig ist. Anhand von Beispielen wie Astronomie vs. Astrologie werden die Prinzipien der Abgrenzung erklärt. Kritische Themen wie Falsifizierbarkeit und die Bedeutung von Induktion sowie Deduktion werden behandelt. Auch Methoden zur Erkennung pseudowissenschaftlicher Aussagen werden diskutiert, wobei die Rolle des kritischen Denkens in einer komplexen Informationslandschaft betont wird.

25 snips
Nov 12, 2019 • 38min
013 - (Pseudo)wissenschaft? Welcher Aussage können wir trauen? Teil 1
In dieser Folge wird das Konzept der Pseudowissenschaft unter die Lupe genommen. Es wird erklärt, wie man zwischen wissenschaftlich fundierten und pseudowissenschaftlichen Behauptungen unterscheidet. Anhand von Beispielen wie Astrologie und Homöopathie werden die Gefahren falscher Informationen thematisiert. Philosophische Prinzipien wie Ockhams Rasiermesser werden vorgestellt, um Wissenschaft von Pseudowissenschaft abzugrenzen. Zudem wird der Einfluss des Naturalismus erörtert und die Grundlagen des wissenschaftlichen Denkens beleuchtet.


