
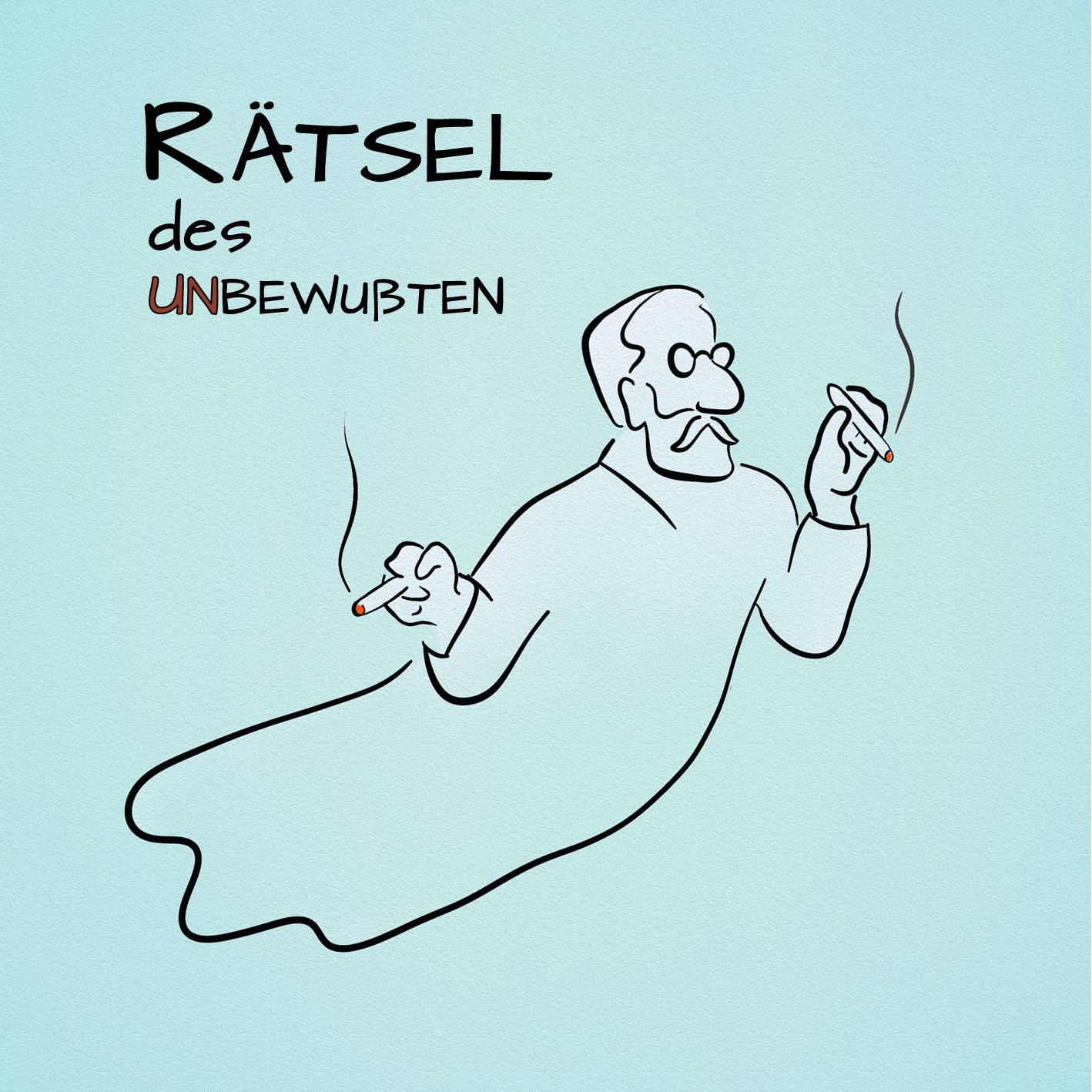
Rätsel des Unbewußten. Psychoanalyse & Psychotherapie.
Dr. Cécile Loetz & Dr. Jakob Müller
Unterstütze unseren Podcast und erhalte mehr als 60 zusätzliche Bonusfolgen, Autorengespräche und Vertiefungen: www.patreon.com/raetseldesubw
Wir widmen uns der Erforschung des Unbewussten, der modernen Psychoanalyse, Tiefenpsychologie und den Verfahren der Psychotherapie. Zudem erzählen wir Fallgeschichten aus der Praxis in unserer Reihe "Tales of Therapy".
Unser Buch mit neuen Fallgeschichten: "Mein größtes Rätsel bin ich selbst" (erscheint im Hanser Verlag) -- überall, wo es Bücher gibt.
Kontakt: Lives@psy-cast.org
Top 10 der Wissenschafts-Podcasts (Spotify) im deutschsprachigen Raum mit über 300.000 Abonnenten
Unser "Heimatinstitut" in Heidelberg: http://www.psychoanalytisches-institut-heidelberg.de/
Deutsche Psychoanalytische Vereinigung: https://www.dpv-psa.de
Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft: https://dpg-psa.de/
Netzwerk Freier Psychoanalytischer Institute: https://dgpt.de/ueber-uns/fachgesellschaften-freie-institute/netzwerk-freie-institute-fuer-psychoanalyse-und-psychotherapie
G-06T4LRH6G4
Wir widmen uns der Erforschung des Unbewussten, der modernen Psychoanalyse, Tiefenpsychologie und den Verfahren der Psychotherapie. Zudem erzählen wir Fallgeschichten aus der Praxis in unserer Reihe "Tales of Therapy".
Unser Buch mit neuen Fallgeschichten: "Mein größtes Rätsel bin ich selbst" (erscheint im Hanser Verlag) -- überall, wo es Bücher gibt.
Kontakt: Lives@psy-cast.org
Top 10 der Wissenschafts-Podcasts (Spotify) im deutschsprachigen Raum mit über 300.000 Abonnenten
Unser "Heimatinstitut" in Heidelberg: http://www.psychoanalytisches-institut-heidelberg.de/
Deutsche Psychoanalytische Vereinigung: https://www.dpv-psa.de
Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft: https://dpg-psa.de/
Netzwerk Freier Psychoanalytischer Institute: https://dgpt.de/ueber-uns/fachgesellschaften-freie-institute/netzwerk-freie-institute-fuer-psychoanalyse-und-psychotherapie
G-06T4LRH6G4
Episodes
Mentioned books

7 snips
Apr 19, 2019 • 21min
Strukturelle Störungen (29)
RÄTSELWISSEN
Episoden-Beschreibung:
Angst ist nicht gleich Angst, Zwang nicht gleich Zwang – in der Psychoanalyse werden psychische Symptome u.a. auch danach untersucht, in welchen psychischen Kontext sie eingebettet sind. Das sogenannte Strukturniveau der Psyche gibt dabei Auskunft über die Architektur und Beschaffenheit des seelischen Gebäudes, das mehr oder weniger stabil gebaut sein kann. Was es mit Störungen dieser seelischen Architektur, den sogenannten strukturellen Störungen, auf sich hat, davon handelt diese Folge.
Download (mp3)
Literaturempfehlungen
Erikson, Erik H.: Identität und Lebenszyklus. Drei Aufsätze; Frankfurt a. M. 1966; 2. Aufl. 1973
Freud, Sigmund (1923/1999). Das Ich und das Es. In: GW, Band 13, Frankfurt a.M., Fischer Taschenbuchverlag, S. 235–289
Kernberg, Otto (1996). Ein psychoanalytisches Modell der Klassifizierung von Persönlichkeitsstörungen. Psychotherapeut 41: 288-296
Mentzos, Stavros: Lehrbuch der Psychodynamik: Die Funktion der Dysfunktionalität psychischer Störungen. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015.
Links
Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD)
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org
Unterstütze unser Projekt auf Patreon und erhalte die Skripte zu den Folgen
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal

7 snips
Apr 5, 2019 • 24min
Klein, Bion, Winnicott: Objektbeziehungstheorien (28)
RÄTSELWISSEN
Episoden-Beschreibung:
Das Geheimnis der Wirksamkeit von Psychoanalysen gründet auf emotionalen Erfahrungen in der therapeutischen Beziehung – auch wenn es zunehmend Versuche gibt, die »Variable« Therapeut durch digitale Anwendungen zu ersetzen. Warum eine Psychoanalyse nicht auf die zwischenmenschliche Begegnung verzichten kann, wird in den sogenannten Objektbeziehungstheorien auf den Begriff gebracht. Die Folge gibt eine Einführung in wesentliche Grundlagen der Objektbeziehungstheorien, ohne die sich die moderne Psychoanalyse nicht verstehen läßt.
Download (mp3)
Literaturempfehlungen
Storck, Timo (2019). Objekte. Stuttgart: Kohlhammer
Klein, Melanie (2001). Das Seelenleben des Kleinkindes und andere Beiträge zur Psychoanalyse. Klett-Cotta, Stuttgart.
Rüth, Ulrich (2005). Bion für Beginner. Eine Einführung zu Wilfred Ruprecht Bion (1897–1979): Leben und Werk. Forum der - Kinder- und Jugendspychiatrie und Psychotherapie, 4, 66–81.
Sandler, Joseph. (2003). On attachment to internal objects. Psychoanalytic Inquiry, 23, 12–26.
Sandler, Joseph; Sandler, Anne-Marie (1999). Innere Objektbeziehungen. Klett-Cotta, Stuttgart 1999
Winnicott, Donald (1979): Die Spiegelfunktion von Mutter und Familie in der kindlichen Entwicklung. In: Winnicott D. W., Vom Spiel zur Kreativität. Stuttgart, Klett-Cotta, S. 128–135
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org
Unterstütze unser Projekt auf Patreon und erhalte die Skripte zu den Folgen
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal

Mar 22, 2019 • 25min
Autismus. Halt im Haltlosen (27)
RÄTSELWISSEN
Hinweis: Einige Beschreibungen in der Folge entsprechen nicht dem aktuellen Forschungsstand. Auch unser Wissen verändert sich mit der Zeit und wir werden die Folge an diesen Stellen noch einmal überarbeiten, bitten die Folge bis dahin mit diesem Hinweis im Hinterkopf zu hören
Episodenbeschreibung
Beim Autismus handelt es sich um eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die sich u.a. maßgeblich auf die Fähigkeit einer Person auswirkt, in einen schwingungsvollen emotionalen Kontakt zu anderen Menschen zu kommen. Dabei scheinen viele autistische Phänomene und Verhaltensweisen von außen betrachtet zunächst unverständlich. In der psychoanalytischen Arbeit mit autistischen Kindern und Erwachsenen wird u.a. versucht, einen verstehenden Zugang zu der autistischen Welt zu finden und dem Betroffenen dadurch Halt zu vermitteln und einen Entwicklungsraum zu eröffnen.
Download (mp3)
Literaturempfehlungen:
Bick, Esther (1968). The Experience of the Skin in Early Object-Relations. International Journal of Psycho-Analysis, 49:484-486
Durban, Joshua (2019). Heimat, Heimatlosigkeit und Nirgendwosein in der frühen Kindheit. Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse, 73(1):17-41
Durban, Joshua (2014). Despair and hope: on some varieties of counter-transference and enactment in the psychoanalysis of ASD (autistic spectrum disorder) children. Journal of Child Psychotherapy, 40(2):187-200
Durban, Joshua (2014). Umhüllung und autistisch falsche Formen als schützende Schale gegen Formlosigkeit und Transformation. Jahrbuch der Psychoanalyse, 68:173-192
Nissen, Bernd (2015). Zur psychoanalytischen Konzeptualisierung und Behandlung von Störungen aus dem autistischen und autistoiden Spektrum. Psychotherapeutenjournal 2/2015, S. 110-119
Nissen, Bernd (2006). Autistische Phänomene in psychoanalytischen Behandlungen. Psychosozial-Verlag
Tustin, Frances (1993). Anmerkungen zum psychogenen Autismus. Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse, 47(12):1172-1183

Mar 8, 2019 • 25min
Warum träumen wir? Teil I: Die Traumlehre Sigmund Freuds. (26)
RÄTSELWISSEN
Episodenbeschreibung
Einen Großteil unseres Lebens verträumen wir – auch wenn wir uns nicht immer an unsere Träume erinnern können. Aber warum träumen wir überhaupt? Und was bedeuten unsere Träume? Im ersten Teil unserer Serie über das Träumen befassen wir uns mit dem Ursprung der Traumdeutung und der Traumlehre Sigmund Freuds.
Bonusfolge: Die Podcastautoren im Gespräch über die Bedeutung Sigmund Freuds für die aktuelle Psychoanalyse (via Patreon)
Download (mp3)
Literaturempfehlungen:
Deserno, H. (Hrsg., 1999). Das Jahrhundert der Traumdeutung. Perspektiven psychoanalytischer Traumforschung. Stuttgart: Klett-Cotta.
Freud, S. (1999a) Gesammelte Werke. Bd. 2/3: Die Traumdeutung. Frankfurt/M.: Fischer.
Freud S. (1910/1999). Über den Gegensinn der Urworte. Gesammelte Werke, Bd. VIII, 214–221. Frankfurt a.M.: Fischer.
Meltzer, D. (1988). Traumleben. Eine Überprüfung der psychoanalytischen Theorie und Technik. München / Wien: Verlag Internationale Psychoanalyse.
Mertens, W. (1999). Traum und Traumdeutung. München: C.H. Beck.
Schredl, M. (2013). Träume. Unser nächtliches Kopfkino. Heidelberg: Springer Spektrum.
Walde, C. (2001). Antike Traumdeutung und moderne Traumforschung. Düsseldorf / Zürich: Artemis und Winkler.
Zu Psychoanalyse & Film: Siehe die Reihe »Im Dialog: Psychoanalyse und Filmtheorie im Psychosozial-Verlag«
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org
Unterstütze unser Projekt auf Patreon und erhalte die Skripte zu den Folgen sowie weitere Bonusinhalte
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal

4 snips
Feb 22, 2019 • 23min
Widerstand. Oder: Warum wir nicht wollen, was wir wollen (25)
RÄTSELWISSEN
Episodenbeschreibung
In unserer Seele wirken seltsame Kräfte. Es gibt viele Dinge, die wir eigentlich tun wollen, zugleich aber keine Entschlußkraft finden. Oder wir vergessen ganz, was wir uns eben noch vorgenommen haben. Nur Zufall oder das Gesetz der Gewohnheit? In der Psychoanalyse gehört der Widerstand zu einem der zentralen Konzepte. Einerseits hilft Widerstand, unser psychisches Gleichgewicht aufrechtzuhalten, verhindert andererseits aber auch Entwicklung – selbst dann, wenn wir sie uns bewußt wünschen. Ein Dilemma für die therapeutische Situation. Was das Konzept des Widerstands genau meint und wie Therapeuten damit arbeiten, erfahrt ihr in dieser Folge.
Download (mp3)
Literaturempfehlungen:
Ermann, Michael (2000). Widerstand. In: Mertens/Waldvogel, Handbuch Psychoanalytischer Grundbegriffe (S.797–802), Stuttgart: Kohlhammer
Freud, Sigmund (1929/1999). Zur Psychologie der Traumvorgänge. In: GW II/III, Frankfurt am Main: Fischer
Freud, Sigmund (1937/1999). Die endliche und die unendliche Analyse. In: GW XVI (S.59–99), Frankfurt am Main: Fischer
Schneider, Gerhard (2005): Die Gefahr der Heilung – Psychische Veränderung als tödliche Bedrohung. Jahrbuch der Psychoanalyse, 51, 81-114.
Storck, Timo (2021). Abwehr und Widerstand. Grundelemente psychodynamischen Denkens. Stuttgart: Kohlhammer.
Trimborn, Winfrid (2005): Die Gefahr der Heilung. Pathologische Identifizierungs- und Mentalisierungsprozesse als Grenzen therapeutischer Möglichkeiten. In: Gerhard Schneider, Günter Seidler (Hg.): Internalisierung und Strukturbildung. Westdeutscher Verlag, Opladen.
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org
Unterstütze unser Projekt auf Patreon und erhalte die Skripte zu den Folgen
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal

6 snips
Feb 8, 2019 • 18min
Das Geheimnis der Kuscheltiere: Übergangsobjekte (24)
RÄTSELWISSEN
Episodenbeschreibung
Kuscheltiere gehören zur Kindheit wie Märchen oder Süßigkeiten. Aber warum lieben Kinder ihre Kuscheltiere so sehr? Diese Folge befaßt sich mit dem Geheimnis der Kuscheltiere – und warum diese für Kindertherapien, aber auch für die gesamte menschliche Entwicklung von Bedeutung sind.
Bonusfolge: Die Podcastautoren im Gespräch über Donald Winnicotts Leben und Werk (via Patreon)
Download (mp3)
Literaturempfehlungen:
Fonagy, P; Gergely, G.; Jurist, E. L., Target, M. (2004).: Affektregulie-rung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst. Stuttgart: Klett-Cotta.
Margaret S. Mahler, Fred Pine, Anni Bergmnn (1980). Die psychische Ge-burt des Menschen. Frankfurt a.M.: Fischer.
Winnicott, D. W. (1969). Übergangsobjekte und Übergangsphänomene. Eine Studie über den ersten, nicht zum Selbst gehörenden Besitz. Dt. in: Psyche Nr. 23.
Winnicott, D.W. (2006). Vom Spiel zur Kreativität, Stuttgart: Klett Cotta.
Stern, D. (2007). Die Lebenserfahrung des Säuglings. Stuttgart: Klett-Cotta (9., erw. Auflage).
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org
Unterstütze unser Projekt auf Patreon und erhalte die Skripte zu den Folgen
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal

Jan 7, 2019 • 2min
Winterpause und neue Folgen
Rätsel des Unbewußten
Wir bedanken uns sehr herzlich bei euch für einen schönen und so erfolgreichen Start in die Podcasting-Welt und die vielen Rückmeldungen, über die wir uns sehr gefreut haben! Auch freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und ab Februar wieder mit uns in die Tiefen und Weiten des Unbewußten taucht.

5 snips
Jan 4, 2019 • 21min
Mentalisierung. Oder: »Ich denke was, was du nicht denkst.« (23)
RÄTSELWISSEN
Episodenbeschreibung:
Jeder hat sich wahrscheinlich schon einmal verwundert gefragt: »Warum habe ich das bloß getan?« oder auch: »Warum verhält sich mein Partner eigentlich so?« Die Fähigkeit, das eigene Handeln und Verhalten oder auch das einer anderen Person in Verbindung mit mentalen Zuständen zu bringen und zu interpretieren, bezeichnet man als Mentalisierungsfähigkeit. Bei manchen Menschen ist sie gut ausgeprägt, bei anderen eher brüchig, wie beispielsweise häufig bei sogenannten »Borderline-Persönlichkeitsstörungen«. Wie wir Mentalisierungsfähigkeit entwickeln und welche Folgen eine mißlingende Mentalisierung hat, davon handelt diese Folge.
Download (mp3)
Literaturempfehlungen:
Allen, Jon G. & Fonagy, Peter (2007). Handbook of Mentalization-Based Treatment. John Wiley & Sons, Ltd, Sussex.
Fonagy, Peter (2003). Bindungstheorie und Psychoanalyse. Klett-Cotta, Stuttgart.
Müller, Jakob Johann (2018). Bindung am Lebensende. Eine Untersuchung zum Bindungserleben von PalliativpatientInnen und HospizbewohnerInnen. Psychosozial-Verlag, Gießen.
Taubner, Svenja (2016). Konzept Mentalisieren. Eine Einführung in Forschung und Praxis. Psychosozial-Verlag, Gießen.
Videos:
Maxi und die Schokolade
False Belief Test
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org
Unterstütze unser Projekt auf Patreon und erhalte das Skript zur aktuellen Folge
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal

9 snips
Dec 28, 2018 • 19min
»O Abschied, Brunnen aller Worte« – Warum Entwicklung auf Verlusten gründet. (22)
RÄTSELWISSEN
Episodenbeschreibung
Leben heißt trennen. Und Bindung, Liebe, geht immer mit Verlusten einher – so sind auch Glück und Trauer nahe Verwandte. Warum Trennung und Verlust nicht nur schmerzhaft, sondern auch wichtig für die psychische Entwicklung sind, davon handelt die letzte Folge dieses Jahres.
Download (mp3)
Literaturempfehlungen:
Balzer, W. (2017). Schrankenlos. Die elektronischen Präsenzmedien und der beschädigte Primärprozess. In: Nitzschmann, K, Döser, J, Schneider, G, Walker, C (Hg.): Kulturpsychoanalyse heute. Grundlagen, aktuelle Beiträge, Perspektiven. Gießen: Psychosozial.
Bion, W. (1962). A Theory of Thinking, in: International Journal of Psy-cho-Analysis 43 (1962).
Bowlby, J. (1974). Attachment and Loss. London, UK: Hogarth.
Bowlby: Das Glück und die Trauer. Herstellung und Lösung affektiver Bin-dungen. Klett-Cotta, Stuttgart 1980.
Freud, Sigmund (1917/1991): Trauer und Melancholie. In: Gesammelte Werke, Bd. X.. Frankfurt am Main: S. Fischer, 427–446.
Haas, E. (1990). Orpheus und Eurydike. Vom Ursprungsmythos des Trauerprozesses. Jahrbuch der Psychoanalyse 26, 230-252.
Volkan, V. (1981). Linking objects and linking phenomena : a study of the forms, symptoms, metapsychology, and therapy of complicated mourning. New York, NY, US: International Universities Press.
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org
Unterstütze unser Projekt auf Patreon und erhalte das Skript zur aktuellen Folge
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal

5 snips
Dec 21, 2018 • 20min
Bindung. Der Stoff, aus dem die Seele ist. (21)
RÄTSELWISSEN
Episodenbeschreibung:
Was unser seelisches Innenleben ausmacht, gründet in wesentlichen Teilen auf unseren frühen Beziehungserfahrungen. Dieser Grundsatz psychoanalytischen Denkens wird besonders am Konzept der Bindung deutlich. Bindung beschreibt dabei die existentielle Erfahrung von emotionaler Resonanz und Geborgenheit in Beziehungen – oder deren folgenreiches Ausbleiben.
Download (mp3)
Literaturempfehlungen:
Bowlby, J. (1988). A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development. London, UK: Tavistock/Routledge.
Brisch, K.-H. (2009). Bindung und Trauma. Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern.
Fonagy, P. & Luyten, P. (2011). Die entwicklungspsychologischen Wurzeln der Borderline-Persönlichkeitsstörung in Kindheit und Adoleszenz: Ein Forschungsbericht unter dem Blickwinkel der Mentalisierungstheorie. Psyche, 65(9-10):900-952.
Grossmann, K. & Grossmann, K. (2008). Bindungen – das Gefüge psychischer Sicherheit. Stuttgart: Klett-Cotta.
Grossmann, K. Grossmann, K. Köhler (Hrsg.): Bindung und seelische Entwicklungswege. Klett-Cotta, Stuttgart 2002
Köhler, L (1998). Anwendung der Bindungstheorie in der psychoanalytischen Praxis. Einschränkende Vorbehalte, Nutzen, Fallbeispiele. Psyche 52, S. 369–397.
Teicher, M. H. (2000): Wounds that time won't heal: The neurobiology of child abuse. Cerebrum, 4, 50-67.
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org
Unterstütze unser Projekt auf Patreon und erhalte das Skript zur aktuellen Folge
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal


