
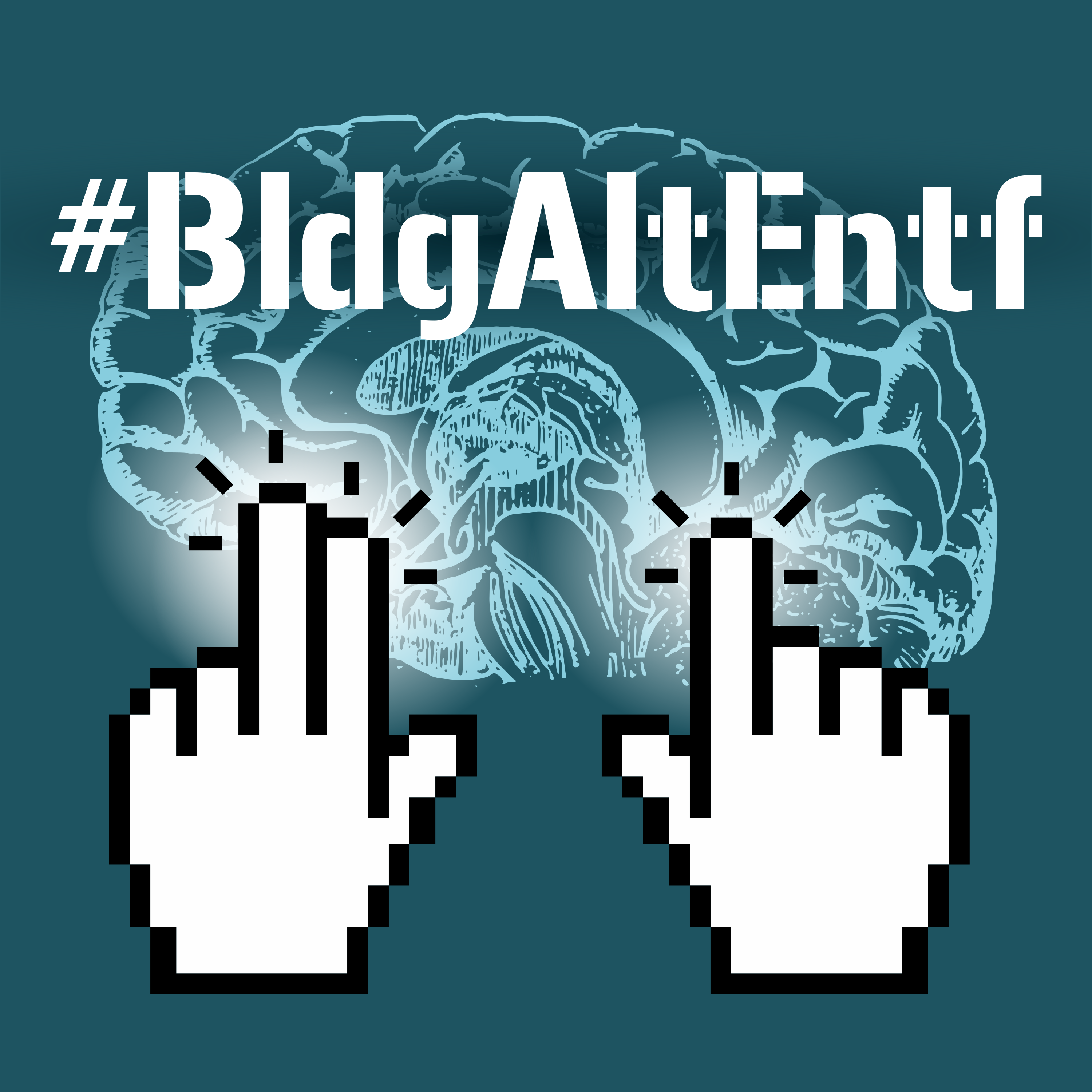
Bildung-Alt-Entfernen
Anja Lorenz, Oliver Tacke
Was früher mal E-Learning hieß ...
Episodes
Mentioned books

Sep 12, 2019 • 1h 59min
BldgAltEntf E019: In Co-Working-Spaces ist Musik drin
Die Folge haben wir am 11.09.2019 aufgenommen.
Intro & Feedback
Ganz unten im Keller des Gesetzesentwurfs „zur weiteren Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ steht, dass „Steuerbefreiung nur noch für Bildungsangebote gelten [soll], die direkt dem beruflichen Fortkommen dienen oder dem Schulunterricht vergleichbar sind“. Mehr dazu auf dem Blog von Jan-Martin Wiarda, sonst rege ich mich beim Shownotes-Schreiben gleich nochmal auf.
Wir bedanken uns bei Martin für den Kommentar auf der Tonspur und irgendwie ist es auch cool, wenn über den Podcast mehr Fragen zu freien Lernmaterialien aufkommen. Da beantworten wir die doch glatt auch mal am Telefon .
News+Alt+Entf
News+O
O hat sich den neuen Tarantino angeschaut und fand ihn ganz gut – anders als „Kollege“ Bastian Bielendorfer im AAA-Podcast (den muss man nicht hören – sollte man aber mal, vor allem wegen der Intros).
Außerdem fetzt Poetry Slam. Wer das nicht kennt und an einem Ort wohnt, wo selten einer ist, sei der YouTube-Kanal PoetrySlam TV empfohlen.
A und O waren beide auf dem stARTcamp in Hamburg, das die Themen Wissenschaft und Kultur miteinander verBarCampte.
Am Tag vorher gab es noch einen Auftakt mit Christian, der für den Podcast Hamburg hOERt ein HOOU einen UnPodcast aufgenommen hat.
News+A
A war beim BarCamp in Kiel. Themen waren u. a. das Open-Data-Portal Schleswig-Holstein (was aber eher keine Konkurrenz für TopfSecret sein wird – aus Gründen), Digitalisierung in der Verwaltung (samt Zuständigkeitsfinder) oder die Gesellschaft für digitale Ethik.
Beim JOINTLY OER- & IT-SommerCamp wurden Code und Content gehackt und über den Föderalismus in der Bildung sinniert. Etwas später hat A auch einen Workshop zu OER bei der MoodleMOOT des IQSH gegeben.
Gemeinsam mit O war A bei der Lage Live in Hamburg des megaerfolgreichen Podcasts „Lage der Nation„.
Außerdem gab es für das EduCamp einiges zu tun: es musste ein Ausrichter für das Frühjahr 2020 gewählt und das EduCamp in Hattingen vorbereitet werden (das bereits ausgebucht ist).
Gerade bastelt A gemeinsam mit Lambert Heller auch an einem Tutorial zu Open Science und Open Education für die DeLFI in Berlin.
A + O (und K) bei der Lage Live in Hamburg
Paper+Alt+Entf
Paper+A+O: „WOERrksamkeit und WOERkung“ oder „OER wirken über den Placebo-Effekt hinaus – zumindest gegen Hunger“
Hilton, JohnOpen educational resources, student efficacy, and user perceptions: a synthesis of research published between 2015 and 2018 Artikel In: Educational Technology Research and Development, 2019, ISSN: 1556-6501.Abstract | Links | BibTeX@article{Hilton2019,
title = {Open educational resources, student efficacy, and user perceptions: a synthesis of research published between 2015 and 2018},
author = {John Hilton},
url = {https://doi.org/10.1007/s11423-019-09700-4},
doi = {10.1007/s11423-019-09700-4},
issn = {1556-6501},
year = {2019},
date = {2019-08-06},
journal = {Educational Technology Research and Development},
abstract = {Although textbooks are a traditional component in many higher education contexts, their increasing price have led many students to forgo purchasing them and some faculty to seek substitutes. One such alternative is open educational resources (OER). This present study synthesizes results from sixteen efficacy and twenty perceptions studies involving 121,168 students or faculty that examine either (1) OER and student efficacy in higher education settings or (2) the perceptions of college students and/or instructors who have used OER. Results across these studies suggest students achieve the same or better learning outcomes when using OER while saving significant amounts of money. The results also indicate that the majority of faculty and students who have used OER had a positive experience and would do so again.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenAlthough textbooks are a traditional component in many higher education contexts, their increasing price have led many students to forgo purchasing them and some faculty to seek substitutes. One such alternative is open educational resources (OER). This present study synthesizes results from sixteen efficacy and twenty perceptions studies involving 121,168 students or faculty that examine either (1) OER and student efficacy in higher education settings or (2) the perceptions of college students and/or instructors who have used OER. Results across these studies suggest students achieve the same or better learning outcomes when using OER while saving significant amounts of money. The results also indicate that the majority of faculty and students who have used OER had a positive experience and would do so again.Schließenhttps://doi.org/10.1007/s11423-019-09700-4doi:10.1007/s11423-019-09700-4Schließen
Die Skepsis gegenüber OER wird oft dadurch begründet, dass es hier wohl kaum solche Prozesse zur Qualitätssicherung gäbe, wie sie kommerzielle Angebote haben. Hilton hat die Wirksamkeit und die Wahrnehmung von OER durch Lehrende und Studierende in den USA untersucht, und das mittlerweile schon zweimal. Immer kam dabei heraus, dass OER überwiegend gleichwertig, zum Teil häufig besser als kommerzielle Lehrbücher in diesen Kategorien bewertet wurden.
A hat schon beim zugehOERt-Podcast angezweifelt, dass das ein spezielles Thema nur für OER sei (sondern wenn dann für Lehrmaterialien insgesamt).
Damit Ihr Os Referenz versteht: das ist TimeTex Castello.
Textbook Assessment and Usage Scale zur Bewertung von Lehrbüchern.
A wird in nächster Zeit wohl öfter automatisch übersetzte Paper lesen. Gerade DeepL liefert erstaunlich gute Ergebnisse.
Fundgrube+Alt+Entf
Projekte, Tools, Apps… das sind doch bürgerliche Kategorien. Wir packen einfach alles in die Fundgrube:
Über den avataaars-Generator kann man sich Avatare generieren. Quelltext ist auch auf GIT. (Danke an Jana.)
Bei InterviewJS kann man Content als Chat-Story präsentieren. Auch hier ist der Quelltext verfügbar. (Danke an Nele.)
Beim Materialnetzwerk entstehen Lehrmaterialien für den Schulbereich. U.a. ist Tutory da mit an Board.
Über Matthias haben wir die “Two Minute Papers” kennengelernt. In etwa 2 Minuten werden Paper vorgestellt, bspw. zu AR-Einsatz für Präsentationen.
Wer die AGBs nicht lesen möchte (und wer möchte das schon), könnte sich auf „Terms of Service, didn’t read“ eine Art Ampelsystem zu den einzelnen Tools anschauen.
Politik+Alt+Entf
Über einen Tweet von Matthias haben wir die Frage diskutiert, ob Co-Working-Space-Abos die Arbeit im Öffentlichen Dienst attraktiver machen könnten.
Veranstaltungstipps
20. September 2019: Demo „Alle fürs Klima“ in ganz vielen Städten
Es ist wichtig. Wirklich.
Ab sofort, Einstieg bis 22. September 2019: creatOERs im Internet (#creatOERs)
In diesem Lernangebot kann man bis zum Ende des Jahres eigene OER erstellen. Man wird dabei begleitet und kann auf eine interessante Community hoffen.
23. bis 26. Oktober 2019: Maker Days 4 Kids in Leipzig
Nach Graz und Bad Reichenhall kommen die Maker Days nach Leipzig. Man kann seine Kinder dort anmelden, Erwachsene dürfen nur am letzten Tag dazu kommen.
4. bis 6. November 2019: OERcamp Werkstatt bei Berlin (#OERCamp)
Man kann sich endlich verbindlich anmelden! Zusammen mit A, O und ganz vielen anderen kann man drei Tage lang OER machen.
Mythos+Alt+Entf
… das erklärt O im Podcast
TED-Talks von Sugata Mitra zum „Hole in the wall“-Projekt
Weltverbesserung+Alt+Entf
DRK Kreisverband Berlin „Haus am Lietzensee“ hat neues Gebäude bekommen und braucht nun noch Einrichtung (Stühle, Tische, Schränke) für das Jugendrotkreuz, Erste-Hilfe-Ausbildung und einige Projekte, die darin untergebracht sind. Das ist eigentlich keine große Sache, in Summe werden 5.500 Euro benötigt. Hier kann man dafür spenden.

Aug 8, 2019 • 3h 21min
BldgAltEntf E018: Faster, Harder, E-Scooter
Die Folge haben wir am 07.08.2019 aufgenommen.
Intro & Feedback
Der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière ist jetzt übrigens Vorsitzender der Telekomstiftung. Mehr im Abschnitt Politik.
Zur letzten Folge hatten wir einen sehr ausführlichen Kommentar von René, der richtigerweise darauf hinweist, dass Lehrerinnen und Lehrer nicht unmündig seien, sondern entlastet werden sollen. Sebastian mag, dass wir Nicht-Pädagogen öffentlich einen solchen Podcast machen (wir glauben, das ist ein Lob ). Markus mochte unser Intro (merke: Spam vorlesen als Podcast-Format durchdenken) und findet Os Vorhaben spannend, nächstes Jahr im Recurse Center anzuheuern. Ein anderer Markus empfiehlt uns und andere Podcasts, wir sagen danke (auch für die nette Gesellschaft der anderen Nennungen ).
News+Alt+Entf
News+O
O arbeitet ständig selbst ganz erfolgreich.
O bedankt sich bei Nele für die schnelle Erweiterung ihres Services Mailnudge (mit dem kann man eine E-Mail an das Zukunfts-Ich schreiben).
Wegen Scammern, Spam/Malware-Mails (hier der Log vom beschriebenen Fall) und Kommentaren mit die menschenverachtenden Inhalten ärgert sich O häufig. Und es ärgert ihn, dass ihn das ärgert.
O ist in Hamburg eScooter gefahren und fand es weniger sinnvoll im Vergleich zu Fahrrad und ÖPNV. Dennoch fand er (und A auch) die Folge von Sascha Lobos Debattencast dazu sehr gut.
News+A
A war im Urlaub,
war dort von den niederländischen Mobilitätskonzepten beeindruckt,
kann auch nach den Erfahrungen dort Free Walking Tours sehr empfehlen,
und findet weiterhin Gefallen an gut gemachten Audio-Guides und Apps in Museen (beides zusammen bspw. mit izi.travel) und
war davon beeindruckt, wie gut sich Google Lens mittlerweile bei der Live-Übersetzung bspw. in Museen oder Restaurants macht
A weist darauf hin, dass die Abstimmung für den Standort des EduCamps im Frühjahr 2020 gestartet ist: Frankfurt und Calberlah haben sich beworben.
Außerdem hat sie noch zwei Podcast-Empfehlungen:
OMR #207 mit Frederick Braun vom Miniaturwunderland
BZT056 mit Enno Park
Google Lens beim Erkennen handgeschriebener Texte auf einer mittelalterlichen Karte im Mercator-Museum St. Niklaas
Paper+Alt+Entf
Paper+O #1: M-M-MOOC Headroom
Dacrema, Maurizio Ferrari; Cremonesi, Paolo; Jannach, DietmarAre We Really Making Much Progress? A Worrying Analysis of Recent Neural Recommendation Approaches Artikel In: Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys 2019), 2019.Abstract | Links | BibTeX@article{Dacrema2019,
title = {Are We Really Making Much Progress? A Worrying Analysis of Recent Neural Recommendation Approaches},
author = {Maurizio Ferrari Dacrema and Paolo Cremonesi and Dietmar Jannach},
url = {https://arxiv.org/abs/1907.06902
https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1907-06902},
year = {2019},
date = {2019-07-23},
urldate = {2019-08-08},
journal = {Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys 2019)},
abstract = {Deep learning techniques have become the method of choice for researchers working on algorithmic aspects of recommender systems. With the strongly increased interest in machine learning in general, it has, as a result, become difficult to keep track of what represents the state-of-the-art at the moment, e.g., for top-n recommendation tasks. At the same time, several recent publications point out problems in today's research practice in applied machine learning, e.g., in terms of the reproducibility of the results or the choice of the baselines when proposing new models. In this work, we report the results of a systematic analysis of algorithmic proposals for top-n recommendation tasks. Specifically, we considered 18 algorithms that were presented at top-level research conferences in the last years. Only 7 of them could be reproduced with reasonable effort. For these methods, it however turned out that 6 of them can often be outperformed with comparably simple heuristic methods, e.g., based on nearest-neighbor or graph-based techniques. The remaining one clearly outperformed the baselines but did not consistently outperform a well-tuned non-neural linear ranking method. Overall, our work sheds light on a number of potential problems in today's machine learning scholarship and calls for improved scientific practices in this area. },
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenDeep learning techniques have become the method of choice for researchers working on algorithmic aspects of recommender systems. With the strongly increased interest in machine learning in general, it has, as a result, become difficult to keep track of what represents the state-of-the-art at the moment, e.g., for top-n recommendation tasks. At the same time, several recent publications point out problems in today's research practice in applied machine learning, e.g., in terms of the reproducibility of the results or the choice of the baselines when proposing new models. In this work, we report the results of a systematic analysis of algorithmic proposals for top-n recommendation tasks. Specifically, we considered 18 algorithms that were presented at top-level research conferences in the last years. Only 7 of them could be reproduced with reasonable effort. For these methods, it however turned out that 6 of them can often be outperformed with comparably simple heuristic methods, e.g., based on nearest-neighbor or graph-based techniques. The remaining one clearly outperformed the baselines but did not consistently outperform a well-tuned non-neural linear ranking method. Overall, our work sheds light on a number of potential problems in today's machine learning scholarship and calls for improved scientific practices in this area. Schließenhttps://arxiv.org/abs/1907.06902https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1907-06902Schließen Kim, Byung-Hak; Ganapathi, VarunLumièreNet: Lecture Video Synthesis from Audio Artikel In: CoRR, Bd. bs/1907.02253, 2019.Abstract | Links | BibTeX@article{Kim2019,
title = {LumièreNet: Lecture Video Synthesis from Audio},
author = {Byung-Hak Kim and Varun Ganapathi},
url = {http://arxiv.org/abs/1907.02253
https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1907-02253},
year = {2019},
date = {2019-07-08},
urldate = {2019-08-08},
journal = {CoRR},
volume = {bs/1907.02253},
abstract = {We present LumièreNet, a simple, modular, and completely deep-learning based architecture that synthesizes, high quality, full-pose headshot lecture videos from instructor's new audio narration of any length. Unlike prior works, LumièreNet is entirely composed of trainable neural network modules to learn mapping functions from the audio to video through (intermediate) estimated pose-based compact and abstract latent codes. Our video demos are available at [22] and [23].},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenWe present LumièreNet, a simple, modular, and completely deep-learning based architecture that synthesizes, high quality, full-pose headshot lecture videos from instructor's new audio narration of any length. Unlike prior works, LumièreNet is entirely composed of trainable neural network modules to learn mapping functions from the audio to video through (intermediate) estimated pose-based compact and abstract latent codes. Our video demos are available at [22] and [23].Schließenhttp://arxiv.org/abs/1907.02253https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1907-02253Schließen
Bei Udacity wird damit experimentiert, wie man aus einer Tonspur automatisch passende Vortragsvideos erzeugen kann, wenn man künstliche neuronale Netze zuvor mit Videovorträgen einer Person trainiert hat. Die Autoren sind zufrieden – auch wenn die gelieferten Beispielvideos noch Luft nach oben lassen.
Vielleicht ist hier tatsächlich eine vorsichtige Einschätzung ratsam, wenn man ein anderes Paper heranzieht: Die Ergebnisse von Algorithmen, die künstliche neuronale Netze verwenden, sind nicht immer reproduzierbar oder einfacheren Ansätzen unterlegen.
für U40-Menschen: Max Headroom
Beispielvideo 1: https://vimeo.com/327196781
Beispielvideo 2: https://vimeo.com/327196551
Paper+A: Ich mag es immer noch
Leitner, Philipp; Ebner, MartinExperiences with a MOOC-platform – Who are our learners and what do they think about MOOCs? Proceedings Article In: Proceedings of Work in Progress Papers of the Research, Experience and Business Tracks at EMOOCs 2019, 2019, ISSN: 1613-0073.Abstract | Links | BibTeX@inproceedings{Leitner2019,
title = {Experiences with a MOOC-platform – Who are our learners and what do they think about MOOCs?},
author = {Philipp Leitner and Martin Ebner},
url = {http://ceur-ws.org/Vol-2356/
http://ceur-ws.org/Vol-2356/experience_short14.pdf
https://www.researchgate.net/publication/333446168_Experiences_with_a_MOOC-platform_-Who_are_our_learners_and_what_do_they_think_about_MOOCs},
issn = {1613-0073},
year = {2019},
date = {2019-05-20},
urldate = {2019-08-08},
booktitle = {Proceedings of Work in Progress Papers of the Research, Experience and Business Tracks at EMOOCs 2019},
volume = {2356},
abstract = {iMooX, the first and currently only Austrian MOOC platform, has been hosting xMOOCs since 2014. Directly after the start a survey of the first three MOOCs was conducted and published in 2015. In the meantime, the MOOC platform contains more than 45 courses and serves many thousands of learners. Therefore, we are investigating, if there is a change towards the learners themselves, their expectations and experiences regarding learning with MOOCs as well as with the platform. Using the exact same survey as years before it can be shown that there are little changes in the right directions or maybe it can be concluded that learning with MOOCs became more common to a broader public, at least in the academic world.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {inproceedings}
}
SchließeniMooX, the first and currently only Austrian MOOC platform, has been hosting xMOOCs since 2014. Directly after the start a survey of the first three MOOCs was conducted and published in 2015. In the meantime, the MOOC platform contains more than 45 courses and serves many thousands of learners. Therefore, we are investigating, if there is a change towards the learners themselves, their expectations and experiences regarding learning with MOOCs as well as with the platform. Using the exact same survey as years before it can be shown that there are little changes in the right directions or maybe it can be concluded that learning with MOOCs became more common to a broader public, at least in the academic world.Schließenhttp://ceur-ws.org/Vol-2356/http://ceur-ws.org/Vol-2356/experience_short14.pdfhttps://www.researchgate.net/publication/333446168_Experiences_with_a_MOOC-platf[...]Schließen Neuböck, Kristina; Kopp, Michael; Ebner, MartinWhat do we know about typical MOOC participants? First insights from the field Proceedings Article In: Proceedings of eMOOCs 2015 conference, S. 183–190, Mons, 2019.Abstract | Links | BibTeX@inproceedings{Neuböck2019,
title = {What do we know about typical MOOC participants? First insights from the field},
author = {Kristina Neuböck and Michael Kopp and Martin Ebner},
url = {https://www.researchgate.net/publication/276473928_What_do_we_know_about_typical_MOOC_participants_First_insights_from_the_field},
year = {2019},
date = {2019-05-20},
urldate = {2019-08-08},
booktitle = {Proceedings of eMOOCs 2015 conference},
pages = {183–190},
address = {Mons},
abstract = {assive Open Online Courses became a worldwide phenomenon. Especially in Central Europe it is a subject of debates whether universities should invest more money or not. This research study likes to give first answers about typical MOOC participants based on data from different field studies of the Austrian MOOC-platform iMooX.
It can be pointed out that the typical learner is a student or an adult learner, strongly interested in the course topic or just interested in learning with media and finally with self- contained learning competencies. The research work concludes that MOOCs broaden the educational field for universities and are a possibility to educate the public in a long run.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {inproceedings}
}
Schließenassive Open Online Courses became a worldwide phenomenon. Especially in Central Europe it is a subject of debates whether universities should invest more money or not. This research study likes to give first answers about typical MOOC participants based on data from different field studies of the Austrian MOOC-platform iMooX.
It can be pointed out that the typical learner is a student or an adult learner, strongly interested in the course topic or just interested in learning with media and finally with self- contained learning competencies. The research work concludes that MOOCs broaden the educational field for universities and are a possibility to educate the public in a long run.Schließenhttps://www.researchgate.net/publication/276473928_What_do_we_know_about_typical[...]Schließen
Die österreichische MOOC-Plattform iMOOX hat im Wintersemester 2017/18 und im Sommersemester geschaut, wer eigentlich an den MOOCs teilnimmt, welche Interessen sie verfolgen und wie sie die Plattform und Kurse bewerten. Da sie das schon einmal 2015 getan haben, konnten die Autoren auch ein paar Änderungen feststellen.
Herbert Schmidt vom efiMOOC
Paper+O #2: Hyper, Hyper!
Perini, Marco; Cattaneo, Alberto A. P.; Tacconi, GuiseppeUsing Hypervideo to support undergraduate students’ reflection on work practices: a qualitative study Artikel In: International Journal of Educational Technology in Higher Education, Bd. 16, Nr. 1, S. 29, 2019, ISSN: 2365-9440.Abstract | Links | BibTeX@article{Perini2019,
title = {Using Hypervideo to support undergraduate students’ reflection on work practices: a qualitative study},
author = {Marco Perini and Alberto A.P. Cattaneo and Guiseppe Tacconi},
url = {https://doi.org/10.1186/s41239-019-0156-z},
doi = {10.1186/s41239-019-0156-z},
issn = {2365-9440},
year = {2019},
date = {2019-07-19},
urldate = {2019-08-08},
journal = {International Journal of Educational Technology in Higher Education},
volume = {16},
number = {1},
pages = {29},
publisher = {Springer International Publishing},
abstract = {According to several exploratory studies, the HyperVideo seems to be particularly useful in highlighting the existing connections between the school-based and the work-based contexts, between authentic work situations and theoretical underpinnings. This tool and its features, in particular, the video annotation, seems to constitute an instrument which facilitates the students' reflection on work-practices. Even though several researchers have already studied the efficacy of HyperVideo, studies concerning the qualitative differences between a reflection process activated with or without its use are still missing. Therefore, the present contribution is focused on the reflective processes activated by two groups of students engaged in a higher education course while they carry out a reflective activity on work practices using the HyperVideo or not. The aim is to investigate wether the HyperVideo can be useful for students to foster the connection between theoretical concepts and work practices. Through multi-step qualitative analysis which combined Thematic Qualitative Text Analysis and Grounded Theory, a sample of reflective reports drafted by a group of students who employed HiperVideo to make a video-interview on a work-practice and to reflect on it (Group A) was compared with a sample of reflective reports drafted by a group who did not use it to complete the same task (Group B).},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenAccording to several exploratory studies, the HyperVideo seems to be particularly useful in highlighting the existing connections between the school-based and the work-based contexts, between authentic work situations and theoretical underpinnings. This tool and its features, in particular, the video annotation, seems to constitute an instrument which facilitates the students' reflection on work-practices. Even though several researchers have already studied the efficacy of HyperVideo, studies concerning the qualitative differences between a reflection process activated with or without its use are still missing. Therefore, the present contribution is focused on the reflective processes activated by two groups of students engaged in a higher education course while they carry out a reflective activity on work practices using the HyperVideo or not. The aim is to investigate wether the HyperVideo can be useful for students to foster the connection between theoretical concepts and work practices. Through multi-step qualitative analysis which combined Thematic Qualitative Text Analysis and Grounded Theory, a sample of reflective reports drafted by a group of students who employed HiperVideo to make a video-interview on a work-practice and to reflect on it (Group A) was compared with a sample of reflective reports drafted by a group who did not use it to complete the same task (Group B).Schließenhttps://doi.org/10.1186/s41239-019-0156-zdoi:10.1186/s41239-019-0156-zSchließen
Videos können als Lernmedium besonders spannend sein, wenn man sie mit unterschiedlichen Interaktionsmöglichkeiten anreichert. Wie wirkt sich beispielsweise die Möglichkeit zur Annotation auf die Reflexion der Inhalte aus? Das haben drei Forscher aus Italien und der Schweiz explorativ untersucht …
„Bandersnatch„: Interaktive Folge der Reihe Black Mirror auf Netflix
Fundgrube+Alt+Entf
Projekte, Tools, Apps… das sind doch bürgerliche Kategorien. Wir packen einfach alles in die Fundgrube:
Auf Twitter wurde diskutiert, ob Open Access denn zwingend mit einer freien Lizenz zusammen hinge (dazu auch Berliner und Budapester Erklärungen zu Open Access)
mapchart.net: Karten kolorieren, Legende beschriften, speichern als PNG (CC BY-SA 4.0 oder anderer Verweis auf die Seite)
Reporterfabrik: Kurse zu Journalistischem Wissen, meist kostenlos, max. 25€, von Correctiv
Im Rijksstudio findet man digitale Bilder aus der Sammlung des Rijksmuseums, i. d. R. unter CC0-Lizenz
Cartesuis: Digitalisierte Karten, überwiegend von Belgien und drumrum (leider nicht frei lizenziert), das Virtuelle Kartenforum der SLUB Dresden ist da meist offener
User Inyerface: Ein kleines Spiel rund um schlechte UIs
Keine Fotoverbote im Rijksmuseum, viele Bilder gibt es online unter CC0-Lizenz
Politik+Alt+Entf
Das BMBF will die deutschen Hochschulen mit der Exzellenzstrategie für den internationalen Wettbewerb stärken (was auch immer das genau heißt). Vor allem ostdeutsche Hochschulen haben dabei auch strukturelle Probleme, in diesem Wettbewerb erfolgreich zu sein.
Und nochmal zurück zum Intro: Wer administriert eigentlich bei der Telekomstiftung die IT? Macht das Thomas de Maizère selbst? Oder kennt sich dort jemand mit Rechnernetzen aus?
Veranstaltungstipps
26. bis 28. August 2019: OER- und IT-Sommercamp in Weimar
Es wird gemeinsam an Bildungsinfrastrukturen entwickelt und Content gehackt.
31. August 2019: BarCamp Education Ost in Halle (#beo19)
Wer nicht bis zum EduCamp in Hattingen warten will, trifft hier sicher auf gleichgesinnte Menschen aus der Bildungswelt.
06. September 2019: stARTcamp Hamburg (#schh19)
Ein BarCamp für alle für Wissenschaft und Kultur für alle. Tickets sind auch alle, nur noch Warteliste.
07. bis 14. September 2019: Digitale Woche Kiel (#diwokiel)
mit Podcast-Tag am 14. September, für den es noch Tickets gibt.
16. bis 18. September 2019: DeLFI & GMW Jahrestagungen in Berlin (#delfigmw2019)
mit einem Tutorial „Wissenschaft richtig gemacht: Tools für Open Scientists und Open Educators“ von Lambert Heller (TIB Hannover) und A.
Mythos+Alt+Entf
… das erklärt O im Podcast
Willingham, DanielDon't Blame the Internet: We Can Still Think and Read Critically, We Just Don't Want to Online RealClear Education 2014, besucht am: 08.08.2019.Links | BibTeX@online{Willingham2014,
title = {Don't Blame the Internet: We Can Still Think and Read Critically, We Just Don't Want to},
author = {Daniel Willingham},
url = {https://www.realcleareducation.com/articles/2014/04/16/dont_blame_the_web_we_can_still_think_and_read_critically_we_just_dont_want_to_942.html},
year = {2014},
date = {2014-04-16},
urldate = {2019-08-08},
organization = {RealClear Education},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {online}
}
Schließenhttps://www.realcleareducation.com/articles/2014/04/16/dont_blame_the_web_we_can[...]Schließen Rosenwald, Michael S.Serious reading takes a hit from online scanning and skimming, researchers say Online The Washington Post 2014, besucht am: 08.08.2019.Links | BibTeX@online{Rosenwald2014,
title = {Serious reading takes a hit from online scanning and skimming, researchers say},
author = {Michael S. Rosenwald},
url = {https://www.washingtonpost.com/local/serious-reading-takes-a-hit-from-online-scanning-and-skimming-researchers-say/2014/04/06/088028d2-b5d2-11e3-b899-20667de76985_story.html?noredirect=on},
year = {2014},
date = {2014-04-06},
urldate = {2019-08-08},
organization = {The Washington Post},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {online}
}
Schließenhttps://www.washingtonpost.com/local/serious-reading-takes-a-hit-from-online-sca[...]Schließen
Weltverbesserung+Alt+Entf
Amnesty International hat immer gute Ideen, wie man Geld in Menschenrechte anlegen kann, beispielsweise damit in Florida allein reisende Kinder nicht in den Knast kommen oder weniger Menschen im Mittelmeer ertrinken müssen.

Jun 27, 2019 • 2h 32min
BldgAltEntf E017: Bildungshomöopathie
Die Folge haben wir am 27.06.2019 aufgenommen.
Intro & Feedback
Wenn Ihr glaubt, dass man Spam und Phishing nicht verteufeln sollte, dass Droh-E-Mails auch nur ein stummer Schrei nach Liebe sind, dann könntet Ihr an diese Bitcoin-Adresse etwas überweisen – oder Ihr schaut wie wir ab und an rein, ob es Menschen gibt, die zwar auf so seltsame E-Mails hereinfallen, aber Bitcoins überweisen können.
Wenn man das hier nicht mehr lesen kann, war es wohl doch keine leere Drohung. „Du Zerstörer“!
News+Alt+Entf
News+O
O bringt uns über seine laufenden Anzeigen und IFG-Anfragen auf den neuesten Stand.
Er hat sein Akademiestudium Philosophie an der Fernuni Hagen wieder geschmissen und hört erst einmal weiter Soziopod.
Für das nächste Jahr versucht er, einen Platz im Recurse Center zu ergattern (Tipp von @blinry).
Er war beim indiELearning-Festival in Dreieich und hat einen Flipped-Classroom-Workshop in Braunschweig gegeben. Er fragt sich, wie er sich immer wiederkehrende Diskussionen sparen kann (bspw. um den Kontrollwahn von Lehrenden, der auch im BZT 55 thematisiert wurde oder den Beat Doebeli schonmal für die Schule systematisiert hat) und ob man mit dem Begriff „Bildungshomöopathie“ im Bildungsbingo noch einen Blumentopf gewinnt.
Außerdem erzählt er vom OERCamp in Lübeck, wo er u.a. zusammen mit Christian und A eine Session „Podcast für Newbies“ begleitet hat.
News+A
A hat fürs OERCamp in Lübeck einen Leuchtturm gebaut, Workshops zum Suchen und Finden von OER sowie zu MOOCs (auf oncampus.de) gegeben. Für Hamburg hOERrt ein HOOU ist sie Podcast-fremdgegangen und wer ein paar Infos über Lübeck wissen möchte, kann sich am Stadtführungsquiz probieren. Sie empfiehlt auch den Blogartikel von Mandy Schütze von der ZUM oder die Übersicht von Nele Hirsch.
Beim 50JahreHAWs-Festival gab es u. a. das Strandbeest vom FabLab Lübeck, Christophs Experimente und einen sehr guten Science Slam.
Bei der Arbeitstagung offene Hochschulen hat sie einen Workshop zum offenen Autorenkurs gegeben und ist ein wenig an der Elfenbeintürmigkeit der Hochschulen verzweifelt.
Und bei 37° C war sie im sonnigen Berlin, wo das Forum Open Education stattfand.
Paper+Alt+Entf
Paper+O: “Gutes Bildungsklima?”
Otto, Daniel; Caeiro, Sandra; Nicolau, Paula; Disterheft, Antje; Teixeira, António; Becker, Sara; Bollmann, Alexander; Sander, KirstenCan MOOCs empower people to critically think about climate change? A learning outcome based comparison of two MOOCs Artikel In: Journal of Cleaner Production, Bd. 222, S. 12–21, 2019, ISSN: 0959-6526.Abstract | Links | BibTeX@article{Otto2019,
title = {Can MOOCs empower people to critically think about climate change? A learning outcome based comparison of two MOOCs},
author = {Daniel Otto and Sandra Caeiro and Paula Nicolau and Antje Disterheft and António Teixeira and Sara Becker and Alexander Bollmann and Kirsten Sander},
url = {https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.190},
doi = {10.1016/j.jclepro.2019.02.190},
issn = {0959-6526},
year = {2019},
date = {2019-06-10},
urldate = {2019-06-27},
journal = {Journal of Cleaner Production},
volume = {222},
pages = {12–21},
publisher = {Elsevier},
abstract = {Climate change can be regarded as one of the key topics of sustainable development where public awareness and education are crucial. In the field of education, Massive Online Open Courses (MOOCs) have raised remarkable attention throughout the last decade as their initial objective is to provide massive open online education for everyone. This article aims to explore the impact of MOOCs on learning about climate change. This is necessary in order to evaluate whether MOOCs can make a substantial contribution to lifelong learning about sustainable development for a wider audience. We therefore present findings from self-assessment questionnaires of participants from two climate change MOOCs provided by two-distance learning universities in Germany and Portugal. Both MOOCs aimed at imparting to the participants the competencies to better understand the topic of climate change. The objective of the survey was a competency-based evaluation to review which learning outcomes have been achieved. The results indicate that taking part in either of the MOOCs increased the participants’ competencies to critically engage in the climate change debate. MOOCs are able to convey certain learning outcomes to the students and thus can contribute to climate change literacy. For further research, we recommend a more differentiated view on MOOCs and the learning opportunities for participants. Options for potential improvement are to think of better ways of how to integrate MOOCs into climate change education or to consider possibilities to increase the attractiveness of MOOCs for instance by using innovative formats to overcome the barriers between formal and informal learning.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenClimate change can be regarded as one of the key topics of sustainable development where public awareness and education are crucial. In the field of education, Massive Online Open Courses (MOOCs) have raised remarkable attention throughout the last decade as their initial objective is to provide massive open online education for everyone. This article aims to explore the impact of MOOCs on learning about climate change. This is necessary in order to evaluate whether MOOCs can make a substantial contribution to lifelong learning about sustainable development for a wider audience. We therefore present findings from self-assessment questionnaires of participants from two climate change MOOCs provided by two-distance learning universities in Germany and Portugal. Both MOOCs aimed at imparting to the participants the competencies to better understand the topic of climate change. The objective of the survey was a competency-based evaluation to review which learning outcomes have been achieved. The results indicate that taking part in either of the MOOCs increased the participants’ competencies to critically engage in the climate change debate. MOOCs are able to convey certain learning outcomes to the students and thus can contribute to climate change literacy. For further research, we recommend a more differentiated view on MOOCs and the learning opportunities for participants. Options for potential improvement are to think of better ways of how to integrate MOOCs into climate change education or to consider possibilities to increase the attractiveness of MOOCs for instance by using innovative formats to overcome the barriers between formal and informal learning.Schließenhttps://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.190doi:10.1016/j.jclepro.2019.02.190Schließen
Wissen für die Massen. Mit MOOCs! Die Autorinnen und Autoren überprüfen diesen Anspruch am Beispiel von zwei Kursen zum Thema Klimawandel mittels Selbstauskunft durch die Absolventinnen und Absolventen.
KlimaMOOC auf oncampus
Der Song der Uni Duisburg-Essen
Wiki+A: “T-Shirt-basierte Lernzielsetzung”
Wikipedianer,Ada Lovelace Online 2019, besucht am: 27.06.2019.Links | BibTeX@online{Wikipedianer2019AdaLovelace,
title = {Ada Lovelace},
author = {Wikipedianer},
url = {https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ada_Lovelace&oldid=189780475},
year = {2019},
date = {2019-06-22},
urldate = {2019-06-27},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {online}
}
Schließenhttps://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ada_Lovelace&oldid=189780475Schließen Klexikonianer,Ada Lovelace Online 2018, besucht am: 27.06.2019.Links | BibTeX@online{Klexikon2019adaLovelace,
title = {Ada Lovelace},
author = {Klexikonianer},
url = {https://klexikon.zum.de/index.php?title=Ada_Lovelace&oldid=88296},
year = {2018},
date = {2018-12-31},
urldate = {2019-06-27},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {online}
}
Schließenhttps://klexikon.zum.de/index.php?title=Ada_Lovelace&oldid=88296Schließen
Ada Lovelace war die erste Programmiererin der Welt – je nachdem, wessen Ausführungen man glaubt, sind da sogar Männer mitgemeint. In jedem Fall hat sie die Entwicklungen rund um die Rechenmaschinen und fast fertig gestellten Computer von Charles Babbage ein ganzes Stück nach vorn gebracht.
https://www.frauen-informatik-geschichte.de/ (2001 erstellt, leider nicht frei lizenziert, daher muss man schon fast froh sein, dass es überhaupt noch da ist)
Ada Lovelace und die Informatik
Die Difference Engine aus Lego und ein bisher nicht umgesetzter Vorschlag auf Lego-Ideas (allerdings nur schematisch)
Diagramm zur Berechnung von Bernoulli-Zahlen, 1842 (gemeinfrei)
Fundgrube+Alt+Entf
Projekte, Tools, Apps, … das sind doch bürgerliche Kategorien. Wir packen einfach alles in die Fundgrube:
Zähle bis 4! Sowohl beim Raspberry Pi (Unboxing-Video) als auch beim Xiaomi Mi Band gibt es neue Versionen für uns Geeks.
Wer sich tolle Methoden und Spiele rund um Geschäftsmodelle von OER ausdenken will, kann das mithilfe der Spielkarten von Sandra Schön und ihrem Team tun.
Ada Lovelace hat es vorhergesagt, auf der Seite (und im Buch) von Joachim Wedekind kann man es sich fast 200 Jahre später anschauen: eine Sammlung von Digital Art, die nicht nur schön anzusehen ist, sondern bei der auch der (grafische Snap-) Code zum Nachvollziehen und weiterem Rumspielen verlinkt ist.
Politik+Alt+Entf
Das BMBF hat eine nationale Weiterbildungsstrategie beschlossen. So richtig strategisch über den aktuellen Status quo hinaus liest sich das aber nicht wirklich, meint auch Bernd Käpplinger in einem Gastkommentar auf dem Blog von Jan-Martin Wiarda.
Veranstaltungstipps
09. und 10. August 2019: BarCamp Kiel (#bcki19)
The one and only. Seit wenigen Minuten nach dem Verkaufsstart nur noch Warteliste.
4. bis 6. November 2019: OERcamp Werkstatt bei Berlin (#OERCamp)
7. bis 9. Februar 2020: OERcamp Werkstatt im Schwarzwald (#OERCamp)
Es wird nicht über OER geredet, sondern es werden freie Lernmaterialien erstellt und veröffentlicht. Anmelden geht schon (unverbindlich).
18. bis 20. Mai 2020: H5P Con 2020 in Madison, Wisconsin, USA (#H5PCon)
Call for Participation ist raus: Sessions möglich zu “Creative Builder Lab”, “Research and Data Driven Teaching and Learning”, “Facilitating the Integration of H5P”, “Teaching with H5P” (Einsendeschluss ist der 1. September 2019)
Mythos+Alt+Entf
O kann ja gut bei Reinhard Remford von MInkorrekt bzw. AAA einschlafen, aber lernt er was dabei?
Es gibt eine russische Studie aus dem Bereich Spionage, die besagt: klappt bei manchen Menschen. Allerdings konnte die nie repliziert werden und es wird gemutmaßt, dass die Menschen womöglich gar nicht geschlafen haben.
Es gibt Menschen, die sich nach Narkose während einer Operation an Gesagtes erinnern können – Narkose und Schlaf sind aber zwei sehr unterschiedliche Dinge.
Was geklappt hat, ist wohl Konditionierung mit Geräuschen und Gerüchen, aber das ist tatsächlich nur ein sehr basale Form des Lernens.
Weltverbesserung+Alt+Entf
Wer wie wir Initiativen zur offenen Bildung fördern möchte, kann bspw. der Open Knowledge Foundation etwas Geld geben, damit sie so tolle Projekte wie Jugend Hackt, Frag den Staat (und alles drumrum), den Prototype Fund oder edulabs auch weiter am Leben hält und sich noch viele weitere ausdenkt.

May 25, 2019 • 2h 10min
BldgAltEntf E016: Bügelperlen sind auch nur Pixel
Die Folge haben wir am 25.05.2019 aufgenommen.
Intro & Feedback
Oh zerfrettelte Grunzwänzlinge… äh, Hörerinnen und Hörer. Leider scheint es die großartige BBC-Serie zum Anhalter bei keinem Streaming-Anbieter zu geben (sehen wir es positiv: deswegen muss man die SkyTicket-App auch nicht behalten). Auf YouTube gibt es aber ein paar Highlights, die man sich anschauen kann.
Wir danken Jens, dass wir durch seinen Kommentar sein Paper aus Episode 14 besser verstehen konnten, O wird aber dennoch nicht mit Schaubildern warm werden und empfiehlt die Bücher von Nancy Duarte oder Garr Reynolds.
David würde gern eine plattformübergreifende Verlaufsliste haben inkl. seiner Gedanken etc. Beat hat das zumindest bezogen auf diverse Literatur in seinem Biblionetz gemacht und plädiert sehr für Lösungen, die man selbst unter Kontrolle haben kann (Hörempfehlung dazu auch: die #uneigentlich-Episode SOU003 mit ihm).
News+Alt+Entf
News+O
O hat viel gearbeitet und deswegen hier gar nicht so viel aufgeschrieben.
Er hat via Topf Secret ein paar Hygieneberichte angefragt (könnt Ihr auch machen, A hat beim Schreiben dieser Shownotes 3 Stück rausgesendet).
Und wie A auch war O auf der Edunautika in Hamburg.
News+A
A war ebenfalls auf der Edunautika und hat gemeinsam mit Kai auch eine Station zu FragDenStaat angeboten.
Sie war beim JOINTLY FrühjahrsCamp in Weimar (mit Graphic Recording von Sandruschka) und danach beim Kernteamtreffen des HFD in Frankfurt (Link zum HFDcert).
Für das EduCamp im Frühjahr 2020 wird derzeit ein Orga-Team gesucht (Deadline 31.07.2019).
Seit langer Zeit hat sich A wieder selbst an einem MOOC versucht (als Teilnehmerin), konnte ihn aber (noch) nicht ganz final zu Ende führen.
Bei den 5min-Terminen im Chaotikum hat A in ihrem Beitrag vorgeschlagen, die Videos davon doch lieber nicht unter eine CC-BY-NC-ND-Lizenz zu stellen (es gibt ein Video davon).
Beim VFH-Symposium in Lübeck hat das FabLab Lübeck den inMoov-Roboter vorgestellt (also das, was davon schon fertig ist) und Nele hat mit splot.io gezeigt, wie man in einem Workshop schnell mal Tools ausprobieren kann.
erste Erfolge mit dem ESP32 und erste Ergebnisse mit Bügelperlen
Paper+Alt+Entf
Paper+O: Zeugnistag für den Grashüpfer
Akçayır, Gökçe; Akçayır, MuratThe flipped classroom: A review of its advantages and challenges Artikel In: Computers & Education, Bd. 126, S. 334–345, 2018, ISSN: 0360-1315.Abstract | Links | BibTeX@article{Akcayir2018,
title = {The flipped classroom: A review of its advantages and challenges},
author = {Gökçe Akçayır and Murat Akçayır},
url = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131518302045
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.07.021},
doi = {10.1016/j.compedu.2018.07.021},
issn = {0360-1315},
year = {2018},
date = {2018-08-01},
urldate = {2019-05-25},
journal = {Computers & Education},
volume = {126},
pages = {334–345},
abstract = {This study presents a large-scale systematic review of the literature on the flipped classroom, with the goals of examining its reported advantages and challenges for both students and instructors, and to note potentially useful areas of future research on the flipped model's in and out-of-class activities. The full range of Social Sciences Citation Indexed journals was surveyed through the Web of Science site, and a total of 71 research articles were selected for the review. The findings reveal that the most frequently reported advantage of the flipped classroom is the improvement of student learning performance. We also found a number of challenges in this model. The majority of these are related to out-of-class activities, such as much reported inadequate student preparation prior to class. Several other challenges and the numerous advantages of the flipped classroom are discussed in detail. We then offer suggestions for future research on flipped model activities.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenThis study presents a large-scale systematic review of the literature on the flipped classroom, with the goals of examining its reported advantages and challenges for both students and instructors, and to note potentially useful areas of future research on the flipped model's in and out-of-class activities. The full range of Social Sciences Citation Indexed journals was surveyed through the Web of Science site, and a total of 71 research articles were selected for the review. The findings reveal that the most frequently reported advantage of the flipped classroom is the improvement of student learning performance. We also found a number of challenges in this model. The majority of these are related to out-of-class activities, such as much reported inadequate student preparation prior to class. Several other challenges and the numerous advantages of the flipped classroom are discussed in detail. We then offer suggestions for future research on flipped model activities.Schließenhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131518302045https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.07.021doi:10.1016/j.compedu.2018.07.021Schließen
Der “flipped classroom” oder “inverted classroom” macht als Neuauflage älterer Ansätze seit nicht ganz 10 Jahren von sich Reden. Das AutorInnen-Duo hat sich 71 wissenschaftliche Beiträge zu Vorteilen und Problemen angesehen und einen Überblick erstellt. Spoiler: Es gibt pro und contra!
Social Sciences Citation Index (SSCI)
Paper+A: Warum liegen hier überhaupt Daten rum?
Hahm, Sabrina; Storck, JohannaDas Potenzial administrativer Daten für das Qualitätsmanagement an Hochschulen Artikel In: Zeitschrift für Hochschulentwicklung, Bd. 13, Nr. 1, 2018, ISSN: 2219-6994.Abstract | Links | BibTeX@article{Hahm2019,
title = {Das Potenzial administrativer Daten für das Qualitätsmanagement an Hochschulen},
author = {Sabrina Hahm and Johanna Storck},
url = {https://www.zfhe.at/index.php/zfhe/article/view/1113},
issn = {2219-6994},
year = {2018},
date = {2018-03-07},
urldate = {2019-05-25},
journal = {Zeitschrift für Hochschulentwicklung},
volume = {13},
number = {1},
address = {Graz},
abstract = {Der Beitrag beschreibt verschiedene Möglichkeiten zur Analyse administrativer Daten der Studierenden- und Prüfungsverwaltung für die evidenzorientierte Qualitätsentwicklung in der Hochschullehre. Es werden sowohl Verfahren zur explorativen Datenanalyse als auch zur Kausalanalyse vorgestellt und am Beispiel von entsprechenden Untersuchungen an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU Berlin) illustriert.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenDer Beitrag beschreibt verschiedene Möglichkeiten zur Analyse administrativer Daten der Studierenden- und Prüfungsverwaltung für die evidenzorientierte Qualitätsentwicklung in der Hochschullehre. Es werden sowohl Verfahren zur explorativen Datenanalyse als auch zur Kausalanalyse vorgestellt und am Beispiel von entsprechenden Untersuchungen an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU Berlin) illustriert.Schließenhttps://www.zfhe.at/index.php/zfhe/article/view/1113Schließen
In der Hochschulverwaltung liegen Daten rum, die man auch dazu nutzen könnte, um Hinweise auf den Studienerfolg liefern können. Die Autorinnen von der Humboldt-Universität zu Berlin haben in dem Werkstattbericht verschiedene Möglichkeiten abgeklopft.
O war die Verbindung zum „Eene-Mene-Mu!“-Paper aus Episode 7 aufgefallen.
Fundgrube+Alt+Entf
Projekte, Tools, Apps… das sind doch bürgerliche Kategorien. Wir packen einfach alles in die Fundgrube:
A macht es dem TTZ nach und wird Outfluencerin (hört rein, ich schreibe hier bestimmt nichts Maschinenlesbares rein ;))
WikiShootMe: Die Open-Street-Map zeigt WikiData-Items, Wikipedia-Artikel und Bilder aus der Wikimedia-Commons, die mit Geo-Koordinaten versehen sind. Wo es noch keine Bilder gibt, kann man selbst welche hinzufügen. Das Tool ist über die Wikimedia Toolforge erreichbar, wo es sicher weitere tolle Tools zu finden gibt.
Mit dem Perler Bead Designer kann man Vorlagen für Bügelperlen erstellen <3
Politik+Alt+Entf
Das Bündnis Freie Bildung hat die Wahlprogramme zur Europawahl bzgl. Digitalisierung und freier Bildung abgeklopft.
Veranstaltungstipps
28. Mai 2019: TwitterChat zum OERCamp 2019 in Lübeck.
(also der Chat ist unter #OERdeChat auf Twitter ;))
07. und 08. Juni 2019: indiELearning-Festival in Dreieich.
An zwei Tagen geht es u. a. um moodle, mahara, h5p, Lego Robotics etc. überwiegend im Schulkontext.
13. und 14. Juni 2019: OERCamp (#OERCamp) in Lübeck.
Das nächste Bildungs-BarCamp gibt es ganz nah bei A (und auch O hat es nicht weit). Achtung: hier ist die Anmeldung bereits möglich!
26. Juni 2019: Forum Open Education in Berlin.
Das Bündnis Freie Bildung will in der Debatte um zeitgemäßes Lehren und Lernen gern weiter kommen und ruft zum Austausch darüber auf. Das Programm ist angenehm Maker-lastig [Anmerkung von A].
Weltverbesserung+Alt+Entf
Schulen sind in Sachen Digitalisierung, Medienkompetenz und Technikverständnis ja nun nicht gerade Vorreiter. Deswegen haben sich in der Initiative „Chaos macht Schule“ Menschen zusammen geschlossen, die Schülerinnen und Schülern, aber auch Lehrkräften und Eltern Nachhilfe darin geben. Ehrenamtlich engagiert bieten sie Vorträge, Schulungen und Workshops an. Spenden kann man an das Projekt „Alpha-BIT-isierung“ (Chaos macht Schule) über die Wau-Holland-Stifung.
Mythos+Alt+Entf
Lernt man in Bewegung besser? O löst auf, ob es nur ein Mythos ist oder nicht. Ein paar Studien zum Nachlesen dazu:
Maillot, Pauline; Perrot, Alexandra; Hartley, AlanEffects of interactive physical-activity video-game training on physical and cognitive function in older adults Artikel In: Psychology and Aging, Bd. 27, Nr. 3, S. 589–600, 2012, ISSN: 0882-7974.Abstract | Links | BibTeX@article{Maillot2012,
title = {Effects of interactive physical-activity video-game training on physical and cognitive function in older adults},
author = {Pauline Maillot and Alexandra Perrot and Alan Hartley},
url = {https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037{37d1f293241a1edd19b097ce37fa29bd44d887a41b5283a0fc9485076e078306}2Fa0026268
https://dx.doi.org/10.1037/a0026268},
doi = {10.1037/a0026268},
issn = {0882-7974},
year = {2012},
date = {2012-09-01},
urldate = {2019-05-25},
journal = {Psychology and Aging},
volume = {27},
number = {3},
pages = {589–600},
abstract = {The purpose of the present study was to assess the potential of exergame training based on physically simulated sport play as a mode of physical activity that could have cognitive benefits for older adults. If exergame play has the cognitive benefits of conventional physical activity and also has the intrinsic attractiveness of video games, then it might be a very effective way to induce desirable lifestyle changes in older adults. To examine this issue, the authors developed an active video game training program using a pretest-training-posttest design comparing an experimental group (24 × 1 hr of training) with a control group without treatment. Participants completed a battery of neuropsychological tests, assessing executive control, visuospatial functions, and processing speed, to measure the cognitive impact of the program. They were also given a battery of functional fitness tests to measure the physical impact of the program. The trainees improved significantly in measures of game performance. They also improved significantly more than the control participants in measures of physical function and cognitive measures of executive control and processing speed, but not on visuospatial measures. It was encouraging to observe that, engagement in physically simulated sport games yielded benefits to cognitive and physical skills that are directly involved in functional abilities older adults need in everyday living (e.g., Hultsch, Hertzog, Small, & Dixon, 1999).},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenThe purpose of the present study was to assess the potential of exergame training based on physically simulated sport play as a mode of physical activity that could have cognitive benefits for older adults. If exergame play has the cognitive benefits of conventional physical activity and also has the intrinsic attractiveness of video games, then it might be a very effective way to induce desirable lifestyle changes in older adults. To examine this issue, the authors developed an active video game training program using a pretest-training-posttest design comparing an experimental group (24 × 1 hr of training) with a control group without treatment. Participants completed a battery of neuropsychological tests, assessing executive control, visuospatial functions, and processing speed, to measure the cognitive impact of the program. They were also given a battery of functional fitness tests to measure the physical impact of the program. The trainees improved significantly in measures of game performance. They also improved significantly more than the control participants in measures of physical function and cognitive measures of executive control and processing speed, but not on visuospatial measures. It was encouraging to observe that, engagement in physically simulated sport games yielded benefits to cognitive and physical skills that are directly involved in functional abilities older adults need in everyday living (e.g., Hultsch, Hertzog, Small, & Dixon, 1999).Schließenhttps://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037{37d1f293241a1edd19b097ce37fa29bd4[...]https://dx.doi.org/10.1037/a0026268Schließen Thomas, Adam; Dennis, Andrea; Bandettini, Peter; Johansen-Berg, HeidiThe Effects of Aerobic Activity on Brain Structure Artikel In: Frontiers in Psychology, Bd. 3, S. 86, 2012, ISSN: 1664-1078.Abstract | Links | BibTeX@article{Thomas2012,
title = {The Effects of Aerobic Activity on Brain Structure},
author = {Adam Thomas and Andrea Dennis and Peter Bandettini and Heidi Johansen-Berg},
url = {https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2012.00086
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00086},
doi = {10.3389/fpsyg.2012.00086},
issn = {1664-1078},
year = {2012},
date = {2012-03-23},
urldate = {2019-05-25},
journal = {Frontiers in Psychology},
volume = {3},
pages = {86},
abstract = {Aerobic activity is a powerful stimulus for improving mental health and for generating structural changes in the brain. We review the literature documenting these structural changes and explore exactly where in the brain these changes occur as well as the underlying substrates of the changes including neural, glial, and vasculature components. Aerobic activity has been shown to produce different types of changes in the brain. The presence of novel experiences or learning is an especially important component in how these changes are manifest. We also discuss the distinct time courses of structural brain changes with both aerobic activity and learning as well as how these effects might differ in diseased and elderly groups.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenAerobic activity is a powerful stimulus for improving mental health and for generating structural changes in the brain. We review the literature documenting these structural changes and explore exactly where in the brain these changes occur as well as the underlying substrates of the changes including neural, glial, and vasculature components. Aerobic activity has been shown to produce different types of changes in the brain. The presence of novel experiences or learning is an especially important component in how these changes are manifest. We also discuss the distinct time courses of structural brain changes with both aerobic activity and learning as well as how these effects might differ in diseased and elderly groups.Schließenhttps://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2012.00086https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00086doi:10.3389/fpsyg.2012.00086Schließen Fedewa, Alicia L.; Ahn, SoyeonThe Effects of Physical Activity and Physical Fitness on Children's Achievement and Cognitive Outcomes Artikel In: Research Quarterly for Exercise and Sport, Bd. 82, Nr. 3, S. 521–535, 2011.Abstract | Links | BibTeX@article{Fedewa2011,
title = {The Effects of Physical Activity and Physical Fitness on Children's Achievement and Cognitive Outcomes},
author = {Alicia L. Fedewa and Soyeon Ahn},
url = {https://doi.org/10.1080/02701367.2011.10599785},
doi = {10.1080/02701367.2011.10599785},
year = {2011},
date = {2011-01-23},
urldate = {2019-05-25},
journal = {Research Quarterly for Exercise and Sport},
volume = {82},
number = {3},
pages = {521–535},
publisher = {Routledge},
abstract = {Abstract It is common knowledge that physical activity leads to numerous health and psychological benefits. However, the relationship between children's physical activity and academic achievement has been debated in the literature. Some studies have found strong, positive relationships between physical activity and cognitive outcomes, while other studies have reported small, negative associations. This study was a comprehensive, quantitative synthesis of the literature, using a total of 59 studies from 1947 to 2009 for analysis. Results indicated a significant and positive effect of physical activity on children's achievement and cognitive outcomes, with aerobic exercise having the greatest effect. A number of moderator variables were also found to play a significant role in this relationship. Findings are discussed in light of improving children's academic performance and changing school-based policy.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenAbstract It is common knowledge that physical activity leads to numerous health and psychological benefits. However, the relationship between children's physical activity and academic achievement has been debated in the literature. Some studies have found strong, positive relationships between physical activity and cognitive outcomes, while other studies have reported small, negative associations. This study was a comprehensive, quantitative synthesis of the literature, using a total of 59 studies from 1947 to 2009 for analysis. Results indicated a significant and positive effect of physical activity on children's achievement and cognitive outcomes, with aerobic exercise having the greatest effect. A number of moderator variables were also found to play a significant role in this relationship. Findings are discussed in light of improving children's academic performance and changing school-based policy.Schließenhttps://doi.org/10.1080/02701367.2011.10599785doi:10.1080/02701367.2011.10599785Schließen

Apr 28, 2019 • 2h 32min
BldgAltEntf E015: Gute Seiten, schlechte Seiten
Die Folge haben wir am 27.04.2019 aufgenommen.
Intro & Feedback
Eigentlich wollten wir mit dem Intro zivil ungehorsam sein, aber leider sind wir zu spät dran. Esst halt eine Otternase für uns mit.
Wir danken allen netten Menschen, die uns das Gefühl geben, den Podcast nicht nur für uns zu machen. Danke auch an die Kollegen vom Edufunk-Podcast „Bildung – Zukunft – Technik“, die uns in ihrer letzten Episode empfohlen haben.
Auch als Referenz für die Bewertung der Meinung von Manfred Spitzer waren wir offenbar hilfreich (A glaubt, dass O im Gespräch diesen Tweet meinte, ist sich aber nicht sicher).
News+Alt+Entf
A und O waren gemeinsam bei der Podcasting-Konferenz Subscribe 10 in Köln. Aufgrund der vorbildlichen Dokumentation kann man einige Vorträge als Aufzeichnung ansehen, noch ein paar mehr als Podcasts nachhören (inklusive einiger dort aufgenommenen Podcast-Episoden der anwesenden Podcaster*innen) und auch die Nachlesen … ähm … nachlesen. Vielleicht wollt Ihr auch in den ESC Schnack oder die Spielbar reinhören.
A und O und Kai auf dem Weg nach Köln.
News+O
O ist wieder dort angekommen, wo er hingehört: an der Seite von A beim ILD (Institut für Lerndienstleistungen der TH Lübeck). Daneben macht er trotzdem noch einiges als Selbstständiger und hat da viel zu tun.
Mit einem H5P-Workshop hat O das moodle-Hochschultreffen in Berlin bereichert.
Dazu gab es einen Gastauftritt von O im Podcast OpenScienceRadio.
O durfte ein Kinderbuch probelesen (Ihr könntet das erste Buch des Autors „Luc – in den Wellen“ lesen) und sich (wie A auch) über die furchtbare SkyTicket-App geärgert.
O ist zurück beim ILD und hat gleich ein Einhorn mitgebracht.
News+A
A war auf der OER19-Konferenz in Galway und hat sich dafür erstmalig mit dem Passierschein der A1-Bescheinigung auseinandergesetzt. Sie hat dort das Projekt JOINTLY vorgestellt und auch dafür getrendscoutet, deshalb kann man die erwähnten Projekte auch alle im Blogartikel auf der JOINTLY-Webseite finden.
Zum 01.04.2019 hatte dieser Podcast (nicht ganz zufällig) einen Gastauftritt im Aprilscherz von oncampus.
Mit dem UV-Drucker aus dem FabLab Lübeck hat A ihre neue Smartphone-Hülle bedruckt (und die ist bis auf die Schriftart perfekt geworden). Außerdem hat sie ihrem Mikrofonhalter einen Ständer verpasst.
Das BldgAltEntf-Logo (mit nicht ganz passender Schriftart) prangt jetzt neben dem EduCamp-Logo auf Anjas Smartphone-Hülle.
Mikrofonständer und Nudelbaum in einem!
Paper+Alt+Entf
Paper+O: Remember, remember, the 5th of … Moment ich suche kurz, wie es weiterging …
Marsh, Elizabeth J.; Rajaram, SuparnaThe Digital Expansion of the Mind: Implications of Internet Usage for Memory and Cognition Artikel In: Journal of Applied Research in Memory and Cognition, Bd. 8, Nr. 1, S. 1–14, 2019, ISSN: 2211-3681.Abstract | Links | BibTeX@article{Marsh2019,
title = {The Digital Expansion of the Mind: Implications of Internet Usage for Memory and Cognition},
author = {Elizabeth J. Marsh and Suparna Rajaram},
url = {https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2018.11.001},
doi = {10.1016/j.jarmac.2018.11.001},
issn = {2211-3681},
year = {2019},
date = {2019-01-19},
journal = {Journal of Applied Research in Memory and Cognition},
volume = {8},
number = {1},
pages = {1–14},
publisher = {Elsevier},
abstract = {The internet is rapidly changing what information is available as well as how we find it and share it with others. Here we examine how this “digital expansion of the mind” changes cognition. We begin by identifying ten properties of the internet that likely affect cognition, roughly organized around internet content (e.g., the sheer amount of information available), internet usage (e.g., the requirement to search for information), and the people and communities who create and propagate content (e.g., people are connected in an unprecedented fashion). We use these properties to explain (or ask questions about) internet-related phenomena, such as habitual reliance on the internet, the propagation of misinformation, and consequences for autobiographical memory, among others. Our goal is to consider the impact of internet usage on many aspects of cognition, as people increasingly rely on the internet to seek, post, and share information.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenThe internet is rapidly changing what information is available as well as how we find it and share it with others. Here we examine how this “digital expansion of the mind” changes cognition. We begin by identifying ten properties of the internet that likely affect cognition, roughly organized around internet content (e.g., the sheer amount of information available), internet usage (e.g., the requirement to search for information), and the people and communities who create and propagate content (e.g., people are connected in an unprecedented fashion). We use these properties to explain (or ask questions about) internet-related phenomena, such as habitual reliance on the internet, the propagation of misinformation, and consequences for autobiographical memory, among others. Our goal is to consider the impact of internet usage on many aspects of cognition, as people increasingly rely on the internet to seek, post, and share information.Schließenhttps://doi.org/10.1016/j.jarmac.2018.11.001doi:10.1016/j.jarmac.2018.11.001Schließen
Welche Eigenschaften machen das Internet eigentlich besonders? Und was davon beeinflusst das Erinnern und Denken? Diesen Fragen gehen die Autor*innen nach und bieten einen strukturierten Überblick mit zahlreichen Quellen zum Vertiefen einzelner Aspekte.
URL auch mit Notizen von O via Hypothesis: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211368118302717
Beitrag auf Netzpolitik zu Echokammern zur Bundestagswahl
Die Kevin-Bacon-Zahl und das Kleine-Welt-Phänomen
Den Punkt mit den Distraktoren in Multiple-Choice-Tests hatte O in der Episode 9 im Paper vorgestellt.
Paper+A: Monty-Burns-Badges plz!
Warm, Johanna; Vettori, OliverWas macht Lehre „ausgezeichnet“? Merkmale und Handlungspraktiken exzellenter Lehrender aus Studierendensicht Artikel In: Zeitschrift für Hochschulentwicklung, Bd. 13, Nr. 1, 2018, ISSN: 2219-6994.Abstract | Links | BibTeX@article{Warm2018,
title = {Was macht Lehre „ausgezeichnet“? Merkmale und Handlungspraktiken exzellenter Lehrender aus Studierendensicht},
author = {Johanna Warm and Oliver Vettori},
url = {https://www.zfhe.at/index.php/zfhe/article/view/1100},
issn = {2219-6994},
year = {2018},
date = {2018-03-07},
journal = {Zeitschrift für Hochschulentwicklung},
volume = {13},
number = {1},
abstract = {Dieser Beitrag befasst sich mit der Frage, wie Studierende Exzellenz in der Lehre fassen. Auf Basis von Begründungen, die Studierende an der Wirtschaftsuniversität Wien im Rahmen eines Lehrpreises für ausgezeichnete Lehrende abgegeben haben, wurden fünf Typen konstruiert, die Aufschluss darüber geben, welche Zugänge zum Thema Exzellenz die Studierenden wählen und anhand welcher Kriterien sie selbige beurteilen. Neben der eingehenden Vorstellung dieser fünf Typen diskutiert der Beitrag auch kritisch, welche Handlungsempfehlungen aus solchen Ergebnissen ableitbar sind – bzw. wo die Grenzen solcher Handlungsempfehlungen liegen.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenDieser Beitrag befasst sich mit der Frage, wie Studierende Exzellenz in der Lehre fassen. Auf Basis von Begründungen, die Studierende an der Wirtschaftsuniversität Wien im Rahmen eines Lehrpreises für ausgezeichnete Lehrende abgegeben haben, wurden fünf Typen konstruiert, die Aufschluss darüber geben, welche Zugänge zum Thema Exzellenz die Studierenden wählen und anhand welcher Kriterien sie selbige beurteilen. Neben der eingehenden Vorstellung dieser fünf Typen diskutiert der Beitrag auch kritisch, welche Handlungsempfehlungen aus solchen Ergebnissen ableitbar sind – bzw. wo die Grenzen solcher Handlungsempfehlungen liegen.Schließenhttps://www.zfhe.at/index.php/zfhe/article/view/1100Schließen
Alle wollen exzellent sein, aber niemand weiß so richtig, was das ist. Nicht einmal die Wikipedia. Dennoch werden Preise für exzellente Hochschullehre vergeben – und an der Wirtschaftsuniversität Wien entscheiden die Studierenden, wer den bekommt und damit auch ein wenig, was sie für exzellent halten. Deswegen hat man sich mal angeschaut, wie sie ihre Nominierungen begründen.
O kam bei einer Vertretungsstunde auch so eher gemischt an.
Wie man Qualität von MOOCs automatisiert bewerten könnte, haben wir uns in Episode 11 am Beispiel von openHPI angeschaut.
Neben dem Wikipediabeitrag zum Advance Organizer kann man sich auch den Post bei wb-web anschauen.
Fundgrube+Alt+Entf
Projekte, Tools, Apps… das sind doch bürgerliche Kategorien. Wir packen einfach alles in die Fundgrube:
Mit shrtco kann man URLs kürzen. Und das auch mit Emojis. Demo: shrtco.de/
Wer ein Paper ablehnen möchte, kann den Generatoren auf Autoreject verwenden.
Mozilla bittet darum, seine Stimme zu spenden (nein, nicht so wie Arielle die Meerjunfrau).
Man kann sich selbst ein xAPI Bookmarklet erstellen und damit die eigenen Daten, die sonst ggf. nur im LMS oder nirgendwo landen, einsammeln. Etwas mehr dazu kann man auf dem OpenLab-Blog nachlesen.
Politik+Alt+Entf
Wir sind weiterhin keine Fans der jüngst verabschiedeten EU-Urheberrechtsrichtlinie. Leider werden wir derzeit eher bestätigt, wenn die Plattform Scribd verhindert, dass ein CC0-Dokument veröffentlicht wird. Weitere Uploadfilter-Fails kann man im Blog von Julia Reda nachlesen.
Die Plattform MILLA a.k.a. „Netflix der Weiterbildung“ (besprochen in Episode 11) wird vorerst doch nicht kommen.
Veranstaltungstipps
03. und 04. Mai 2019: Edunautika (#edunautika) in Hamburg.
In diesem Frühjahr gibt es leider kein EduCamp, aber deswegen muss man nicht auf Bildungs-BarCamps verzichten. Die Edunautika stellt zeitgemäße Bildung in den Fokus. Neben den klassischen BarCamp-Sessions wird es auch Stationen geben. (Leider kann man sich nicht mehr anmelden bzw. muss stark darauf hoffen, dass die Warteliste gut nachrutscht.)
06. und 07. Mai 2019: OER- und IT-Sommercamp in Weimar.
Im Projekt JOINTLY werden Tools und Services für die OER-Community entwickelt. Auf dem Camp soll konzentriert bspw. an einer Übersicht nötiger Infrastrukturen gearbeitet werden.
07. und 08. Juni 2019: indiELearning-Festival in Dreieich.
An zwei Tagen geht es u. a. um moodle, mahara, h5p, Lego Robotics etc. überwiegend im Schulkontext.
13. und 14. Juni 2019: OERCamp (#OERCamp) in Lübeck.
Das nächste Bildungs-BarCamp gibt es ganz nah bei A (und auch O hat es nicht weit). Achtung: hier ist die Anmeldung bereits möglich!
16. September 2019: Tutorial „Wissenschaft richtig gemacht: Tools für Open Scientists und Open Educators“ auf der DeLFI in Berlin.
Zusammen mit Lambert Heller von der TIB Hannover will A zusammentragen, mit welchen Tools man als vorbildlicher Mensch in der Wissenschaft arbeitet. Achtung: auch hier gibt es bis zum 30.06.2019 noch den ermäßigten Frühbucherpreis!
Weltverbesserung+Alt+Entf
Wer die Edu-Podcasts mag, die sich unter dem Netzwerk „Edufunk“ zusammen geschlossen haben, der kann dem Betreiber dieses Netzwerks, nämlich dem gemeinnützigen Verein ZLL21 e.V. etwas spenden.

Mar 21, 2019 • 2h 12min
BldgAltEntf E014: Brainstorming in der Pullerpause
Die Folge haben wir am 20.03.2018 aufgenommen.
Intro & Feedback
Dieses Intro wurde von Bots erstellt… wie der Rest des Podcasts auch.
Im Selbst-Feedback schämt sich A, weil sie in der letzten Episode mit dem 30jährigen Krieg 100 Jahre zu früh dran war. Eine andere Anja hat uns mit uns ihre Erfahrung zum Engagement in der Hochschuldidaktik geteilt: bringt zwar was, interessiert aber bei der Stellenvergabe kaum jemanden. David hat uns nicht nur mit Tweets und Videos (1, 2, 3) über die diesjährige dghd-Tagung auf dem Laufenden gehalten, sondern uns auch für die nächsten zig Folgen mit Bildungsmythen versorgt. Wer nicht so auf Überraschungen steht, kann hier schonmal vorarbeiten, wir fragen dann in den nächsten Folgen ab:
Bruyckere, Pedro De; Kirschner, Paul A.; Hulshof, Casper D.Urban Myths about Learning and Education Buch Academic Press, San Diego, 2015, ISBN: 9780128017319.Abstract | Links | BibTeX@book{DeBruyckere2015,
title = {Urban Myths about Learning and Education},
author = {Pedro De Bruyckere and Paul A. Kirschner and Casper D. Hulshof},
url = {https://www.elsevier.com/books/urban-myths-about-learning-and-education/de-bruyckere/978-0-12-801537-7},
doi = {10.1016/C2013-0-18621-7},
isbn = {9780128017319},
year = {2015},
date = {2015-03-04},
publisher = {Academic Press},
address = {San Diego},
abstract = {Many things people commonly believe to be true about education are not supported by scientific evidence. Urban Myths about Learning and Education examines commonly held incorrect beliefs and then provides the truth of what research has shown. Each chapter examines a different myth, with sections on learning, the brain, technology, and educational policy. A final section discusses why these myths are so persistent. Written in an engaging style, the book separates fact from fiction regarding learning and education.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {book}
}
SchließenMany things people commonly believe to be true about education are not supported by scientific evidence. Urban Myths about Learning and Education examines commonly held incorrect beliefs and then provides the truth of what research has shown. Each chapter examines a different myth, with sections on learning, the brain, technology, and educational policy. A final section discusses why these myths are so persistent. Written in an engaging style, the book separates fact from fiction regarding learning and education.Schließenhttps://www.elsevier.com/books/urban-myths-about-learning-and-education/de-bruyc[...]doi:10.1016/C2013-0-18621-7Schließen
News+Alt+Entf
News+O
O ist immer freier beruflich unterwegs, hat einige Buchungen und Aufträge und auch sonst einen gut gefüllten Terminkalender.
Für die Verbesserung der H5P-DialogCards für Spaced Repetition kann man O im Crowdfunding ein paar Groschen zuwerfen. Wer außer „Verbesserung“ keines der Substantive verstanden hat, kann in Os Blog nachlesen (Groschen sind bzw. waren Münzen).
Wer etwas Freizeit in Hamburg hat, kann es O nachmachen und dort das Museum der Illusionen oder das Planetarium besuchen. Auch eine Bootstour durch Hamburg bei Nacht bietet sich an. Bastian Bielendorfer vom AAA-Podcast ist leider nicht mehr da, aber weiterhin in Deutschland auf Tour – muss man nicht hingehen.
Ab mit dem Kooopf!
News+A
Es wird wieder eine ganze Reihe an OERCamp-Veranstaltungen geben \o/ A war in Hamburg mit dabei, als eine Gruppe toller Menschen (und A) über deren Ausgestaltung nachgeworkshopt haben.
Mit den Menschen vom Team Bildungsmanagement shopte A nochmal work: im kommenden Jahr soll es in der Wissenschaftskommunikation noch etwas mehr voran gehen.
In Marburg fand die 8. Inverted Classroom Konferenz statt. A hat sich dort mit Robotern fotografiert (hier kann man schauen, wie die in der Lehre eingesetzt werden), über vitalisiertes Wasser im Hotel geärgert und auslachen lassen, weil sie meinte, ihr Job sei jetzt auch nicht so leicht.
A und Roboter Pepper (oder Yuki?)
Paper+Alt+Entf
Paper+O #1: Trendvulkan Hochschule
Reder, Constanze; Lukács, BenceOffene Bildungspraxis erlebbar machen – die Rolle von Podcasts für Projektdokumentationen und Reflexionsprozesse Artikel In: MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung, Bd. 32, S. 17–27, 2018, ISSN: 1424-3636.Abstract | Links | BibTeX@article{Reder2018,
title = {Offene Bildungspraxis erlebbar machen – die Rolle von Podcasts für Projektdokumentationen und Reflexionsprozesse},
author = {Constanze Reder and Bence Lukács},
url = {https://www.medienpaed.com/article/view/610},
doi = {10.21240/mpaed/32/2018.10.20.X},
issn = {1424-3636},
year = {2018},
date = {2018-10-20},
journal = {MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung},
volume = {32},
pages = {17–27},
abstract = {Der vorliegende Beitrag widmet sich der Frage, wie Reflexion als Teil akademischer Medienkompetenz an Hochschulen adressiert werden kann. Als Beispiel dient ein Praxisprojekt, über das Studierende in labs mit Open Educational Resources (frei verfügbares Bildungsmaterial, OER), aber darüber hinaus vor allem mit Open Educational Practices (offenen Bildungspraktiken, OEP) und offenen Lehrinhalten in Kontakt kommen. Dabei stehen auch andere hochschulische Akteursgruppen im Fokus, die gemeinsam mit den Studierenden in moderierten Dialogen darüber beraten, wie nicht nur OER sondern auch OEP an der Hochschule etabliert werden können, um Dozierenden wie Studierenden den Zugang zu offener Bildung zu erleichtern. Ausgehend von dieser Praxiserfahrung greift der Artikel den Baustein des projektbegleitenden Podcasts heraus, der die Anlage des Projekts dokumentiert, aber auch ein reflexives Element im Doing darstellt, durch das die verschiedenen Perspektiven der Mitarbeitenden an den beiden Standorten, aber auch die von Stakeholdern und Kooperationsakteurinnen und Kooperationsakteuren widergespiegelt wird. Er widmet sich der Frage, wie dementsprechend ein reflektierter Umgang mit offener Lehr-Lernpraxis an der Hochschule unterstützt werden kann und wie offene Praxis nicht nur als Seminarinhalt, sondern auch nachhaltig als Teil von Hochschulentwicklungsprojekten implementiert werden kann.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenDer vorliegende Beitrag widmet sich der Frage, wie Reflexion als Teil akademischer Medienkompetenz an Hochschulen adressiert werden kann. Als Beispiel dient ein Praxisprojekt, über das Studierende in labs mit Open Educational Resources (frei verfügbares Bildungsmaterial, OER), aber darüber hinaus vor allem mit Open Educational Practices (offenen Bildungspraktiken, OEP) und offenen Lehrinhalten in Kontakt kommen. Dabei stehen auch andere hochschulische Akteursgruppen im Fokus, die gemeinsam mit den Studierenden in moderierten Dialogen darüber beraten, wie nicht nur OER sondern auch OEP an der Hochschule etabliert werden können, um Dozierenden wie Studierenden den Zugang zu offener Bildung zu erleichtern. Ausgehend von dieser Praxiserfahrung greift der Artikel den Baustein des projektbegleitenden Podcasts heraus, der die Anlage des Projekts dokumentiert, aber auch ein reflexives Element im Doing darstellt, durch das die verschiedenen Perspektiven der Mitarbeitenden an den beiden Standorten, aber auch die von Stakeholdern und Kooperationsakteurinnen und Kooperationsakteuren widergespiegelt wird. Er widmet sich der Frage, wie dementsprechend ein reflektierter Umgang mit offener Lehr-Lernpraxis an der Hochschule unterstützt werden kann und wie offene Praxis nicht nur als Seminarinhalt, sondern auch nachhaltig als Teil von Hochschulentwicklungsprojekten implementiert werden kann.Schließenhttps://www.medienpaed.com/article/view/610doi:10.21240/mpaed/32/2018.10.20.XSchließen
Podcasts sind trendy, und sie in Hochschulen nicht nur dazu benutzt werden, um vorproduzierte Inhalte zu verteilen. Im Beitrag wird der Podcast “Bildungsshaker” vorgestellt, in dem wissenschaftliche MitarbeiterInnen eigene Projekte dokumentieren, reflektieren und publizieren – und darüber sogar in einen Dialog mit Hochschulexternen treten.
Podcast „Bildungsshaker“ (auch im Edufunk– und WissPod-Netzwerk)
Episode 11 zu Modell von Baake
Paper+A: Same, same, but diverse
FriezeEmail, Carol; Quesenberry, Jeria L.; Kemp, Elizabeth; Velázquez, AnthonyDiversity or Difference? New Research Supports the Case for a Cultural Perspective on Women in Computing Artikel In: Journal of Science Education and Technology, Bd. 21, Nr. 4, S. 423–439, 2011, ISSN: 1573-1839.Abstract | Links | BibTeX@article{Frieze2012,
title = {Diversity or Difference? New Research Supports the Case for a Cultural Perspective on Women in Computing},
author = {Carol FriezeEmail and Jeria L. Quesenberry and Elizabeth Kemp and Anthony Velázquez},
url = {https://doi.org/10.1007/s10956-011-9335-y
https://twitter.com/lauralindal/status/1098942462012338177 },
doi = {10.1007/s10956-011-9335-y},
issn = {1573-1839},
year = {2011},
date = {2011-09-08},
urldate = {2019-03-20},
journal = {Journal of Science Education and Technology},
volume = {21},
number = {4},
pages = {423–439},
publisher = {SpringerLink},
abstract = {Gender difference approaches to the participation of women in computing have not provided adequate explanations for women’s declining interest in computer science (CS) and related technical fields. Indeed, the search for gender differences can work against diversity which we define as a cross-gender spectrum of characteristics, interests, abilities, experiences, beliefs and identities. Our ongoing case studies at Carnegie Mellon University (CMU) provide evidence to show that a focus on culture offers the most insightful and effective approach for investigating women’s participation in CS. In this paper, we illustrate this approach and show the significance of cultural factors by describing a new case study which examines the attitudes of CS majors at CMU. Our analysis found that most men and women felt comfortable in the school, believed they could be successful in the CS environment at CMU, and thought they fit in socially and academically. In brief, we did not see any evidence of a strong gender divide in student attitudes towards fitting in or feeling like they could be successful; indeed we found that the Women-CS fit remained strong from prior years. Hence, our research demonstrates that women, alongside their male peers, can fit successfully into a CS environment and help shape that environment and computing culture, for the benefit of everyone, without accommodating presumed gender differences or any compromises to academic integrity.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenGender difference approaches to the participation of women in computing have not provided adequate explanations for women’s declining interest in computer science (CS) and related technical fields. Indeed, the search for gender differences can work against diversity which we define as a cross-gender spectrum of characteristics, interests, abilities, experiences, beliefs and identities. Our ongoing case studies at Carnegie Mellon University (CMU) provide evidence to show that a focus on culture offers the most insightful and effective approach for investigating women’s participation in CS. In this paper, we illustrate this approach and show the significance of cultural factors by describing a new case study which examines the attitudes of CS majors at CMU. Our analysis found that most men and women felt comfortable in the school, believed they could be successful in the CS environment at CMU, and thought they fit in socially and academically. In brief, we did not see any evidence of a strong gender divide in student attitudes towards fitting in or feeling like they could be successful; indeed we found that the Women-CS fit remained strong from prior years. Hence, our research demonstrates that women, alongside their male peers, can fit successfully into a CS environment and help shape that environment and computing culture, for the benefit of everyone, without accommodating presumed gender differences or any compromises to academic integrity.Schließenhttps://doi.org/10.1007/s10956-011-9335-yhttps://twitter.com/lauralindal/status/1098942462012338177doi:10.1007/s10956-011-9335-ySchließen
Weiber, wa? In den Informatikstudiengängen findet man sie kaum, und wenn man versucht, es damit zu begründen, dass „Frauen eben so sind“, finden sie das auch nicht gut (achja, die Daten geben es wohl auch nicht wieder her). Und wenn man dann, wie an der Carnegie Mellon University die Lehre auf konkrete Anwendungen hin ausrichtet (weil das Frauen lieber mögen), dann profitieren nicht nur sie davon: auch Männern geht es damit insgesamt besser.
Link zum Twitter-Threat „Frauen im IT-Bereich„
Paper+O #2: Das OERxperiment
Leuchtenbörger, JensErstellung und Weiterentwicklung von Open Educational Resources im Selbstversuch Artikel In: MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung, Bd. 32, S. 101–117, 2018, ISSN: 1424-3636.Abstract | Links | BibTeX@article{Leuchtenbörger2018,
title = {Erstellung und Weiterentwicklung von Open Educational Resources im Selbstversuch},
author = {Jens Leuchtenbörger},
url = {https://www.medienpaed.com/article/view/651},
doi = {10.21240/mpaed/34/2019.03.02.X},
issn = {1424-3636},
year = {2018},
date = {2018-10-20},
journal = {MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung},
volume = {32},
pages = {101–117},
abstract = {Open Educational Resources (OER) versprechen einerseits den Abbau von Hürden im Bildungszugang und andererseits die Vermeidung redundanter Arbeit bei der Erstellung ähnlicher und gleichzeitig qualitativ hochwertiger Bildungsressourcen in unterschiedlichen Organisationen. Der Verbreitung von OER stehen jedoch bekannte Hürden gegenüber, wobei das ALMS-Framework einen Rahmen für die Bewertung der Wieder- und Weiternutzung von OER aus technischer Sicht bereitstellt. Ausgehend von einem Selbstversuch zur OER-Einführung werden in dieser Arbeit das ALMS-Framework erweiternde Anforderungen an OER basierend auf Konzepten aus Software-Entwicklung und technischem Schreiben definiert. Unter Beachtung dieser Anforderungen werden zwei OER-Projekte beschrieben: Zum einen wird die Weiterentwicklung eines Lehrbuchs unter Creative-Commons-Lizenz skizziert. Zum anderen werden Erstellung und Nutzung der neu entwickelten Software emacs-reveal für die Erzeugung von für das Selbststudium geeigneten, mit Audiokommentaren unterlegten HTML-Präsentationen beschrieben; die Präsentationen werden in einfachen Textdateien erstellt, wobei die Erzeugung von HTML-Code automatisiert in einer öffentlichen GitLab-Infrastruktur abläuft und damit die Software-Nutzung vereinfacht. Ergebnisse einer Umfrage unter Studierenden verdeutlichen die Vorzüge der erzeugten Präsentationen.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenOpen Educational Resources (OER) versprechen einerseits den Abbau von Hürden im Bildungszugang und andererseits die Vermeidung redundanter Arbeit bei der Erstellung ähnlicher und gleichzeitig qualitativ hochwertiger Bildungsressourcen in unterschiedlichen Organisationen. Der Verbreitung von OER stehen jedoch bekannte Hürden gegenüber, wobei das ALMS-Framework einen Rahmen für die Bewertung der Wieder- und Weiternutzung von OER aus technischer Sicht bereitstellt. Ausgehend von einem Selbstversuch zur OER-Einführung werden in dieser Arbeit das ALMS-Framework erweiternde Anforderungen an OER basierend auf Konzepten aus Software-Entwicklung und technischem Schreiben definiert. Unter Beachtung dieser Anforderungen werden zwei OER-Projekte beschrieben: Zum einen wird die Weiterentwicklung eines Lehrbuchs unter Creative-Commons-Lizenz skizziert. Zum anderen werden Erstellung und Nutzung der neu entwickelten Software emacs-reveal für die Erzeugung von für das Selbststudium geeigneten, mit Audiokommentaren unterlegten HTML-Präsentationen beschrieben; die Präsentationen werden in einfachen Textdateien erstellt, wobei die Erzeugung von HTML-Code automatisiert in einer öffentlichen GitLab-Infrastruktur abläuft und damit die Software-Nutzung vereinfacht. Ergebnisse einer Umfrage unter Studierenden verdeutlichen die Vorzüge der erzeugten Präsentationen.Schließenhttps://www.medienpaed.com/article/view/651doi:10.21240/mpaed/34/2019.03.02.XSchließen
Wenn OER produziert und genutzt werden, ist es schön, wenn auch die dafür Werkzeuge offen sind. Im Beitrag wird einerseits ein Kriterienkatalog vorgestellt, mit dem man den Offenheitsgrad von Werkzeugen festhalten kann. Darauf aufbauend wird vorgestellt, wie für eine Vorlesung Werkzeuge ausgesucht wurden, um Schaubilder inkl. Tonspuren zu erstellen.
Episode 12 mit Reveal.js
OER+Alt+Entf
Fundgrube+Alt+Entf
Projekte, Tools, Apps… das sind doch bürgerliche Kategorien. Wir packen einfach alles in die Fundgrube:
In Brandenburg trinken Schulkinder in der 9. Klasse Bier unter Aufsicht! Vielleicht wollen sie aber nur den Begriff „Alkoholpädagogik“ zurück erobern…
Nachtrag zuerst: Das Spiel heißt Supertrumpf! Mit dem Wikidata Card Game Generator kann man Karten für das klassische Quartettkartenspiel generieren, zum Beispiel zu Superheld*innen oder Betriebssystemen. Wenn etwas fehlt, kann man es ja in der Wikipedia ergänzen und auf die semantischen Daten dabei achten.
PDFs kann man mit PDFCandy bearbeiten. Auf jede erdenkliche Art. Jede. (Danke David für den Hinweis!)
Politik+Alt+Entf
Weil die EU-Abgeordneten immer noch davon überzeugt werden müssen, dass die aktuelle Fassung der EU-Urheberrechtsreform nicht gut ist, sollten wir es ihnen noch einmal sagen. Am 23.03.2019 machen das in ganz Europa hoffentlich viele Menschen. Ihr auch?
Veranstaltungstipps
4. und 5. April 2019: Moodle-Hochschultreffen in Berlin.
Die TU Berlin und die die Beuth-Hochschule für Technik in Berlin sind in diesem Jahr die Ausrichter und haben ein Programm zusammengestellt, das sich unter anderem um E-Assessments, Opencast, Learning Analytics und die Zukunft von moodle dreht. Die offizielle Anmeldefrist ist zwar vorüber, aber es werden gerne noch Einzelanmeldungen angenommen.
10 und 11. April 2019: OER19 (#OER19) in Galway.
Bei der internationalen OER-Konferenz kann man über den deutschsprachigen Tellerrand hinaus blicken. Dabei geht es neben Formaten und Tools vor allem um die Auswirkungen von OER und Open Education.
Mythos+Alt+Entf
Ist die klassische Brainstorming-Methode gut so, wie sie ist, vor allem, dass beim Sammeln der Ideen zunächst erst einmal nicht diskutiert werden darf? O hat da mal genauer nachgelesen…
Sawyer, R. KeithExplaining Creativity: The Science of Human Innovation Buch 2, Oxford University Press, 2012, ISBN: 9780199737574.Abstract | BibTeX@book{Sawyer2012,
title = {Explaining Creativity: The Science of Human Innovation},
author = {R. Keith Sawyer},
isbn = {9780199737574},
year = {2012},
date = {2012-01-12},
publisher = {Oxford University Press},
edition = {2},
abstract = {Explaining Creativity is an accessible introduction to the latest scientific research on creativity. In the last 50 years, psychologists, anthropologists, and sociologists have increasingly studied creativity, and we now know more about creativity than at any point in history. It considers not only arts like painting and writing, but also science, stage performance, and business innovation. Until about a decade ago, creativity researchers tended to focus on highly valued activities like fine art painting and Nobel prize winning science. Sawyer brings this research up to date by including movies, music videos, cartoons, video games, hypertext fiction, and computer technology. For example, this is the first book on creativity to include studies of performance and improvisation. Sawyer draws on the latest research findings to show the importance of collaboration and context in all of these creative activities. Today's science of creativity is interdisciplinary; in addition to psychological studies of creativity the book includes research by anthropologists on creativity in non-Western cultures, and research by sociologists about the situation, contexts, and networks of creative activity. It brings these approaches together within the sociocultural approach to creativity pioneered by Howard Becker, Mihaly Csikszentmihalyi, and Howard Gardner. The sociocultural approach moves beyond the individual to consider the social and cultural contexts of creativity, emphasizing the role of collaboration and context in the creative process.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {book}
}
SchließenExplaining Creativity is an accessible introduction to the latest scientific research on creativity. In the last 50 years, psychologists, anthropologists, and sociologists have increasingly studied creativity, and we now know more about creativity than at any point in history. It considers not only arts like painting and writing, but also science, stage performance, and business innovation. Until about a decade ago, creativity researchers tended to focus on highly valued activities like fine art painting and Nobel prize winning science. Sawyer brings this research up to date by including movies, music videos, cartoons, video games, hypertext fiction, and computer technology. For example, this is the first book on creativity to include studies of performance and improvisation. Sawyer draws on the latest research findings to show the importance of collaboration and context in all of these creative activities. Today's science of creativity is interdisciplinary; in addition to psychological studies of creativity the book includes research by anthropologists on creativity in non-Western cultures, and research by sociologists about the situation, contexts, and networks of creative activity. It brings these approaches together within the sociocultural approach to creativity pioneered by Howard Becker, Mihaly Csikszentmihalyi, and Howard Gardner. The sociocultural approach moves beyond the individual to consider the social and cultural contexts of creativity, emphasizing the role of collaboration and context in the creative process.Schließen Nemeth, Charlan J.; Personnaz, Bernard; Personnaz, Marie; Goncalo, Jack A.The liberating role of conflict in group creativity: A study in two countries Artikel In: European Journal of Social Psychology, Bd. 34, Nr. 4, S. 365–374, 2004.Abstract | Links | BibTeX@article{Nemeth2004,
title = {The liberating role of conflict in group creativity: A study in two countries},
author = {Charlan J. Nemeth and Bernard Personnaz and Marie Personnaz and Jack A. Goncalo},
url = {https://doi.org/10.1002/ejsp.210
https://www.researchgate.net/publication/252896556_The_liberating_role_of_conflict_in_group_creativity_A_study_in_two_countries},
doi = {10.1002/ejsp.210},
year = {2004},
date = {2004-07-02},
journal = {European Journal of Social Psychology},
volume = {34},
number = {4},
pages = {365–374},
abstract = {Researchers of group creativity have noted problems such as social loafing, production blocking, and especially, evaluation apprehension. Thus, brainstorming techniques have specifically admonished people ‘not to criticize’ their own and others' ideas, a tenet that has gone unexamined. In contrast, there is research showing that dissent, debate and competing views have positive value, stimulating divergent and creative thought. Perhaps more importantly, we suggest that the permission to criticize and debate may encourage an atmosphere conducive to idea generation. In this experimental study, traditional brainstorming instructions, including the advice of not criticizing, were compared with instructions encouraging people to debate—even criticize. A third condition served as a control. This study was conducted both in the United States and in France. Results show the value of both types of instruction, but, in general, debate instructions were superior to traditional brainstorming instructions. Further, these findings hold across both cultures. Results are discussed in terms of the potential positive value of encouraging debate and controversy for idea generation.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenResearchers of group creativity have noted problems such as social loafing, production blocking, and especially, evaluation apprehension. Thus, brainstorming techniques have specifically admonished people ‘not to criticize’ their own and others' ideas, a tenet that has gone unexamined. In contrast, there is research showing that dissent, debate and competing views have positive value, stimulating divergent and creative thought. Perhaps more importantly, we suggest that the permission to criticize and debate may encourage an atmosphere conducive to idea generation. In this experimental study, traditional brainstorming instructions, including the advice of not criticizing, were compared with instructions encouraging people to debate—even criticize. A third condition served as a control. This study was conducted both in the United States and in France. Results show the value of both types of instruction, but, in general, debate instructions were superior to traditional brainstorming instructions. Further, these findings hold across both cultures. Results are discussed in terms of the potential positive value of encouraging debate and controversy for idea generation.Schließenhttps://doi.org/10.1002/ejsp.210https://www.researchgate.net/publication/252896556_The_liberating_role_of_confli[...]doi:10.1002/ejsp.210Schließen
Weltverbesserung+Alt+Entf
Wer die Wikidata-Supertrumpflkarte, die IDEA-Visualisierungen für Algorithmen (aus Episode 3), Twitterbots für Gebärdensprache und Harry-Potter-Nerd-Fanfiction, das Hacken-Shirt bei GetDigital, eine Druckversion zum Passierschein A38, eine ECHTE Spacebar auf der Tastatur, Möbius-Bacon und noch viel mehr gut findet, der kann Sebastian Morr via Patreon Geld geben, damit er mehr Zeit damit verbringen kann, solche Sachen zu tun.

Feb 16, 2019 • 2h 38min
BldgAltEntf E013: Scheißhausbongo
Die Folge haben wir am 15.02.2018 aufgenommen.
Intro & Feedback
Wenn man das akademische Viertel mal abzieht, dann passt unser Intro natürlich hervorragend zum Valentinstag.
Mit der letzten Episode haben wir für David unseren neuen Service ausprobiert: Instant Service Reading. Im P2P-Hörertreffen mit Julian hat O herausgefunden, dass wir dank A bei Spotify nun in den großen Clubs spielen… ok, da auch eher vor dem Hinterausgang, aber isso!
„In einer Reihe“ mit Fest & Flauschig und Herrengedeck!!!
Und dank Arnim haben wir nun auch eine Idee für eine „Sag was am Anfang und löse es gegen Ende auf“-Kategorie: wir werden Bildungsmythen vorstellen – oder Dinge, die doch keine Mythen sind.
News+Alt+Entf
A und O inkorrekt live
News+O
O würde seinen „Urlaub“ in Hamburg fast in vollen Zügen genießen, wenn da nicht diese(r) nervige(n) Identitätsdieb(e) wären – oder Plattformen, die mit Neukunden sehr großzügig umgehen.
A und O haben sich mittlerweile schon „in echt“ wieder gesehen: bei der großartigen Live-Show von Methodisch Inkorrekt in Hamburg!
News+A
Bei oncampus fand das traditionelle Jahres-Kick-Off statt, bei dem es u.a. mehrere Stationen zum Ausprobieren von ganz verschiedenen Sachen gab (wie damals in Naumburg/Hessen bei verdi). Außerdem gibt es jetzt Merch-Kram von oncampus.
Es gibt jetzt ein neues Buch „Digitale Schule: Was heute schon im Unterricht geht“ von Jöran, A war auf der zünftigen Buch-Release-Party. Jöran hat darüber auch in seinem Podcast Jöran-Ruft-An Episode 88 drüber gesprochen.
A hat für die EMOOCs 2019 ein paar Einreichungen begutachtet, fand Helene Bockhorst live in Lübeck sehr lustig und hat die Live-Show von Methodisch Inkorrekt auch sehr genossen.
Paper+Alt+Entf
Paper+O: Ist das Pädagogik oder kann das weg?
Kaynardağ, Aynur YürekliPedagogy in HE: does it matter? Artikel In: Studies in Higher Education, Bd. 44, Nr. 1, S. 111–119, 2017, ISSN: 1470-174X.Abstract | Links | BibTeX@article{Yuerekli17,
title = {Pedagogy in HE: does it matter?},
author = {Aynur Yürekli Kaynardağ},
url = {https://doi.org/10.1080/03075079.2017.1340444},
doi = {10.1080/03075079.2017.1340444},
issn = {1470-174X},
year = {2017},
date = {2017-06-19},
urldate = {2019-02-16},
journal = {Studies in Higher Education},
volume = {44},
number = {1},
pages = {111–119},
publisher = {Routledge},
abstract = {Pedagogical competencies of instructors play a crucial role in improving the quality of the teaching and learning in higher education institutions. However, in many countries worldwide, pedagogical training is not a requirement for being an instructor at a university [Postareff, L., S. Lindblom-Ylänne, and A. Nevgi. 2007. “The Effect of Pedagogical Training on Teaching in Higher Education.” Teaching and Teacher Education 23: 557–71; Badley, G. 2000. “Developing Globally-Competent University Teachers.” Innovations in Education and Training International 37 (3): 244–53]. This study explores how pedagogical competencies of instructors affect the perceptions of students by focusing on three key dimensions of classroom pedagogy; namely delivery (provision of content and facilitation), communication and assessment. The results of the scale administered to a total of 1083 university students suggests that there are meaningful differences in terms of students’ perceptions regarding their instructors’ pedagogical competencies. The greatest difference is reflected in the ratings of items related to the communication dimension.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenPedagogical competencies of instructors play a crucial role in improving the quality of the teaching and learning in higher education institutions. However, in many countries worldwide, pedagogical training is not a requirement for being an instructor at a university [Postareff, L., S. Lindblom-Ylänne, and A. Nevgi. 2007. “The Effect of Pedagogical Training on Teaching in Higher Education.” Teaching and Teacher Education 23: 557–71; Badley, G. 2000. “Developing Globally-Competent University Teachers.” Innovations in Education and Training International 37 (3): 244–53]. This study explores how pedagogical competencies of instructors affect the perceptions of students by focusing on three key dimensions of classroom pedagogy; namely delivery (provision of content and facilitation), communication and assessment. The results of the scale administered to a total of 1083 university students suggests that there are meaningful differences in terms of students’ perceptions regarding their instructors’ pedagogical competencies. The greatest difference is reflected in the ratings of items related to the communication dimension.Schließenhttps://doi.org/10.1080/03075079.2017.1340444doi:10.1080/03075079.2017.1340444Schließen
Lehrende an Hochschulen in Deutschland brauchen keine pädagogisch-didaktische Ausbildung, um Lehren zu dürfen. Im Paper geht Aynur Yürekli Kaynardağ der Frage nach, ob es grundsätzlich trotzdem sinnvoll sein könnte, sich mit Hochschuldidaktik zu beschäftigen – sprich: ob es bei diversen Kriterien “guter Lehre” messbare Unterschiede zwischen Lehrenden mit und ohne pädagogisch-didaktische Kenntnisse gibt.
Wiki+A: Submitted 1543, rejected 1616
Wikipedianer,Nikolaus Kopernikus Online Wikipedia 2018, besucht am: 16.02.2019.Links | BibTeX@online{Wikipedia2019Kopernikus,
title = {Nikolaus Kopernikus},
author = {Wikipedianer},
url = {https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikolaus_Kopernikus&oldid=184010871},
year = {2018},
date = {2018-12-25},
urldate = {2019-02-16},
organization = {Wikipedia},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {online}
}
Schließenhttps://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikolaus_Kopernikus&oldid=1840108[...]Schließen Klexikonianer,Nikolaus Kopernikus Online 2018, besucht am: 16.02.2019.Links | BibTeX@online{Klexikon2019Kopernikus,
title = {Nikolaus Kopernikus},
author = {Klexikonianer},
url = {https://klexikon.zum.de/index.php?title=Nikolaus_Kopernikus&oldid=83283},
year = {2018},
date = {2018-10-28},
urldate = {2019-02-16},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {online}
}
Schließenhttps://klexikon.zum.de/index.php?title=Nikolaus_Kopernikus&oldid=83283Schließen
Der Sommerurlaub führte A in letztem Jahr nach Thorn und Frauenburg in Polen, und sie hat dort viel über Nikolaus Kopernikus erfahren. Nachhaltig beeindruckt war sie von einer Kopie seines Doktordiploms, das in seinem Geburtshaus ausgestellt war: während aktuell über digitale Kompetenznachweise wie Badges oder Blockchain-gesichterte Zertifikate diskutiert wurde, reichte Anfang des 16. Jhd. offenbar ein etwa A5-großer Zettel (den die meisten ohnehin nicht lesen konnten).
Neben den beiden „Nikolaus Kopernikus“-Seiten im Klexikon und der Wikipedia hat sich A auch durch diese Wiki-Seiten gelesen:
Kopernikanische Wende
De revolutionibus orbium coelestium
Ockhams Rasiermesser
Milch, Eier, ein Doktortitel…
Fundgrube+Alt+Entf
Projekte, Tools, Apps… das sind doch bürgerliche Kategorien. Wir packen einfach alles in die Fundgrube:
In der Stavanger–Erklärung haben 130 Leseforscherinnen und -forscher Studien zum Lesen auf Papier und auf dem Bildschirm ausgewertet. In der Erklärung betonen sie, auch im Zeitalter der Digitalisierung, dass Papier als Medium für lange Informationstexte besser geeignet seien. Leider fehlt es (noch) an einer Publikation der Untersuchungsmethodik und -ergebnisse. Bisher wird lediglich die Erklärung selbst diskutiert.
Mit LyricsTraining kann man im Web oder Via App Hörverstehen üben, indem man Texte in Liedern erkennt.
Politik+Alt+Entf
Bereits in den Episoden 5, 6, und 12 haben wir über die geplante Urheberrechtsreform der Europäischen Union gesprochen. Nun gibt es einen Entwurf, der im März abgestimmt werden soll. Anja und Olli haben den deutschen Abgeordneten im EU-Parlament geschrieben, warum sie diesen Entwurf nicht gut finden, und ihre Mailtexte in ihren Blogs veröffentlicht. Du kannst das auch tun: hier gibt es eine Textvorlage und die Kontaktadressen der Abgeordneten.
Nochmal Gutes kann man tun, indem man dafür sorgt, dass alte Abituraufgaben frei zur Verfügung stehen. Durch die gemeinsame Kampagne „Frag Sie Abi!“ von FragDenStaat und Wikimedia geht das sehr bequem und schnell.
SPIEGEL ONLINE hat Bildungsministerin Anja Karliczek als „die Unsichtbare“ betitelt. Leider hat wohl auch die letzte Berufsbachelor mitbekommen, dass man Studien über Kinder, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen aufwachsen, bereits heute an jeder Milchkanne bekommen kann, dass die Azubi-Mindestvergütung nicht brutto wie netto ist und dass das Bafög keine Almosen für Studis im Stadtrand sein darf.
Veranstaltungstipps
9. bis 23. Februar 2019: Didacta(#didacta oder #didacta19) in Köln
Vom 19. bis 23. Februar findet in Köln die Messe für alle Beutelratten im Bildungssektor statt. Ausgestattet mit Rollkoffer und Jutebeutel können Bildungsbegeisterte wieder von Stand zu Stand pilgern und Goodies von Verlagen und anderen Anbietern abgreifen. Wir freuen uns schon auf vielleicht neue Videos von TimeTex. Im Gegensatz zur Learntec gibt’s auch kostenloses WLAN ohne eigene App!
18.03.2019: BarCamp Open Science (#oscibar) in Berlin
Früher war es das BarCamp „Science 2.0“, nun machen sie es richtig: Zu diesem BarCamp treffen sich Menschen, die wissen, dass Open Science keine Utopie ist, „just Science done right.“ Das BarCamp ist leider bereits ausgebucht, aber vielleicht hat man über die Warteliste Glück.
Wiederholt empfohlen:
26. und 27. Februar: Inverted-Classroom-Model-Konferenz (#icm8) in Marburg
Zum inzwischen 8. Mal findet in Marburg die Inverted-Classroom-Model-Konferenz statt, die sich um eben dieses Modell und den Blick über den Tellerrand dreht. Diesmal geht es ausdrücklich um die “next stage”, einen Blick in die Zukunft, was die Digitalisierung bereithalten könnte.
22. bis 24. März: subscribe 10 (#subscribe10) in Köln
Mit ihrer 10. Ausgabe kommt die Podcasting-Konferenz nach Berlin und München das erste mal in den deutschen (geografischen) Westen, zum Deutschlandfunk in Köln. Wer selbst Podcasts aufnimmt oder das möchte, aber auch wer selbst begeistert Podcasts hört, ist herzlich eingeladen – zur Teilnahme und zur Mitgestaltung des Programms.
Mythos+Alt+Entf
Laut der Lernpyramide der National Training Laboratories in Bethel in Maine ist die durchschnittliche Behaltensleistung abhängig vom Vermittlungsformat:
Vorlesung: 5 %
Lesen: 10 %
Audiovisuell: 20 %
Demonstration: 30 %
Diskussion: 50 %
Praktisches Tun: 70 %
Anderen etwas erklären: 100%
Ob das stimmt haben u.a. Lalley und Miller hinterfragt.
Lalley, James P.; Miller, Robert H.The Learning Pyramid: Does it point teachers in the right direction? Artikel In: Education, Bd. 128, Nr. 1, S. 64–79, 2007, ISSN: 0013-1172.Abstract | Links | BibTeX@article{Lalley2019,
title = {The Learning Pyramid: Does it point teachers in the right direction?},
author = {James P. Lalley and Robert H. Miller},
url = {http://www.impudent.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/Lalley-Miller-TheLearningPyramid-Education-200709-.pdf},
issn = {0013-1172},
year = {2007},
date = {2007-09-01},
journal = {Education},
volume = {128},
number = {1},
pages = {64–79},
abstract = {This paper raises serious questions about the reliability of the learning pyramid as a guide to retention among students. The pyramid suggests that certain teaching methods are connected with a corresponding hierarchy of student retention. No specific credible research was uncovered to support the pyramid, which is loosely associated with the theory proposed by the well-respected researcher, Edgar Dale. Dale is credited with creating the Cone of Experience in 1946. The Cone was designed to represent the importance of altering teaching methods in relation to student background knowledge: it suggests a continuum of methods not a hierarchy. While no credible research was uncovered to support the pyramid, clear research on retention was discovered regarding the importance of each of the pyramid levels: each of the methods identified by the pyramid resulted in retention, with none being consistently superior to the others and all being effective in certain contexts. A key conclusion from the literature reviewed rests with the critical importance of the teacher as a knowledgeable decision maker for choosing instructional methods. (Contains 3 figures.)},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenThis paper raises serious questions about the reliability of the learning pyramid as a guide to retention among students. The pyramid suggests that certain teaching methods are connected with a corresponding hierarchy of student retention. No specific credible research was uncovered to support the pyramid, which is loosely associated with the theory proposed by the well-respected researcher, Edgar Dale. Dale is credited with creating the Cone of Experience in 1946. The Cone was designed to represent the importance of altering teaching methods in relation to student background knowledge: it suggests a continuum of methods not a hierarchy. While no credible research was uncovered to support the pyramid, clear research on retention was discovered regarding the importance of each of the pyramid levels: each of the methods identified by the pyramid resulted in retention, with none being consistently superior to the others and all being effective in certain contexts. A key conclusion from the literature reviewed rests with the critical importance of the teacher as a knowledgeable decision maker for choosing instructional methods. (Contains 3 figures.)Schließenhttp://www.impudent.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/Lalley-Miller-Th[...]Schließen
Weltverbesserung+Alt+Entf
Tommy Krappweis hat den das Lied „Entdumm’ Dich“ geschrieben und spendet alle Einnahmen an das Deutsche Kinderhilfswerk. Ihr könnt es kaufen oder direkt spenden.

Jan 24, 2019 • 2h 52min
Bldg-Alt-Entf E012: Rein in die Apfelblase
Die Folge haben wir am 23.01.2019 aufgenommen.
Intro & Feedback
Wir wünschen Euch wahlweise ein frohes oder gesundes neues Jahr (gern auch beides)!
The same procedure as every Episode: Dank an Stammhörer Martin, der das IG-Nobelpreis-Paper, das wir in Folge E009 vorgestellt haben, bei Methodisch Inkorrekt wieder erkannt hat. Für die Kollegen von BZT hat O noch weitere Bildungspodcasthörempfehlungen: Bildungsshaker, 42, Podcampus und via FYYD findet man sicher noch einige mehr (A hat aber auch beim Shownotes schreiben nicht herausbekommen, wofür fyyd steht – vermutlich ist es einfach nur phonetisch ähnlich zu Feed…? Sonst weiß das Internet doch auch immer alles!).
News+Alt+Entf
News+O
O ist zurück in Deutschland und hat kulinarisch erst einmal aufgeholt.
Juristen und Betriebswirte machen O Netflix kaputt, weil er sie für das Ende von Daredevil und Punisher verantwortlich macht.
O musste auch noch zur Polizei, weil böse Menschen auf seinen Namen Dinge im Internet bestellt, aber nicht bezahlt haben.
„Und jetzt zu etwas völlig anderem“: O hat sich für ein Akademiestudium Philosophie eingeschrieben.
Schöner Döner
News+A
A war von den 2. Leipziger Rollertagen sehr begeistert. Talks gibt es hier oder auf YouTube zum Nachschauen und das allmächtige Wiki hier. Die Dokumentation „All Creatures Welcome“ fängt einen Teil davon auf (hier gibt es auch den Talk mit den Macher*innen), steht unter CC-BY-NC-SA-Lizenz und stellt auch OER für Lehrkräfte zur Behandlung im Unterricht bereit. Ein paar Ideen für unseren Podcast hat A auch mitgenommen.
Gleich die erste Dienstreise des Jahres verlief ganz im Zeichen von OER: A war in Weimar zum KickOff des Nachfolgeprojekts JOINTLY4OER.
Das FabLab Lübeck hat die Sumobot Competion veranstaltet. Hier gibt es den aufgezeichneten YouTube-Stream und hier den Bericht auf heise.de/MAKE.
Beim MOiN-Assembly auf dem 35c3
Paper+Alt+Entf
Paper+O: Brumm, brumm, brumm – MOOC dreht sich herum
Reich, Justin; Ruipérez-Valiente, José A.The MOOC pivot Artikel In: Science, Bd. 363, Nr. 6423, S. 130–131, 2019, ISSN: 1095-9203.Abstract | Links | BibTeX@article{Reich2019,
title = {The MOOC pivot},
author = {Justin Reich and José A. Ruipérez-Valiente},
url = {http://dx.doi.org/10.1126/science.aav7958},
doi = {10.1126/science.aav7958},
issn = {1095-9203},
year = {2019},
date = {2019-01-11},
journal = {Science},
volume = {363},
number = {6423},
pages = {130–131},
abstract = {When massive open online courses (MOOCs) first captured global attention in 2012, advocates imagined a disruptive transformation in postsecondary education. Video lectures from the world's best professors could be broadcast to the farthest reaches of the networked world, and students could demonstrate proficiency using innovative computer-graded assessments, even in places with limited access to traditional education. But after promising a reordering of higher education, we see the field instead coalescing around a different, much older business model: helping universities outsource their online master's degrees for professionals (1). To better understand the reasons for this shift, we highlight three patterns emerging from data on MOOCs provided by Harvard University and Massachusetts Institute of Technology (MIT) via the edX platform: The vast majority of MOOC learners never return after their first year, the growth in MOOC participation has been concentrated almost entirely in the world's most affluent countries, and the bane of MOOCs—low completion rates (2)—has not improved over 6 years.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenWhen massive open online courses (MOOCs) first captured global attention in 2012, advocates imagined a disruptive transformation in postsecondary education. Video lectures from the world's best professors could be broadcast to the farthest reaches of the networked world, and students could demonstrate proficiency using innovative computer-graded assessments, even in places with limited access to traditional education. But after promising a reordering of higher education, we see the field instead coalescing around a different, much older business model: helping universities outsource their online master's degrees for professionals (1). To better understand the reasons for this shift, we highlight three patterns emerging from data on MOOCs provided by Harvard University and Massachusetts Institute of Technology (MIT) via the edX platform: The vast majority of MOOC learners never return after their first year, the growth in MOOC participation has been concentrated almost entirely in the world's most affluent countries, and the bane of MOOCs—low completion rates (2)—has not improved over 6 years.Schließenhttp://dx.doi.org/10.1126/science.aav7958doi:10.1126/science.aav7958Schließen
Die Autoren haben alle MIT- und Harvard-MOOCs auf edX von Oktober 2012 bis Mai 2018 statistisch ausgewertet. Drei Muster ließen sich über die 565 Durchgänge von 261 Kursen erkennen: Die meisten Lernenden sind nach einem Jahr nicht mehr auf der Plattform, die Lernenden kommen fast ausschließlich aus wohlhabenden Ländern, und die Abschlussquote hat sich in den sechs Jahren nicht verbessert.
The Year of the MOOC, Artikel der New York Times vom 2. November 2012
Wann ist ein MOOC ein MOOC? Ein Definitionsversuch von O
Statistik zu Abschlussquoten von Katy Jordan
Paper+A: Metriken sind auch nur Meinungen, die sich als Mathematik verkleidet haben
Lemke, Steffen; Mehrazar, Maryam; Mazarakis, Athanasios; Peters, Isabella“When You Use Social Media You Are Not Working”: Barriers for the Use of Metrics in Social Sciences Artikel In: Frontiers in Research Metrics and Analytics, Bd. 3, S. 39, 2019, ISSN: 2504–0537.Abstract | Links | BibTeX@article{Lemke2019,
title = {“When You Use Social Media You Are Not Working”: Barriers for the Use of Metrics in Social Sciences},
author = {Steffen Lemke and Maryam Mehrazar and Athanasios Mazarakis and Isabella Peters},
url = {https://doi.org/10.3389/frma.2018.00039},
doi = {10.3389/frma.2018.00039},
issn = {2504–0537},
year = {2019},
date = {2019-01-08},
journal = {Frontiers in Research Metrics and Analytics},
volume = {3},
pages = {39},
abstract = {The Social Sciences have long been struggling with quantitative forms of research assessment – insufficient coverage in prominent citation indices and overall lower citation counts than in STM subject areas have led to a widespread weariness regarding bibliometric evaluations among social scientists. Fueled by the rise of the social web, new hope is often placed on alternative metrics that measure the attention scholarly publications receive online, in particular on social media. But almost a decade after the coining of the term altmetrics for this new group of indicators, the uptake of the concept in the Social Sciences still seems to be low. Just like with traditional bibliometric indicators, one central problem hindering the applicability of altmetrics for the Social Sciences is the low coverage of social science publications on the respective data sources – which in the case of altmetrics are the various social media platforms on which interactions with scientific outputs can be measured. Another reason is that social scientists have strong opinions about the usefulness of metrics for research evaluation which may hinder broad acceptance of altmetrics too.
We conducted qualitative interviews and online surveys with researchers to identify the concerns which inhibit the use of social media and the utilization of metrics for research evaluation in the Social Sciences. By analyzing the response data from the interviews in conjunction with the response data from the surveys, we identify the key concerns that inhibit social scientists from (1) applying social media for professional purposes and (2) making use of the wide array of metrics available.
Our findings show that aspects of time consumption, privacy, dealing with information overload, and prevalent styles of communication are predominant concerns inhibiting Social Science researchers from using social media platforms for their work. Regarding indicators for research impact we identify a widespread lack of knowledge about existing metrics, their methodologies and meanings as a major hindrance for their uptake through social scientists. The results have implications for future developments of scholarly online tools and show that researchers could benefit considerably from additional formal training regarding the correct application and interpretation of metrics.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenThe Social Sciences have long been struggling with quantitative forms of research assessment – insufficient coverage in prominent citation indices and overall lower citation counts than in STM subject areas have led to a widespread weariness regarding bibliometric evaluations among social scientists. Fueled by the rise of the social web, new hope is often placed on alternative metrics that measure the attention scholarly publications receive online, in particular on social media. But almost a decade after the coining of the term altmetrics for this new group of indicators, the uptake of the concept in the Social Sciences still seems to be low. Just like with traditional bibliometric indicators, one central problem hindering the applicability of altmetrics for the Social Sciences is the low coverage of social science publications on the respective data sources – which in the case of altmetrics are the various social media platforms on which interactions with scientific outputs can be measured. Another reason is that social scientists have strong opinions about the usefulness of metrics for research evaluation which may hinder broad acceptance of altmetrics too.
We conducted qualitative interviews and online surveys with researchers to identify the concerns which inhibit the use of social media and the utilization of metrics for research evaluation in the Social Sciences. By analyzing the response data from the interviews in conjunction with the response data from the surveys, we identify the key concerns that inhibit social scientists from (1) applying social media for professional purposes and (2) making use of the wide array of metrics available.
Our findings show that aspects of time consumption, privacy, dealing with information overload, and prevalent styles of communication are predominant concerns inhibiting Social Science researchers from using social media platforms for their work. Regarding indicators for research impact we identify a widespread lack of knowledge about existing metrics, their methodologies and meanings as a major hindrance for their uptake through social scientists. The results have implications for future developments of scholarly online tools and show that researchers could benefit considerably from additional formal training regarding the correct application and interpretation of metrics.Schließenhttps://doi.org/10.3389/frma.2018.00039doi:10.3389/frma.2018.00039Schließen
Bibliometrische Kenngrößen wie der Journal Impact Faktor (JIP) oder der Hirsch-Index (h-Index) versuchen die Relevanz von wissenschaftlichen Publikationen oder wissenschaftlichen Autorinnen und Autoren in Zahlen auszudrücken. Meist geht es darum, was wie häufig zitiert wurde. Seitdem man wissenschaftliche Paper auch im Web veröffentlichen kann, kommen immer mehr sog. Altmetriken hinzu, also Kenngrößen wie Download-Zahlen oder Likes in sozialen Netzwerken.
Die Sozialwissenschaften schneiden bei den traditionellen Metriken nicht allzu gut ab. Dennoch scheinen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch die alternativen Ansätze meist nicht zu kennen und ihnen auch zu misstrauen: Sichtbarkeit in Social Media kostet schließlich Zeit, in der man „richtig forschen“ könnte und dort ohnehin nur schwer präzise und faktenbasiert diskutiert werden könne.
Wie man es auch dreht: hier müssen alle mal etwas aufgeschlaut werden, damit die Metriken richtig interpretiert werden – oft genug werden sie zur Erfolgsmessung herangezogen, obwohl sie einige Schwachstellen haben.
Zugabe+O: Aber Herr Spitzer hat doch gesagt…
Orben, Amy; Przybylski, Andrew K.The association between adolescent well-being and digital technology use Artikel In: Nature Human Behaviour, 2019, ISSN: 2397-3374.Abstract | Links | BibTeX@article{Orben2019,
title = {The association between adolescent well-being and digital technology use},
author = {Amy Orben and Andrew K. Przybylski},
url = {https://doi.org/10.1038/s41562-018-0506-1},
doi = {10.1038/s41562-018-0506-1},
issn = {2397-3374},
year = {2019},
date = {2019-01-14},
journal = {Nature Human Behaviour},
abstract = {The widespread use of digital technologies by young people has spurred speculation that their regular use negatively impacts psychological well-being. Current empirical evidence supporting this idea is largely based on secondary analyses of large-scale social datasets. Though these datasets provide a valuable resource for highly powered investigations, their many variables and observations are often explored with an analytical flexibility that marks small effects as statistically significant, thereby leading to potential false positives and conflicting results. Here we address these methodological challenges by applying specification curve analysis (SCA) across three large-scale social datasets (total n = 355,358) to rigorously examine correlational evidence for the effects of digital technology on adolescents. The association we find between digital technology use and adolescent well-being is negative but small, explaining at most 0.4{37d1f293241a1edd19b097ce37fa29bd44d887a41b5283a0fc9485076e078306} of the variation in well-being. Taking the broader context of the data into account suggests that these effects are too small to warrant policy change.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenThe widespread use of digital technologies by young people has spurred speculation that their regular use negatively impacts psychological well-being. Current empirical evidence supporting this idea is largely based on secondary analyses of large-scale social datasets. Though these datasets provide a valuable resource for highly powered investigations, their many variables and observations are often explored with an analytical flexibility that marks small effects as statistically significant, thereby leading to potential false positives and conflicting results. Here we address these methodological challenges by applying specification curve analysis (SCA) across three large-scale social datasets (total n = 355,358) to rigorously examine correlational evidence for the effects of digital technology on adolescents. The association we find between digital technology use and adolescent well-being is negative but small, explaining at most 0.4{37d1f293241a1edd19b097ce37fa29bd44d887a41b5283a0fc9485076e078306} of the variation in well-being. Taking the broader context of the data into account suggests that these effects are too small to warrant policy change.Schließenhttps://doi.org/10.1038/s41562-018-0506-1doi:10.1038/s41562-018-0506-1Schließen
Manche sogenannte Wissenschaftler*innen behaupten in ihren Büchern und in Talkshows, digitale Medien machten Jugendliche unglücklich. Das hat nun ein Team aus echten Wissenschaftler*innen genauer untersucht: Ergebnis: Es gibt tatsächlich einen negativen Zusammenhang, der aber bloß 0,4 % (Null-komma-vier Prozent) des Wohlbefindens erklärt – fast denselben Wert erzielt das Essen von Kartoffeln.
Besprochen in der Süddeutschen Zeitung vom 16.01.2019: Der Kartoffel-Effekt von Christian Gschwendtner
Fundgrube+Alt+Entf
Projekte, Tools, Apps… das sind doch bürgerliche Kategorien. Wir packen einfach alles in die Fundgrube:
Mit RevealJS kann man hübsche HTML-basierte Slides erstellen, Nele Hirsch zeigt in einem Screencast, wie es geht.
Schnelle Ausmalbilder, Piktogramme usw. kann man via http://umrissbilder.de/ erstellen.
Politik+Alt+Entf
Die Politik befindet sich im Winterloch. Aus Bayern haben A und O vernommen, dass sie jetzt Schafkopf lernen müssen, gehört wohl irgendwie zu den 21st Century skills…
Zuletzt in E006 kommentiert gibt es nun vielleicht doch Hoffnung: der EU-Rat kam zu keiner richtigen Einigung und vielleicht schaffen sie das bis zu den Europawahlen auch nicht mehr. Verpasst trotzdem keine Chance Euren Politikerinnen und Politikern zu sagen, dass Ihr Uploadfilter überhaupt nicht gut finden würdet (und das wäre leider die logische Konsequenz aus dem aktuellen Entwurf).
Veranstaltungstipps
07. Februar: Methodisch Inkorrekt Live in Hamburg
Wir haben in der vergangenen Episode bereits auf den Termin hingewiesen, aber nun heißt es: AUSVERKAUFT bis auf Aachen am 9. Februar! Wer es nicht geschafft hat, kann es nach den Sommerferien noch einmal probieren, wenn Nicolas und Reinhard noch einmal unterwegs sein wollen.
26. und 27. Februar: Inverted-Classroom-Model-Konferenz (#icm8) in Marburg
Zum inzwischen 8. Mal findet in Marburg die Inverted-Classroom-Model-Konferenz statt, die sich um eben dieses Modell und den Blick über den Tellerrand dreht. Diesmal geht es ausdrücklich um die “next stage”, einen Blick in die Zukunft, was die Digitalisierung bereithalten könnte.
22. bis 24. März subscribe 10 (#subscribe10) in Köln
Mit der 10. Ausgabe der kommt die Podcasting-Konferenz nach Berlin und München das erste mal in den deutschen (geografischen) Westen, zum Deutschlandfunk in Köln. Wer selbst Podcasts aufnimmt oder das möchte, aber auch wer selbst begeistert Podcasts hört, ist herzlich eingeladen – zur Teilnahme und zur Mitgestaltung des Programms.
Hausmeisterei
A hat tatsächlich mal ein paar Minuten recherchiert und SCHON NACH fast 1 JAHR ist unser Podcast nun auch via iTunes und Spotify erreichbar. Für O ist das kurz vor dem Ende des Neulands, aber man muss doch auch mal an die Kinder denken!
Und [Trommelwirbel]: Wir sind jetzt stolzes Mitglied im Edufunk-Netzwerk \o/
Edufunk-Netzwerk

Dec 21, 2018 • 2h 32min
BldgAltEntf E011: Das Glas ist ein Zehntel voll
Die Folge haben wir am 20.12.2018 aufgenommen.
Intro & Feedback
Danke, dass Euch das Intro aus der letzten Episode offenbar doch ganz gut gefallen hat. O hat daraufhin gleich noch einmal gedichtet. Auch das Service-Reading-Konzept kommt gut an.
News+Alt+Entf
News+O
Die H5Pcon2018 fand in Melbourne statt. O war dort und es gab einige Neuigkeiten, u.a. die neuen Content-Typen Digibook, Dictation, Minicourse und BullshitBingo.
O hat leider noch nicht viel von Weihnachten im hohen Norden mitbekommen, aber schon ein paar weihnachtliche Speisen gegessen. Außerdem wird es kaum hell draußen.
Nachdem O das erste Buch der Känguru-Chroniken gelesen hat… ach, naja, was soll’s. Sonst ist er ja ganz nett.
So hell wurde es vor einer Woche noch in Sommarøy
News+A
Die Campus Innovation in Hamburg war echt gut, vor allem die Keynote über die Code University und der VR/AR/Holografie-Track (letzterer mit frei lizenzierten Anleitungen im Netz).
Traditionell am Freitag und Samstag vor dem 1. Advent findet das BarCamp in Lübeck statt (Beitrag in der LN). A gehört zum Orga-Team und war erleichtert, dass es trotz neuer Location in der Dräger Garage kaum Probleme gab. Außerdem hat A gelernt, was ein Shadowban auf Twitter ist, und es gleich in einer Montagsbildung bei oncampus verarbeitet. O hat das auch schon einmal bei YouTube erlebt.
Leider von A dieses Jahr ein wenig vernachlässigt: der Weihnachtsmarkt in Lübeck
Paper+Alt+Entf
Paper+O: Was hat OER je für uns getan?
Könitz, ChristopherOER – Auf dem Weg in eine selbstverschuldete digitale Unmündigkeit? Artikel In: MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung, Bd. 32, Nr. Oktober, S. 63–71, 2018, ISSN: 1424-3636.Abstract | Links | BibTeX@article{Könitz_2018,
title = {OER – Auf dem Weg in eine selbstverschuldete digitale Unmündigkeit?},
author = {Christopher Könitz},
url = {https://www.medienpaed.com/article/view/609},
doi = {10.21240/mpaed/32/2018.10.24.X},
issn = {1424-3636},
year = {2018},
date = {2018-10-24},
urldate = {2018-12-20},
journal = {MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung},
volume = {32},
number = {Oktober},
pages = {63–71},
abstract = {Spätestens seit der Debatte um die Vergütung von urheberrechtlich geschütztem Material nach UrhG §52a, scheinen Open Educational Resources (OER) die Antwort auf proprietäre Verlagsangebote zu sein. Jedoch gibt es lizenzrechtliche, technische und begriffliche Unschärfen, die dazu führen, dass OER in eine selbstverschuldete digitale Unmündigkeit führen können. Dieser Beitrag liefert daher im Kern eine kritische Auseinandersetzung mit dem OER-Begriff aus einer bildungstheoretisch-medienpädagogischen Perspektive. Im ersten Teil werden die genannten Unschärfen näher beleuchtet und erste Lösungsansätze aufzeigt. Der Beitrag plädiert für eine Hinwendung zu einem starken Copyleft, welches derzeit mit den Creative Commons nicht möglich ist, da diese unter Umständen zu proprietären Materialen führen können. Die technische Perspektive richtet sich auf die verwendeten Dateiformate von OER, die häufig nicht frei und/oder editierbar sind. Die begriffliche Perspektive stellt heraus, dass der OER-Begriff ein negatives Konzept von Freiheit verfolgen und mit Blick auf die Medienpädagogik untertheoretisiert sind.
Im zweiten Teil werden daher durch das Medienkompetenzmodell nach Baacke und der Strukturalen Medienbildung nach Jörissen und Marotzki zwei mögliche medienpädagogische Anschlüsse geschaffen. Durch diese Anschlüsse werden die Momente der Medienkritik und der Reflexivität eingebracht. Damit wird der Fokus von einer Outputorientierung auf den Aufbau eines Orientierungswissens – und damit auf transformatorische Bildungsprozesse und den damit verbundenen medialen Artikulationen – verschoben.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenSpätestens seit der Debatte um die Vergütung von urheberrechtlich geschütztem Material nach UrhG §52a, scheinen Open Educational Resources (OER) die Antwort auf proprietäre Verlagsangebote zu sein. Jedoch gibt es lizenzrechtliche, technische und begriffliche Unschärfen, die dazu führen, dass OER in eine selbstverschuldete digitale Unmündigkeit führen können. Dieser Beitrag liefert daher im Kern eine kritische Auseinandersetzung mit dem OER-Begriff aus einer bildungstheoretisch-medienpädagogischen Perspektive. Im ersten Teil werden die genannten Unschärfen näher beleuchtet und erste Lösungsansätze aufzeigt. Der Beitrag plädiert für eine Hinwendung zu einem starken Copyleft, welches derzeit mit den Creative Commons nicht möglich ist, da diese unter Umständen zu proprietären Materialen führen können. Die technische Perspektive richtet sich auf die verwendeten Dateiformate von OER, die häufig nicht frei und/oder editierbar sind. Die begriffliche Perspektive stellt heraus, dass der OER-Begriff ein negatives Konzept von Freiheit verfolgen und mit Blick auf die Medienpädagogik untertheoretisiert sind.
Im zweiten Teil werden daher durch das Medienkompetenzmodell nach Baacke und der Strukturalen Medienbildung nach Jörissen und Marotzki zwei mögliche medienpädagogische Anschlüsse geschaffen. Durch diese Anschlüsse werden die Momente der Medienkritik und der Reflexivität eingebracht. Damit wird der Fokus von einer Outputorientierung auf den Aufbau eines Orientierungswissens – und damit auf transformatorische Bildungsprozesse und den damit verbundenen medialen Artikulationen – verschoben.Schließenhttps://www.medienpaed.com/article/view/609doi:10.21240/mpaed/32/2018.10.24.XSchließen
Der Autor geht im Artikel geht der Frage nach, ob bei all den schönen Aspekten von OER etwas zu kurz kommt. Er kommt zu dem Schluss, dass zwar Freiheit von diversen Zwängen erlangt wurde, aber noch keine Freiheit zu etwas wie “offener Bildung”. Der Autor schlägt den Anschluss an existierende Modelle der Medienkompetenz vor, um die Medienkritik stärker in den Fokus der OER-Welt zu bringen.
Bei der Vorstellung erwähnt:
Patrick Stewart sketch: what has the ECHR ever done for us?
Betteridge’s law of headlines
L3T
Das Urteil gegen Wikimedia wegen Fotografien von gemeinfreien Bildern
Positive und Negative Freiheit
Paper+A: Qualität braucht sehr wohl Grenzen, Qualität kennt kein Pardon!
Renz, Jan; Rohloff, Tobias; Meinel, ChristophAutomatisierte Qualitätssicherung in MOOCs durch Learning Analytics Konferenzberichte Proceedings of DeLFI and GMWWorkshops 2017, Chemnitz, Germany, September 5, 2017, 2017, ISSN: 1613-0073.Abstract | Links | BibTeX@proceedings{Renz2017,
title = {Automatisierte Qualitätssicherung in MOOCs durch Learning Analytics},
author = {Jan Renz and Tobias Rohloff and Christoph Meinel},
editor = {Carsten Ullrich and Martin Wessner},
url = {http://ceur-ws.org/Vol-2092/paper24.pdf
https://www.researchgate.net/publication/325226167_Automatisierte_Qualitatssicherung_in_MOOCs_durch_Learning_Analytics
https://www.researchgate.net/publication/321105881_Automatisierte_Qualitatssicherung_in_MOOCs_durch_Learning_Analytics},
issn = {1613-0073},
year = {2017},
date = {2017-09-05},
urldate = {2018-12-20},
series = {CEUR Workshop Proceedings},
abstract = {Dieser Beitrag beschreibt wie mithilfe von Learning Analytics Daten eine automatisierte Qualitätssicherung in MOOCs durchgeführt werden kann. Die Ergebnisse sind auch für andere skalierende E-Learning Systeme anwendbar. Hierfür wird zunächst beschrieben, wie in den untersuchten Systemen (die als verteilte Dienste in einer Microservice-Architektur implementiert sind) Learning Analytics Werkzeuge umgesetzt sind. Darauf aufbauend werden Konzept und Implementierung einer automatisierten Qualitätssicherung beschrieben. In einer ersten Evaluation wird die Nutzung der Funktion auf einer Instanz der am HPI entwickelten MOOC-Plattform untersucht. Anschließend wird ein Ausblick auf Erweiterungen und zukünftige Forschungsfragen gegeben.},
howpublished = {Proceedings of DeLFI and GMWWorkshops 2017, Chemnitz, Germany, September 5, 2017},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {proceedings}
}
SchließenDieser Beitrag beschreibt wie mithilfe von Learning Analytics Daten eine automatisierte Qualitätssicherung in MOOCs durchgeführt werden kann. Die Ergebnisse sind auch für andere skalierende E-Learning Systeme anwendbar. Hierfür wird zunächst beschrieben, wie in den untersuchten Systemen (die als verteilte Dienste in einer Microservice-Architektur implementiert sind) Learning Analytics Werkzeuge umgesetzt sind. Darauf aufbauend werden Konzept und Implementierung einer automatisierten Qualitätssicherung beschrieben. In einer ersten Evaluation wird die Nutzung der Funktion auf einer Instanz der am HPI entwickelten MOOC-Plattform untersucht. Anschließend wird ein Ausblick auf Erweiterungen und zukünftige Forschungsfragen gegeben.Schließenhttp://ceur-ws.org/Vol-2092/paper24.pdfhttps://www.researchgate.net/publication/325226167_Automatisierte_Qualitatssiche[...]https://www.researchgate.net/publication/321105881_Automatisierte_Qualitatssiche[...]Schließen
Da den Kursautoren oft die Zeit zur Qualitätssicherung von MOOCs fehlt und sie auch keine Manuals lesen, sollen Algorithmen diese nicht unbedingt kreative Arbeit verrichten. In OpenHPI wurden Regeln entwickelt und Grenzwerte zur Regeleinhaltung bestimmt, bspw. dafür, dass Videos zu lang oder Quizzes zu schwer sind. Wird der Grenzwert überschritten, wird eine Warnung ausgelöst. Das ist bei vielen Sachen cool und unstrittig, dennoch sollte man schauen, ob die berühmte „Ausnahme von der Regel“ nicht doch auch einmal sinnvoll sein kann.
Fundgrube+Alt+Entf
Projekte, Tools, Apps… das sind doch bürgerliche Kategorien. Wir packen einfach alles in die Fundgrube:
Mit Autodraw kann man drauf los malen und KI-gestützt wird erkannt, was man malen möchte – außer man versucht, einen Schlitten zu zeichnen.
Nele Hirsch hat nicht nur einen echt coolen Adventskalender gebaut, sondern ihn auch noch mit der Webseite open.education in eine permanente Sammlung von coolen Tools und Anwendungsszenarien verstetigt.
O ist mit Sans Forgetica auf eine Schriftart aufmerksam geworden, die (angeblich) wissenschaftlich bestätigt dazu beiträgt, dass man sich das Gelesene besser merken kann. Da es keine Publikationen dazu gab, hat O ein wenig tiefer gegraben: leider ist es vermutlich doch nicht so einfach. Dazu hat er noch ein paar Paper gelesen:
Yue, Carole L; Castel, Alan D; Bjork, Robert AWhen disfluency is—and is not—a desirable difficulty: The influence of typeface clarity on metacognitive judgments and memory Artikel In: Memory & Cognition, Bd. 41, Nr. 2, S. 229–241, 2013, ISSN: 1532-5946.Abstract | Links | BibTeX@article{Yue2013,
title = {When disfluency is—and is not—a desirable difficulty: The influence of typeface clarity on metacognitive judgments and memory},
author = {Carole L Yue and Alan D Castel and Robert A Bjork},
url = {https://doi.org/10.3758/s13421-012-0255-8},
doi = {10.3758/s13421-012-0255-8},
issn = {1532-5946},
year = {2013},
date = {2013-02-01},
urldate = {2018-12-21},
journal = {Memory & Cognition},
volume = {41},
number = {2},
pages = {229–241},
abstract = {There are many instances in which perceptual disfluency leads to improved memory performance, a phenomenon often referred to as the perceptual-interference effect (e.g., Diemand-Yauman, Oppenheimer, & Vaughn (Cognition 118:111–115, 2010); Nairne (Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 14:248–255, 1988)). In some situations, however, perceptual disfluency does not affect memory (Rhodes & Castel (Journal of Experimental Psychology: General 137:615–625, 2008)), or even impairs memory (Glass, (Psychology and Aging 22:233–238, 2007)). Because of the uncertain effects of perceptual disfluency, it is important to establish when disfluency is a ``desirable difficulty'' (Bjork, 1994) and when it is not, and the degree to which people's judgments of learning (JOLs) reflect the consequences of processing disfluent information. In five experiments, our participants saw multiple lists of blurred and clear words and gave JOLs after each word. The JOLs were consistently higher for the perceptually fluent items in within-subjects designs, which accurately predicted the pattern of recall performance when the presentation time was short (Exps. 1a and 2a). When the final test was recognition or when the presentation time was long, however, we found no difference in recall for clear and blurred words, although JOLs continued to be higher for clear words (Exps. 2b and 3). When fluency was manipulated between subjects, neither JOLs nor recall varied between formats (Exp. 1b). This study suggests a boundary condition for the desirable difficulty of perceptual disfluency and indicates that a visual distortion, such as blurring a word, may not always induce the deeper processing necessary to create a perceptual-interference effect.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenThere are many instances in which perceptual disfluency leads to improved memory performance, a phenomenon often referred to as the perceptual-interference effect (e.g., Diemand-Yauman, Oppenheimer, & Vaughn (Cognition 118:111–115, 2010); Nairne (Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 14:248–255, 1988)). In some situations, however, perceptual disfluency does not affect memory (Rhodes & Castel (Journal of Experimental Psychology: General 137:615–625, 2008)), or even impairs memory (Glass, (Psychology and Aging 22:233–238, 2007)). Because of the uncertain effects of perceptual disfluency, it is important to establish when disfluency is a ``desirable difficulty'' (Bjork, 1994) and when it is not, and the degree to which people's judgments of learning (JOLs) reflect the consequences of processing disfluent information. In five experiments, our participants saw multiple lists of blurred and clear words and gave JOLs after each word. The JOLs were consistently higher for the perceptually fluent items in within-subjects designs, which accurately predicted the pattern of recall performance when the presentation time was short (Exps. 1a and 2a). When the final test was recognition or when the presentation time was long, however, we found no difference in recall for clear and blurred words, although JOLs continued to be higher for clear words (Exps. 2b and 3). When fluency was manipulated between subjects, neither JOLs nor recall varied between formats (Exp. 1b). This study suggests a boundary condition for the desirable difficulty of perceptual disfluency and indicates that a visual distortion, such as blurring a word, may not always induce the deeper processing necessary to create a perceptual-interference effect.Schließenhttps://doi.org/10.3758/s13421-012-0255-8doi:10.3758/s13421-012-0255-8Schließen Oppenheimer, Daniel M.; Yauman, Connor Diemand; Vaughan, Erikka B.Fortune Favors the Bold (and the Italicized): Effects of Disfluency on Educational Outcomes Artikel In: Cognition, Bd. 32, S. 2739–2742, 2010, ISSN: 0010-0277.Abstract | Links | BibTeX@article{Oppenheimer,
title = {Fortune Favors the Bold (and the Italicized): Effects of Disfluency on Educational Outcomes},
author = {Daniel M. Oppenheimer and Connor Diemand Yauman and Erikka B. Vaughan},
doi = {10.1016/j.cognition.2010.09.012},
issn = {0010-0277},
year = {2010},
date = {2010-01-01},
journal = {Cognition},
volume = {32},
pages = {2739–2742},
abstract = {Previous research has shown that disfluency – the subjective experience of difficulty associated with cognitive operations – leads to deeper processing. Two studies explore the extent to which this deeper processing engendered by disfluency interventions can lead to improved memory performance. Study 1 found that information in hard-to-read fonts was better remembered than easier to read information in a controlled laboratory setting. Study 2 extended this finding to high school classrooms. The results suggest that superficial changes to learning materials could yield significant improvements in educational outcomes.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenPrevious research has shown that disfluency – the subjective experience of difficulty associated with cognitive operations – leads to deeper processing. Two studies explore the extent to which this deeper processing engendered by disfluency interventions can lead to improved memory performance. Study 1 found that information in hard-to-read fonts was better remembered than easier to read information in a controlled laboratory setting. Study 2 extended this finding to high school classrooms. The results suggest that superficial changes to learning materials could yield significant improvements in educational outcomes.Schließendoi:10.1016/j.cognition.2010.09.012Schließen
Politik+Alt+Entf
Open or not to be open: Die Schul-Cloud
Birgit Lachner hat in ihrem Artikel die Schul-Cloud mit Moodle verglichen. Daraufhin (und außerdem frisch angestachelt vom Jahrestreffen des Bündnis‘ Freie Bildung) hat A auf Instagram und O auf Twitter nachgehakt, ob die Plattform denn Open Source werden würde. Die Antwort des Social-Media-Teams auf Instagram zeigt, wie sehr es an informatischer Grundbildung (vermutlich nicht nur im Bildungsministerium) mangelt:
Screenshot von Instagram
Die Antwort war sogar überraschend positiv: Ja, die Schul-Cloud ist Open Source.
MILLA: Wenigstens spricht man drüber FTW
Die CDU/CSU-Fraktion hat sich das Thema „Weiterbildung“ geschnappt, es gibt bisher nur ein paar Slides dazu und ein paar Berichte. Michael Kerres hat für das Hochschulforum Digitalisierung (HfD) darüber geschrieben, das HfD teasert den Text mit „unterm Strich aber positiv“ – SRSLY? A hat mehr als die Zusammenfassung des Beitrags gelesen. Nachdem sich Christian und Markus vom Feierabendbier-Podcast schon mehrfach darüber ausgelassen haben, haben nun auch A und O die Plattform thematisiert. Noch lohnt sich ja auch das Mitreden – hoffentlich.
Veranstaltungstipps
27. Dezember bis 30. Dezember 2018 Chaos Communication Congress in Leipzig (#35c3, Videoserver für Aufzeichnungen unter https://media.ccc.de/).
19. Januar 2019 Sumobot Competition im FabLab Lübeck (#sumobot2019, mit Live-Stream)
07. Februar 2019 MInkorrekt Live in Hamburg (und weitere Termine in ganz Deutschland)

Nov 19, 2018 • 2h 12min
BldgAltEntf E010: Cookie-Monster Superstar
Die Folge haben wir am 18.11.2018 aufgenommen.
Intro & Feedback
Wir haben es getan: Zur Feier der 10. Folge haben wir gesungen! Hier noch ein paar Funfacts, die A beim Schreiben der ShowNotes ohnehin gelesen hat:
Obwohl die Serie erst in den 90ern im deutschen TV ausgestrahlt wurde, ist sie bereits 1968 bis 1970 in Japan produziert worden.
Es gab neben der Serie in den 70ern auch 4 Kinofilme und 2005 wurde auch eine Mini-Serie als Realverfilmung gedreht (falls das hier jemand von Netflix liest: bitte bitte!!!).
Die Synchronsprecherin von Mila ist u.a. auch die deutsche Stimme von Charlene Sinclaire aus der Serie „Die Dinos“, die Synchronsprecherin von Midori leiht regelmäßig Pamela Anderson ihre Stimme.
Wir danken auch wieder den Menschen, die unsere letzten Sendungen kommentiert haben. Dank Christian können wir hoffentlich auch bald Moore’s Law, Murphy’s Law und Godwin’s Law besser auseinanderhalten.
Im Stehen singt es sich besser und A muss sich doch noch einen Gelenkarmständer besorgen
News+Alt+Entf
News+O
O war leider nicht erfolgreich bei seiner Einreichung zum 35c3, was aber nicht bedeutet, dass diese schlecht gewesen ist. Er gehört damit zu 75% der 600 Einreichenden, die es leider nicht geschafft haben. Wer einen Vorgeschmack bekommen möchte, kann sich seinen Lightningtalk vom OERde17 anschauen.
Dafür gibt es seinen Beitrag „Mit Open-Source-Software die Lehre öffnen – ein Plädoyer“ vom JFMH17 nun in der Zeitschrift MedienPädagogik (natürlich Open Access).
O hat den Soziopod für sich gefunden und empfiehlt ihn weiter. Ebenso hat er für die Verbesserung der Barrierefreiheit von H5P noch einmal die Episode „Blindtwittern“ vom Kulturkapital gehört.
Schließlich gibt es tolle neue Funktionen bei H5P (LaTex, Metadaten, Copy and Paste) und er freut sich auf die H5P Con in Melbourne.
News+A
Auch das JFMH17-Paper von A ist in der MedienPädagogik erschienen: „Eine offene Bildungsressource (OER) ist konsequent eingesetzt eine Chance für den Hochschulzugang: Ein Praxisbericht“
Die Projekte bei oncampus laufen gut: Jointly wird fortgeführt und auch der Projektträger von pMOOCs 2 war beim Besuch offenbar sehr zufrieden mit dem Zwischenständen.
Wie im letzten Jahr war die MetaNOOK in Lübeck hervorragend. A war mit Lightningtalks zu OER und gemeinsam mit Kai zum BarCamp Lübeck dabei und fand u.a. den Vortrag von Dorina Gumm zum Thema Identitätsdiebstahl sehr spannend.
A war in Harburg und kann die Känguru-Chroniken auch als Aufführung empfehlen. Außerdem freut sie sich, dass sie Tickets für den 35c3 ergattern konnte – auch wenn O nun nicht dort sein wird.
BarCamps, BarCamps, BarCamps: Für die Vorstandsarbeit im EduCamp e.V. wird A zum ersten Mal in ihrem Leben einen Notar aufsuchen müssen. Daneben laufen die letzten Vorbereitungen für das BarCamp Lübeck.
Am letzten Wochenende war A noch für den jbjMOOC in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, hat mit Ilona Buchem und Dominic Orr das erste Treffen der HFD Community Working Group „Kompetenz-Badges“ durchgeführt und war beim Treffen vom Bündnis freie Bildung dabei. Daraus ergeben sich viele Aufgaben für die nächste Zeit.
Paper+Alt+Entf
Paper+O: Die Einfalt gibt es in großer Vielfalt
Seidel, NielsAufgabentypen für das Zusammenspiel von E-Assessment und Lernvideos Buchkapitel In: Bergert, Aline; Lehmann, Anje; Liebscher, Maja; Schulz, Jens (Hrsg.): Videocampus Sachsen – Machbarkeitsuntersuchung, S. 45–60, TU Bergakademie Freiberg, Freiberg, 1, 2018, ISBN: 978-3-86012-575-5.Abstract | Links | BibTeX@inbook{Seidel2018,
title = {Aufgabentypen für das Zusammenspiel von E-Assessment und Lernvideos},
author = {Niels Seidel},
editor = {Aline Bergert and Anje Lehmann and Maja Liebscher and Jens Schulz},
url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:105-qucosa2-312017},
isbn = {978-3-86012-575-5},
year = {2018},
date = {2018-08-10},
urldate = {2018-11-18},
booktitle = {Videocampus Sachsen – Machbarkeitsuntersuchung},
pages = {45–60},
publisher = {TU Bergakademie Freiberg},
address = {Freiberg},
edition = {1},
institution = {Medienzentrum der TU Bergakademie Freiberg},
series = {Freiberger Forschungshefte},
abstract = {Lernvideos werden oft als Instruktionsmedien verstanden, die Lerninhalte in audiovisueller Form konservieren und transportieren. Dieser Beitrag ergänzt diese Sichtweise um den Aspekt der Überprüfung des Lernerfolgs mit Hilfe von E-Assessments. Durch die Integration von speziellen Aufgabentypen in den Ablauf der Videowiedergabe können höhere Kompetenzlevel geprüft und weiterführende didaktische Intentionen, Lernszenarien und -formen umgesetzt werden. Im Rahmen der Verbundförderung des Videocampus Sachsen (VCS) konnten entsprechende Feldstudien ausgewertet und Pilotanwendungen im Rahmen des Innovationsvorhabens ViAssess entwickelt werden.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {inbook}
}
SchließenLernvideos werden oft als Instruktionsmedien verstanden, die Lerninhalte in audiovisueller Form konservieren und transportieren. Dieser Beitrag ergänzt diese Sichtweise um den Aspekt der Überprüfung des Lernerfolgs mit Hilfe von E-Assessments. Durch die Integration von speziellen Aufgabentypen in den Ablauf der Videowiedergabe können höhere Kompetenzlevel geprüft und weiterführende didaktische Intentionen, Lernszenarien und -formen umgesetzt werden. Im Rahmen der Verbundförderung des Videocampus Sachsen (VCS) konnten entsprechende Feldstudien ausgewertet und Pilotanwendungen im Rahmen des Innovationsvorhabens ViAssess entwickelt werden.Schließenhttp://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:105-qucosa2-312017Schließen
Service-Reading für David Lohner, der uns auf Twitter auf das Paper aufmerksam gemacht hatte
Im Paper wird eine Reihe an Aufgabentypen vorgestellt, mit denen Videos angereichert werden können. Zu jedem Aufgabentyp werden einige Einschätzungen angeführt, etwa die Eignung für ein Lernziel, der Aufwand für Erstellung oder Bewertung oder Möglichkeiten zur Kollaboration.
Link zum Paper, inkl. Anmerkungen auf Hypothesis
Link zu den Gestaltungsempfehlungen für Videolernumgebungen
Paper+A: Qualitätspakt Cookies
Hessler, Michael; Pöpping, Daniel M; Hollstein, Hanna; Ohlenburg, Hendrik; Arnemann, Philip H; Massoth, Christina; Seidel, Laura M; Zarbock, Alexander; Wenk, ManuelAvailability of cookies during an academic course session affects evaluation of teaching Artikel In: Medical Education, Bd. 52, Nr. 10, S. 1064–1072, 2018, ISSN: 1365-2923.Abstract | Links | BibTeX@article{Hessler2018,
title = {Availability of cookies during an academic course session affects evaluation of teaching},
author = {Michael Hessler and Daniel M Pöpping and Hanna Hollstein and Hendrik Ohlenburg and Philip H Arnemann and Christina Massoth and Laura M Seidel and Alexander Zarbock and Manuel Wenk},
url = {https://doi.org/10.1111/medu.13627},
doi = {10.1111/medu.13627},
issn = {1365-2923},
year = {2018},
date = {2018-06-29},
urldate = {2018-11-19},
journal = {Medical Education},
volume = {52},
number = {10},
pages = {1064–1072},
abstract = {Objectives Results from end-of-course student evaluations of teaching (SETs) are taken seriously by faculties and form part of a decision base for the recruitment of academic staff, the distribution of funds and changes to curricula. However, there is some doubt as to whether these evaluation instruments accurately measure the quality of course content, teaching and knowledge transfer. We investigated whether the provision of chocolate cookies as a content-unrelated intervention influences SET results. Methods We performed a randomised controlled trial in the setting of a curricular emergency medicine course. Participants were 118 third-year medical students. Participants were randomly allocated into 20 groups, 10 of which had free access to 500 g of chocolate cookies during an emergency medicine course session (cookie group) and 10 of which did not (control group). All groups were taught by the same teachers. Educational content and course material were the same for both groups. After the course, all students were asked to complete a 38-question evaluation form. Results A total of 112 students completed the evaluation form. The cookie group evaluated teachers significantly better than the control group (113.4 ± 4.9 versus 109.2 ± 7.3; p = 0.001, effect size 0.68). Course material was considered better (10.1 ± 2.3 versus 8.4 ± 2.8; p = 0.001, effect size 0.66) and summation scores evaluating the course overall were significantly higher (224.5 ± 12.5 versus 217.2 ± 16.1; p = 0.008, effect size 0.51) in the cookie group. Conclusions The provision of chocolate cookies had a significant effect on course evaluation. These findings question the validity of SETs and their use in making widespread decisions within a faculty.},
keywords = {},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}
SchließenObjectives Results from end-of-course student evaluations of teaching (SETs) are taken seriously by faculties and form part of a decision base for the recruitment of academic staff, the distribution of funds and changes to curricula. However, there is some doubt as to whether these evaluation instruments accurately measure the quality of course content, teaching and knowledge transfer. We investigated whether the provision of chocolate cookies as a content-unrelated intervention influences SET results. Methods We performed a randomised controlled trial in the setting of a curricular emergency medicine course. Participants were 118 third-year medical students. Participants were randomly allocated into 20 groups, 10 of which had free access to 500 g of chocolate cookies during an emergency medicine course session (cookie group) and 10 of which did not (control group). All groups were taught by the same teachers. Educational content and course material were the same for both groups. After the course, all students were asked to complete a 38-question evaluation form. Results A total of 112 students completed the evaluation form. The cookie group evaluated teachers significantly better than the control group (113.4 ± 4.9 versus 109.2 ± 7.3; p = 0.001, effect size 0.68). Course material was considered better (10.1 ± 2.3 versus 8.4 ± 2.8; p = 0.001, effect size 0.66) and summation scores evaluating the course overall were significantly higher (224.5 ± 12.5 versus 217.2 ± 16.1; p = 0.008, effect size 0.51) in the cookie group. Conclusions The provision of chocolate cookies had a significant effect on course evaluation. These findings question the validity of SETs and their use in making widespread decisions within a faculty.Schließenhttps://doi.org/10.1111/medu.13627doi:10.1111/medu.13627Schließen
Und nochmal wurde uns das Paper via Twitter zugespielt (das klappt echt gut, macht gern weiter so). Unser Dank geht raus dafür an Timo van Treeck!
In Lehrevaluationen sollen Studierende die Qualität der Lehre bewerten – so steht es im Gesetz (§6 HRG)! Das Paper zeigt: eine Lehrveranstaltung wird besser bewertet, wenn es Kekse gab. Yeah! Das ist transitiv → Kekse steigern die Qualität der Lehre \o/
Henning Wötzel-Herber a.k.a. @plastikstuhl: “Keine Bildung ohne Kuchen! Das kuchenpädagogische Manifest. Oder so.”
Fundgrube+Alt+Entf
Projekte, Tools, Apps… das sind doch bürgerliche Kategorien. Wir packen einfach alles in die Fundgrube:
Die tolle Nele hat auf dem MozFest u.a. die Hackastory Tools entdeckt. darunter werden auch die izi.Travel Audioguides geführt.
Wenn man OER für globales Lernen erstellt, dann kann man die zur GlOERchallenge einreichen und vielleicht einen Preis gewinnen. Deadline ist der 31.03.2019.
Nochwas Lustiges: @learninstyle
Politik+Alt+Entf
Die FDP hat die Bundesregierung in einer kleinen Anfrage (PDF) im Großen und Ganzen danach gefragt, ob OER im Digitalpakt Schule eine Rolle spielen werden. Leider ist das nicht vorgesehen (PDF). Das Bündnis Freie Bildung fand das auch nicht gut.
Auch 2015 gab es bereits eine kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu OER (PDF).
Veranstaltungstipps
22. November und 23. November Campus Innovation in Hamburg (#cihh18),
30. November und 01. Dezember BarCamp Lübeck in Lübeck (#bchl18),
3. bis 5. Dezember 2018 H5P-Konferenz in Melbourne (#h5pcon18) und
27. bis 30. Dezember Chaos Communication Congress in Leipzig (#35c3).


