
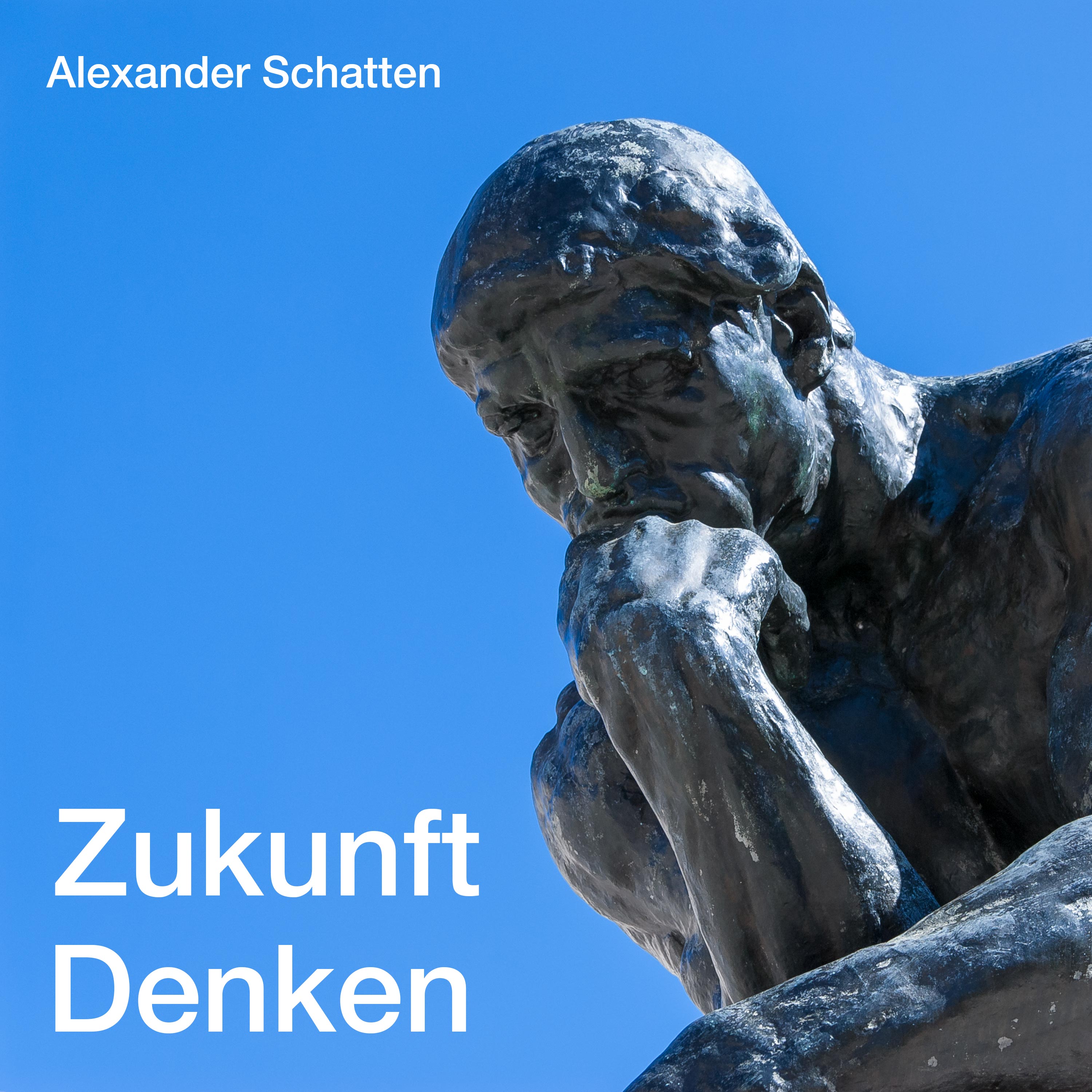
Zukunft Denken – Podcast
Alexander Schatten
Woher kommen wir, wo stehen wir und wie finden wir unsere Zukunft wieder?
Episodes
Mentioned books

Jan 23, 2022 • 22min
052 — Reflexionen
Ich habe mittlerweile über 50 Episoden erstellt, was durchaus ein Anlass zu einer ersten kritischen Reflexion sein darf. Vor Weihnachten habe ich zahlreiche Zuschriften bekommen, die mich alle sehr gefreut haben. Dabei war auch das eine oder andere, was mich nachdenklich gemacht hat, und das mich zusätzlich zu dieser Episode motiviert hat.
Vielen Dank jedenfalls an dieser Stelle an alle, die mir schreiben. Ich versuche allen zu antworten, und freue mich über weitere Kommentare, Anregungen, Kritik.
Ich habe durch das machen der Podcasts selbst viel dazugelernt. Gesehen, dass es sehr schwer ist, Dinge angemessen einzuordnen. In dieser Reflexion versuche ich nochmals übergreifende Themen aufzunehmen:
Realismus und Bescheidenheit,
die Rolle der Wissenschaft,
Wunschdenken,
Unsicherheit und Verantwortung,
aber vor allem auch die Frage, ob man überhaupt noch positiv, mit Hoffnung in die Zukunft blicken soll.
Referenzen
Episode 11: Ethik, oder: Warum wir Wissenschaft nicht den Wissenschaftern überlassen sollten!
Episode 17: Kooperation
Episode 25: Entscheiden unter Unsicherheit
Episode 27: Wicked Problems
Episode 28: Jochen Hörisch: Für eine (denk)anstössige Universität!
Episode 30: (Techno-)Optimismus – ein Gespräch mit Tim Pritlove
Episode 36: Energiewende und Kernkraft, ein Gespräch mit Anna Veronika Wendland
Episode 37: Probleme und Lösungen
Episode 39: Follow the Science?
Episode 41: Intellektuelle Bescheidenheit: Was wir von Bertrand Russel und der Eugenik lernen können
Episode 42: Gesellschaftliche Verwundbarkeit, ein Blick hinter die Kulissen: Gespräch mit Herbert Saurugg
Episode 44: Was ist Fortschritt? Ein Gespräch mit Philipp Blom
Episode 45: Mit »Reboot« oder Rebellion aus der Krise?
Episode 46: Activism, a Conversation with Zion Lights
Episode 47: Große Worte
Episode 50: Die Geburt der Gegenwart und die Entdeckung der Zukunft — ein Gespräch mit Prof. Achim Landwehr
Episode 51: Vorbereiten auf die Disruption? Ein Gespräch mit Herbert Saurugg und John Haas

Dec 30, 2021 • 58min
051 — Vorbereiten auf die Disruption? Ein Gespräch mit Herbert Saurugg und John Haas
In Episode 42 habe ich mit Herbert Saurugg über gesellschaftliche Verwundbarkeit, mit starkem Fokus auf Blackout und die Gründe dafür, sowie die Risiken, die zu wenig im Bewusstsein sind, gesprochen. Wenn wir die Reaktion auf die Covid-Pandemie in vielen Staaten beobachten, sowie den Umgang mit Energiesystemen — Stichwort »Energiewende« — wird vielen Menschen klar, dass eine Disruption, ein katastrophaler Einschnitt, ein Kollaps der gewohnten Prozesse der Moderne durchaus möglich, wenn nicht gar wahrscheinlich ist.
Ein Blackout des Energiesystems, wie mit Herbert in der vorigen Folge besprochen, ist aber nur eine der zahlreichen möglichen Auslöser von Disruptionen des gesellschaftlichen Lebens und dies mit unter Umständen globalen Dimensionen. Man könnte unter anderem an folgende Auslöser denken:
Covid-19 als Vorgeschmack anderer (gefährlicherer) Pandemien
Konflikte großer politischer Systeme (USA, Europa, China, Russland, …)
Finanz-Crash
Lieferketten-Risiken (etwa in Folge der Fragilität ausgelöst durch »Just in Time« Optimierung der 1990er)
Carrington Event (siehe Referenzen)
IT-Störungen / Hack-Angriffe, außer Kontrolle geratene Systeme usw. (siehe andere Episoden)
In dieser Episode spreche ich wieder mit Herbert Saurugg und als neuer Gast hinzu kommt John Haas:
John Haas ist Psychologe, FH-Lektor und Autor des Bestsellers Covid-19 und Psychologie - Mensch und Gesellschaft in Zeiten der Pandemie
Herbert Saurugg ist internationaler Blackout- und Krisenvorsorge-Experte und betreibt ein Fachblog zum Thema.
Wir beginnen die Episode mit der Frage, was wir unter Moderne und deren Disruptions-Risiken verstehen? Herbert betont, dass wir seit spätestens den 1950er Jahren in einer Netzwerkgesellschaft leben und diese Vernetzung und damit verbundene Komplexität ständig an Fahrt aufnimmt. Wie geht unser Bildungssystem mit diesen Änderungen um?
Wir erleben bei vielen globalen systemischen Problemen eine zeitverzögerte Wirkung wo kleine Ursache große Wirkung zeigen können. Bis heute scheint dies in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nicht hinreichend verstanden.
Wir versuchen vielmehr alte Strukturen aufrechtzuerhalten, die mit der Komplexität der modernen Welt nicht mehr zusammenpassen — kann das gut gehen? Auch wenn es keine fertigen Lösungen geben mag — in welchen Räumen könnte und sollte man nachdenken?
Aus psychologischer Sicht könnte man sehen, dass die Funktionserwartung der Welt den Diskurs über Disruption voraussetzt!
Was machen wir mit einem »Alten Hirn in einer neuen Welt?«, John
Denken wir immer noch in monokausalen Pfaden und Attributionen? Wie kann unsere »alte Hardware« mit der neuen Welt umgehen (lernen) und was ist in diesem Zusammenhang von dem »Hype-Wort« Resilienz zu verstehen oder zu halten?
Ein »Blackout«, wie in der letzten Folge besprochen, kann als eines, von vielen möglichen Szenarien gelten — in diese Folge stelle ich die Frage, ob wir uns an einer abstraktere Betrachtung und Krisenvorsorge versuchen sollten?
Die Idee, so John, von einem Weltenende begleitet uns seit Jahrtausenden. Was steckt dahinter? Vielleicht tiefenpsychologisch der Drang, die Welt als einfach zu verstehen, nach dem Motto: »Die Welt ist mir zu kompliziert, daher muss das alles mal den Bach runtergehen.« oder theologisch eine Endzeiterwartung?
Sehnen wir uns die Disruption also nur herbei, oder droht sie tatsächlich?
Was bedeutet »vorbereiten« aus psychologischer Sicht? Welche Rolle spielt die evolutionäre Entwicklung unseres Gehirns?
Konkreter gesprochen: was hat es mit dem Ziel als Individuum und Familie 14 Tage autark über die Runde kommen zu können auf sich?
Aber das kann nicht alles gewesen sein: den eigenen »kleinen Misthaufen« zu optimieren, scheint oftmals irrelevant. Wenn in einer vernetzten Welt die Krise über uns hereinbricht — kann man sich da hinreichend isolieren? Sieht jeder nur seine kleine Welt, nicht aber die Risiken der Abhängigkeiten von anderen?
Wie können wir als Gesellschaft und als Politik mit dem Vorsorgeparadoxon umgehen: gerade wenn man gut vorbereitet ist, passiert die Katastrophe nicht und man muss sich unter Umständen rechtfertigen, warum man Geld für eben diese Vorsorge ausgegeben hat. Rächt sich gar die enorm hohe Versorgungssicherheit der letzten Jahrzehnte im Westen heute in Form schlechter Risiko-Kompetenz?
Wie kann bessere Risikokompetenz — wie sie etwa Gert Gigerenzer fordert — erreicht werden?
Was also können wir auf individueller Ebene (als Vorsorge) tun? Welche Rolle spielen Strukturen verschiedener Skalierung (Gemeinde, Stadt, Staat, EU, ...) und was ist auf diesen anderen Ebenen systemisch zu erledigen, aber auch von staatlichen Organisationen wie dem Militär?
Nach Frederic Vester gilt: mit Vernetzung steigt Stabiliät — aber wie lange?
Und ebenso wichtig: welcher psychologischer Hilfsmittel kann ich mich bedienen? Oder birgt gerade die präventive Beschäftigung mit diesen Themen Risiken (für manche Gruppen von Menschen)? Welche Rolle spielt das Individuum als Medienproduzent, sprich: was ist die Rolle des Internets und der sozialen Medien in der Herstellung »richtiger« Strukturen oder der Verhinderung notwendiger lokaler Strukturen? Spielen diese weak ties hier eine wesentliche Rolle oder führen sie eher zu Störung und Ablenkung, gar zu existentieller Verunsicherung bei (manchen) Menschen?
Ein Schwarz/Weiß-Denken hilft letztlich nicht, sondern nur »sowohl als auch«: Der Weg aus der Disruption kann letztlich nur aus einem klugen Zusammenspiel zwischen Individuen, kleinen Gruppen und gesellschaftlichen Strukturen funktionieren, aber wie?
Welche Rolle spielen Effizienz und Optimierung?
Wenn es im Zuge dieser Notwendigkeiten zu einem Verlust der Bedeutung des Nationalstaats kommt, vielleicht sogar kommen muss, welche — auch negativen — Effekte sind zu erwarten?
Und um die politische Dimension weiterzudenken: gibt es eine »linke« und »rechte« oder »libertäre« Betrachtung der Krise? In welchem Wechselspiel sollten wir denken? Welche Rolle spielt Wettbewerb und Kollaboration?
Wo stehen wir global, wenn sich einflussreiche intellektuelle und ökonomische »Eliten« von der Welt mit Phantasien oder Plänen von Rückzug auf einsamen Inseln mit Privatarmeen, durch vermeintliche Kolonialisierung des Weltraums oder in die Singularität des Computers verabschieden?
Was ist psychologisch im Falle einer Disruption zu erwarten? Die extremen Ängste dieser ökonomischen Eliten mit Mord und Totschlag oder eher der Versuch kooperativ wieder einen Normalzustand herzustellen?
Was ist in diesem Fall die Inkompetenz-Illusion?
»Die Menschen können nach wie vor viel, nur unterschätzen sie sich in vielerlei Belangen«, John
Referenzen
John Haas
John Haas, "Covid-19 und Psychologie - Mensch und Gesellschaft in Zeiten der Pandemie"
Linkedin
Research Gate
Persönliche Webseite
Herbert Saurugg
Fachblog Vernetzung & Komplexität / Blackout
Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge
Initiative "Mach mit! Österreich wird krisenfit!"
Netzwerkgesellschaft
Email office@saurugg.net
Twitter
LinkedIn
Andere Episoden
Episode 42: Gesellschaftliche Verwundbarkeit, ein Blick hinter die Kulissen: Gespräch mit Herbert Saurugg
Episode 45: Mit Reboor oder Rebellion aus der Krise
Episode 17: Kooperation
Fachliche Referenzen
Carrington Event: Lloyds, Solar Storm Risk und NASA science: near miss of 2012
Frederic Vester, Unser Welt — ein vernetztes System, dtv (1983)
Rupert Riedl, Biologie der Erkenntnis, Parey (1980)
Gert Gigerenzer, Risiko: Wie man die richtigen Entscheidungen trifft, Bertelsmann (2013)
Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, langsames Denken, Penguin (2016)
Geoffrey West, Scale, W&N (2018)
Koyaanisqatsi Film — »Die Welt außerhalb der Balance«
Steward Brand, Pace Layering: How Complex Systems Learn and Keep Learning (2018)
Mark Elsberg, Gier, blanvalet (2020)
Der Seneca-Effekt - Bardi, Ugo
Der plötzliche Kollaps von allem, John Casti
Nassim Taleb, Antifragilität, Pantheon (2018)
Die Zerbrechlichkeit der Welt: Kollaps oder Wende. Wir haben es in der Hand, Stefan Thurner
Klaus Vondung, Apokalypse ohne Ende, Universitätsverlag Winter, Heidelberg (2018)

Dec 3, 2021 • 1h 10min
050 — Die Geburt der Gegenwart und die Entdeckung der Zukunft — ein Gespräch mit Prof. Achim Landwehr
Dies ist mittlerweile die 50. Episode von Zukunft Denken. Bei einem Podcast mit diesem Namen muss die Frage erlaubt sein, was wir als Gesellschaft überhaupt unter Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verstehen. Es bietet sich also diese Episode auch als Zwischenschritt der Selbst-Reflexion an.
Daher freue ich mich, dass ich Prof. Achim Landwehr für ein Gespräch gewinnen konnte. Achim Landwehr ist deutscher Historiker und Germanist, er war unter anderem an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, am Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte, und an der Uni Augsburg tätig. Er ist heute Dekan der philosophischen Fakultät der Heinrich Heine Universität Düsseldorf.
In dieser Episode setzen wir uns mit der Frage auseinander, wie sich das Verständnis der Zeit und der Gegenwart (in Europa) in der Neuzeit verändert hat.
Zuvor war es die Vergangenheit, die positiv besetzt war, oftmals eine Idealisierung der Antike. Die Zukunft galt eher negativ oder vorherbestimmt. Es herrschte ein Zeitverständnis vor, das auf Statik hinausläuft und Stabilität der Verhältnisse idealisiert, beziehungsweise eine Rückkehr zu den Ideen der Antike. Das Neue heißt Veränderung und ist eher nicht erwünscht, weil es eine Veränderung zum schlechteren ist.
»Die Aussichten auf das Leben waren für die Zeitgenossen des 16. und 17. Jahrhunderts nicht unbedingt erfreulich. Die Dinge, die da kommen würden, waren schon längst vorherbestimmt, man musste eigentlich nur noch auf ihr Eintreffen warten. Die Wegweiser zeigten eindeutig in Richtung Untergang, […]«
Mit der Neuzeit beginnt sich manches zu ändern.
»Seit der Antike gilt: es ist egal wann sie geboren sind oder sterben, es läuft immer dasselbe Stück – Dies stimmt seit 200 Jahren nun nicht mehr.«, Peter Sloterdijk
Aber was ist es, das sich ändert? Wo setzen wir Epochen? Denn Rückschau verzerrt die Dinge auch immer: je weiter weg, desto stabiler erscheinen sie uns und wir bekommen ein Perspektivenproblem. Und so deckt sich die Wahrnehmung der Zeit nicht immer mit der Wahrnehmung der Rückschau:
»1450-1500 wurden europaweit genauso viele Bücher produziert wie in den eintausend Jahren zuvor — es war eine mediale Explosion!!«
So ist auch die Rolle des 30 jährigen Krieges heute den meisten kaum gegenwärtig: die Zerstörung und Verunsicherung war enorm — es war wohl die größte menschengemachte Katastrophe bis zum 20. Jahrhundert
Und dennoch verschieben sich die Dinge: Das Zeitalter der Universalgelehrten geht langsam aber sicher zu Ende — sofern der Begriff des Universalgenies überhaupt von der Menge der Information abghängig ist? Aber auch das christliche apokalyptische Denken wird brüchig.
Gegenwart ist zunächst ein räumlicher Begriff, der dann abstrahiert auf das Verständnis der Zeit wird. Zeitbegriffe können also auch als Abstraktion verstanden werden.
Abstraktion, die wir in Wirkungen auf zahlreiche Bereiche beobachten können: von den Anfängen der Naturwissenschaft, über die Sprache und Politik bis zum Versicherungswesen verändert sich der Umgang mit der Welt und der Zeit. Die Rolle der Naturwissenschaften liegt dabei nicht nur im Veständnis der Welt sondern besonders auch im Verständnis der Veränderbarkeit und Gestaltbarkeit der Welt und führt langsam zur Ausformung der modernen wissenschaftlichen Disziplinen.
Auch die zunehmende Technik spielt natürlich eine Rolle, die etwa Uhrengebrauch hervorbringt und Prozesse erfordert, die diese technischen Systeme der industriellen Revolution am Laufen halten.
Nicht immer kommen die heute bekannten Umbrüche aber von sogenannten Progressiven, manchmal werden aus Traditionalisten (ungewollt) Revolutionäre, wir wir am Beispiel von Galileo, Kepler und Descartes diskutieren — sozusagen eine »Neuzeitlichkeit wider Willen«.
»Pflanzen binden Energie. Tiere binden Raum, sie können sich bewegen, jagen, Energie und Ressourcen eines wesentlich größeren Raumes einfangen. Menschen allerdings, sind in der Lage Zeit zu binden: wir können die Erfahrungen einer Generation erfassen und an die nächste weitergeben.«, Douglas Ruskoff
Wie gehen wir dann mit diesen neuen Möglichkeiten und auch gesellschaftlichen Ideen der Gegenwart und Zukunft um — im Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert? Um die Idee der Zeitbindung weiter zu spinnen: folgen aus den neuen Technischen Möglichkeitung und dem Binden der Zeit neue Verantwortungen?
Prof. Landwehr betont, dass selten eine einzelne Wahrnehmung von Zeit und Geschwindigkeit gilt, sondern dass eher eine Pluritemporalität vorherrscht. Auch in der heutigen Zeit. Dazu passt auch das Zitat von Herfried Münkler:
»Demokratie ist eine träge Maschinerie, konzipiert um Entscheidungen zu verlangsamen.«
Zuletzt bewegen wir uns in die heutige Zeit. Was bedeutet die zunehmende Ökonomisierung der Zeit, Zeit als Ressource und Zeit als Lebensqualität? Wie gehen wir wir mir diesen Pluritemporalitäten heute um? — von Nostalgie (die zu gewissen Zeiten auch als Krankheit galt) bis zu den zum Teil abstrusen Widersprüchen von Retropien bis zur techno-Phantasie der Singularität.
»Wir leben in einer besonderen historische Phase, in der die Freiheit selbst Zwänge hervorruft. Die Freiheit des Könnens erzeugt sogar mehr Zwänge als das disziplinarische Sollen, das Gebote und Verbote ausspricht. Das Soll hat eine Grenze. Das Kann hat dagegen keine.«, Byung-Chul Han
Am Ende gibt es noch eine — von historischer Perspektive getragene — optimistischen Blick in die Zukunft und den Umgang mit apokalyptischen Vorstellungen, die die Menschheit ebenfalls seit langer Zeit begleiten.
»Wenn Apokalypse nie ausstirbt, dann heißt das aber auch: Die Welt geht nie unter. Das ist dann vielleicht die positive Konsequenz, die man daraus ableiten könnte.«
Referenzen
Prof. Achim Landwehr
Achim Landwehr an der Heinrich Heine Universität Düsseldorf
andere Episoden
Episode 9: Abstraktion: Platos Idee, Kommunismus und die Zukunft
Episode 12: Wie wir die Zukunft entdeckt und wieder verloren haben
Episode 44, Was ist Fortschritt, im Gespräch mit Philip Blom
Episode 37 – Probleme und Lösungen (Über Generalisten)
fachliche Referenzen
Achim Landwehr, Geburt der Gegenwart: Eine Geschichte der Zeit im 17. Jahrhundert, Fischer (2014)
Achim Landwehr, Diesseits der Geschichte, Wallstein (2020)
Douglas Rushkoff, Present Shock, Current (2013)
Peter Sloterdijk: Sternstunden Philosophie
Philipp Blom: Was auf dem Spiel steht, Hanser (2017); (Zitat Herfried Münkler)
Alexander Luria
Byung-Chul Han, Psychopolitik, S. Fischer (2014)
Zygmunt Baumann, Retrotopia, Edition Suhrkamp (2017)

Nov 10, 2021 • 29min
049 — Wo denke ich? Reflexionen über den »undichten« Geist.
Über lange Zeit war die Ansicht geläufig, dass eines der wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen Tier und Mensch beim Werkzeuggebrauch liegt. Diese Idee, wie viele andere eindimensionale Unterscheidungen zwischen Tier und Mensch, scheinen aber wissenschaftlich nicht haltbar zu sein. Dennoch ist der Gebrauch und die Schaffung von Werkzeugen einer der konstituierenen Faktoren moderner Gesellschaften.
Manche Artefakte sind aber keine Werkzeuge im klassischen Verständnis, sondern scheinen vielmehr unser Denken zu erweitern. Damit stellt sich die etwa von Andy Clark und David Chalmers aufgeworfene Frage:
»Wo endet der Geist und wo beginnt der Rest der Welt?«
Andy Clark sieht dies in seinem Buch Being There etwas bildlich so:
»Der Geist ist ein undichtes Organ, er entflieht stetig seinen natürlichen Beschränkungen und mischt sich schamlos mit dem Körper und der Welt.«
Schon aus der Antike kennen wir die Ansicht, dass Körper und Geist in einer wesentlichen Wechselwirkung stehen, so schreibt Juvenal:
»Mens sana in corpore sano«, »Ein gesunder Geist steck in einem gesunden Körper.«
Aber in einem klassischen philosophischen Artikel aus dem Jahr 1998 konkretisieren Clark und Chalmers anhand einer Reihe von Beispielen die These, dass das Denken auch immer mehr unsere Umgebung einbezieht.
In dieser Folge versuche ich weniger die komplizierte philosophische Diskussion zu erfassen als mehr die Frage, welche Folgen diese Idee für unsere moderne Gesellschaft hat. Warum ist es wünschenswert, die natürlichen Beschränkungen unseres »biologischen Geistes« zu überwinden?
Wir werden in dieser Folge feststellen, dass wohl fast alle komplexen Prozesse unserer Gesellschaft ohne diesen »ausfließenden Geist« kaum vorstellbar wären.
Aber, wie so oft, gibt es auch Risiken oder Seiteneffekte, derer man sich bewusst sein sollte.
Was bedeutet dies etwa für das Selbstverständnis und die Fähigkeiten des Menschen, das Ich, das Selbst?
Wenn wir erweiterte Kognition erleben, wo sich die Denkprozesse mehrerer Menschen überschneiden, was hat dies für Folgen?
Was bedeutet dies für die Komplexität und Resilienz unserer Gesellschaft uns so manchen abenteuerlicher Ideen, wie der Kolonialisierung des Weltraums, um ein extremes Beispiel zu nennen?
Referenzen
Andere Episoden
Episode 9: Abstraktion: Platos Idee, Kommunismus und die Zukunft
Episide 10: Komplizierte Komplexität
Episode 17: Kooperation
Episode 32: Überleben in der Datenflut – oder: warum das Buch wichtiger ist als je zuvor
Fachliche Referenzen
Andy Clark, David Chalmers, The Extended Mind, Analysis 58.1. (1998)
Andy Clark, Being There, Bradford (1998)
Externalism about the mind, Stanford Encyclopedia of Philosophy
Henry David Thoreau, Journal 1851
Watson und Crick — (an)sichten Artikel: James Watson, Die Doppel-Helix, Die Struktur der DNS Teil 1 (Watson und Crick) und Teil 2 (Die Doppelhelix)
Mark Rowlands, Extended Mentality (YouTube)
Leonard E. Read, I, Pencil
Annie Murphy Paul, The Extended Mind
GitHub Copilote
Jonathan Haidt, How Social Media Is Changing Social Networks, Group Dynamics, Democracies & Gen Z
Nicholas Christakis, Connected, Harper Collins (2021)

Oct 17, 2021 • 1h 14min
048 — Evolution, ein Gespräch mit Erich Eder
In vergangenen Episoden habe ich mehrfach über evolutionäre Veränderungen gesprochen — es ist also höchste Zeit zum Thema »Evolution« eine eigene Episode zu machen.
Ich freue mich besonders dieses Thema mit Erich Eder diskutieren zu können. Erich ist Professor für Biologe an der medizinische Fakultät der Sigmund Freud Privatuniversität. Erich lehrt auch an der Univ. Wien, hat jahrelang an Urzeitkrebsen, sowie am Department für Evolutionsbiologie geforscht.
Zu dieser Aufnahme hat mich Erich auf seinen wunderbaren Bauernhof in die »Urwälder Wiens« eingeladen. Diese Atmosphäre hat auch auf die Aufnahme auf sehr schöne Weise abgefärbt: Wir haben Nachmittags bei Sonnenschein mit der Aufnahme begonnen , dann ist ein Unwetter durchgezogen, was auch zur Folge hatte, das ein Schaf gerne bei uns im Haus Unterschlupf bekommen hätte.
In dieser tollen Atmosphäre sprechen wir über die Geschichte der Evolution und damit die ersten wesentlichen Erkenntnisse die auf Charles Darwin und seine Zeitgenossen zurückgehen. Dies sind Erkenntnisse, die teilweise aber auf Ideen beruhen, die bis zur Antike zurückreichen.
»Es ist deshalb müssig, immer wieder auf die Nützlichkeit der einzelnen Tiere oder Pflanzen, sowie auf ihre erstaunliche Anpassung aneinander hinzuweisen. Ich möchte gerne wissen, wie ein Lebewesen existieren könnte, wenn seine Teile nicht in dieser Weise angepasst wären. Finden wir nicht, dass es sogleich eingeht, wenn diese Anpassung aufhört? [...] Und kann man nicht auf diese Weise den Anschein von Weisheit und Planung, wie ihn das Universum bietet erklären?«, David Hume
Charles Darwin war eine äußerst interessante Persönlichkeit, der in regem Austausch mit bedeutenden Zeitgenossen wie etwa Thomas Henry Huxley, Alfred Russel Wallace und Sir Charles Lyell stand. Erich erzählt von Darwins Reise mit der »Beagle« und dem Verhältnis zu Captain Fitzroy, das als Beispiel für die Reaktion vieler auf Darwins Erkenntnisse dienen kann. Im Jahr 1858 werden Darwins Forschungsergebnisse in der Royal Society präsentiert — und finden keine Beachtung. Das eher populärwissenschaftliche Buch »On the Origin of Species« (veröffentlicht 1859) wird hingegen ein durchschlagender Erfolg.
»Evolution always wins«
Wir sprechen weiters über Biologismus, Sozialdarwinismus des beginnenden 20. Jahrhunderts und Ideen der Eugenik, über die ich ansatzweise schon in den Episoden 44 mit Philipp Blom sowie 41 über Bertrand Russel diskutiert habe.
Dann erklärt Erich wesentliche neue Erkenntnisse des 20. und 21. Jahrhunderts, wie etwa Symbiose, die Rolle von Viren im Austausch von DNA und Epigenitik, Variation in der Mutationsrate, Gruppenselektion und die Systemtheorie nach Rupert Riedl und was ist vom »selbstsüchtigen Gen« zu halten?
Nicht nur die Erkenntnis wächst, auch unsere Fähigkeit das Genom von Organismen (und Viren) zu manipulieren. Was können wir von der Zukunft erwarten, mit der synthetischen Biologie, die bereits voll an Fahrt aufnimmt — wird jeder Schüler in der Garage seine eigenen Viren züchten können?
Zuletzt stelle ich die Frage, welche Rolle die Prinzipien der Evolution jenseits der Biologie, also etwa in unseren techno-sozialen Systemen, aber auch aus erkenntnistheoretischer Sicht spielen (könnten).
Referenzen
Andere Episoden
Episode 33: Naturschutz im Anthropozän, Ein Gespräch mit Prof. Frank Zachos
Episode 41 – Intellektuelle Bescheidenheit: Was wir von Bertrand Russel und der Eugenik lernen können
Episode 44 – Was ist Fortschritt? Ein Gespräch mit Philipp Blom
Erich Eder
https://www.sfu.ac.at/en/person/eder-erich/
Fachliche Referenzen
Gerhard Streminger, Hume, Rowolth bildmonographien (1984)
Charles Darwin, On the Origin of Species
Brian Arthur über Algorithmen und Wissenschaft
John Gray, Black Mass, Penguin (2008)
Richard Dawkins, The Selfish Gen: 40th Anniversary Edition, Oxford Landmark Science (2016)

Sep 22, 2021 • 21min
047 — Große Worte
»Der Starke ist am mächtigsten allein.«, Friedrich Schiller, Wilhelm Tell, beziehungsweise Dagobert Duck in der Übersetzung von Dr. Erika Fuchs
Die Idee zu dieser Episode reift schon seit längerer Zeit, aber gerade meine Beobachtung vom Verhalten und Auftreten Intellektueller und Wissenschafter in sozialen (aber auch traditionellen) Medien hat jetzt den Ausschlag gegeben. Einerseits erlauben uns soziale Medien die Vernetzung untereinander und fallweise auch Verteilung und Diskussion interessanter neuer Ideen, gleichzeitig aber fühlen sich Netzwerke wie Twitter immer mehr wie ein Virus an, der viele von uns und damit die Diskussionskultur vergiftet.
Selbst führende Intellektuellen, schaffen es oftmals nicht einen kühlen, ruhigen and distanzierten Kopf zu bewahren und werden auf dieser Plattform zu schlechteren Menschen und schlechteren Wissenschaftern / Experten. Dümmer, weniger interessant, polarisierend. Oder wie es der Internet-Pionier Jaron Lanier eine Spur provokanter ausdrückt:
»Soziale Medien machen dich (wahrscheinlich) zum Arschloch« und »Die heutigen sozialen Medien ziehen Großmäuler und Arschlöcher an.«
Was mich besonders beunruhigt: In der aktuellen Krise zeigt sich, dass auch Intellektuelle, die bisher eher zu nüchternder und kluger Analyse geneigt haben, zunehmend neben der Spur stehen.
In Episode 32 habe ich mich mit einem anderen, aber überschneidenden Aspekt dieses Themas beschäftigt: Was ist Information, was sind Daten, in welcher Form werden wir am besten informiert? In Episode 41 diskutiere ich ebenfalls intellektuelle Bescheidenheit, beziehungsweise meine Forderung danach, aber auch in dieser vergangenen Episode ist der Bezug ein anderer, nämlich die Frage, wie wir mit vergangenen Irrtümern und intellektuellen Irrläufern umgehen sollten.
In dieser Episode steht eher die umgekehrte Richtung im Vordergrund: also nicht nur wie konsumieren wir Information und nicht nur Rauschen, sondern vor allem auch, wie interagieren wir mit anderen und wie tragen wir aktuell zu Diskursen bei. Welche Rolle spielen soziale Medien dabei heute, und welche sollten sie für uns in der Zukunft spielen.
Auch in dieser Folge nehme ich zunächst auf Ansichten des Philosophen Karl Popper aus den 1980er Jahren Bezug:
»Wir dürfen nie vorgeben zu wissen, und dürfen nie große Worte gebrauchen«
»Wenn ein Mensch verantwortlich sprechen will, muß er so reden, daß man ihm nachweisen kann, daß er etwas Falsches gesagt hat. Dann wird er auch etwas bescheidener sein.«
Ein Aufruf, der heute aktueller ist als je zuvor. Wir sind umgeben von Besserwissern, Leuten, die die eigenen Fähigkeiten dramatisch überschätzen oder ihrer Umgebung mehr Sicherheit vorspielen als gegeben ist. Große Worte und Arroganz schaden der wichtigen Auseinandersetzung bei unterschiedlichen Ansichten.
Nicht nur soziale Netzwerke selbst sind vergiftet, sondern zunehmend auch der wissenschaftliche und politisch/gesellschaftliche Diskurs — quasi als Kollateralschaden der Reproduktionsform, um mit Günther Anders zu sprechen:
“Wenn das Ereignis in seiner Reproduktionsform sozial wichtiger wird als in seiner Originalform, dann muß das Original sich nach seiner Reproduktion richten, das Ereignis also zur bloßen Matrize ihrer Reproduktion werden.”
“Wenn das Ferne zu nahe tritt, entfernt oder verwischt sich das Nahe.”
Sowohl in den Naturwissenschaften aber besonders auch den Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften finden wir immer mehr Blender und Schwätzer.
»Jeder Intellektuelle hat eine ganz spezielle Verantwortung. Er hat das Privileg und die Gelegenheit, zu studieren. Dafür schuldet er es seinen Mitmenschen (oder der Gesellschaft), die Erkenntnisse seines Studiums in der einfachsten und klarsten und bescheidensten Form darzustellen. Das Schlimmste ist, wenn die Intellektuellen es versuchen, sich ihren Mitmenschen gegenüber als große Propheten aufzuspielen und sie mit orakelnden Philosophien zu beeindrucken. Wer’s nicht einfach und klar sagen kann, der soll schweigen und weiterarbeiten, bis er’s klar sagen kann.«, Karl Popper
Dieses Wettrüsten der Worte um immer großspurigere und gleichzeitig inhaltsleere Darstellungen zu befeuern mag dem eigenen Image dienen (in Form von moral grandstanding und virtue signaling) schadet aber Wissenschaft, Gesellschaft und Politik.
Wie können wir es wieder ruhiger und bescheidener angehen und die (a)sozialen Netzwerke weitgehend hinter uns lassen? Was hat es mit Rudeln und Einzelgängern auf sich und wie helfen uns diese Überlegungen bessere Gespräche zu führen und damit zu besseren Entscheidungen zu kommen.
Referenzen
Andere Episoden
Episode 41: Intellektuelle Bescheidenheit: Was wir von Bertrand Russel und der Eugenik lernen können
Episode 32: Überleben in der Datenflut – oder: warum das Buch wichtiger ist als je zuvor
Episode 16: Innovation und Fortschritt oder Stagnation?
Fachliche Referenzen
Jaron Lanier, Zehn Gründe, warum du deine Social Media Accounts sofort löschen musst
Karl Popper, Ich weiß, dass ich nichts weiß – und kaum das
Karl Popper, Auf der Suche nach einer besseren Welt (1987)
Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, Band 1, Band 2
Brett Weinstein, Dark Horse Podcast mit Daniel Schmachtenberger, 11. Feb. 2021
Friedrich Schiller, Wilhelm Tell
Philipp Blom, Was auf dem Spiel steht, Carl Hanser (2017)
Justin Tosi, Grandstanding: The Use and Abuse of Moral Talk, Oxford Univ. Press (2020)

Aug 30, 2021 • 1h 3min
046 – Activism, a Conversation with Zion Lights
This is an exceptional episode — not only because of my guest, but also because of the fact that this episode is in English in a generally German speaking podcast. I might make the odd exception also in the future. Check the Tags to select English episodes.
Das ist heute ausnahmsweise eine englischsprachige Episode, es würde mich freuen, wenn Sie dabei bleiben, andernfalls geht es in Zukunft wieder deutschsprachig weiter.
In todays episode I am exctited to welcome Zion Lights. Zion Lights is a science communicator who is known for her environmental advocacy work. She is Founder of Emergency Reactor and author of The Ultimate Guide to Green Parenting, the first evidence-based book of its kind. Zion is an astronomer and she has given a TED talk on stargazing and she is the former Editor of The Hourglass, Extinction Rebellion's print newspaper, and a former spokesperson for the group.
The overarching topic of this episode is activism. I talked about activism, let's say in the footnotes of other episodes (see references). Activism clearly plays an important role in our world to change things — hopefully for the better, and exactly »hopefully« is the term I am discussing with Zion.
»Soundbites are appealing to people«
What is the role of activism in our world? How can activism go wrong — activism is (also historically) very strong on the side of reason but increasingly also on the side of nonsense. We see that small numbers of people can change the world — for the good or for the worse, how can we ensure it is for the better?
»Every great cause begins as a movement, becomes a business and eventually degenerates into a racket.«, Eric Hoffer
What role does science play and maybe more importantly: what is the interaction between good science and good activism? We then talk about naturalistic fallacies and the precautionary principle. Finally we touch on the difficult but important subject of risk communication.
»We have to learn to be more rational creatures, really«
What additionally fascinates me about Zion Lights: she openly changed her mind on an important and divisive topic (nuclear energy) as a person with significant exposure. She didn't fall into the »ideology trap«, but constantly revisited her opinions, continued to learn and listened to science — even though it would have been much easier to stick to the more popular opinions in her circle, like most of her peers did.
Other Episodes
Episode 45: Mit »Reboot« oder Rebellion aus der Krise?
Episode 39: Follow the Science
Episode 37: Probleme und Lösungen
References
Zion Lights:
Twitter @ziontree
www.zionlights.co.uk
The Ultimate Guide to Green Parenting
Sign up to the mailing list at www.emergencyreactor.org
TEDx Talk: Don't forget to look up
Andrew Neill Show
Zwentendorf nuclear powerplant
Andrew Wakefield, The discredited doctor hailed by the anti-vaccine movement, Nature (2020)
David MacKay, Without the hot air (2015)

Aug 4, 2021 • 21min
045 – Mit »Reboot« oder Rebellion aus der Krise?
Gerade in Zeiten der Krise liest und hört man immer wieder Geschichten, Phantasien, manchmal auch Schreckens- oder gar Wunschvorstellungen, unsere (globale) Gesellschaft könnte kollabieren und dann einen sogenannten Reboot durchleben. Wie ein Phoenix aus der Asche könnte eine neue, bessere Gesellschaft aus den Ruinen der alten aufstehen.
So wird auch von manchen extremeren Gruppen die Idee in den Raum gestellt, eine solche Disruption bewusst herbeizuführen.
»Traditionelle Strategien wir Petitionen, Lobbying, Wahlen und Proteste haben aufgrund der tief verankerten Interessen von politischen und ökonomischen Kräften nicht funktioniert. Unser Vorgehen ist daher gewaltfreier, disruptiver ziviler Ungehorsam — eine Rebellion um Änderungen herbeizuführen, zumal alle anderen Mittel versagt haben«, Extinction Rebellion global, Website (Hervorhebungen von mir)
Es gibt noch radikalere Vorstellungen und Phantasien in politisch radikalen Strömungen, von Anarchisten bis zu rechts-radikalen und in radikal religiösen Bewegungen wie dem Islamismus oder evangelikalen Bewegungen, etwa in den USA, die ebenfalls glauben über radikale Änderungen eine bessere Welt herbeiführen zu können oder gar über einen Kollaps und Neuaufbau.
Der britische Philosoph John Gray fasst dies so zusammen:
»Der millenaristische Geist glaubt, die menschliche Welt kann komplett und schlagartig transformiert werden […] Zur Zeit des Mittelalters wurde dies durch Gott oder Gottes Vertreter auf Erden erreicht. In modernen Zeiten, gilt als Autor dieser neuen Welt die Humanität oder selbsternannte revolutionäre Avantgarde.«
Nutzen wir doch die Krise, räumen wir das alte Zeug weg, und bauen wir von vorne neu auf! Wir beginnen also von vorne, aber wissen es diesmal besser, machen alles besser und alles wird gut?
In dieser Episode diskutiere ich einerseits die Idee schneller, radikaler Reformen und die Frage, ob es möglich ist, eine moderne Gesellschaft aus den Ruinen der heutigen wieder aufzubauen.
Die kurze Antwort ist: nein. Wir haben die Leitern, auf denen wir auf die heutige gesellschaftliche Komplexität hochgeklettert sind, weggeworfen. Nicht nur würde ein Kollaps unfassbares Leid anrichten, wir wären wohl auch nicht mehr in der Lage eine moderne Gesellschaft wiederherzustellen.
Auch die Phantasien schneller, radikaler Reformen sind aus mehreren Gründen nicht nur unrealistisch sondern wahrscheinlich brandgefährlich. Etwas zerstören ist einfach, etwas funktionierendes Aufbauen ungeheuer schwierig und, wenn es große Teile der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik betrifft, auch nicht planbar.
»Eine Revolution lässt sich nicht als Fortschritt beschreiben«, Christoph Möllers
Die Kunst der Transformation unserer Gesellschaft hin zu einem nachhaltigen Lebensstil ist daher wohl ein ungeheuer komplexer Balanceakt, wo substantielle Veränderung geschehen sollte, dies hochgradig rational und nicht von Ideologien getrieben, aber bei gleichzeitiger Erhaltung bestehender Systeme und Strukturen, bis diese tatsächlich durch funktionierende neue ersetzt wurden.
Referenzen
Andere Episoden
Episode 44: Was ist Fortschritt, Gespräch mit Philipp Blom
Episode 41: Intellektuelle Bescheidenheit
Episode 37: Probleme und Lösungen
Episode 27: Wicked Problems
Episode 17: Kooperation
Fachliche Referenzen
John Gray, Black Mass
John Gray, BBC A Point of View, The recurrent dream of an end-time (2019)
Andy Clark, Being There
Extinction Rebellion Website
Christoph Möllers, Freiheitsgrade, Suhrkamp (2020)

Jul 14, 2021 • 1h 15min
044 – Was ist Fortschritt? Ein Gespräch mit Philipp Blom
Auf diese Episode habe ich mich lange gefreut: Ich spreche mit dem Historiker, Philosophen, Autor und Generalisten Philipp Blom über Fortschritt und die Reflexion des Fortschrittsbegriffes in der Geschichte.
Ich beginne das Gespräch mit einer persönlichen Frage zur Bedeutung von Geschichte für das Verständnis aktueller Probleme und der Suche nach einer lebenswerten Zukunft. Sehen wir aktuell das »Auftauchen alter Probleme in neuem Gewand?« oder ist Gegenwart und Zukunft doch etwas völlig anderes?
Wie so oft dürfte die Wahrheit in der Mitte liegen: zahlreiche Muster scheinen sich zu wiederholen und moderne Konflikte sind häufig ohne die geschichtliche Perspektive nicht zu begreifen und dann gibt es doch Brüche:
»Die Möglichkeit unserer Auslöschung ist etwas Neues – die realistische Möglichkeit, dass sich der Mensch selbst abschafft ist etwas Neues.«
Dies wurde uns als Menschheit das erste Mal mit der Erfindung der Atombombe bewusst, wiederholt sich aber in den letzten Jahrzehnten mit den Folgen neuer Technologien, etwa bei Klimawandel oder synthetischer Biologie. Waren die Menschen früher ebenso töricht wie heute, hatten aber nicht die notwendigen technischen Möglichkeiten um die ganze Welt und sich selbst mit der Welt zu zerstören?
Philipp Blom gehört aus meiner Sicht zu den wichtigen Generalisten der Zeit, weil er sich nicht auf eine enge Betrachtung von Geschichte beschränkt, sondern das intellektuelle Risiko eingeht sie im Wechselspiel mit Technik, Gesellschaft und Natur zu beschreiben. Besonders auch der Aspekt der Natur wird im Gespräch immer wieder vorkommen:
»Im Westen haben wir Geschichte ohne die Natur geschrieben.«
Wir diskutieren über die nur langsam reifende Erkenntnis systemischen Denkens, eine Erkenntnis, die so langsam reift, dass die Auto-Korrektur meines aktuellen Computers den Begriff »systemisch« ständig in »systematisch« korrigieren will. Dieses Verständnis, dass »alles mit allem« in komplexer Weise verbunden ist, geht im europäischen Denken sehr stark auf Alexander von Humboldt, einem Universalgelehrten des frühen 19. Jahrhunderts, zurück.
Dem gegenüber steht ein für die christlichen Tradition wirkmächtiger Satz in der Bibel: »Macht euch die Erde untertan«. Ist dies ein Rückschritt im Vergleich zur mythologischen Welt der Griechen? Die Vielzahl an Göttern konnte man als Metaphern für verschiedene Aspekte der Natur begreifen — man steht in Wechselwirkung mit der Natur und ist abhängig von ihr?
Diese Abwendung von der Interaktion mit der Natur als Ergebnis technischer Naturbeherrschung – Erhöhung über die Natur, wie in der Bibel dargestellt — kommt in der Neuzeit zu einem Höhepunkt und es dauert auch nach Humboldt noch lange, bis sich dieses Verständnis langsam zu ändern beginnt.
Ist Fortschritt somit historisch ein Fortschritt Mancher zu Lasten Anderer? Ist Fortschritt notwendig mit der Unterwerfung der Natur verbunden? Beginnt sich diese Logik heute umzukehren?
Der Begriff des »Fortschritts« findet zum ersten Mal in der Neuzeit breite Verwendung — eine Zeit, in der unter anderem die jungen Naturwissenschaften und die darauf bauende Industrialisierung zeigen: man kann eine neue Welt gestalten, eine Zukunft schaffen.
»Dass man tatsächlich eine neue Welt konstruieren kann, und nicht nur auf sie warten muss bis der Herr beschließt, jetzt ist der richtige Moment.«
Der Stein scheint ins Rollen gebracht. Die industrielle Revolution treibt die Idee des Fortschrittes voran. Das spiegelt sich dann auch tatsächlich in der Realität der Menschen wieder: Leben in Städten mit steigender Wohlstand, mehr Dynamik, Erfindungen, Neuigkeiten, aber auch ausufernder Glaube an positive Veränderungen
»Wir werden Armut und Kriege ausrotten.«
Spätestens mit dem 20. Jahrhundert beginnt dieser Glaube aber auch Risse zu bekommen. Am Beispiel des Begriffes der Neurastenie sprechen wir über Verwerfungen in der Gesellschaft — die Geschwindigkeit wirft uns um, und führt zu einem »Zauberlehrlings-Moment«:
»Und sie laufen! Naß und nässer
wirds im Saal und auf den Stufen.
Welch entsetzliches Gewässer!
Herr und Meister! hör mich rufen! –
Ach, da kommt der Meister!
Herr, die Not ist groß!
Die ich rief, die Geister
werd ich nun nicht los.«
Mit dem Unterschied, dass uns kein »Meister« zu Hilfe eilen wird um den Schlamassel, den wir angerichtet haben, aufzuräumen.
Wir sprechen auch über Szientismus, in dessen Folge etwa Eugenik zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einer weit akzeptierten und progressiven Agenda wird. Spätestens mit dem Erste Weltkrieg zeigt der Fortschritt seine schreckliche Seite. Wir leben in der Ambivalenz der Maschine, die dem Menschen helfen, ihn aber auch immer leichter töten kann:
»Der Fortschrittsgedanke kippt mit dem ersten Weltkrieg. […] Die Soldaten merken, dass sie den Wettlauf gegen die Maschine verloren haben.«
Wir verwenden heute den Begriff der Eugenik nicht mehr gerne, aber es ist wohl nur eine Frage der Zeit bis genetische modifizierte Menschen auf die Welt kommen. Stecken wir immer häufiger in ethischen Dilemmata und Zugzwängen fest?
Wir haben seit der Neuzeit auch immer weniger gesicherte Identitäten — mit allen Vor- und Nachteilen: einerseits erleben wir reale individuelle Freiheit, andererseits wird diese Freiheit auch zur Zumutung.
Wir sprechen weiter über die Ästhetik des Fortschrittes — wie reflektiert Kunst und Propaganda den Fortschrittsgedanken — und damit verbunden die Frage, ob Technik ein Mittel der Demokratisierung oder der sozialen Trennung ist.
»Wir leben in einer besonderen historische Phase, in der die Freiheit selbst Zwänge hervorruft. Die Freiheit des Könnens erzeugt sogar mehr Zwänge als das disziplinarische Sollen, das Gebote und Verbote ausspricht. Das Soll hat eine Grenze. Das Kann hat dagegen keine.«, Byung-Chul Han
Woher kommt mit zunehmender Technisierung und individueller Freiheit nach der Aufklärung die Struktur, die wir als Menschen brauchen? Wie lässt sich das Dilemma an der aktuellen Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen diskutieren?
Letztlich stellt sich die Frage: wie frei sind wir wirklich? Lässt sich Erkenntnis aufhalten, oder sind wir letztlich vom Technium getrieben?
»It is almost as if life has an imperative. It wants to materialize certain patterns.«, und »We are at a second tipping point where the technium's ability to alter us exceeds our ability to alter the technium.« Kevin Kelly
Was können wir somit überhaupt noch über die Zukunft entscheiden? Über den Fluß der Technik? Haben wir die Hoffnung für eine bessere und lebenswerte Zukunft verloren und denken nur noch in Retropien?
Andererseits: kein Mensch der Macht hatte, kannte zu seiner Zeit den Namen von Baruch Spinoza, und dennoch hat er sich als äußerst wirkmächtig herausgestellt. Die Rolle von sozialen Bewegungen in der Entscheidung, wohin unsere Welt sich bewegt ist kaum vorherzusagen.
Manchmal scheint magisches, kontrafaktische Denken auch das einzige zu sein, das uns als Menschheit wachsen lässt.
»Wir wissen noch nicht vor was wir gelebt haben werden.«
Referenzen
Philipp Blom
Webseite von Philipp Blom
Philipp Blom, Die Welt aus den Angeln (2017)
Philipp Blom, Was auf dem Spiel steht, Hanser (2017)
Philipp Blom, Der taumelnde Kontinent, 1900-1914 (2011)
Philipp Blom, Die zerrissenen Jahre, 1918-1938, dtv (2016)
Philipp Blom, Der taumelnde Kontinent: Europa 1900–1914 (2011)
Philipp Blom, Böse Philosophen (2013)
Andere Episoden
Episode 4 und Episode 5: Was will Technologie?
Episode 12: Wie wir die Zukunft entdeckt und wieder verloren haben
Episode 15: Innovation oder Fortschritt?
Episode 16: Innovation und Fortschritt oder Stagnation?
Episode 21: Der Begriff der Natur — oder: Leben im Anthropozän
Episode 29: Fakten oder Geschichten? Wie gestalten wir die Zukunft?
Episode 37: Probleme und Lösungen
Episode 41: Intellektuelle Bescheidenheit: Was wir von Bertrand Russel und der Eugenik lernen können
Fachliche Referenzen
Andrea Wulf, Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur, C. Bertelsmann (2016)
Byung Chul Han, Psychopolitik, S. Fischer (2014)
Kevin Kelly, What Technology Wants, Penguin (2011)
Kevin Kelly, Inevitable, Penguin (2016)
Zygmunt Bauman, Retrotopia, Suhrkamp (2017)
Achim Landwehr, Geburt der Gegenwart: Eine Geschichte der Zeit im 17. Jahrhundert, S. Fischer (2014)
Johann Wolfgang von Goethe, Der Zauberlehrling
Walt Disneys Interpretation des Zauberlehrlings aus Fantasia

Jun 21, 2021 • 27min
043 – Deep Fakes: Wer bist du, und – was passiert da eigentlich?
Wollte man den Titel dieser Episode etwas gelehrter ausdrücken könnte man vielleicht sagen: Das Fenster der vermittelten Authentizität, das das 20. Jahrhundert geprägt hat, schließt sich gerade. Und es schließt sich in bemerkenswertem Tempo.
Bitte die Referenzen unten ansehen: dort finden sich alle in der Episode genannten Bilder.
Vor Ende des 19. Jahrhunderts gab es keine Mittel technischer Reproduktion der »Wirklichkeit«, also weder Photographie, noch Film noch Tonaufnahmen. Diese analogen Reproduktionstechniken haben einen interessanten »Sweetspot«: sie sind schnell, billig und effektiv genug um die Welt mit Abbildungen von Ereignissen über weite Strecken zu versorgen, aber unflexibel genug, dass Manipulation und Fälschung verhältnismässig aufwändig sind. So haben wir im 20. Jahrhundert natürlich Fälschungen gesehen, aber diese waren im Vergleich zu den authentischen Medien vergleichsweise selten.
Robert Capa, Death of a loylist soldier (Spanischer Bürgerkrieg)
Im Augenblick entstehen technische aber extrem einfach zugängliche technische Mittel (Software, Smartphones), die glaubwürdige Manipulationen oder Fabrikationen beliebiger Medien für Jedermann ermöglichen – auch Deep Fakes genannt.
In dieser Episode bespreche ich den geschichtlichen Hintergrund der technischen Innovationen, wie wesentliche Information vor dem 20. Jahrhundert vermittelt wurde – auch am Beispiel der Schlachtenmalerei – und wo wir uns heute hinbewegen. Ich zeige, wie analoge Medien gefälscht wurden, warum dies aber nur ein vergleichsweise kleines Problem war.
Dann diskutiere ich, was Deep Fakes eigentlich manipulieren und was Authentizität in der vermittelten Abbildung der Welt für uns bedeutet? Wie werden wir (bald) damit umgehen, wenn jeder 14 Jährige auf der ganzen Welt:
eine Podcast-Episode erstellen kann, in der vermeintlich Joe Rogan mit Donald Trump oder Barack Obama spricht;
ein YouTube Video, wo ein bekannter Journalist die Bundeskanzlerin interviewt;
einen Film, in dem Tom Cruise mit Marilyn Monroe gemeinsam auf dem Motorrad fährt;
oder ein unappetitliches Video anfertigt und online stellt oder über Plattformen teilt, dass eine Klassenkameradin in einer pornographischen Situation zeigt?
All diese Medien werden kaum oder gar nicht von echten Aufnahmen unterscheidbar sein und all diese Medien werden, wie gesagt, mit äußerst geringen Sachkenntnissen und ubiquitär verfügbaren Computern hergestellt werden können.
Können wir diese Entwicklung noch verhindern? Die Effekte eingrenzen? Können wir das Vertrauen in vermittelte Realität wieder zurückgewinnen, sollte es einmal durch einen Tsunami an solchen Deep Fakes zerstört worden sein?
Referenzen
Andere Episoden
Episode 4 und Episode 5: Was will Technologie?
Episode 30: (Techno-)Optimismus – ein Gespräch mit Tim Pritlove
Episode 40: Software Nachhaltigkeit, ein Gespräch mit Philipp Reisinger
Episode 15: Innovation oder Fortschritt?
Fachliche Referenzen
(an)sichten Blog: The Closing Window auf Mediated Authenticity
Stalin und Photo-Manipulationen
Die sowjetische Flagge am Berliner Reichstag 1945
Robert Capa, der fallende Soldat: Philipp Blom, Der taumelnde Kontinent, dtv (2011)
Bobby Chesney, Danielle Citron, Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security (2019)
Pedro J. Colombo, Der Photograph von Mauthausen, Tahoe books (2021)
Zu Deep Fakes: keine konkrete Referenz, weil sich hier alles so schnell bewegt. Eine Internet Suche zum Stichwort »Deep Fake« bringt zahlreiche Beispiele (Obama, Trump, Fake Porn, Joe Rogan)
The Guardian, European MPs targeted by Deep Fake Video Calls Imitating Russian Opposition (2021)


