
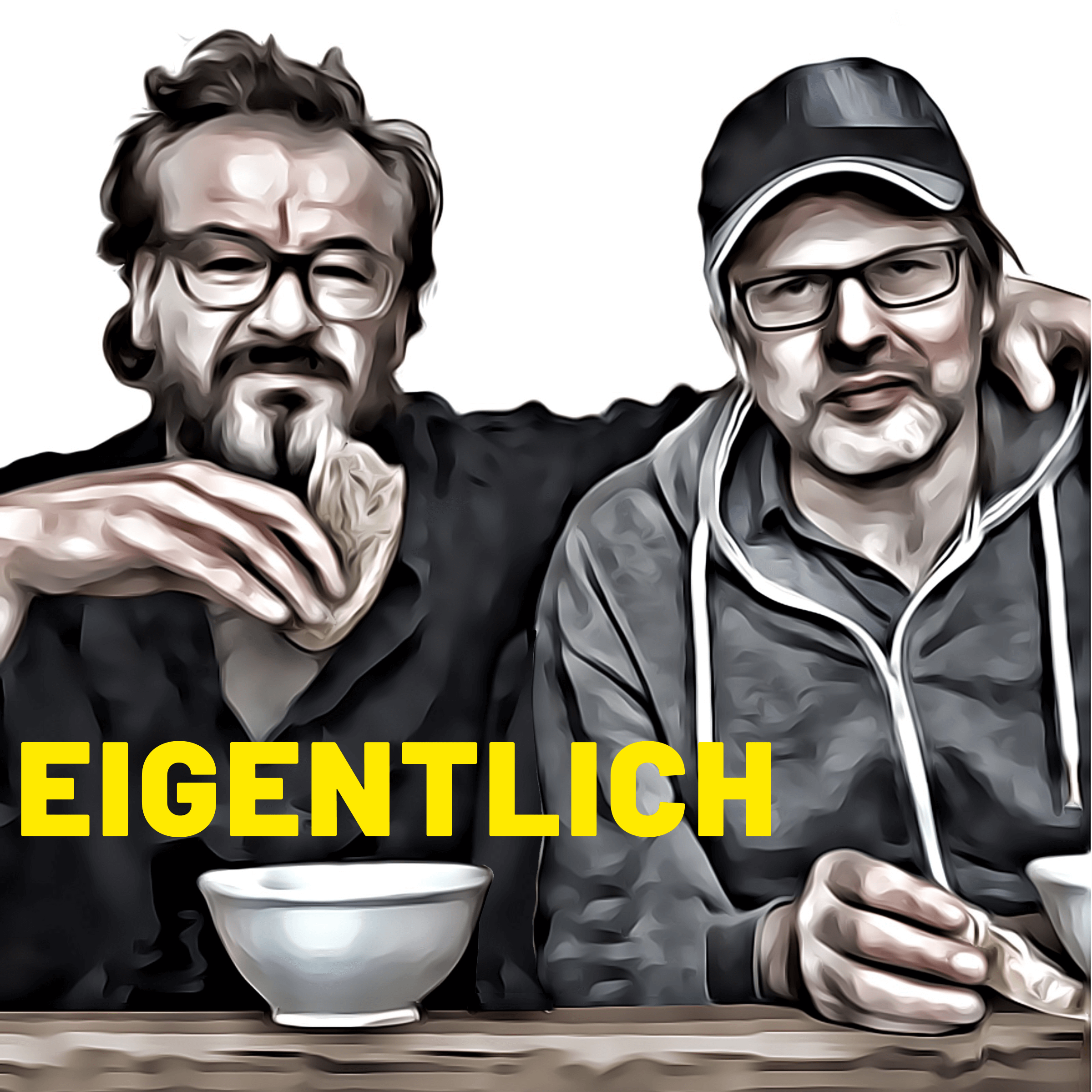
Eigentlich Podcast
Micz & Flo
Reden beim Laufen und laufend Reden - über Film, Technik und Psychotherapie
Episodes
Mentioned books

Aug 17, 2023 • 2h 5min
EGL032 Beau is afraid: Ari Asters überladenes surrealistisches Werk, das Ängste, Schuldgefühle und Traumata visualisiert
"Thank you, sorry, thank you!"
Wie vor einem Jahr ist Chris wieder zu Besuch in Berlin und auch diesmal nehmen Chris und Flo nach Midsommar einen Podcast über das neueste Werk von Ari Aster auf: Beau is afraid. Wir beide verehren den Hauptdarsteller Joaquim Phoenix sehr. Wir unterhalten uns über das tragische Schicksal von Joaquims Bruder River Phoenix, über die Erfolge der Produktionsfirma A24 und Ari Asters Filmografie, bevor wir dann zum eigentlichen Kernstück des Podcast kommen: dem Film "Beau is afraid". Wir sind uns einig, dass die ersten beiden Teile des Films, die Szenen in und um Beaus Wohnung und die Familiengeschichte in der Vorstadt, die stärksten Teile des Films sind. Angst, Schuld und Trauma werden hier in verschiedenen Varianten des gesellschaftlichen und familiären Zusammenlebens ausgelotet, die alptraumhafte Zustände annehmen. Chris bemerkt, dass Beau im Alltag mit einer Sprachfloskel eine Strategie entwickelt hat, mit der er seine Angst in der Konfrontation mit seiner Umwelt bewältigen möchte: "Thank you, sorry, thank you." Doch damit schliddert er von einer katastrophalen Situation in die nächste, ohne die Möglichkeit zu bekommen, die Situation selbst in die Hand nehmen zu können. Der Zuschauer könnte annehmen, dass Beau in einer fast schuldlosen Weise seinem Schicksal ausgeliefert sei, wäre da nicht seine Mutter. Die zweite Hälfte des Films wird von einem Mutter-Sohn Konflikt dominiert, der manchmal so banal ist, dass nur die überladenen und ausschweifenden Bilderwelten von Ari Aster der Leinwand etwas Gehaltvolles geben können. Der Film schafft trotz allem und gerade dank der genialen Kameraführung und des ausschweifenden Set-Designs mächtige Bilder, die im Kopf hängen bleiben. Wir tauchen in verschiedenen Tiefen des Films ab, sind uns uneins über die Bedeutung des Ganzen, finden aber schöne Referenzen in anderen Werken und gesellschaftlichen Phänomenen. Unsere Route führt uns durch das periphere Lichtenberg an einem heißen Nachmittag unter der Woche, das so leer und leblos wirken kann wie das Ende des Films Beau is afraid.
Shownotes
Laufroute
EGL032 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
Ari Aster – Wikipedia
Beau Is Afraid - Wikipedia
A24 (Unternehmen) – Wikipedia
Hereditary (film) - Wikipedia
Midsommar - Wikipedia
Joaquin Phoenix - Wikipedia
Parker Posey - Wikipedia
Nathan Lane - Wikipedia
Stephen McKinley Henderson - Wikipedia
Gladiator (2000 film) - Wikipedia
River Phoenix - Wikipedia
Inherent Vice (film) - Wikipedia
Fear and Loathing in Las Vegas (film) - Wikipedia
Inherent Vice - Wikipedia
Thomas Pynchon - Wikipedia
My Own Private Idaho - Wikipedia
Speedball (Droge) – Wikipedia
Gus Van Sant - Wikipedia
Kurt Cobain - Wikipedia
Stand by Me (film) - Wikipedia
The Family International - Wikipedia
People for the Ethical Treatment of Animals - Wikipedia
Last Days (2005 film) - Wikipedia
Comic Relief (Stilmittel) – Wikipedia
Narzissmus – Wikipedia
Station Eleven (miniseries) - Wikipedia
Oxycodon – Wikipedia
Opioidkrise in den Vereinigten Staaten – Wikipedia
Fentanyl - Wikipedia
All the Beauty and the Bloodshed - Wikipedia
Laura Poitras - Wikipedia
Edward Snowden – Wikipedia
Citizenfour – Wikipedia
Nan Goldin - Wikipedia
Sackler family - Wikipedia
Brown recluse spider - Wikipedia
Pawel Pogorzelski - Wikipedia
Die Archetypen und das kollektive Unbewußte von C. G. Jung — Gratis-Zusammenfassung
Gernhardt, Robert: Reim und Zeit | Reclam Verlag
The Strange Thing About The Johnsons (2011) A Short Film by Ari Aster - YouTube
Das siebente Siegel – Wikipedia
Fanny und Alexander – Wikipedia
Mitwirkende
Chris Flor
(Erzähler)
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Verwandte Episoden
EGL056 Veganes Kochen mit Tipps und Tricks aus der täglichen Küche
Der Film „Beau is afraid“ von Ari Aster entführt die Zuschauer in ein dichtes Gewebe von Ängsten, Neurosen und Traumata. Mit Hauptdarsteller Joaquin Phoenix, der in dem Film einen verstörten und ängstlichen End-40er mit grauen Haaren verkörpert, gelingt es dem Regisseur, eine Vielzahl archaischer Motive aus der Antike und der Gegenwart zu verweben. Das Ergebnis ist eine surreale und alptraumhafte Komödie, die von familiären Schlachtfeldern und toxischen Beziehungen geprägt ist.
Eine der stärksten Motive im Film ist die Mutter-Sohn-Beziehung. Von Anfang an wird der Hauptfigur Beau eine tiefe Angst und Schuld attestiert, die er mithilfe von Tabletten zu ertragen versucht. Der Film lässt sich nicht ohne einen psychologisierenden Blick betrachten, da er sich intensiv mit den individuellen und gesellschaftlichen Ängsten auseinandersetzt.
Eine interessante Parallele zum Film „Beau is afraid“ lässt sich in Laura Poitras‚ Dokumentarfilm „All the Beauty and the Bloodshed“ finden, der über die Fotografin Naan Goldin und ihre Aktivismus gegen die Familie Sackler berichtet. Goldin wurde 2014 von einer Medikamentenabhängigkeit von dem Schmerzmittel Oxycontin betroffen, was als Teil der dritten Welle der Drogentoten-Epidemie angesehen wird, die durch eine Opium-Krieg im eigenen Land hervorgerufen wurde.
Ein weiteres herausragendes Element im Film ist eine Theatergruppe, die als eine Art Parallelgesellschaft und einzige normale Entität in einer verschobenen „Normalgesellschaft“ dargestellt wird. Diese Parallele erinnert an den Roman „Station Eleven“ und wirft Fragen nach dem Wert von Kunst und der Bedeutung von Gemeinschaft in einer dystopischen Welt auf.
In einer kritischen Analyse des Films lässt sich feststellen, dass Ari Aster mit „Beau is afraid“ auf hohem Niveau gescheitert ist. Der Film wirkt überladen und es fehlt ihm an einer klaren Struktur. Der Regisseur nimmt sich die Freiheit, das zu machen, was er will, doch leider fehlt es an Disziplin und Klarheit, die in seinem früheren Werk „Midsommar“ noch zu finden waren. Stattdessen werden die Zuschauer in den unklaren Gefilden und Willkürlichkeiten des Regisseurs zurückgelassen.
Die Bilderwelten und die surrealistischen Elemente des Films sind beeindruckend, aber es fällt schwer, einen roten Faden oder eine verständliche Struktur in ihnen zu erkennen. Ari Aster lässt den Zuschauer in einem Irrgarten der Angst zurück, ohne eine klare Allegorie oder eine Möglichkeit der Interpretation anzubieten. Die Handlung wird zunehmend verwirrend, und ab der 90. Minute fühlt man sich als Zuschauer nur noch der Einbildungskraft des Regisseurs ausgeliefert.
Die Paranoia, die als Kernbestandteil der amerikanischen Gesellschaft betrachtet wird, ist ein ergiebiges Thema, das Ari Aster in „Beau is afraid“ anspricht. Die ökonomische Abhängigkeit und die Überwachung erzeugen eine Paranoia, die wiederum Ängste und Verrücktheiten auslöst. Leider bleibt der Film in der Umsetzung hinter seinen Möglichkeiten zurück. Der Mutter-Sohn-Konflikt und die verwirrenden Animationen dominieren die Handlung, während die gesellschaftliche Diagnose und die Paranoia in den Hintergrund geraten.
Insgesamt ist „Beau is afraid“ ein Film, der mit vielversprechenden Ansätzen startet, aber letztendlich an einer Überladung und mangelnder Klarheit scheitert. Ari Aster packt zu viele Elemente und Ideen in den Film, ohne ihnen eine klare Struktur zu geben. Der Film bietet einen Einblick in individuelle Ängste und gesellschaftliche Paranoia, verliert jedoch zunehmend an Fokus und lässt den Zuschauer mit einem Rätsel zurück. Trotz einiger beeindruckender Momente bleibt die Substanz des Films letztendlich unausgeschöpft und führt zu einer enttäuschenden Erfahrung.
Fotos zur Laufroute

Aug 3, 2023 • 2h 5min
EGL031 Oppenheimer Film: Die Trinity der Atombombe-Urteil-Intrige Zeitstränge
„Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten.“
Im Delphi Filmpalast am Zoo sahen wir Christopher Nolans Film "Oppenheimer" und beginnen -- während der Abspann noch läuft -- vor dem Kino mit einer Reflektion des Films. Es geht im Film um die Lebensgeschichte von J. Robert Oppenheimer, einem amerikanischen Physiker, der eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Atombombe während des Zweiten Weltkriegs spielte. Nolans Blockbuster beginnt mit Oppenheimer, der seine Lebensgeschichte vorlesen möchte. Er tut dies in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg vor einem Untersuchungsausschuss, also auch nach der Glanzzeit von J. Robert Oppenheimer, dem charismatischen Wunderkind der Wissenschaft. Seine Erzählung trägt uns zurück in die Studienzeit Oppenheimers begleitet. Zu den beiden Zeitebenen "Werdegang" und "Untersuchungsausschuss" kommt noch ein dritter hinzu: "Intrige". Erst wenn alle drei Stränge sich ineinanderfalten und die Trinity von Atombombe-Urteil-Intrige explodiert, kommt der Film zum Urteil: alleine wenn etwas passieren kann, ist alles schon zu Ende.
Shownotes
Laufroute
EGL031 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
Robert Oppenheimer – Wikipedia
Christopher Nolan – Wikipedia
Manhattan-Projekt – Wikipedia
Anterograde Amnesie beschreibt die Störung in Memento
Die Armbrust und geächtete Kriegsmittel
Prometheus – Wikipedia
Otto Hahn – Wikipedia
Trinity-Test – Wikipedia
Krieg – Wikipedia
Mitwirkende
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
In der Nähe des Bahnhof Zoos, vor dem Delphi Kino beginnen wir Aufnahme und Reflektion des Films „Oppenheimer“. Christopher Nolans Blockbuster entführt uns auf eine filmische Reise in das Leben des charismatischen Wissenschaftlers J. Robert Oppenheimer. Wir nehmen den Film im Handgepäck mit, versuchen die Echtzeit-Reflektion jedoch mit einer Formulierung unserer emotionalen Färbung direkt nach dem Ende zu beginnen. Was wir erleben ist Wut und Hoffnungslosigkeit — und das ist keine Antwort auf die Inhalte sondern die Wirkung des Films.
Wir verheddern uns in den Nebenstraßen Charlottenburgs genauso wie in der Filmografie Nolans. Nachreichen möchten wir hier, dass der Schauspieler in Memento Guy Pearce heißt und später in „The Time Machine“ (2002) die Hauptrolle spielt, der lose auf dem gleichnamigen Roman von H. G. Wells basiert.
„Oppenheimer“ bezieht sich stark auf die Biografie „American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer“ von Kai Bird und Martin J. Sherwin. Nolan nimmt uns mit auf Oppenheimers akademischen Werdegang, seine Beiträge zur theoretischen Physik und den unaufhaltsamen nuklearen Countdown. Oppenheimer selbst wird nicht nur als charismatischer Intellektueller dargestellt, sondern auch als Autor und Regisseur des Manhattan-Projekts. Er stellt ein Team führender Wissenschaftler:innen zusammen, um die Theorie der Quantenmechanik mit der Praxis der Kernspaltung zu vereinen.
Doch der Film zeigt nicht nur das Licht des Projektors und der Bombe, sondern auch die Schatten, die entstehen, wenn das Licht ausgeht. Die McCarthy-Ära schlägt zu, und Oppenheimers politische Vergangenheit und fortschrittliche Ansichten ziehen ihn in die Hitze der Antikommunismus-Hysterie. Eine erschütternde Kettenreaktion beginnt, die sein Leben auf den Kopf stellt.
In Nolans Werk entfaltet sich die Lebensgeschichte von Oppenheimer in verschiedenen Zeitebenen: „Werdegang“, „Untersuchungsausschuss“ und „Intrige“. Über die Intrige, die in schwarz/weiß gefilmt wurde, spekulieren wir am meisten, auch weil sie sich am meisten wie Spekulation anfühlt. An diesem Punkt zerfällt das Gefühl des Biopics, denn wir können nicht mehr alles glauben, was da projiziert wird.
Erst wenn diese Stränge sich ineinanderfalten, platzt der Erzählknoten so richtig und wir erleben die explosive Trinität von Atombombe, Urteil und Intrige.

Jul 20, 2023 • 59min
EGL030 Soylent Green: Eine düstere Vision der Zukunft und die Kritik an Ressourcenknappheit und sozialer Ungerechtigkeit
Soylent Green isst Menschenfleisch
Wir starten unsere Episode im ruhigeren Teil des Treptower-Parks. Flo bringt wieder einen Film als Thema mit: Wir sprechen über den Filmklassiker "Soylent Green", der eine dystopische Zukunftsvision von Überbevölkerung, Umweltzerstörung und Ressourcenknappheit zeigt. Der Film erschien ein Jahr nach dem Bericht "Die Grenzen des Wachstums" des Club of Rome und gehört somit zu den ersten Ökodystopien. Der Regisseur Richard Fleischer inszenierte den Film im Jahre 1973. Fleischer hat sich in Hollywood eher als B-Picture Regisseur etabliert. Auch, weil er sich nicht von den Studiobossen in seine Filme reinreden ließ. Er hat in unterschiedlichen Genres Filme geschaffen, mit einer eigenen starken Ästhetik und mit vielen namenhaften Schauspielern wie Charlton Heston, Kirk Douglas oder Arnold Schwarzenegger zusammengearbeitet.
Flo erzählt im ersten Teil der Episode die Geschichte des Films nach und Micz kann noch einige Szenen aus seiner Erinnerung beisteuern. Der Film hat starke Bilder geschaffen, die sich lange ins Gedächtnis einschreiben: ein von schlafenden Menschen übersäumtes Treppenhaus oder Radlader, die die Demonstranten willkürlich in Containern wegbaggern und natürlich das monströse Ende des Films: "Soylent Green is people", noch treffender im Deutschen: "Soylent Green ist Menschenfleisch". Uns treibt die Frage, wie unwissender Kannibalismus in einer desolaten Gesellschaft geduldet werden kann. Uns treibt auch in der Diskussion die Zukunftsvision des Filmes - was ist nach über 50 Jahren eingetroffen und was nicht: Überbevölkerung, mächtige Megacorps, Klimaerwärmung, die massive Kluft zwischen Arm und Reich.
Mitten in unserem Gespräch werden wir auf offener Wiese angegriffen: wilde Junikäfer wirbeln in der Abenddämmerung um unsere Köpfe und Mikros, so dass wir Reißaus nehmen müssen. Der Angriff trifft nicht nur uns, sondern sämtliche Parkbesucher. Wie sich später in einem Zeitungsartikel herausstellt, suchen die Junikäfer am Abend den Schutz von Bäumen, um sich zu paaren. Für die Junikäfer waren wir also nichts weiter als laufende und sprechende Bäume. Tsss…
Shownotes
Laufroute
EGL030 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
Film – Eigentlich-Podcast
Archenhold-Sternwarte – Wikipedia
Zelluloidfilm – Wikipedia
Sojasauce – Wikipedia
… Jahr 2022 … die überleben wollen – Wikipedia
Richard Fleischer – Wikipedia
Charlton Heston – Wikipedia
Planet der Affen (1968) – Wikipedia
Amityville III – Wikipedia
Christoph Schlingensief – Wikipedia
20.000 Meilen unter dem Meer (1954) – Wikipedia
Die phantastische Reise – Wikipedia
Doktor Dolittle (1967) – Wikipedia
Der Frauenmörder von Boston – Wikipedia
Arnold Schwarzenegger – Wikipedia
Conan der Zerstörer – Wikipedia
National Rifle Association – Wikipedia
Science-Fiction-Film – Wikipedia
Science-Fiction-Filme der 1970er Jahre – Wikipedia
Der Omega-Mann – Wikipedia
Flucht ins 23. Jahrhundert – Wikipedia
Club of Rome – Wikipedia
Die Grenzen des Wachstums – Wikipedia
Thriller – Wikipedia
Megacorporation – Wikipedia
New York 1999 – Wikipedia
Gerippter Brachkäfer – Wikipedia
GAG100: Der Fall der „Mignonette“ und seine Folgen - Geschichten aus der Geschichte
Die Körperfresser kommen (Film) – Wikipedia
Holocaust – Wikipedia
The Texas Chain Saw Massacre - Wikipedia
Blood Diamond – Wikipedia
Matrix (Film) – Wikipedia
Junikäfer erobern Berlin: Darum rempeln sie Menschen an
Mitwirkende
Florian Clauß
(Erzähler)
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Der Film Soylent Green aus dem Jahr 1973, unter der Regie von Richard Fleischers, gilt als Meilenstein des Science-Fiction-Films und als einer der ersten Ökothriller. Der deutsche Titel lautet „Soylent Green … Jahr 2022 … die überleben wollen„. Dieser Film erschien ein Jahr nach dem Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome und zählt somit zu den ersten Ökodystopien.
„Soylent Green“ spielt in einer überbevölkerten und umweltzerstörten Zukunft im Jahr 2022. Die Gesellschaft ist von einer massiven Kluft zwischen Arm und Reich geprägt. Die Straßen sind voller lethargischer schlafender Menschen, und die Bilder, die der Film erzeugt, sind stark und beklemmend. Die Menschen tragen merkwürdige Uniformen, die fast wie Lageranzüge wirken. Der Film folgt der Dramaturgie des klassischen Detektivfilms der 70er Jahre. Der Protagonist, Detective Robert Thorn, gespielt von Charlton Heston, untersucht einen Mordfall in der reichen Oberschicht von New York City. Dieser Mord steht in Verbindung mit dem Lebensmittelunternehmen „Soylent Corporation“.
In dieser dystopischen Zukunft lebt die Bevölkerung in Armut und ernährt sich hauptsächlich von künstlichen Lebensmitteln, die von der Soylent Corporation hergestellt werden. Echte Lebensmittel sind selten geworden und nur den Reichen vorbehalten. Während seiner Ermittlungsarbeit teilt Detective Thorn das echte Essen aus dem Haushalt des Ermordeten mit seinem Mitbewohner Sol Roth, gespielt von Edward G. Robinson, der noch aus früheren Tagen echte Lebensmittel kennt.
Der Film kritisiert nicht nur die soziale Ungerechtigkeit, sondern auch die Ausbeutung der Ressourcen und die Profitgier der Großkonzerne. Er stellt eine düstere Zukunftsvision dar und dehumanisiert die Gesellschaft. Es werden Themen wie Überbevölkerung, Umweltzerstörung und moralische Verdorbenheit aufgegriffen. Dabei wirft der Film Fragen auf, die auch heute noch relevant sind: Was ist aus den Prognosen von 1973 geworden? Ressourcenknappheit, Überbevölkerung, Verteilungsgerechtigkeit, Verlust der menschlichen Würde, die Verwebung zwischen Megakonzernen und dem Staat, Artensterben und Klimaerwärmung sind Themen, die heute aktueller sind als je zuvor.
Der Film „Soylent Green“ legt weniger Wert auf die Darstellung zukünftiger Technologien, sondern konzentriert sich stattdessen auf die ästhetische Darstellung einer Gesellschaft in Verfall. Die Bilder, die der Film erzeugt, sind eindrucksvoll und verstörend. Die Uniformen, die lethargischen Menschen und die Wasserknappheit vermitteln eine beklemmende Atmosphäre. Der Film zeigt eine patriarchalische Struktur und verdeutlicht die Verfügbarkeit von Waffen als Mittel zur Machtausübung.
Ein zentraler Aspekt des Films ist der industrialisierte Sterbeprozess, der als normaler Teil des Lebens dargestellt wird. In einer Szene wird ein Dialog gezeigt, in dem die Menschen ihren eigenen Tod musikalisch untermalen können. Diese Szene verdeutlicht die Entmenschlichung der Gesellschaft und den Verlust der menschlichen Würde.
Ein weiteres erschütterndes Element des Films ist die Enthüllung, dass das Produkt „Soylent Green“ aus recyceltem menschlichem Gewebe hergestellt wird. Detective Thorn verfolgt die Spur bis in die Fabrik, in der Soylent Green produziert wird. Dort sieht er, wie menschliche Körper in Säcke auf Laufbändern geladen werden und am Ende grüne Täfelchen als Nahrung herauskommen. Diese schockierende Wahrheit soll von der Regierung und der Soylent Corporation vertuscht werden, weshalb der Mord begangen wurde.
Der Film endet mit einem Kampf zwischen Detective Thorn und dem ehemaligen Leibwächter in der Fabrik. Thorn überlebt nur knapp und bittet seinen Vorgesetzten, die Wahrheit zu verbreiten: „Soylent Green ist Menschenfleisch“ („Soylent Green is people“).
„Soylent Green“ ist ein Thriller, der über die Grenzen des Science-Fiction-Genres hinausgeht. Er stellt eine düstere Zukunftsvision dar und regt zum Nachdenken über Themen wie Überbevölkerung, Ressourcenknappheit, soziale Ungerechtigkeit und die Rolle von Großkonzernen in der Gesellschaft an. Der Film hinterlässt beim Zuschauer ein Gefühl der Beklemmung und zeigt, dass die Realität von 1973 heute in vielen Aspekten erschreckend aktuell ist.

Jul 6, 2023 • 1h 4min
EGL029 Gestalttherapie Teil 2: Phänomenologie, Emotionsfokussierte Therapie, Techniken
"Lose your mind and come to your senses"
Auf der Reise von Schöneberg nach Kreuzberg beschäftigen wir uns mit der Gestalttherapie und beginnen mit Ergänzungen aus der letzten Episode zum Thema. Zunächst erläutern wir den Unterschied zwischen den Kontaktfunktionen Deflektion und Egotismus. Deflektion bezeichnet den Versuch, unangenehme Erfahrungen zu vermeiden oder abzulenken, während Egotismus eine selbstbezogene Haltung ist, bei der der Fokus auf den eigenen Bedürfnissen liegt und Interaktion mit anderen vernachlässigt. Wir lassen die Phänomenologie erscheinen, die Unterscheidung zwischen Husserls transzendentaler Phänomenologie und Schmitz' leibphänomenologischer Perspektive. Auch spazieren wir durch die emotionsfokussierter Psychotherapie mit ihren primären und sekundären Emotionen, die von Leslie Greenberg entwickelt wurde. Primäre Emotionen sind grundlegende und unmittelbare Reaktionen auf bestimmte Situationen oder Ereignisse, während sekundäre Emotionen als Reaktionen auf primäre Emotionen entstehen und weniger direkt mit den Bedürfnissen einer Person verbunden sind. Schließlich gelangen wir nach Kreuzberg und zum *eigentlichen* Gegenstand der Episode: den Techniken der gestalttherapeutischen Arbeit. In der Gestalttherapie liegt der Fokus jedoch weniger auf spezifischen Techniken, sondern vielmehr auf dem Prozess der Selbsterforschung, des Gewahrseins und des unmittelbaren Erlebens der Klient:innen. Techniken dienen als Mittel zur Unterstützung dieser Ziele und können je nach Therapeut und Situation variieren. Auf unserer Website ein Zitat des Gründers Fritz Perls, wie er gegen Techniken wettert.
Shownotes
Der Stuhl-Dialog in der psychodynamischen Therapie
Laura (bzw. Lore) Perls, geboren in Pforzheim
Fritz Perls
Paul Goodman
Ralph F. Hefferline: Der unbekannte Gestalttherapeut
The Paul Goodman Reader at the Internet Archive
Fritz Perls: Was ist Gestalttherapie? Ein fast vergessenes Interview
Nationaldenkmal für die Befreiungskriege von Karl Friedrich Schinkel im Viktoriapark
Osteria No 1
5-Why-Methode
Agile Softwareentwicklung
Mitwirkende
Micz Flor
(Erzähler)
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Unsere Tour führt uns von Schöneberg über die Monumentenbrücke nach Kreuzberg. Diese Episode über die Praxis und Techniken der Gestalttherapie hat eine ähnliche Zweiteilung. So werden erst in Kreuzberg die praxisnahen Techniken vorgestellt. Die erste Hälfte der Tour durch Schöneberg verwendet Micz darauf ein paar Korrekturen zur letzten Episode über Gestalttherapie nachzureichen. Er beginnt mit einer Unterscheidung der beiden Kontaktfunktionen Deflektion und Egotismus, die in der letzten Folge nicht angemessen erklärt wurden. Obwohl diese in der Literatur manchmal als ähnlich oder sogar deckungsgleich geführt werden, besteht ein deutlicher Unterschied darin, dass Deflektion den Versuch darstellt, unangenehme Erfahrungen zu vermeiden oder abzulenken, während Egotismus eine selbstbezogene Haltung ist, die den Fokus auf die eigenen Bedürfnisse und Gefühle legt und die Interaktion mit anderen vernachlässigt. Um die zweite Korrektur verständlich zu machen, schiebt er eine sehr vereinfachte Einleitung in die Phänomenologie und die Neue Phänomenologie dazwischen. Husserls Phänomenologie ist eine transzendentale Phänomenologie, während Schmitz‘ Neue Phänomenologie eine leibphänomenologische Perspektive vertritt. Husserl konzentriert sich auf die Untersuchung der transzendentalen Strukturen des Bewusstseins und der Erfahrung, während Schmitz die Bedeutung des leiblichen Erlebens und der leiblichen Existenz betont.
Im Rahmen der Praxis sprechen wir auch über die primären und sekundären Emotionen in der emotionsfokussierten Psychotherapie (EFT), die von Leslie Greenberg entwickelt wurde und in der emotionale Erfahrungen und deren Verarbeitung in den Mittelpunkt der therapeutischen Arbeit stehen. Nicht selten lässt sich zeigen, dass Emotionen andere Emotionen überdecken. Dies ist in der Unterscheidung der primären und sekundären Emotionen festgehalten. Während primäre Emotionen grundlegende und unmittelbare emotionale Reaktionen auf bestimmte Situationen oder Ereignisse sind, sind sekundäre Emotionen eine Reaktionen auf primäre Emotionen und deshalb weniger direkt mit den tatsächlichen Bedürfnissen einer Person verbunden. Sekundäre Emotionen sind oft komplexer und nicht selten sozial erwünschter.
Techniken in der Gestalttherapie
Gestalttherapie-Techniken — wie die dialogische Arbeit mit Stühlen — sind weithin bekannt. Gleichzeitig liest man immer wieder, dass in der Gestalttherapie der Fokus weniger auf spezifischen Techniken liegt. So sagte der Mitbegründer Fritz Perls:
„Ich akzeptiere niemanden als kompetenten Gestalttherapeuten, solange er noch ›Techniken‹ benützt. Wenn er seinen eigenen Stil nicht gefunden hat, wenn er sich selbst nicht ins Spiel bringen kann und den Modus (oder die Technik), die die Situation verlangt, nicht der Eingebung des Augenblicks folgend erfindet, ist er kein Gestalttherapeut.“
Dieses vermeintliche Paradox löst sich (fast) in Wohlgefallen auf, wenn wir zwischen die Techniken und die Theorie der Gestalttherapie mittelbare Ziele schieben. Es geht nicht um Techniken, sondern vielmehr umden Prozess der Selbsterforschung, Förderung von Gewahrsein und das unmittelbare Erleben der Klient:innen. Über einzelne Techniken wird in der Gestaltliteratur viel geschrieben. Manche meinen sogar, dass die Schematherapie die Stuhlarbeit der Gestalttherapie geklaut habe!
Diese Techniken sind jedoch immer nur Mittel zum oben formulierten Zweck und nie in einem vorgegebenen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang. Auch variieren die Techniken je nach Therapeut:in und Situation. Andersherum ist die gleiche Anleitung nie die gleiche, wenn man Therapeut:innen vergleichen würde. In der Gestalttherapie steht immer die Förderung von Bewusstheit, Verantwortung und Selbstausdruck im Vordergrund. Wir reflektieren einige Techniken wie Verlangsamung (oder Beschleunigung), Intensivierung, Veränderung des Settings, Körperübungen und die Rolle der Emotionen am Beispiel der emotionsfokussierten Psychotherapie, die weiter oben erklärt wurde.
Angeleitete Atemübung
Die angeleitete Atemübung, die helfen kann sich bei einer beginnenden Panikattacke wieder mit dem Körper zu verbinden wurde von Flo freigegeben und wir haben sie hier online bereitgestellt.

Jun 22, 2023 • 1h 2min
EGL028 Fermentieren
Fermantation ist kontrollierte und schmackhafte Verwesung
In dieser Episode geht um die Haltbarmachung von Lebensmitteln durch Gärung. Welche Methoden gibt es zur Konservierung von Lebensmitteln? Mit Blick auf die Rummelsburger Bucht sprechen Micz und Flo über Kimchi, sonnengetrocknete Tomaten, den Einsatz von Alkohol zur Konservierung von Lebensmitteln wie dem Rumtopf und vor allen Dingen dem Eisschrank, der in der Bucht mit der Gründung der Norddeutschen Eiswerke sein Futter fand. Der "Bimmel-Bolle" belieferte in den 1870ern Berliner Haushalte wie auch Kneipen und Brauereien mit dem begehrten Eis.
Über diesen geschichtlichen Ausflug geht es dann ins Eingemachte: der Fermentation von Lebensmitteln. Fermentieren ist ein Prozess bei dem bewusst ein sauerstoffarmes Milieu geschaffen wird, in dem sich Milchsäurebakterien vermehren und das Fermentat zu einem schmackhaften und gesundem Verwesungsprodukt umwandeln. Flo hat einen Volkshochschulkurs absolviert und erzählt Micz von seinen Erkenntnissen. Jeder kann fermentieren, die Mittel zur Produktion sind sehr einfach und alles ist fermentierbar. Es muss einem nur schmecken. Wir kommen auch auf die jüngste Bibel der Fermentation zu sprechen, dem Buch "The Noma Guide of Fermentation", das von den Machern des weltbesten Restaurants in Kopenhagen herausgebracht wurde.
Wir sprechen auch über die Magie des Lebendigen, welche diffizilen Verbindungen und Milieus an Mikrobenkulturen an verschiedenen Orten entstehen können und wie einzigartig diesezu sein scheinen.
Am Schluss überrascht Flo Micz mit selbstgebackenen Dinkel-Teigtaschen, gefüllt mit selbstgemachtem Sauerkraut, Creme Fraiche, getrockneten Steinpilzen und Tomaten. Wir enden schließlich mit einem Ausblick auf zukünftige Folgen unter einer neuen Kategorie des Podcast: "Kochen, Backen, Essen".
Shownotes
Laufroute
EGL028 | Wanderung | Komoot
Links zur Epsiode
Rummelsburger See – Wikipedia
Fermentation – Wikipedia
\r\n\tDie Berliner Volkshochschulen - Kurssuche
Gärung – Wikipedia
Kimchi – Wikipedia
Obst und Gemüse lagern, einkochen und haltbar machen | MDR.DE
Trocknen - Lexikon der Ernährung
Konservendose – Wikipedia
GAG126: Für immer im Eis – die Franklin Expedition - Geschichten aus der Geschichte
Eiswerk – Wikipedia
Eisfabrik (Berlin-Mitte) – Wikipedia
Carl Bolle (Unternehmer) – Wikipedia
Eisschrank – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisfischen
Geoportal – Daten und Dienste - Berlin.de
Luftbild+DOP
Luftbild Rummelsburger Bucht
Heizkraftwerk Klingenberg – Wikipedia
Meerrettich – Wikipedia
Old smokehouses served as meat smokers and as storage facilities
Lebensmittelkonservierung – Wikipedia
Maillard-Reaktion – Wikipedia
Milchsäurebakterien – Wikipedia
Acetobacteraceae – Wikipedia
Liste von Bakterien in der Lebensmittelherstellung – Wikipedia
Käseherstellung – Wikipedia
Käseersatz – Wikipedia
So funktioniert Fermentieren\n- Landesschau Rheinland-Pfalz - SWR Fernsehen
Sauerkraut selber machen: Rezept in wenigen Schritten - Utopia.de\t
GAG368: Wie das Jod ins Salz kam - Geschichten aus der Geschichte
Noma (Restaurant) – Wikipedia
René Redzepi, David Zilber: Foundations of Flavor: The Noma Guide to Fermentation (Buch) - bei Buchhandlung Moritzplatz GmbH
Fermenting at Noma: old techniques in modern cuisine... with David Zilber! - YouTube
Sauerteig – Wikipedia
Netflix - Abstract mit Olafur Eliasson
Whisky – Wikipedia
Hygiene – Wikipedia
Pirogge – Wikipedia
Umami – Wikipedia
Obstwein – Wikipedia
Rezept für Tofu und Spinat in einer schwarzen Limetten Soße — Yasmoya
Mitwirkende
Florian Clauß
(Erzähler)
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Verwandte Episoden
EGL056 Veganes Kochen mit Tipps und Tricks aus der täglichen Küche
Fermentation ist, isst, zischt
Laurie Mlodzik
Fermentation ist Verwandlung, ist Zeit, ist Luft, ist Aufmerksamkeit, ist Widerstand, ist wild. Fermentation isst und lässt uns essen. Fermentation lebt und lässt uns leben. Offiziell gesehen ist jede mikrobielle oder enzymatische Transformation organischer Stoffe eine Art Fermentation. Und wenn ich die lateinische Wurzel dieses Worts betrachte, fervere, verrät es uns einiges über den Prozess, nämlich kochen, sieden, aufwallen. Die Gärung ist seit Beginn in vielen Gesellschaften überall auf der Welt dokumentiert als ein Verfahren, Lebensmittel aufzubewahren, geschmacklich zu beeinflussen oder überhaupt genießbar zu machen, dokumentiert.
Und kein Wunder, denn eigentlich passiert es auch schon von allein. Trauben wachsen bedeckt mit deren eigenen Hefen an, das Wurzelgemüse ist in der Erde umgeben von den Mikroben, die es danach gären lassen, und wehender Weizen, ist auch schon von jenen Bakterien und Hefen umschwirrt, die das Brot aufgehen und das Bier sprudeln lassen. Fermentation und die Mikroben, die diese Arbeit betätigen sind dauerhaft um uns, auf uns und in uns, und ohne sie kämen wir nicht sehr weit. Sie kurbeln das Verwesen von biologischem Material an, sodass die nächste Generation von Pflanzen und Tieren davon Nahrung heranziehen können, sie helfen uns beim Verdauen und Aufnehmen von Nährstoffen in unserem Verdauungstrakt, und sie bringen auch manche Freude und wilde Zeiten in unser Leben in Form einer Vielfalt an Essen und vergorenen Getränken.
Bei jedem wilden Ferment, wild, weil die Gärung ohne Zusatz von spezifischen kommerziellen Hefen oder anderen Kulturen verläuft, ist ein komplexes Netzwerk von lebenden Mikroorganismen am Werk. Die Kunst des Vergärens besteht eben darin, die uns nützlichen Organismen gegen die schädlichen auszuspielen. Der Hauptunterschied zwischen Essen, welches einfach verrottet und dem, das für eine köstliche Fermentation verwendet wird, liegt hauptsächlich in der Aufmerksamkeit und Arbeit, die wir ihm schenken. Wir schaffen für die Mikroben, die wir unterstützen wollen, ein geeignetes Umfeld, sodass sie ihre Umgebung zu ihrem und unserem Vorteil nutzen und weiter verändern können. Sie wird saurer, alkoholisch, oder für andere Mikroorganismen giftig. Solange die Nützlinge genügend Nahrung haben, vor allem Stärke- oder Zuckermoleküle, arbeiten sie munter vor sich hin und blubbern Kohlendioxidbläschen. Zwar verbrauchen sie dabei einige Nährstoffe aus dem Ausgangsprodukt, hinterlassen uns aber im Gegenzug nicht nur andere Nährstoffe wie Vitamine und Mineralien, sondern auch neue Aromen, Texturen und Geschmacksnuancen.
Es gibt eine noch teils unentdeckte Vielfalt an verschieden Mikroben, die in unterschiedlicher Umgebung am besten ihre Arbeit betätigen und uns auch ganz andere Resultate bieten. Eines dieser sehr gängigen Prozesse ist die Laktofermentation oder Milchsäuregärung. Durch die Erschaffung einer sauerstoffarmen und vor allem salzigen Umgebung, können wir das Wachstum des erwünschten Bakterienstamms, der Lactobacilli, die unter anderem für Sauerkraut zuständig sind, begünstigen. Die Salzmenge in dem Ferment kann erheblich schwanken. Je mehr Salz wir nehmen, desto langsamer läuft die Fermentation an und desto saurer wird das Endresultat. Bei einem Übermaß an Salz kann allerdings kein Mikroorganismus überleben, es kommt zu keiner Fermentation. Allerdings brauchen verschiedene Lebensmittel auch unterschiedliche Mengen, um deren Eigenschaften entgegenzukommen und den Lactobacilli eine möglichst hohe Überlebenschance zu geben. Bei festem und Wurzelgemüse wie Kohl, Rüben, Randen, Bohnen, Rettich, Blumenkohl, Kartoffeln etc. sind 2-3% Salz je Gewicht gängig. Aber bei weicherem oder wässrigem Gemüse und Obst, zum Beispiel Spargeln, Gurken, Paprika, Chilis, Tomaten werden 3-5% empfohlen. Und für einige Gemüse wie zum Beispiel Oliven, die meistens erst durch die Fermentation genießbar werden, ist sogar bis 10% Salz der Norm.
Es geht um gesammelte Erfahrungen, manche durch Jahrtausende und es geht um Aufmerksamkeit. Wir lernen diese Mikroben kennen, deren Eigenarten und Vorlieben, die unsere Vorfahren schon kannten und können so zusammen Neues erschaffen. Dafür braucht es eine Offenheit, mit den Sinnen zu erfahren; deine Haut und das Kohlblatt als lebendige Oberfläche zu sehen, die eigenen Geschmackspräferenzen mit Nase, Zunge und Zähnen zu erforschen, und das Achten auf ein Glas voll Leben. Dieses Glas wird duften und blubbern und zischen, manchmal mehr und manchmal weniger, in warmen und dunkleren Räumen vielleicht mal mehr, bei gewissen Zutaten vielleicht mal weniger, alles hat einen Einfluss, und die Offenheit, auch mit Unerwartetem umzugehen, Zu warten, und auch zu scheitern, wird belohnt. Schließlich arbeiten wir hier mit Lebewesen auf anderen Lebens- und Zeitskalen zusammen und so viel wie wir voneinander lernen und profitieren können, bleiben wir einander auch fremd. Umso magischer sind dann die Momente, wo wir es schaffen, zusammen zu kommen und etwas Neues, Lebendiges, Wildes, Fermentiertes zusammen zu erschaffen.
Text aus einem Reader. Dieser Reader wurde für den Workshop alles-ist-ver-gär-bar gedruckt, der am 6. Oktober 2022 in Brewsters Till Ten Bar im Kunstverein Freiburg stattfand. Geleitet von Laurie Mlodzik mit Unterstützung vom Kunstverein Freiburg, dessen Kunsterlischen Beirat und der Praktikantin Kathrin Mohn.
Sauerkraut
Zutaten:
1000 g Weißkohl oder Rotkohl
Salz (10-15g)
getrocknete Gewürze (Kümmel, Wacholder-/Lorbeeren oder andere Kräuter) – optional
Zusätzlich:
1 Schüssel
1 Einmachglas oder eine Kraut-(Tsukemono-) Presse
1 Mandoline / Küchenhobel oder Messer und Schneidebrett
Zubereitung:
Den Kohl gut waschen. Die äußeren Blätter beiseite legen und ganz lassen, sie werden später zum beschweren verwendet. Den restlichen Kohl fein hobeln und mit dem Salz mind. 5 Minuten lang gut und stark kneten. Man kann auch einen Holzstampfer verwenden. Es muss so viel Wasser austreten, dass man später das Kraut im Einmachglas damit bedecken kann. Das geknetete Kraut dann in ein großes, sehr gut gesäubertes Einmachglas geben. Dabei immer nach und nach eine Handvoll einfüllen und fest andrücken bzw. mit dem Holzstampfer hinein stampfen, so dass keine Luft zwischendrin bleibt. Am Ende das Ganze ausgetretene Wasser zugießen und mit den äußeren ganzen Kohlblättern bedecken.
Dann mit einer Konstruktion so beschweren, dass der Kohl von seinem eigenen Saft bedeckt wird. Falls es nicht ausreichen sollte, ein klein wenig Salzlake (2%-ig) nachgießen. Das Gefäß mit einem Handtuch abdecken. Hat man eine Tsukemono Presse oder ein Einmachglas-System mit durchlässigem Gummideckel, braucht man nichts weiter abdecken.Den Kohl nun so bei Raumtemperatur +/- 1 Woche stehen lassen. Luftbläschen und ein säuerlicher Geruch sind ein Indikator für die Fermentation. Ich teste meinen Sauerkraut ab ca. 5 Tagen täglich. Wenn das Kraut (je nach Geschmack) einen angenehmen und noch nicht zu intensiven Säuregrad erreicht hat, in Gläser füllen, bzw. den Gummideckel mit dem Lagerdeckel austauschne und im Kühlschrank lagern oder im kalten Keller. Dort ist es bis zu einem Jahr haltbar und verändert sich weiter durch den Reifungsprozess.
Dinkeltaschen gefüllt mit Sauerkraut, Creme Fraiche, getrocktene Tomaten und Pilzen
Zutaten:
6 Dinkelblätterteig Quadrate
1 Creme Fraiche
4-5 in Öl eingelegte getrocknete Tomaten
7 getrocknete Steinpilze
selbstgemachtes Sauerkraut
Zubereitung:
Pilze in gekochtem Wasser 10min einweichen, kleinschneiden. Tomaten kleinschneiden und alles zusammen mit Sauerkraut und Creme Fraiche vermischen. Blätterteig-Quadrate auf Backbleich auslegen, Mischung verteilen und zu Taschen falten. Ränder mit Daumen zusammendrücken ggf. befeuchten. Dreiecke mit etwas Öl und/oder Pflanzenmilch bestreichen, bei 200° Ober / Unterhitze backen, nach 12min wenden, nochmals bestreichen und weiter backen, bis der gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist.

Jun 8, 2023 • 1h 21min
EGL027 Was ist eigentlich Gestalttherapie?
»Anarchie gibt´s nicht auf Krankenschein«
Wir sind am Hauptbahnhof verabredet, um über Gestalttherapie zu sprechen.
Denn inzwischen ist Gestalttherapie relativ bekannt -- da hat sich in den letzten zehn oder zwanzig Jahren was getan.
Wer hätte das gedacht, feierte sie doch vielleicht Ihre größten Erfolge in Amerika der 1960er oder 70er Jahre?
Als eine der wichtigsten humanistischen Therapien, die sich nicht primär mit der Beseitigung von Störung, sondern auch mit Wachstum, Identität und Ressourcen beschäftigte, passte sie in die Zeit der Individualisten und utopischen Gedanken zu Gesellschaft, Kapitalismus und Zusammenleben.
Über diese Zeit sprechen wir gar nicht in diesem Podcast, aber Flo fordert zum Schluss: vielleicht sollte es noch einen zweiten Teil geben.
Shownotes
Laufroute
EGL027 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
Malteserkreuz / Malteserkreuzgetriebe
Tonillusionen bei Super Mario World
Was ist Gestalttherapie? Auf der Seite der deutschen Vereinigung für Gestalttherapie
Vorder- und Hintergrund
Figur-Hintergrund-Bildung
Topdog versus Underdog
Die Gegenwart, das Hier und Jetzt
Eine Erklärung des Begriffs 'Gestalt'
Katharina Stahlmann: Gestalttherapie und Anarchie
Gestalttherapie in Adam Curtis' "The Century of the Self"
Video: Demonstrating the Gestalt approach to anxiety, Dr. Frederick Perls works with a young woman who is self-conscious about her height and with a man troubled by memories of war
Buch auf Archive.org: Ego, hunger, and aggression; the beginning of gestalt therapy by Perls, Frederick S
Laura (bzw. Lore) Perls, geboren in Pforzheim
Fritz Perls
Paul Goodman
Ralph F. Hefferline: Der unbekannte Gestalttherapeut
The Paul Goodman Reader at the Internet Archive
Fritz Perls: Was ist Gestalttherapie? Ein fast vergessenes Interview
Christian von Ehrenfels – Wikipedia
Gestaltpsychologie - Lexikon der Psychologie
Kontaktstörungen (Lexikon der Gestalttherapie)
Art Critics Orchestra | 20th Anniversary
Cuckoocaster
Mitwirkende
Micz Flor
(Erzähler)
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Die Gestalttherapie wurde im wesentlichen von Frederick S. Perls (später „Fritz“ genannt, Psychiater und Psychotherapeut), Laura Perls (geb. Posner, Gestaltpsychologin und Psychoanalytikerin) und Paul Goodman (Soziologe, Autor und Psychotherapeut) entwickelt und legt den Fokus auf das gegenwärtige Erleben und die persönliche Verantwortung des Individuums.
Der Begriff „Gestalt“ stammt aus der Gestaltpsychologie und bedeutet am ehesten „Form“ oder „Gefüge“ und wird jedoch oft als „Herstellen“ oder „Kreieren“ missverstanden. Die Gestaltpsychologie, die von Christian von Ehrenfels, Max Wertheimer, Wolfgang Köhler und Kurt Koffka entwickelt wurde, betonte die Bedeutung der Wahrnehmung von Ganzheiten oder „Gestalten“. Sie argumentierten, dass unser Geist nicht nur aus isolierten Elementen besteht, sondern dass wir die Welt um uns herum als organisierte und sinnvolle Einheiten wahrnehmen.
Bevor man sich für die Bezeichnung „Gestalttherapie“ entschied, waren auch „Existentialtherapie“ und „Konzentrationstherapie“ Kandidaten für die Benamsung des Verfahrens. Der Verweis auf den Existentialismus im ersten Fall bezieht sich auf die Rolle der Verantwortung und der Dialogphilosophie (vor allem des Philosophen Martin Buber) in den therapeutischen Prozessen. Konzentrationstherapie war der Versuch die Rolle des „Gewahrseins“ im Namen festzuhalten, das in der therapeutischen Arbeit eine wichtige Rolle spielt und ungefähr dem heutigen Verständnis der „Achtsamkeit“ entspricht.
Das erste Buch von F. Perls, dass die Gestalttherapie schon erkennen lässt ist „Das Ich, der Hunger und die Aggression“ von 1942. 1951 erscheint dann „Gestalt therapy: Excitement and growth in the human personality“ gemeinsam mit Paul Goodman und Ralph F. Hefferline. Die Gestalttherapie betrachtet den Menschen als ganzheitliches Wesen und betrachtet seine Erfahrungen, Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen als Teil eines größeren Ganzen. Ein zentraler Ansatzpunkt der Gestalttherapie ist das Hier und Jetzt. Der therapeutische Prozess hilft Klient:innen, sich mittels Gewahrsein bewusst zu werden und das gegenwärtige Erleben zu erforschen. Dabei werden vor allem Körperempfindungen, Gefühle und nonverbale Ausdrucksweisen berücksichtigt.
Die Gestalttherapie arbeitet auch mit verschiedenen Techniken und Methoden, um den Klienten zu unterstützen. Am bekanntesten ist sicherlich die Arbeit mit Stühlen, die in letzten Jahren durch die Schematherapie viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Andere Methoden sind z.B. Rollenspiele, Traumarbeit, Imaginationsübungen und kreative Ausdrucksformen. Der Fokus liegt darauf, Klient:innen dabei zu unterstützen, ihre eigenen Ressourcen zu entdecken, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen und ihre Beziehungen zu verbessern.
In Deutschland wird die Gestalttherapie nicht von den Krankenkassen erstattet, die Kosten müssen also von den Klient:innen gezahlt werden. Die Gestalttherapie wird in verschiedenen Settings angewendet, wie Einzeltherapie, Gruppentherapie, Paartherapie oder Familientherapie. Sie kann bei einer Vielzahl von psychischen Problemen und persönlichen Entwicklungsthemen eingesetzt werden, wie z.B. Angststörungen, Depressionen, Beziehungsproblemen, Selbstwertproblemen und Identitätsfragen.
Als zentrales Merkmal der Gestalttherapie in Abgrenzung zu anderen Verfahren verstehe ich das prozesshafte Arbeiten. Es bezieht sich auf die Betonung des gegenwärtigen Erlebens und der Aufmerksamkeit auf den laufenden Prozess im Therapieraum. Statt sich nur auf vergangene Ereignisse oder auf Ziele zu konzentrieren, richtet die Gestalttherapie den Fokus auf das Hier und Jetzt und auf das, was im Moment geschieht. Der Therapeut unterstützt den Klienten dabei, sich bewusst zu werden, wie er sich fühlt, welche Gedanken und Impulse auftauchen und wie er sich körperlich ausdrückt. Durch die Aufmerksamkeit auf den aktuellen Prozess können verborgene Muster, unvollendete Erfahrungen und unbewusste Dynamiken ans Licht kommen.
Damit eng verbunden ist die „Kontaktkurve“, das den Verlauf des Kontakts und der Interaktion eines Individuums mit seiner Umwelt, anderen Menschen oder auch inneren körperlichen Prozessen beschreibt. Sie umfasst verschiedene Phasen und Dynamiken, die sich im therapeutischen Prozess entfalten können. Die dazugehörigen Kontaktfunktionen (oder -störungen) wie Konfluenz, Introjekte, Projektion und Retroflektion besprechen wir auch in dieser Episode. Die Gestalttherapie nutzt die Kenntnis der Kontaktkurve, um den Klienten dabei zu unterstützen, bewusster und authentischer in Beziehung zu treten. Der Therapeut hilft dabei, die verschiedenen Dynamiken zu erkennen, Verantwortung zu übernehmen und neue Möglichkeiten für einen gesunden Kontakt und eine reichhaltige Interaktion mit der Umwelt zu entwickeln.
Da jeder Kontaktkurve eine neue folgt, wir immer im Feld in Kontakt sind und die Prozesse nicht aufhören zu fließen, gilt natürlich: auch wenn die Episode geschlossen ist, bleiben hoffentlich viele Fragen offen.
In dieser Episode werden Evidenzstudien angesprochen. Dabei handelt es sich um diese:
Tschuschke, V., von Wyl, A., Koemeda-Lutz, M. et al. Bedeutung der psychotherapeutischen Schulen heute. Psychotherapeut 61, 54–65 (2016). https://doi.org/10.1007/s00278-015-0067-y
FAZIT: Psychotherapeuten unterschiedlicher konzeptueller Ansätze setzen weitgehend ähnliche Interventionstechniken ein, indem ein Großteil aller Interventionen allgemeiner, nichtspezifischer Natur ist, der eine optimierte menschliche Kommunikation darstellt. Therapeuten sollten gegenüber ihrem gelernten Therapieverfahren eine gelassene, flexible Haltung einnehmen. Rigide oder unflexible Umsetzungen von Techniken aus gelernten psychotherapeutischen Konzepten scheinen ungünstig zu sein. Die Sicherstellung eines tragfähigen, vertrauensvollen Arbeitsbündnisses muss Priorität haben, etwa indem konzeptkonforme Interventionen zugunsten allgemeiner, nichtspezifischer Techniken zurückgestellt werden, insbesondere zu Beginn der Behandlung und bei belasteten Arbeitsbündnissen, z. B. bedingt durch das Ausmaß der psychischen Belastung des Patienten. Professionelle Therapie scheint den Ergebnissen zufolge eine geglückte und stimmige Integration optimierter Kommunikations- und Beziehungstechniken mit zusätzlichen Techniken anderer Konzepte und den eigenen, gelernten darzustellen.
Tschuschke, V., Koemeda-Lutz, M., von Wyl, A. et al. The Impact of Clients’ and Therapists’ Characteristics on Therapeutic Alliance and Outcome. J Contemp Psychother 52, 145–154 (2022). https://doi.org/10.1007/s10879-021-09527-2
ABSTRACT: This article investigates distances between therapists and their clients in their experience of the therapeutic alliance across the duration of the psychotherapeutic treatments in a naturalistic study. We looked at the working alliances from different vantage points—rupture, repair of ruptures, distances in the alliance impressions of both clients and therapists—and their correlation with treatment outcome. The only predictive variable of alliance ruptures was the inability of therapists to bond sufficiently with their clients regarding a sustainable working atmosphere, which could be identified through a continuous distant alliance rating by the therapists. Alliance ruptures in turn significantly predicted premature termination of treatments, whereas alliance ruptures per se did not necessarily predict treatment outcome. The paper discusses the possible role of the quality of therapists’ attachment styles as a potentially crucial variable in an effective working alliance in psychotherapy.

May 25, 2023 • 1h 49min
EGL026 Der Eisenhans - Grimms Märchen von 1857
Die Geschichte vom Goldjungen und dem wilden Mann
In dieser unserer zweiten Märchen-Episode geht es heiß her. Wir sprechen über das Märchen "Der Eisenhans" von den Gebrüdern Grimm in der Fassung von 1857. Eigentlich sollte es "Der wilde Mann" heißen, was Micz viel besser gefällt. Nach einem kurzen akademischen Überbau lassen wir uns die Geschichte von Flo aus der Präproduktion vorlesen. Und Micz steigt gleich voll ein: der Sumpf, der Wald - das ist die Vagina. Flo möchte aus der Trockenlegung des Sumpfes und damit die Gefangennahme von Eisenhans einen industriellen Zivilisationsschritt rauslesen hinein in die Eisenzeit. So interpretieren wir das Märchen Absatz für Absatz aus verschiedenen Sichtweisen: von psycho- und gestalttherapeutischen, über Kultur- und Wissenschaftsgeschichtlichen bis hin zu spirituellen Deutungsansätzen bleibt nichts außen vor. Natürlich fehlen auch nicht unsere obligatorischen Filmreferenzen, denn wir sind ja EIGENTLICH ein Filmpodcast. Wir ergänzen uns gut und es macht Spaß unseren Gedanken auf Feld und Wald freiem Lauf zu lassen. Einzig unser kleiner Gast im Tragetuch kommt nicht so leicht zur Ruh und brabbelt ein bisschen in die Aufnahme hinein. Das haben wir mit dem neuen AI-Filterset von Auphonic rausgebügelt. Dafür klingen unsere Stimmen wie direkt aus dem Studio nur in etwas atemlos...
Shownotes
Laufroute
EGL026 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
Der Eisenhans - Erzählung von 1857 vorgelesen als komplette Audiodatei
Der Eisenhans – Wikipedia
Brüder Grimm – Wikipedia
Der Eisenhans (1850) – Wikisource
Der Eisenhans (1857) – Wikisource
Aarne-Thompson-Uther-Index – Wikipedia
Hedwig von Beit – Wikipedia
David Cronenberg – Wikipedia
A.I. – Künstliche Intelligenz – Wikipedia
Eisenzeit – Wikipedia
Bronzezeit – Wikipedia
Eisen – Wikipedia
Hochofen – Wikipedia
Chihiros Reise ins Zauberland – Wikipedia
Flussgott | Ghibli Wiki | Fandom
Ödipuskonflikt – Wikipedia
Zahlen im Märchen: Die Drei (Symbolik, Beispiele) - Märchenatlas
Meditation – Wikipedia
Iron John: A Book About Men - Wikipedia
Erik H. Erikson – Wikipedia
Latenz (Psychologie) – Wikipedia
Robert Bly – Wikipedia
Eisenhans (Robert Bly) – Wikipedia
Nukleosynthese – Wikipedia
Supernova – Wikipedia
Extremer Ort: Gold kann in Materiescheiben um Schwarze Löcher entstehen | MDR.DE
Ausstellung zur Inka-Kultur - Schweiß der Sonne - Kultur - SZ.de
Dynamische Psychiatrie – Wikipedia
Ich-Struktur-Test | ISTA Online
Lorica segmentata – Wikipedia
Walter Moers – Wikipedia
Zamonien – Wikipedia
Rumo & Die Wunder im Dunkeln – Wikipedia
Kupferne Kerle | Zamonien Wiki | Fandom
Terminator 2 – Tag der Abrechnung – Wikipedia
Krieg der Sterne – Wikipedia
Mitwirkende
Florian Clauß
(Erzähler)
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Der Eisenhans.
Es war einmal ein König, der hatte einen großen Wald bei seinem Schloß, darin lief Wild aller Art herum. Zu einer Zeit schickte er einen Jäger hinaus, der sollte ein Reh schießen, aber er kam nicht wieder. „Vielleicht ist ihm ein Unglück zugestoßen,“ sagte der König, und schickte den folgenden Tag zwei andere Jäger hinaus, die sollten ihn auf suchen, aber die blieben auch weg. Da ließ er am dritten Tag alle seine Jäger kommen und sprach „streift durch den ganzen Wald und laßt nicht ab bis ihr sie alle drei gefunden habt.“ Aber auch von diesen kam keiner wieder heim, und von der Meute Hunde, die sie mitgenommen hatten, ließ sich keiner wieder sehen. Von der Zeit an wollte sich niemand mehr in den Wald wagen, und er lag da in tiefer Stille und Einsamkeit, und man sah nur zuweilen einen Adler oder Habicht darüber hin fliegen. Das dauerte viele Jahre, da meldete sich ein fremder Jäger bei dem König, suchte eine Versorgung und erbot sich in den gefährlichen Wald zu gehen. Der König aber wollte seine Einwilligung nicht geben und sprach „es ist nicht geheuer darin, ich fürchte es geht dir nicht besser als den andern, und du kommst nicht wieder heraus.“ Der Jäger antwortete „Herr, ich wills auf meine Gefahr wagen: von Furcht weiß ich nichts.“
Der Jäger begab sich also mit seinem Hund in den Wald. Es dauerte nicht lange, so gerieth der Hund einem Wild auf die Fährte und wollte hinter ihm her: kaum aber war er ein paar Schritte gelaufen, so stand er vor einem tiefen Pfuhl, konnte nicht weiter und ein nackter Arm streckte sich aus dem Wasser, packte ihn und zog ihn hinab. Als der Jäger das sah, gieng er zurück und holte drei Männer, die mußten mit Eimern kommen und das Wasser ausschöpfen. Als sie auf den Grund sehen konnten, so lag da ein wilder Mann, der braun am Leib war, wie rostiges Eisen, und dem die Haare über das Gesicht bis zu den Knieen herab hiengen. Sie banden ihn mit Stricken und führten ihn fort, in das Schloß. Da war große Verwunderung über den wilden Mann, der König aber ließ ihn in einen eisernen Käfig auf seinen Hof setzen und verbot bei Lebensstrafe die Thüre des Käfigs zu öffnen, und die Königin mußte den Schlüssel selbst in Verwahrung nehmen. Von nun an konnte ein jeder wieder mit Sicherheit in den Wald gehen.
Der König hatte einen Sohn von acht Jahren, der spielte einmal auf dem Hof, und bei dem Spiel fiel ihm sein goldener Ball in den Käfig. Der Knabe lief hin und sprach „gib mir meinen Ball heraus.“ „Nicht eher,“ antwortete der Mann, „als bis du mir die Thüre aufgemacht hast.“ „Nein,“ sagte der Knabe, „das thue ich nicht, das hat der König verboten,“ und lief fort. Am andern Tag kam er wieder und forderte seinen Ball: der wilde Mann sagte „öffne meine Thüre,“ aber der Knabe wollte nicht. Am dritten Tag war der König auf die Jagd geritten, da kam der Knabe nochmals und sagte „wenn ich auch wollte, ich kann die Thüre nicht öffnen, ich habe den Schlüssel nicht.“ Da sprach der wilde Mann „er liegt unter dem Kopfkissen deiner Mutter, da kannst du ihn holen.“ Der Knabe, der seinen Ball wieder haben wollte, schlug alles Bedenken in den Wind und brachte den Schlüssel herbei. Die Thüre gieng schwer auf, und der Knabe klemmte sich den Finger. Als sie offen war, trat der wilde Mann heraus, gab ihm den goldenen Ball und eilte hinweg. Dem Knaben war angst geworden, er schrie und rief ihm nach „ach, wilder Mann, geh nicht fort, sonst bekomme ich Schläge.“ Der wilde Mann kehrte um, hob ihn auf, setzte ihn auf seinen Nacken und gieng mit schnellen Schritten in den Wald hinein. Als der König heim kam, bemerkte er den leeren Käfig und fragte die Königin wie das zugegangen wäre. Sie wußte nichts davon, suchte den Schlüssel, aber er war weg. Sie rief den Knaben, aber niemand antwortete. Der König schickte Leute aus, die ihn auf dem Feld suchen sollten, aber sie fanden ihn nicht. Da konnte er leicht errathen was geschehen war, und es herrschte große Trauer an dem königlichen Hof.
Als der wilde Mann wieder in dem finstern Wald angelangt war, so setzte er den Knaben von den Schultern herab und sprach zu ihm „Vater und Mutter siehst du nicht wieder, aber ich will dich bei mir behalten, denn du hast mich befreit, und ich habe Mitleid mit dir. Wenn du alles thust, was ich dir sage, so sollst dus gut haben. Schätze und Gold habe ich genug und mehr als jemand in der Welt.“ Er machte dem Knaben ein Lager von Moos, auf dem er einschlief, und am andern Morgen führte ihn der Mann zu einem Brunnen und sprach „siehst du der Goldbrunnen ist hell und klar wie Krystall: du sollst dabei sitzen und acht haben daß nichts hinein fällt, sonst ist er verunehrt. Jeden Abend komme ich und sehe ob du mein Gebot befolgt hast.“ Der Knabe setzte sich an den Rand des Brunnens, sah wie manchmal ein goldner Fisch, manchmal eine goldne Schlange sich darin zeigte, und hatte acht daß nichts hinein fiel. Als er so saß, schmerzte ihn einmal der Finger so heftig daß er ihn unwillkürlich in das Wasser steckte. Er zog ihn schnell wieder heraus, sah aber daß er ganz vergoldet war, und wie große Mühe er sich gab das Gold wieder abzuwischen, es war alles vergeblich. Abends kam der Eisenhans zurück, sah den Knaben an und sprach „was ist mit dem Brunnen geschehen?“ „Nichts, nichts“ antwortete er und hielt den Finger auf den Rücken, daß er ihn nicht sehen sollte. Aber der Mann sagte „du hast den Finger in das Wasser getaucht: diesmal mags hingehen, aber hüte dich daß du nicht wieder etwas hinein fallen läßt.“ Am frühsten Morgen saß er schon bei dem Brunnen und bewachte ihn. Der Finger that ihm wieder weh und er fuhr damit über seinen Kopf, da fiel unglücklicher Weise ein Haar herab in den Brunnen. Er nahm es schnell heraus, aber es war schon ganz vergoldet. Der Eisenhans kam und wußte schon was geschehen war. „Du hast ein Haar in den Brunnen fallen lassen,“ sagte er, „ich will dirs noch einmal nachsehen, aber wenns zum drittenmal geschieht, so ist der Brunnen entehrt, und du kannst nicht länger bei mir bleiben.“ Am dritten Tag saß der Knabe am Brunnen, und bewegte den Finger nicht, wenn er ihm noch so weh that. Aber die Zeit ward ihm lang, und er betrachtete sein Angesicht, das auf dem Wasserspiegel stand. Und als er sich dabei immer mehr beugte, und sich recht in die Augen sehen wollte, so fielen ihm seine langen Haare von den Schultern herab in das Wasser. Er richtete sich schnell in die Höhe, aber das ganze Haupthaar war schon vergoldet und glänzte wie eine Sonne. Ihr könnt denken wie der arme Knabe erschrack. Er nahm sein Taschentuch und band es um den Kopf, damit es der Mann nicht sehen sollte. Als er kam, wußte er schon alles und sprach „binde das Tuch auf.“ Da quollen die goldenen Haare hervor und der Knabe mochte sich entschuldigen, wie er wollte, es half ihm nichts. „Du hast die Probe nicht bestanden und kannst nicht länger hier bleiben. Geh hinaus in die Welt, da wirst du erfahren, wie die Armuth thut. Aber weil du kein böses Herz hast und ichs gut mit dir meine, so will ich dir eins erlauben: wenn du in Noth geräthst, so geh zu dem Wald und rufe „Eisenhans,“ dann will ich kommen und dir helfen. Meine Macht ist groß, größer als du denkst, und Gold und Silber habe ich im Überfluß.“
Da verließ der Königssohn den Wald und gieng über gebahnte und ungebahnte Wege immer zu, bis er zuletzt in eine große Stadt kam. Er suchte da Arbeit, aber er konnte keine finden und hatte auch nichts erlernt, womit er sich hätte forthelfen können. Endlich gieng er in das Schloß und fragte ob sie ihn behalten wollten. Die Hofleute wußten nicht wozu sie ihn brauchen sollten, aber sie hatten Wohlgefallen an ihm und hießen ihn bleiben. Zuletzt nahm ihn der Koch in Dienst und sagte er könnte Holz und Wasser tragen und die Asche zusammen kehren. Einmal, als gerade kein anderer zur Hand war, hieß ihn der Koch die Speisen zur königlichen Tafel tragen, da er aber seine goldenen Haare nicht wollte sehen lassen, so behielt er sein Hütchen auf. Dem König war so etwas noch nicht vorgekommen, und er sprach „wenn du zur königlichen Tafel kommst, mußt du deinen Hut abziehen.“ „Ach Herr,“ antwortete er, „ich kann nicht, ich habe einen bösen Grind auf dem Kopf.“ Da ließ der König den Koch herbei rufen, schalt ihn und fragte wie er einen solchen Jungen hätte in seinen Dienst nehmen können; er sollte ihn gleich fortjagen. Der Koch aber hatte Mitleiden mit ihm und vertauschte ihn mit dem Gärtnerjungen.
Nun mußte der Junge im Garten pflanzen und begießen, hacken und graben, und Wind und böses Wetter über sich ergehen lassen. Einmal im Sommer als er allein im Garten arbeitete, war der Tag so heiß daß er sein Hütchen abnahm und die Luft ihn kühlen sollte. Wie die Sonne auf das Haar schien, glitzte und blitzte es daß die Strahlen in das Schlafzimmer der Königstochter fielen und sie aufsprang um zu sehen was das wäre. Da erblickte sie den Jungen und rief ihn an „Junge, bring mir einen Blumenstrauß.“ Er setzte in aller Eile sein Hütchen auf, brach wilde Feldblumen ab und band sie zusammen. Als er damit die Treppe hinauf stieg, begegnete ihm der Gärtner und sprach „wie kannst du der Königstochter einen Strauß von schlechten Blumen bringen? geschwind hole andere, und suche die schönsten und seltensten aus.“ „Ach nein,“ antwortete der Junge, „die wilden riechen kräftiger und werden ihr besser gefallen.“ Als er in ihr Zimmer kam, sprach die Königstochter „nimm dein Hütchen ab, es ziemt sich nicht daß du ihn vor mir auf behältst.“ Er antwortete wieder „ich darf nicht, ich habe einen grindigen Kopf.“ Sie griff aber nach dem Hütchen und zog es ab, da rollten seine goldenen Haare auf die Schultern herab, daß es prächtig anzusehen war. Er wollte fortspringen, aber sie hielt ihn am Arm und gab ihm eine Hand voll Dukaten. Er gieng damit fort, achtete aber des Goldes nicht, sondern er brachte es dem Gärtner und sprach „ich schenke es deinen Kindern, die können damit spielen.“ Den andern Tag rief ihm die Königstochter abermals zu er sollte ihr einen Strauß Feldblumen bringen, und als er damit eintrat, grapste sie gleich nach seinem Hütchen und wollte es ihm wegnehmen, aber er hielt es mit beiden Händen fest. Sie gab ihm wieder eine Hand voll Dukaten, aber er wollte sie nicht behalten und gab sie dem Gärtner zum Spielwerk für seine Kinder. Den dritten Tag giengs nicht anders, sie konnte ihm sein Hütchen nicht weg nehmen, und er wollte ihr Gold nicht.
Nicht lange danach ward das Land mit Krieg überzogen. Der König sammelte sein Volk und wußte nicht ob er dem Feind, der übermächtig war und ein großes Heer hatte, Widerstand leisten könnte. Da sagte der Gärtnerjunge „ich bin herangewachsen und will mit in den Krieg ziehen, gebt mir nur ein Pferd.“ Die andern lachten und sprachen „wenn wir fort sind, so suche dir eins: wir wollen dir eins im Stall zurück lassen.“ Als sie ausgezogen waren, gieng er in den Stall und zog das Pferd heraus; es war an einem Fuß lahm und hickelte hunkepuus, hunkepuus. Dennoch setzte er sich auf und ritt fort nach dem dunkeln Wald. Als er an den Rand desselben gekommen war, rief er dreimal Eisenhans so laut daß es durch die Bäume schallte. Gleich darauf erschien der wilde Mann und sprach „was verlangst du?“ „Ich verlange ein starkes Roß, denn ich will in den Krieg ziehen.“ „Das sollst du haben und noch mehr als du verlangst.“ Dann gieng der wilde Mann in den Wald zurück, und es dauerte nicht lange, so kam ein Stallknecht aus dem Wald und führte ein Roß herbei, das schnaubte aus den Nüstern, und war kaum zu bändigen. Und hinterher folgte eine große Schaar Kriegsvolk, ganz in Eisen gerüstet, und ihre Schwerter blitzten in der Sonne. Der Jüngling übergab dem Stallknecht sein dreibeiniges Pferd, bestieg das andere und ritt vor der Schaar her. Als er sich dem Schlachtfeld näherte, war schon ein großer Theil von des Königs Leuten gefallen und es fehlte nicht viel, so mußten die übrigen weichen. Da jagte der Jüngling mit seiner eisernen Schaar heran, fuhr wie ein Wetter über die Feinde und schlug alles nieder was sich ihm widersetzte. Sie wollten fliehen, aber der Jüngling saß ihnen auf dem Nacken und ließ nicht ab bis kein Mann mehr übrig war. Statt aber zu dem König zurück zu kehren, führte er seine Schaar auf Umwegen wieder zu dem Wald und rief den Eisenhans heraus. „Was verlangst du?“ fragte der wilde Mann. „Nimm dein Roß und deine Schaar zurück und gib mir mein dreibeiniges Pferd wieder.“ Es geschah alles, was er verlangte, und ritt auf seinem dreibeinigen Pferd heim. Als der König wieder in sein Schloß kam, gieng ihm seine Tochter entgegen und wünschte ihm Glück zu seinem Sieg. „Ich bin es nicht, der den Sieg davon getragen hat“ sprach er „sondern ein fremder Ritter, der mir mit seiner Schaar zu Hilfe kam.“ Die Tochter wollte wissen wer der fremde Ritter wäre, aber der König wußte es nicht und sagte „er hat die Feinde verfolgt, und ich habe ihn nicht wieder gesehen.“ Sie erkundigte sich bei dem Gärtner nach seinem Jungen: der lachte aber und sprach „eben ist er auf seinem dreibeinigen Pferd heim gekommen, und die andern haben gespottet und gerufen „da kommt unser Hunkepuus wieder an.“ Sie fragten auch „hinter welcher Hecke hast du derweil gelegen und geschlafen?“ Er sprach aber „ich habe das beste gethan, und ohne mich wäre es schlecht gegangen.“ Da ward er noch mehr ausgelacht.“
Der König sprach zu seiner Tochter „ich will ein großes Fest ansagen lassen, das drei Tage währen soll, und du sollst einen goldenen Apfel werfen: vielleicht kommt der unbekannte herbei.“ Als das Fest verkündigt war, gieng der Jüngling hinaus zu dem Wald und rief den Eisenhans. „Was verlangst du?“ fragte er. „Daß ich den goldenen Apfel der Königstochter fange.“ „Es ist so gut als hättest du ihn schon“ sagte Eisenhans, „du sollst auch eine rothe Rüstung dazu haben und auf einem stolzen Fuchs reiten.“ Als der Tag kam, sprengte der Jüngling heran, stellte sich unter die Ritter und ward von niemand erkannt. Die Königstochter trat hervor und warf den Rittern einen goldenen Apfel zu, aber keiner fieng ihn als er allein, aber sobald er ihn hatte, jagte er davon. Am zweiten Tag hatte ihn Eisenhans als weißen Ritter ausgerüstet und ihm einen Schimmel gegeben. Abermals fieng er allein den Apfel, verweilte aber keinen Augenblick, sondern jagte damit fort. Der König ward bös und sprach „das ist nicht erlaubt, er muß vor mir erscheinen und seinen Namen nennen.“ Er gab den Befehl, wenn der Ritter, der den Apfel gefangen habe, sich wieder davon machte, so sollte man ihm nachsetzen und wenn er nicht gutwillig zurück kehrte, auf ihn hauen und stechen. Am dritten Tag erhielt er vom Eisenhans eine schwarze Rüstung und einen Rappen und fieng auch wieder den Apfel. Als er aber damit fortjagte, verfolgten ihn die Leute des Königs und einer kam ihm so nahe daß er mit der Spitze des Schwerts ihm das Bein verwundete. Er entkam ihnen jedoch, aber sein Pferd sprang so gewaltig daß der Helm ihm vom Kopf fiel, und sie konnten sehen daß er goldene Haare hatte. Sie ritten zurück und meldeten dem König alles.
Am andern Tag fragte die Königstochter den Gärtner nach seinem Jungen. „Er arbeitet im Garten: der wunderliche Kautz ist auch bei dem Fest gewesen und erst gestern Abend wieder gekommen; er hat auch meinen Kindern drei goldene Äpfel gezeigt, die er gewonnen hat.“ Der König ließ ihn vor sich fordern, und er erschien und hatte wieder sein Hütchen auf dem Kopf. Aber die Königstochter gieng auf ihn zu und nahm es ihm ab, und da fielen seine goldenen Haare über die Schultern, und er war so schön, daß alle erstaunten. „Bist du der Ritter gewesen, der jeden Tag zu dem Fest gekommen ist, immer in einer andern Farbe, und der die drei goldenen Äpfel gefangen hat?“ fragte der König. „Ja“ antwortete er, „und da sind die Äpfel,“ holte sie aus seiner Tasche und reichte sie dem König. „Wenn ihr noch mehr Beweise verlangt, so könnt ihr die Wunde sehen, die mir eure Leute geschlagen haben, als sie mich verfolgten. Aber ich bin auch der Ritter, der euch zum Sieg über die Feinde geholfen hat.“ „Wenn du solche Thaten verrichten kannst, so bist du kein Gärtnerjunge: sage mir, wer ist dein Vater?“ „Mein Vater ist ein mächtiger König und Goldes habe ich die Fülle und so viel ich nur verlange.“ „Ich sehe wohl,“ sprach der König, „ich bin dir Dank schuldig, kann ich dir etwas zu Gefallen thun?“ „Ja“ antwortete er, „das könnt ihr wohl, gebt mir eure Tochter zur Frau.“ Da lachte die Jungfrau und sprach „der macht keine Umstände, aber ich habe schon an seinen goldenen Haaren gesehen daß er kein Gärtnerjunge ist:“ gieng dann hin und küßte ihn. Zu der Vermählung kam sein Vater und seine Mutter und waren in großer Freude, denn sie hatten schon alle Hoffnung aufgegeben ihren lieben Sohn wieder zu sehen. Und als sie an der Hochzeitstafel saßen, da schwieg auf einmal die Musik, die Thüren giengen auf und ein stolzer König trat herein mit großem Gefolge. Er gieng auf den Jüngling zu, umarmte ihn und sprach „ich bin der Eisenhans, und war in einen wilden Mann verwünscht, aber du hast mich erlöst. Alle Schätze, die ich besitze, die sollen dein Eigenthum sein.“
https://de.wikisource.org/wiki/Der_Eisenhans_(1857)

May 11, 2023 • 58min
EGL025 Onggi und Kimchi: vom Töpfern und Zubereiten der Koreanischen Köstlichkeit
"Zu viel Kimchi."
Ein besonderes Geburtstagsgeschenk sollte es werden: eine moderne Variante des koreanischen Onggi-Topfes, in dem Flo sein eigenes, selbstgemachtes Kimchi fermentieren kann. Dabei geht es um Töpfern, Fermentieren und den Zusammenhang zwischen Sauerkraut und der koreanischen Köstlichkeit Kimchi. Wir sprechen mit einer koreanischen Köchin und einer experimentierfreudigen Töpferin, um besser zu verstehen welche Rolle der traditionelle Onggi-Topf bei der koreanischen Kunst der Fermentation spielt. Dank der Kapillaren in der keramischen Oberfläche des Topfes wird das darin aufbewahrte Essen nicht nur vor Licht und Luft geschützt, sondern auch vor Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Die poröse Oberfläche des Tons sorgt für eine natürliche Belüftung, die eine optimale Umgebung für Bakterien und Hefen schafft, um Lebensmittel zu fermentieren und dadurch ihren Geschmack und ihre Haltbarkeit zu verbessern. Die südkoreanischen Onggi-Töpfe sind aber mehr als nur einfache Gefäße zum Aufbewahren von Lebensmitteln. Sie sind ein lebendiger Ausdruck der traditionellen koreanischen Kultur und Kunsthandwerkskunst.
Shownotes
Onggi (english) auf Wikipedia
Kimchi
Barbara Jenner
Atelier von Ehren gründete Barbara Jenner für Einzelstücke, Kunst und Handarbeit
Keramik der OBAstudios optimiert Alltagsgegenstände in Funktionalität und Design
Porosität keramischer Massen
Was ist Fermentation und welche Lebensmittel sind fermentiert?
So funktioniert Fermentieren (text plus video)
Unsere Rezeptempfehlung: Baechu Kimchi (Napa Kohl Kimchi) nach Sunny Lee auf Serious Eats
Die Kimchi-Herstellerin Sunny Lee
Leckeres Kimchi in Düsseldorf gibt's hier
Mitwirkende
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Barbara Jenner
About
Sarl
Kimchi Queen
Die erste Eigentlich-Episode bei der wir zwar laufend reden, aber beim Reden nicht laufen. In Berlin und Düsseldorf versuchen wir getrennt Antwort auf die Fragen zu finden, die wir uns im Verlauf der Recherche bei unseren Telefonaten stellen.
Wir sprachen in Düsseldorf mit einer Koreanerin, die Köchin in ihrem eigenen Restaurant ist und erst in Deutschland Gefallen an der Zubereitung von Kimchi gefunden hat. Sie erinnert sich, welche Rolle Kimchi für die ganze Familie in Korea gespielt hat, wie ihre Mutter einmal im Jahr die Onggi-Töpfe ausgebrannt und die Steine zum Beschweren blitzeblank geputzt hat. Sie weiß noch, dass der beste Ton für die Herstellung der Onggi-Töpfe direkt nach dem Winter aus der Erde gegraben wurde, dass die Töpfe im Winter im Heu nahe des Hauses und im Sommer eingegraben am Flussufer kühl lagern, idealerweise bei 5 Grad Celsius. Wir haben viel über die verschiedenen Arten von Kimchi gelernt, die es in Korea gibt und wie man den Fermentationsprozess steuert, um das beste Ergebnis zu erzielen.
In Berlin treffen wir auf die Töpferin, Künstlerin und promovierte Kunstwissenschaftlerin Barbara Jenner, die ein offenes Ohr und dazu passend viele Ideen für einen zeitgemäßen Onggi-Topf hat, der koreanische Tradition mit deutschem Sauerkraut zu verbinden weiß. Wir lernen viel über das Brennen von Ton, das Glasieren, Porosität, Schrumpfen beim Trocknen — und wider erwarten, dass Onggi nicht der Name des Topfes ist, sondern die Bezeichnung für die Art der Herstellung solcher Töpfe. Auch wenn wir anfangs dachten wir könnten Flo vielleicht selber was töpfern, entscheiden wir uns erleichtert den Topf beim Atelier von Ehren, Barbara Jenners Werkstatt für Einzelstücke, Kunst und Handarbeit, in Auftrag zu geben.
Wir schaffen es gerade so — und das haben wir leider nicht in unseren Telefongesprächen und Interviews festgehalten — in Berlin ein Kimchi anzusetzen, dass genau die optimalen 6-8 Wochen Fermentierung durchlaufen kann, bis wir alles zu Flos Geburtstagsparty zusammenführen können. Unser Kimchi ist echt scharf und wir geben den Startschuss für das Buffet: „Onggi, Töpfe, fertig, los!“
Nach der Folge ‚ran an den Kohl: Unsere Kimchi-Rezept Empfehlung. In der Episode selbst hören wir viel über die Tradition und Herstellung von Kimchi — aber ein detailliertes Rezept fehlt noch. Den fertigen Onggi-Topf wollten wir Flo natürlich mit Kimchi überreichen. Lange haben wir nach einem Rezept gesucht und uns schließlich für eines der passionierten Kimchi-Herstellerin Sunny Lee entschieden. Sie wurde in Seoul geboren und zog in den USA auf, wo sie ihre Liebe zum Kimchi entdeckte und begann, es selbst herzustellen. Auf der Seite schreibt sie auch viel über ihre Techniken und Methoden, um die beste Qualität zu bieten und gleichzeitig ihre kulturelle Verbindung zur koreanischen Küche aufrechtzuerhalten. Das passt gut zu unserer Episode. Wichtiger noch: das fertige Kimchi war wirklich lecker. Für die vegange Variante geht es auch ohne Fischsauce.
Kimchi Machen: unsere leckeren Fotos!

Apr 27, 2023 • 1h 25min
EGL024 Unter Schnee - Märchen von Fuchsgeistern
Unsere Märchenreihe startet mit Geschichten von Fuchsgeistern aus der chinesischen Mythologie.
Flo schlägt in dieser Episode einen langen Einleitungsbogen aus aktuellem Anlass: Ulrike Ottinger übergibt ihr Werk der Stiftung Deutscher Kinemathek und der Akademie der Künste. Ulrike Ottinger hat großartige Filme und Kunstwerke geschaffen. Eines davon heißt "Unter Schnee" und erzählt eine magische Geschichte von einer Fuchsfee und einem Studenten, die durch das alte Japan reisen. Flo nimmt sich die Hörspiel-Fassung von "Unter Schnee" zum Anlass, um tiefer in die Geschichten von Fuchsgeistern in der asiatischen Mythologie einzusteigen: Er liest Micz fünf chinesische Märchen vor, die von Fuchsgeistern handeln. Micz darf im Anschluss die Märchen analysieren und so erfahren wir mehr über die Eigenschaften von Fuchsgeistern.
Auch dieses Mal führt unsere Route auf einen "Berg" zu einem Flakturm hoch, dem Flakturm des Humboldthains. Dieser jedoch ist im Gegensatz zu den anderen Trümmerbergen unserer vergangenen Episoden noch ganz geblieben und lässt uns manchmal außer Puste kommen.
Shownotes
EGL024 | Wanderung | Komoot
Ulrike Ottinger
Ulrike Ottinger – Wikipedia
Ulrike Ottinger - Ulrike OTTINGER
Südostpassage - Ulrike OTTINGER
Ulrike Ottinger übergibt ihr Archiv an die Akademie der Künste und Deutsche Kinemathek | Akademie der Künste, Berlin
Ottinger | Akademie der Künste, Berlin
Ulrike Ottinger: »Die Realität ist eine Konstruktion, manchmal eine Illusion« - YouTube
Ulrike Ottinger | filmportal.de
Unter Schnee - Ulrike OTTINGER
Märchen
Asien, Richard Wilhelm: Chinesische Volksmärchen, Anmerkungen, Natur- und Tiergeister - Zeno.org
Märchen – Wikipedia
Fuchsgeister in Asien (China / Japan)
Fox spirit - Wikipedia
Kitsune – Wikipedia
Nine-tailed fox - Wikipedia
https://www.japanwelt.de/blog/kitsune-mythologie
Kitsune, die Fuchsgeister der japanischen Folklore - Blogs - derStandard.de › Diskurs
Shintō – Wikipedia
https://epub.ub.uni-muenchen.de/5334/1/5334.pdf
Die Geschichte von "Unter Schnee"
Filmaufnahmen und Hörspiel: "Unter Schnee" von Ulrike Ottinger | Hörspiel | Bayern 2 | Radio | BR.de\n\n
Provinz Echigo – Wikipedia
Kabuki – Wikipedia
Über die Laufroute
Berliner Flaktürme – Wikipedia
Wiener Flaktürme – Wikipedia
Zu den Märchen
Der Fuchs und der Tiger – Wikisource
Der Grüffelo – Wikipedia
Äsops Fabeln – Wikipedia
Daji - Wikipedia
Fuchsfeuer – Wikisource
Das kalte Herz – Wikipedia
Konfuzianismus – Wikipedia
Luminary Web
Mitwirkende
Florian Clauß
(Erzähler)
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Hier noch mal die Märchen zur Episode zum (nach)lesen, weil sich das Vorlesen nicht immer als flüßig gestaltet hat…
Märchen I: Der Fuchs und der Tiger
Der Fuchs begegnete einst einem Tiger. Der zeigte ihm die Zähne, streckte die Krallen hervor und wollte ihn fressen. Der Fuchs sprach: »Mein Herr, Ihr müßt nicht denken, daß Ihr allein der Tiere König seid. Euer Mut kommt meinem noch nicht gleich. Wir wollen zusammen gehen, und Ihr wollet Euch hinter mir halten. Wenn die Menschen mich sehen und sich nicht fürchten, dann mögt Ihr mich fressen.«Der Tiger wars zufrieden, und so führte ihn der Fuchs auf eine große Straße. Die Wanderer nun, wenn sie von fern den Tiger sahen, erschraken alle und liefen weg.Da sprach der Fuchs: »Was nun? Ich ging voran; die Menschen sahen mich und sahen Euch noch nicht.«Da zog der Tiger seinen Schwanz ein und lief weg.Der Tiger hatte wohl bemerkt, daß die Menschen sich vor dem Fuchse fürchteten, doch hatte er nicht bemerkt, daß der Fuchs des Tigers Furchtbarkeit entlehnte.
Märchen II: Ein Fuchsgeist macht die Rechnung auf
Ein gewisser Zhang aus Hezhou war zu Gast in Yangzhou und wohnte in einem Tempel. In einer der Mönchszellen trieb immer ein Fuchsgeist sein Unwesen, darum wagte niemand, darin zu wohnen. Zhang aber hatte ein unbekümmertes Wesen, darum ging er hin und nahm dort Quartier. Ehe drei Tage um waren, erschien tatsächlich ein alter Mann, der sich Wu Gangzi nannte und darum bat, ihm seine Aufwartung machen zu dürfen. Als er sprach, nachdem er sich verbeugt hatte, war er von außergewöhnlichem Charme, und er wußte überVergangenheit und Zukunft Bescheid. Zhang fragte ihn: »Ihr seid doch e?n Unsterblicher?« Dar- auf erwiderte er nur: »Zuviel der Ehre!«Als armer Gelehrter wünschte sich Zhang, er könnte Umgang mit dem Fuchsgeist haben, um so zu Reichtum und Ansehen zu kommen, darum tischte er Wein und Speisen auf und lud ihn ein. Wu bedankte sich mit einer Gegeneinladung. Es dauerte keinen halben Monat, da waren Zhangs Mittel erschöpft, bei Wu aber war der Tisch stets reich gedeckt. In seiner Gier lud sich Zhang immer wieder bei ihm ein, und Wu war als Gastgeber nicht knauserig.Nachdem es länger als einen Monat so gegangen war, kam Wu plötzlich nicht mehr. Da eben Regenzeit war, öffnete Zhang seine Truhe, um die Kleider zu lüften, und fand sie leer, nur eine Rechnung und ein paar Pfandzettel lagen darin. Auf der Rechnung stand, wie viele Hühner und Fische Wu an welchem Tag gekauft hatte und wieviel Obst und Gemüse. Um aber die Einkäufe zu bezahlen, hatte er Zhangs Kleider versetzt. Kein einziges Gastmahl war ausgelassen, und keine einzige Bronzemünze hatte er unterschlagen.
Märchen III: Fuchsfeuer
Es war einmal ein Bauer, der war jung und stark und kam eines Abends spät vom Markte heim. Der Weg führte an dem Garten eines reichen Herrn vorbei, in dem viel hohe Gebäude standen. Plötzlich sah er drinnen etwas Helles in die Höhe schweben, das leuchtete wie eine Kristallperle. Er wunderte sich darüber und stieg über die Mauer in den Garten, aber da war kein Mensch zu sehen; nur von weitem erblickte er ein Ding, das sah aus wie ein Hund und schaute nach dem Mond empor. Immer wenn es den Atem ausstieß, kam eine Feuerkugel aus seinem Maul heraus, die stieg empor bis zum Mond. Wenn es den Atem einzog, so senkte sich die Kugel wieder herunter, und es fing sie mit dem Maule wieder auf. So ging es unaufhörlich fort. Da merkte der Bauer, daß es ein Fuchs war, der das Lebenselixier bereitete. Er versteckte sich nun im Gras und wartete, bis die Feuerkugel wieder herunterkam, ungefähr in die Höhe seines Kopfes. Da trat er eilends hervor und nahm sie weg. Sofort verschluckte er sie. Er fühlte, wie es heiß ihm die Brust hinunterging bis in die Gedärme hinein. Als der Fuchs es merkte, wurde er böse. Er blickte ihn wütend an, doch fürchtete er sich vor seiner Stärke; darum wagte er nicht, ihn anzugreifen, sondern ging zornig weg.
Von da ab konnte der Bauernbursche sich unsichtbar machen, er konnte Geister und Teufel sehen und hatte Verkehr mit der andern Welt. Er konnte in Krankheitsfällen, wenn die Leute bewußtlos waren, ihre Seelen wieder zurückrufen und wenn sich jemand versündigt hatte, für ihn eintreten. Er verdiente sehr viel Geld auf diese Weise.
Als er sein fünfzigstes Jahr vollendet hatte, da zog er sich von all diesen Dingen zurück und übte seine Künste nicht mehr aus. An einem Sommerabend saß er in seinem Hof, um der Kühlung zu genießen. Er trank für sich allein einen Becher Wein um den andern. Um Mitternacht war er vollkommen betrunken. Er stemmte die Hände auf den Boden und erbrach sich. Da war es ihm plötzlich, als ob ihm jemand auf den Rücken klopfte. Das Erbrechen wurde heftiger, und schließlich sprang die Feuerkugel ihm zum Halse heraus.
Der andere nahm sie in die Hand und sprach: »Dreißig Jahre lang hast du meinen Schatz entlehnt. Aus einem armen Bauernburschen bist du ein reicher Mann geworden. Nun hast du genug. Ich möchte ihn wieder zurück haben.«
Da ward der Mann vollkommen nüchtern. Aber der Fuchs war weg.
Märchen IV: Zhang Guang
Zhang Guang aus der Provinz Zhili war schon als Kind außergewöhnlich klug gewesen. Als er achtzehn Jahre alt war, wohnte er im Westbau des Anwesens und studierte dort die Schriften. Die Familie war reich und mächtig und besaß viele Sklavenmädchen und Nebenfrauen, aber die Eltern hielten ihn sehr streng.Am siebten Tag des siebten Monats schaute er, mit dem Gedanken an die Geschichte vom Hirten und der Weberin im Kopf, zu den Sternen empor und träumte davon, daß wenigstens in dieser Nacht ein Sklavenmädchen ihn Einsamen besuche kam. Und kaum daß sich dieser Gedanke bei ihm geregt hatte, sah er hinter dem Türvorhang ein Mädchen stehen. Als er sie anrief, antwortete sie nicht, Wenig später aber trat sie langsam vor ihn hin, und als er sie anschaute, stellte er fest, daß sie keines der Sklavenmädchen des Hauses war. Er fragte sie nach dem Namen ihrer Familie, und sie antwortete: »Wang.« Als er fragte, wo sie wohnte, sagte sie: »Wir eure Nachbarn auf der Westseite. Morgens und abends kann ich dich hinaus- und hineingehen sehen und liebe dich deines Aussehens wegen. Deshalb bin ich gekommen, um mich dir hinzugeben.« Zhang freute sich, und sie teilten sogleich das Lager. Von nun an kam sie jede Nacht.Da ein Sklavenjunge bei Zhang wohnte, stachelte sie Zhang an: »Es ist nicht gut, daß der Junge hier ist. Du könntest ihm befehlen, weiter weg zu schlafen und erst zu kommen, wenn du ihn rufst.« Also wollte Zhang den Sklavenjungen fortschicken, der aber sagte: »Jede Nacht höre ich eine zarte Frauenstimme aus Eurem Bett und fürchte, es steckt etwas dahinter. Der alte Herr hat mir befohlen, für Euch zu sorgen und Euch zu beschützen, darum wage ich mich nicht zu entfernen.« Da konnte Zhang nichts machen und berichtete dem Mädchen, was der Sklavenjunge gesagt hatte. »Schon gut«, bemerkte sie dazu. »Er bringt sich nur selbst in Schwierigkeiten.«Am selben Abend wurde der Sklavenjunge, ehe er fest eingeschlafen war, von jemand gepackt und gefesselt und im westlichen Garten an einen Baum gehängt. Dort rief er verzweifelt nach seinem jungen Herrn um Hilfe. Lachend sagte das Mädchen zu ihm: »Wenn du deine Schuld wirklich einsiehst und dich fernhältst, soll dir vergeben werden. Wenn du aber wagst, etwas auszuplaudern, so daß es der alte Herr erfährt, wird dir doppelt so großes Leid geschehen.«Der Sklavenjunge versprach es, und sofort löste sich und der stand wieder auf der Erde.Nach gut einem Jahr wurde Zhang allmählich mager und hinfällig. Sein Vater befragte den Sklavenjungen, der versicherte beim jungen Herrn sei alles In Ordnung, seine Miene aber wurde derweil immer verzagter. Da wuchs das Mißtrauen des Vaters und er ging zur Studierstube des Sohnes, um sich ein eigenes Bild zu verschaffen. Als er zwischen den Bettvorhängen eine Frauenstimme hörte, stieg er ohne weiteres durchs Fenster. Aber als er den Bettvorhang hochhob, war keine Frau dahinter. Nur ein goldener Haarpfeil und eine Weißdornblüte lagen neben dem Kissen. Der Vater bedachte, daß in ihrer Gegend kein Weißdorn wuchs, deshalb glaubte er, die Blüte könne nur ein Dämon mitgebracht haben, und in seinem Zorn wollte er den Sohn durchprügeln, der jetzt notgedrungen die Wahrheit sagte. Daraufhin ließ der Vater angesehene buddhistische und daoistische Mönche holen, die Altäre errichteten und Beschwörungen vornahmen.In der Nacht kam das Mädchen noch einmal und sagte weinend zu Zhang: »Das Geheimnis ist offenbar geworden, ich bitte, mich verabschieden zu dürfen.«Auch Zhang war tiefbetrübt. Als sie sich trennen mußten, fragte er: »Werden wir einander wiedersehen?« – »In zwanzig Jahren sehen wir uns in Huazhou«, erwiderte das Mädchen, und von nun an kam sie nicht mehr.Zhang heiratete dann eine Frau Chen, bestand die Prüfung als Doktor, wurde zum Kreisvorsteher von Wujiang ernannt und schließlich zum Gebietsvorsteher von Huazhou befördert. Als seine Frau starb, suchte sein Vater in der Heimat ein Fräulein Wang als neue Frau für ihn aus und schickte sie zu ihm an seinen Amtssitz in Huazhou, damit er sie dort heiratete. Als er am Abend nach vollzogenen Riten zum erstenmal das Gesicht der Neuen sah, entdeckte er, daß sie aufs Haar dem Mädchen glich, das in seiner Studierstube die Nächte mit ihm geteilt hatte. Und als er nach ihrem Alter fragte, ergab sich, dass sie eben zwanzig war.Jemand sagte: »Sie ist ein Fuchsgeist und wurde nur aus Liebe wiedergeboren.« Doch als Zhang von der Vergangenheit sprach, konnte sie sich an nichts erinnern.
Märchen V: Die große Unsterbliche auf dem Lanzhu-Berg
Auf dem Lanzhu-Berg im Kreis Huijil gibt es ein daoistisches Kloster, das den Namen Orchideenpavillon trägt. Dort wohnt die große Unsterbliche aus dem Norden. Die große Unsterbliche aus dem Norden ist ein Fuchsgeist.Ehedem hielt sich ein Kaufmann namens Chen, der aus Huiji stammte, besuchsweise in Chu auf. Er büßte all sein Vermögen ein und wurde so arm, daß er seinen Unterhalt nicht mehr bestreiten konnte, überdies war er krank. Als Wohnung diente ihm ein verfallener Tempel. Eines Nachts kam ein schönes junges Mädchen zu ihm, das glänzende Kleider trug, die ganz aus leuchtenden Perlen gemacht waren. Als Chen sich erschrocken aufsetzte, streifte sie einen Armreifen vom Handgelenk, den sie ihm mit den Worten reichte: » Ich weiß, daß du Mangel leidest, darum komme ich, um dir dies zu schenken.« Mit diesen Worten ging sie davon.Am nächsten Tag kam sie wieder, und so hielt sie es dann mehrere Monate lang. Sie harmonierten auf Kissen und Matte, und ihre Zuneigung wuchs von Tag zu Tag. Mit Hilfe des goldenen Armreifens kam Chen zu Geld und nahm sein altes Gewerbe wieder auf. Das Mädchen ließ ein Haus bauen und führte ihm die Wirtschaft. Was sie ihm Tag für Tag an Gold, Silber und Kostbarkeiten zukommen ließ, ging in die Zehntausende.Nachdem so mehrere Jahre vergangen waren, bekam Chen plötzlich einen Brief von seinen Angehörigen, und in ihm erwachte der Wunsch, in seiner Heimat den großen Herrn zu spielen. Er hatte aber den Verdacht, das Mädchen müsse ein Geist sein. Darum wartete er ab, bis sie eines Tages nicht zu Hause war, dann rief er Hunderte Träger und Diener zusammen, die schwer beladen in einem langen Zug mit ihm davongingen. Als das Mädchen zurückkam und das Haus ausgeräumt fand, eilte sie Chen hinterher an den Fluß, doch als sie dort ankam, hatten Chens Leute schon unter Rufen und Gesang die Segel gehißt. Da stand sie bitterlich weinend am Ufer und konnte nicht folgen.In die Heimat zurückgekehrt, lebte Chen als reicher Mann. Zehn Jahre später erschien das Mädchen bei ihm, rief ihn an und sprach: »Ich bin ein Fuchsgeist. Tausend Jahre lang hatte ich im verborgenen gute Taten getan, ehe mein Name in die Liste der Unsterblichen aufgenommen wurde.Für deine Untreue habe ich dich beim Himmelskaiser verklagt. Er hat dem Flußgeist befohlen, mir sein Strafmanifest zu übergeben und mich hierherzubringen. Jetzt mußt du sterben!«Von nun an wirbelten Messer durch die Luft, und Flammen züngelten auf, so daß Chens Familie keine ruhige Stunde mehr hatte. Sie versuchten hundert Mittel, um dem Spuk abzuhelfen, aber vergeblich. Da sprach das Mädchen eines Tages seufzend aus der Luft: »Nur weil ich dich einst geliebt habe, ist es so weit gekommen! Wenn ich dich um-bringe, werden wohl alle, die ein Herz in der Brust haben, mich verlachen. Wenn deine Familie mir ein großes Opfer bringt und einen berühmten Berg aussucht, wo ich in Ruhe leben kann, will ich von meiner Rache ablassen.«Damals gab es auf dem Lanzhu-Berg einen Daoisten, der ein großer Magier war. Er richtete ein Opfer aus, das neunundvierzig Tage währte, und fragte das Mädchen: »Willst du nicht bei mir auf dem Lanzhu-Berg wohnen?«»Sehr gern«, erwiderte sie, »aber ich muß fünfhundert Jahre dort wohnen, ehe ich wieder fortgehe.«Von nun an spukte es nicht mehr bei den Chens. Heute gehört das Kloster einer Familie Luo. Die Luos ließen dem Mädchen ein schönes Standbild errichten, und an bestimmten Tagen im Jahr kommt das Mädchen bei Nacht hervor, um sich mit den Leuten zu unterhalten.
Das ausgelassene Märchen:
Der Student Li begegnet einer Füchsin
Der Student Li Shengxiu aus dem Kreis She war eine stattliche Erscheinung. Mit vierzehn Jahren lernte er zwanzig Li* von zu Hause entfernt in der Yanzhen-Villa. Eines Abends in der zweiten Nachtwache erblickte er, nachdem er sich schlafen gelegt hatte, plötzlich ein schönes Mädchen, das bei ihm auf dem Bett saß und ihn lieblich anschaute. Sie mochte etwa fünfzehn Jahre alt sein. Das Herz begann ihm zu klopfen, und er hob die Hand, um sie zu Decken. Das Mädchen wehrte sich nicht, und so wurden sie beide ein Paar.Sie kam dann von sich aus jede Nacht mit flinken Schritten. Häufig unterwies sie ihn in der Dichtkunst und verbesserte seine Verse, als er jedoch einmal auf Prüfungsaufsätze zu sprechen kam, machte sie ein finsteres Gesicht und sagte: »Das hat nichts mit Bildung zu tun. Außerdem ist dir kein Prüfungsglück beschieden. Wozu also willst du dich diesen Mühen unterwerfen?« Dann widmeten sie sich einander wieder den Gedichten, und das wurde ihnen nie langweilig.So ging es mehrere Jahre, ohne daß jemand etwas davon merkte.Dann aber zog auch Lis Vetter Yang in die Villa, um dort in Abgeschiedenheit zu lernen, und sein Zimmer war nur durch eine Wand von der Studierstube getrennt, in der Li wohnte.Yang wunderte sich oft, daß Li seine Tür schloß, sobald es nur dunkel wurde. In einer Mondnacht spähte er heimlich durch eine Mauerritze und sah Li mit einem schönen Mädchen im Arm dasitzen. Sofort klopfte er bei ihm an und trat ein, doch obwohl er alles mit der Kerze ableuchtete, konnte er niemand finden. Und als er direkt danach fragte, leugnete Li. In der nächsten Nacht spähte Yang wieder durch die Ritze und sah genau das gleiche, außerdem hörte er die beiden plaudern und lachen. Er konnte sich denken, daß das Mädchen eine Füchsin war, darum lief er zu Lis Vater und erzählte ihm alles.Als Li nach Hause kommen mußte, folgte ihm die Füchsin dorthin, aber niemand anders konnte sie sehen als Li allein.Die ganze Familie glaubte, sie werde ihm schaden. Eines Tages kam Lis Schwägerin zu Besuch und erhob mit lauter Stimme den Vorwurf: »Ist diese Gespensterfüchsin nicht unverschämt, daß sie sich einfach einen Mann schnappen will?! Dabei ist doch mein Schwager schon von klein auf verlobt. Wenn er heiratet, wer soll dann Hauptfrau sein und wer Nebenfrau?«In der Nacht sprach die Füchsin unter Tränen zu Li: »Deine Schwägerin hat vollkommen recht mit ihren Vorwürfen. Es gibt keinen anderen Weg, ich muß fortgehen. Heute nehmen wir Abschied für immer!«Li brach darüber in Tränen aus und versuchte vergeblich, sie zum Bleiben zu bewegen. Dann schluchzten sie die ganze Nacht hindurch auf dem Kissen, und als das Krähen der Hähne zu hören war, stieg das Mädchen aus dem Bett und war verschwunden.Sowohl seine dichterischen Fähigkeiten als auch seine Geschicklichkeit in der Kampfkunst verdankte Li der Füchsin.Die Gedichte, die sie für ihn geschrieben hat, sollen von klarer Schönheit gewesen sein. Leider haben die Leute, von denen die Geschichte verbreitet wurde, sie nicht aufgeschrieben. Auch Li selbst soll kein Geheimnis daraus gemacht haben.

Apr 13, 2023 • 1h 20min
EGL023 Stromgitarre Teil 2 - Tonabnehmer: Single-Coil, Humbucker, Coil-Tapping -Splitting, Magnete, Spulen, Alumitone Pickups.
"Just keep playing" -- J Mascis
Die schwingende Saite einer E-Gitarre wirkt auf ein Magnetfeld ein, dessen Veränderung von einer Spule erfasst und dadurch in elektrische Spannung umgewandelt wird. Eigentlich sind damit schon die Pickup-Basics erklärt. So bleibt uns viel Zeit in dieser Episode den begeisterten Blick auf die vielen Parameter wie Position, Windungsanzahl und -richtung, Abstand der Pole oder die Art der Magnete zu richten, die Klang und Charakter einer Stromgitarre ausmachen. Humbucker und Coil-Splitting finden genauso Platz wie Single-Coil und Coil-Tapping. Abschließend sprechen wir noch über die vielleicht aktuellste 'game changing' Neuerung im Bereich passiver Tonabnehmer: den Alumitone Pickup. Nicht genügend Zeit haben wir leider für Rails, P90, Jazzmaster, Mini-Humbucker oder P-Rails gefunden. Das nennen wir Hausaufgaben!
Shownotes
Laufroute
EGL023 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
Mehringplatz (weil wir laufend Reden)
Hallesches Tor
Elektro-magnetische Tonabnehmer (englisch: Pickup)
Der Single-Coil Pickup
Der Humbucker Pickup und die Variationen split-coil und stacked
Große Sammlung an Pickup Sounds auf der Rockinger Website
Magnetmaterialien und ihre Auswirkungen auf den Klang
Technisches Verständnis Coil Tapping vs Splitting (Forum)
DIY Alumitone from Copper Full Build and Demo (Super Simple!)
1960’s Vintage Guitar Designs
1970’s Vintage Guitar Designs
Guitar Design: From Cheap Imports to Vintage Gear: the Story of Teisco Guitars
Coil Tap vs Coil Split: What's The Difference? | Too Afraid To Ask
Brummen: Übliche Abschirmungs- und Massefehler
J Mascis: "Just keep playing"
Identifying Pickup Wires & Polarities - Humbucker
Fred Stuart demonstrates the art of hand-winding pickups
Gibson Les Paul Comparison | Humbucker vs P90 vs Mini Humbucker
How Do Noiseless Single Coils Work?
FENDER Noiseless Pickups vs Single Coils! - Can You Hear The Difference?
Mitwirkende
Micz Flor
(Erzähler)
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Verwandte Episoden
EGL052 Darum klingen handgewickelte Tonabnehmer wirklich besser: die Rolle parasitärer Kapazität und Kondensatoren bei „scatter wound pickups“ E-Gitarren | Stromgitarre Teil 3EGL057 Ist der Sommer so schön wie die Fender Telecaster Thinline, klangvoll wie ein P-90 Pickup und werden wir ihn vermissen wie ich meine grüne SG Copy? Stromgitarre Teil 4EGL086 Pickup-Physik deiner E-Gitarre: Humbucking und Phasendrehung richtig planen (Stromgitarre 7)
Miczs Begeisterung vermag Flo nur begrenzt mitzureißen. E-Gitarren elektrisieren ihn einfach weniger. Vielleicht liegt es aber auch am Wetter, einem nasskalten Frühlingstag, an dem wir unsere Tour am Moritzplatz beginnen. Kreuz und quer laufen wir durch die windigen Schluchten zwischen vielen Nachkriegsbauten in Richtung Mehringplatz, zum Rondell am Halleschen Tor.
Für Micz sind elektromagnetische Tonabnehmer faszinierende Kreaturen, die seit Jahrzehnten sein Herz höherschlagen lassen. Der Zauber liegt in der Vielfältigkeit, die sich schon ganz ohne Effekte oder Modelling herstellen lassen, in den reinen, passiven Systemen. Vom klaren und präzisen Sound eines Single-Coil-Tonabnehmers bis hin zum vollen und satten Klang eines Humbucker-Tonabnehmers gibt es unzählige Möglichkeiten, den Sound der Gitarre zu formen und zu modellieren. Doch es geht hier nicht nur um den Klang, sondern auch um die Technologie und das Design dahinter. Flo wünscht sich gegen Ende Sound-Beispiele, wie sie z.B. hier auf der Rockinger Website zu finden sind.
Die Kombination aus Magnetismus, Elektrizität und Materialwissenschaften kann süchtig machen (sagt Micz, nicht Flo). Mit einfach Mitteln lassen sich die Grenzen des Klangs zu erweitern und neue musikalische Welten erschließen, indem man z.B. die Anzahl der Windungen, Position oder Winkel der Pickups, die Magneten oder die Art des Coil-Splittings beim Humbucker verändert.
Wir erklären Coil-Splitting und Coil-Tapping. Beim Splitting spaltet man einen Humbucker-Tonabnehmer in zwei Single-Coil-Tonabnehmer auf, um in beiden Welten unterwegs zu sein: einen fetten Humbucker-Sound und den klaren, durchdringenden Klang eines Single-Coil-Tonabnehmers. Beim Coil-Tapping hingegen wird ein Teil der Wicklung des Tonabnehmers abgezapft, um den Sound zu verändern. Dadurch kann man die Anzahl der Spulen im Tonabnehmer reduzieren und so den Sound eines fetten Single-Coil Pickups z.B. feiner machen, eher wie bei einer Vintage Strat.
Alleine durch die Varianz der Windungen und Art der Wicklung sowie Distanz zu den Magneten lassen sich so unterschiedliche Sounds erstellen wie Stratocaster Single-Coils (klarer, durchdringender Klang) und P90 Pickups (wärmerer, vollerer Klang mit höherer Ausgangsleistung).
Aber hört selbst. Kragen hoch, Kapuze auf und ab in den Nieselregen. Live and learn.


