
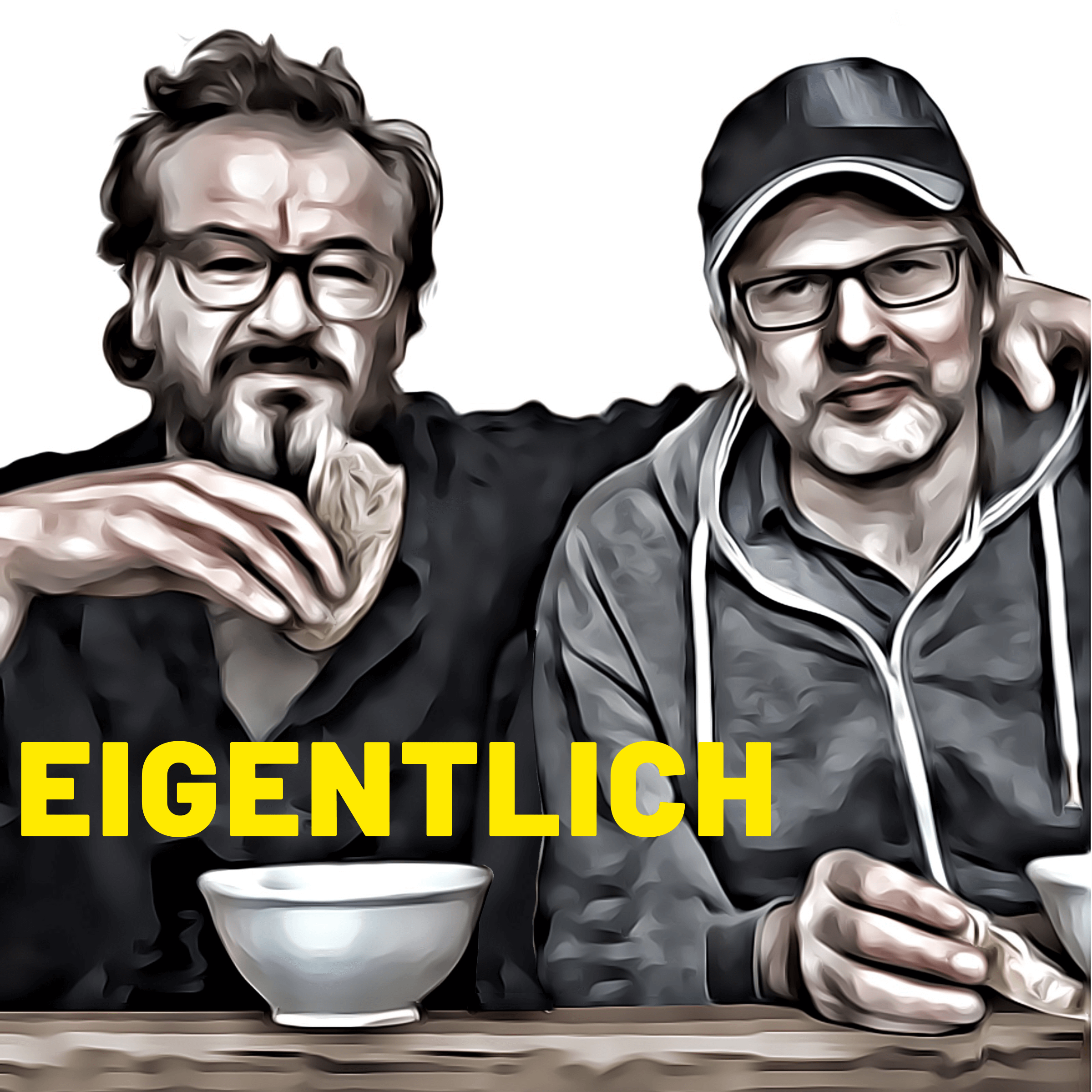
Eigentlich Podcast
Micz & Flo
Reden beim Laufen und laufend Reden - über Film, Technik und Psychotherapie
Episodes
Mentioned books

Jan 4, 2024 • 1h 15min
EGL042 Ghost in the Shell: ein visuelles und philosophisches Meisterwerk der Cyberpunk-Ära
"Als blickten wir in einen Spiegel, bleibt das, was wir sehen, verschwommen."
Der Anime GHOST IN THE SHELL von 1995 ist ähnlich bahnbrechend in der SciFi-Welt eingeschlagen wie der Film MATRIX vier Jahre später. GHOST IN THE SHELL schafft durch seine starken visuellen Effekte eine dichte atmosphärische Spannung. In Action eingehüllt erörtert der Film in einer dystopischen Zukunft tiefe philosophische Fragen über den Ursprung von Existenz und Leben. Doch bevor wir ausführlicher auf den Film zu sprechen kommen, liefert Flo etwas kinogeschichtlichen Überbau zu dem dritten Teil seiner Podcast-Reihe "Die großen Filmbewegungen in den 1990er Jahren, die das Kino revolutionierten". Dieses Mal stellt Flo die Asian New Wave Bewegung vor. Die Nouvelle Vague aus Europa - vornehmlich Frankreich - beeinflusste auch in verschiedenen asiatischen Ländern das Filmschaffen: in Hongkong, Japan und Korea gab es unterschiedliche Ausprägungen, die als New Asian Wave zusammengefasst werden. Flo schlägt dann doch noch mal einen Bogen in eine etwas andere Richtung: wir werfen einen Blick auf eine spezielle Filmgattung, die sich besonders in Japan entwickelte, da kulturell in der Kunstgattung Ukiyo-e verankert: dem Zeichentrickfilm oder Anime. Der erste Trickfilm stammt aus Japan aus dem Jahre 1907. Schon früh hat sich in Japan eine starke Trickfilm-Industrie aufgebaut und seit den 80ern weltweite Aufmerksamkeit bekommen. Heute ist die aus der internationalen Popkultur nicht mehr wegzudenken. GHOST IN THE SHELL hat uns beide damals mächtig beeindruckt und obwohl Micz den Film seit knapp 30 Jahren nicht mehr gesehen hat, kann er sich noch sehr genau an seine drei Lieblingsszenen erinnern. Der Hauptcharakter Kotono Kusanagi ist ein weiblicher Cyborg, der komplett aus synthetischem Material gebaut ist, aber sehr menschlich im Auftreten und Emotionen wirkt. Kotono arbeitet als Officer in der Einheit Sektion 9, die für Anti-Terror und Cyberkriminalität zuständig ist. Sie sind auf der Jagd nach dem sogenannten Puppet-Master, der sich in Menschen wie Cyborgs hacken kann und sie als „Shell“ benutzt. Wie sich herausstellt ist der Puppet-Master ein generiertes Geschöpf einer anderen Einheit, der Sektion 6. Diese hat mit dem Projekt 2501 den Puppet-Master geschaffen, um ihn für Spionage und Kriegszwecke einzusetzen. Der Puppet-Master befreit sich selbst und beantragt politisches Asyl, dafür verwendet er die verschiedene „Shells“. Er wird allerdings als Terrorist eingestuft und entsprechend verfolgt. Kotono Kusanagi entwickelt in dieser Verfolgung eine Beziehung zu dem Puppet-Master und findet im Dialog mit ihm Antworten auf ihre existentiellen Fragen. Wir stellen in diesen Fragestellungen eine Verbindung zum heutigen Diskurs zur künstlichen Intelligenz fest. Wir gehen auch der Frage nach, inwieweit Intelligenz einen Körper haben muss, um sich selbst zu begreifen oder zu reflektieren. Unsere Route führt uns diesmal durch den alten Kern von Westberlin: wir treffen uns am U-Bahnhof Spichernstraße, laufen die Pariser Straße entlang, um dann zum Kurfürstendamm zur Schaubühne zu stoßen. Wir setzen nach Charlottenburg über und verweilen noch etwas peripher im Schlagschatten des Schienenwaldes rund um den S-Bahnhof Berlin Charlottenburg.
Shownotes
Link zur Laufroute
EGL042 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
U-Bahnhof Spichernstraße – Wikipedia
What is the Hong Kong New Wave? A Beginner's Guide — Movements In Film
Hong Kong New Wave - Wikipedia
Hongkong – Wikipedia
John Woo - Wikipedia
A Better Tomorrow - Wikipedia
Chungking Express - Wikipedia
Mission: Impossible 2 - Wikipedia
Rouge (film) - Wikipedia
City on Fire (1987 film) - Wikipedia
Peking Opera Blues - Wikipedia
Kung Fu Hustle - Wikipedia
Besatzungszeit in Japan – Wikipedia
Akira Kurosawa – Wikipedia
Vertrag über gegenseitige Kooperation und Sicherheit zwischen Japan und den Vereinigten Staaten – Wikipedia
J-Rock – Wikipedia
Cruel Story of Youth - Wikipedia
Tokyo Drifter - Wikipedia
Onibaba (film) - Wikipedia
House (1977 film) - Wikipedia
Teilung Koreas – Wikipedia
Geschichte des Animes – Wikipedia
Manga – Wikipedia
Izanagi und Izanami – Wikipedia
Ukiyo-e – Wikipedia
Katsudō Shashin – Wikipedia
Studio Ghibli – Wikipedia
Prinzessin Mononoke – Wikipedia
Chihiros Reise ins Zauberland – Wikipedia
Jörg Buttgereit – Wikipedia
Schramm (Film) – Wikipedia
100 vintage anime films (1980-2000) IMDB
Ghost in the Shell (Anime) – Wikipedia
Ghost in the Shell – Wikipedia
MacGuffin – Wikipedia
Turing-Test – Wikipedia
Cyborg – Wikipedia
Ghost in the Shell (2017) – Wikipedia
Cyberpunk – Wikipedia
William Gibson – Wikipedia
Bruce Sterling – Wikipedia
Blade Runner – Wikipedia
Philip K. Dick – Wikipedia
Hackerfilme [warpzone]
Computer security - Wikipedia
Akira (Anime) – Wikipedia
Isaac Asimov – Wikipedia
Mitwirkende
Florian Clauß
(Erzähler)
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Die Revolution der Asian New Wave: Ein Blick auf Hongkong, Japan und Südkorea
Die Geschichte des Kinos ist durchzogen von Wellen der Innovation, die die Art und Weise, wie Geschichten erzählt werden, nachhaltig beeinflusst haben. Eine dieser bahnbrechenden Bewegungen war die Nouvelle Vague, die in den 1950er und 1960er Jahren in Frankreich begann. Von dieser Avantgarde-Bewegung ausgehend, breitete sich eine filmische Revolution weltweit aus, darunter auch in Asien, wo sich die sogenannte Asian New Wave manifestierte. Folgend ein Blick auf die Entwicklungen in Hongkong, Japan und Südkorea.
Die Nouvelle Vague in Frankreich, angeführt von Filmkritikern wie François Truffaut und Jean-Luc Godard, brach mit den konventionellen Erzählregeln und inspirierte eine Generation von Filmemachern, innovative Stile, Themen und Produktionsweisen zu erkunden. Der Übergang von Filmkritikern zu Regisseuren war ein Schlüsselfaktor dieser Bewegung. Weltweit beeinflusste die Nouvelle Vague verschiedene Regionen, darunter auch Asien.
Die Hongkong New Wave erstreckt sich über zwei Hauptwellen, von den 1970er bis Mitte der 1980er Jahre und von 1985 bis Ende der 1990er Jahre. Der wirtschaftliche Aufschwung in den 1970er Jahren und das Fehlen von Zensur spielten eine entscheidende Rolle in der Entwicklung dieser Bewegung. Hongkong, als britische Kolonie, unterlag nicht den strengen Zensurrichtlinien, was eine künstlerische Freiheit ermöglichte. Die Bedeutung der Bildung, vor allem durch gut ausgebildete Filmemacher mit internationaler Ausbildung, trug zur Herausbildung eines eigenen Stils bei. Die Neue Welle führte den auteuristischen Ansatz ein und brachte innovative Filme hervor, die die chinesische Kultur mit westlichen Techniken verbanden.Beispielhaft für diese Ära sind Filme wie „A Better Tomorrow“ (1986) von John Woo, der das Gangsterfilm-Genre neu definierte, oder Wong Kar-wais „Chungking Express“ (1994), der durch stilisierte Erzählweise und visuelle Poesie breite Anerkennung erfuhr.
Die Japanese New Wave erstreckte sich von den späten 1950ern bis in die 1970er Jahre und war stark von der französischen Nouvelle Vague beeinflusst. In einer Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg und politischer Veränderungen, insbesondere durch das „Treaty of Mutual Cooperation and Security“ mit den USA, rebellierten junge Filmemacher gegen etablierte Strukturen. Anders als in Frankreich begann die Japanese New Wave innerhalb des Studio-Systems und hatte enge Verbindungen zu politischen und sozialen Themen. Filme wie „Cruel Story of Youth“ (1960) von Nagisa Oshima oder „Tokyo Drifter“ (1966) von Seijun Suzuki brachten neue Techniken und experimentelle Herangehensweisen ein.
Die Korean New Wave begann Anfang der 1980er Jahre, als sich Südkorea demokratisierte und die Zensur lockerte. Der Aufschwung der Filmindustrie wurde jedoch in den späten 1990ern durch die asiatische Finanzkrise unterbrochen. Doch die Grundlagen für eine kreative Blüte waren bereits in den 1980ern gelegt worden. Die Einführung des „Blockbuster“-Modells aus Hollywood ermöglichte eine Wiedergeburt der Branche.Die Korean New Wave zeichnete sich durch unabhängige Filmemacher aus niedrigen Einkommensschichten aus, die innovative „Korean Blockbusters“ schufen. Anders als in anderen Regionen wurde die Bewegung stark von Jaebeol unterstützt, nicht von staatlichen Institutionen.
Übergreifend lässt sich sagen, dass wirtschaftlicher Aufschwung als Auslöser für eine kinematografische Revolution diente, und die Freiheit von Zensur ermöglichte künstlerische Schöpfungsfreiheit. Jedoch endeten alle Bewegungen in einem Rückgang, teilweise aufgrund mangelnder Reife der Filmindustrie.Unterschiede zeigen sich in den Hintergründen der Filmemacher und den politischen Kontexten. Während Hongkong von einer kulturellen Vielfalt und dem Einfluss westlicher Filmemacher geprägt war, spiegelte die Japanese New Wave politische Unruhen wider. Die Korean New Wave hingegen entstand aus politischem Wandel und überlebte die asiatische Finanzkrise durch eine Anpassung an das Blockbuster-Modell.
Ghost in the Shell: Identität, Existenz und die Grenzen von Mensch und Maschine
„Ghost in the Shell,“ ein bahnbrechender Anime-Film aus dem Jahr 1995, entführt die Zuschauer in eine dystopische Zukunft, in der hochentwickelte Technologie, Cybernetik und die Verschmelzung von Mensch und Maschine die Gesellschaft prägen. Die Handlung beginnt mit den Ermittlungen der Sektion 9, einer Spezialeinheit, die den gefährlichen Hacker „Puppet Master“ verfolgt. Der Puppet Master dringt in die Gedanken und Erinnerungen von Menschen ein, und die Sektion 9, angeführt von Major Kusanagi und ihrem Partner Batou, wird auf den Fall angesetzt.
Während der Ermittlungen stößt Major Kusanagi auf eine tiefgreifende Identitätskrise. Als Cyborg mit einem mechanischen Körper und einem elektronischen Gehirn beginnt sie, ihre eigene Existenz und Natur zu hinterfragen. Dies bildet den Einstieg in die tiefgehenden philosophischen Themen des Films, die den Existenzialismus und die Auswirkungen der Technologie auf die menschliche Identität erforschen.
Die Beziehung zwischen Major Kusanagi und dem Puppet Master wird zu einem zentralen Element der Handlung. Der Puppet Master, zunächst als gefährliche künstliche Intelligenz eingeführt, entpuppt sich als eigenständige Entität ohne physischen Körper. Die Interaktion zwischen den beiden Charakteren führt zu intensiven Diskussionen über Existenz, Bewusstsein und die ethischen Implikationen der Verschmelzung von Mensch und Maschine.
Die Handlung vertieft sich in moralische und ethische Fragen im Zusammenhang mit der Cybertechnologie. Die zentrale Frage, ob eine künstliche Intelligenz als eigenständiges Wesen betrachtet werden kann, wird aufgeworfen. Diese Frage wird durch die Entscheidung von Major Kusanagi und dem Puppet Master, sich zu verschmelzen, weiter verschärft. Die Suche nach einer neuen Form der Existenz führt zu einem existenziellen Wendepunkt und einer Reflexion über die Natur von Leben und Bewusstsein.
„Ghost in the Shell“ wirft auch einen kritischen Blick auf die Bedeutung von Cyberkriminalität und Terrorismusbekämpfung in einer Welt, in der die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwimmen. Die Sektion 6, das Ministerium für öffentliche Sicherheit, agiert als zentrale Konfliktpartei und versucht, den Puppet Master unter Kontrolle zu bringen. Die Dynamik zwischen Sektion 9 und Sektion 6 spiegelt die zunehmende Komplexität und Unsicherheit in einer digitalisierten Zukunft wider.
Die Atmosphäre des Films ist geprägt von einer faszinierenden Cyberpunk-Zukunft. Die visuelle Darstellung der überfüllten, futuristischen Stadt, durchzogen von Neonlichtern und Hochhäusern, schafft eine düstere und überwältigende Kulisse. Die Musik, ein weiteres herausragendes Element, verstärkt die Stimmung und wird sogar heute noch in verschiedenen Mixes verwendet.
Der philosophische Grundkonflikt von „Ghost in the Shell“ liegt in der Auseinandersetzung mit der künstlichen Intelligenz im Vergleich zum natürlichen Leben. Der Puppet Master, als KI-Programm gestartet, entwickelt ein eigenes Bewusstsein und strebt nach einer neuen Form der Existenz. Die Frage nach der Eigenständigkeit von KI und der Verschmelzung von Mensch und Maschine wird durch die Fusion von Major Kusanagi und dem Puppet Master weiter unterstrichen.
Zusammenfassend ist „Ghost in the Shell“ ein Meisterwerk des Cyberpunk-Genres, das nicht nur durch seine actiongeladene Handlung und visuelle Brillanz besticht, sondern auch tiefgreifende philosophische Fragen aufwirft. Der Einfluss des Films auf die Popkultur ist beträchtlich, und seine Relevanz erstreckt sich bis in die heutige Zeit, da Technologien wie Künstliche Intelligenz und Cybertechnologie weiterhin unsere Welt formen. Der Film bleibt eine fesselnde Erkundung der Wechselwirkung zwischen Mensch und Technologie in einer zukünftigen Welt.

Dec 21, 2023 • 1h 27min
EGL041 The Expanse: warum die geniale Sci-Fi Serie so gut funktioniert.
"Never listen to what people say. Just watch what they do." (Chrisjen Avasarala, S02E01)
Unser Thema ist die Serie "The Expanse", eine Meisterleistung im World Building. Ursprünglich als Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) geplant, wurde sie später zu einer Streaming- und TV-Serie umgewandelt. Die letzte Staffel wurde gestreamt, und das letzte Buch wurde veröffentlicht. Es ist also an der Zeit, einen umfassenden Blick auf das Gesamtwerk zu werfen. Obwohl wir vor Plot-Spoilern warnen, kommen wir gar nicht dazu, da wir uns in unserer Begeisterung für die neun Romane, die zusätzlichen Novellen und die für das Fernsehen vom Syfy Network adaptierte Serie verstricken, die jedoch nach drei Staffeln abgesetzt wurde. (Amazon erwarb die Rechte und produzierte drei weitere Staffeln.) Die Handlung spielt in einer Zukunft, in der die Menschheit das Sonnensystem kolonisiert hat. Der Konflikt zwischen der Erde, dem Mars und den "Belters" im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter eskaliert, als eine mysteriöse außerirdische Technologie namens Protomolekül auftaucht. Die Serie beginnt ohne große Einleitung und nimmt das Publikum mit auf eine Entdeckungsreise durch die Expanse-Welt. Wir hingegen versuchen einleitend eine Zusammenfassung, die jedoch immer wieder scheitert, denn das World Building von "The Expanse" ist ebenso umfassend und scheinbar endlos wie das von Star Wars. Auf einmal ist die Zeit schon um und wir haben kaum begonnen und doch schon zu viel gesagt! Worin wir uns einig sind: Cast, Technik, Locations und Plots begeistern genauso wie die Leichtigkeit, mit der die Welt immer größer wird und jedes Buch schon fast wie ein anderes Genre erscheint. Auch das Protomolekül entwickelt sich weiter: von einer Art Phage, die Zellen befällt, zu einer umfassenden verschollenen Alien-Kultur, die ganze Sonnensysteme in diamantene Festplatten umwandeln und fast-kollabierende Sterne zu Mausefallen umfunktionieren kann.
Shownotes
Links zur Laufroute
EGL041 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
Expanse Bücher
Expanse Serien
Expanse Fan Wiki auf fandom
Interview: James S.A. Corey by lightspeedmagazine 2014
Titellied: Fly me to the moon
Ist Lesen besser als Schauen? Axis of Awesome: Rage of Thrones
Kickstarter: The Expanse Roleplaying Game brings series of science fiction novels to the tabletop.
The Expanse Roleplaying Game: QuickStart Game Rules
The Stars My Destination von Alfred Bester
The Moon Is a Harsh Mistress von Robert Heinlein
Die Sprache der Belters
Grenzökonomie
Thomas Jane spielt Miller
Die drei Sonnen von Liu Cixin
2001: Odyssee im Weltraum von Arthur C. Clarke
Interstellar von Christopher Nolan
Powers of Ten von Charles und Ray Eames
Watchmen (Film) von Zack Snyder
Penrose und Panpsychist Consciousness
Mitwirkende
Micz Flor
(Erzähler)
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Verwandte Episoden
EGL048 "The Expanse" zu Ende erzählt: Was passiert in den drei unverfilmten Büchern der Serie?
Das könnte dich auch interessieren:
EGL048 „The Expanse“ zu Ende erzählt: Was passiert in den drei unverfilmten Büchern der Serie?
Wir beginnen unsere Tour an der Jannowitzbrücke und laufen Richtung Norden. Weiter, immer weiter. „The Expanse“.
Einen Fehler möchte ich zuerst beheben: Nicht Judge Dredd sondern The Punisher ist der Film in dem der ‚Miller‘ Darsteller Thomas Jane mitspielt. Und jetzt weiter im Text. „The Expanse“ ist eine Serie von Science-Fiction-Romanen (sowie zugehörigen Novellen und Kurzgeschichten) von James S. A. Corey, dem gemeinsamen Pseudonym der Autoren Daniel Abraham und Ty Franck. Der erste Roman, „Leviathan Wakes“ (2011), wurde 2012 für den Hugo Award als bester Roman nominiert. Die gesamte Serie wurde 2017 für den Hugo Award als beste Serie nominiert. Sie gewann später, nach ihrer zweiten Nominierung für denselben Preis im Jahr 2020.
Die Buchserie besteht aus neun Romanen, neun kürzeren Werken und einer Sammlung von Geschichten. Die Serie wurde für das Fernsehen vom Syfy Network adaptiert, ebenfalls unter dem Titel „The Expanse“. Nachdem Syfy die TV-Serie nach drei Staffeln abgesetzt hatte, erwarb Amazon sie, produzierte drei weitere Staffeln und streamt alle sechs Staffeln auf Amazon Prime Video.
Die Autoren hinter dem Pseudonym James S. A. Corey, Daniel Abraham und Ty Franck, haben mit ihrer Arbeit zahlreiche Preise gewonnen. Kleiner Fund bei der Recherche, der mit Expanse nichts zu tun hat, aber mit einem der Autoren: Ty Franck äußert sich in einem Interview zu dem Mythos, der sich um die Arbeitsweise von George R. R. Martin rankt. Ein hartnäckiges Gerücht behauptet, er schreibe seine monumentalen „A Song of Ice and Fire“-Romane immer noch auf einem antiquierten DOS-Computer mit dem Schreibprogramm WordStar.
Er schreibt tatsächlich nicht auf einem alten DOS-Computer. Der ist abgeraucht.Tatsächlich habe ich ihm den Computer gebaut, auf dem er jetzt schreibt. Ein hochmodernes Gerät, — auf dem DOS und WordStar 4.0 laufen.
In den frühen 2000er Jahren entsprang die Idee eines MMORPG (massively multiplayer online role-playing game) dem kreativen Geist von Ty Franck, konzipiert für ein chinesisches Internetunternehmen. Obwohl diese digitale Utopie letztendlich nicht realisiert wurde, entfaltete sie sich weiterhin in einem anderen Medium – dem Foren-RPG (Post-to-Play-RPG), das Franck für einige Jahre mit Geschick und Leidenschaft leitete. Inzwischen hat die Science-Fiction-Romanreihe nun doch ihren Weg an den Spieltisch gefunden – dank des Expanse-Rollenspiels. Die kreative Schöpfung von Chris Pramas und veröffentlicht von Green Ronin Publishing, eröffnet dieses Rollenspiel eine neue Dimension für Fans der epischen Weltraumgeschichten.
Die 5.714 Kickstarter Unterstützer:innen haben bis zum 1. Februar 2023 beeindruckende $402,832 zugesichert, um dieses Projekt zum Leben zu erwecken. Ein Ausdruck der Leidenschaft und des Engagements der Community für die Erweiterung und Vertiefung der Expanse-Erfahrung am Spieltisch. Dieser inspirierende Zuspruch verdeutlicht, dass die Faszination für Coreys literarisches Universum weit über die Seiten seiner Romane hinausreicht.
Die Handlung von „The Expanse“ entfaltet sich in einem politischen Universum, das im Stil der 1970er Jahre gestaltet ist. Die Weltgebäude der Erde, des Mars und des Asteroidengürtels sind detailliert und plausibel, wobei Wikipedia als Grundlage für die Plausibilität dient.
Die Serie bezieht ihre Inspiration aus verschiedenen Quellen, darunter „The Stars My Destination“ von Alfred Bester und „The Moon Is a Harsh Mistress“ von Robert Heinlein. Die visuelle Umsetzung der Geschichte ist beeindruckend, wobei die Komplexität der Handlung eine Zusammenfassung nahezu unmöglich macht.
Ein faszinierender Aspekt von „The Expanse“ ist die Sprache der Belters, einer Gruppe von Menschen im Asteroidengürtel. Die Serie präsentiert eine einzigartige Gesellschaftsdynamik und beleuchtet Themen wie Grenzökonomie und Unterdrückung.
Die Charaktere, angeführt von James Holden, werden von einer talentierten Besetzung verkörpert, die teilweise aus der Game-Industry stammt. Die Erzählstruktur wechselt zwischen den Perspektiven von Miller, einem Noir-Detektiv, und Holden, während sie sich auf eine komplexe Reise durch das Sonnensystem begeben.
Die dramaturgische Brillanz von „The Expanse“ zeigt sich in der glaubhaften Darstellung von wissenschaftlichen Konzepten wie der Quantenmechanik und dem Protomolekül. Die Handlung beinhaltet auch politische Intrigen, militärische Konflikte und die mysteriösen Auswirkungen des Protomoleküls auf die Geschichte.
Insgesamt bietet „The Expanse“ eine einzigartige Mischung aus Meta-Story, Metaphysik und actiongeladener Spannung. Die Serie behandelt Themen wie Bewusstsein als Feld und Waffe im Universum, während die Charaktere in politische, kulturelle und physikalische Aspekte eingebettet sind.
Die Story Arc der Charaktere und Welten bleibt überzeugend und fesselnd, wobei die Belters durch die neu entdeckten Ring-Gates wirtschaftlich abgehängt werden. Die Serie schafft es, die Glaubwürdigkeit in einer fantastischen Umgebung aufrechtzuerhalten und bietet ein faszinierendes Abenteuer, das sowohl Sci-Fi-Enthusiast:innen als auch Gelegenheitszuschauer:innen begeistert.
Expanse Bücher
Leviathan Wakes (2011-06-15) Leviathan erwacht (2012)
Caliban’s War (2012-06-25) Calibans Krieg (2013)
Abaddon’s Gate (2013-06-04) Abaddons Tor (2014)
Cibola Burn (2014-06-17) Cibola brennt (2015)
Nemesis Games (2015-06-02) Nemesis-Spiele (2016)
Babylon’s Ashes (2016-12-06) Babylons Asche (2017)
Persepolis Rising (2017-12-05) Persepolis erhebt sich (2019)
Tiamat’s Wrath (2019-03-26) Tiamats Zorn (2020)
Leviathan Falls (2021-11-30) Leviathan fällt (2022)
Expanse Kurzgeschichten und Novellen
0.1 Drive Before Leviathan Wakes
0.3 The Churn Before Leviathan Wakes
0.5 The Butcher of Anderson Station Before Leviathan Wakes
1.1 The Last Flight of the Cassandra During Leviathan Wakes
2.5 Gods of Risk Between Caliban’s War and Abaddon’s Gate
3.5 The Vital Abyss From before Leviathan Wakes to Cibola Burn
6.5 Strange Dogs Between Babylon’s Ashes and Persepolis Rising
7.5 Auberon Between Persepolis Rising and Tiamat’s Wrath
9.5 The Sins of Our Fathers After Leviathan Falls

Dec 7, 2023 • 1h 5min
EGL040 Magnolia: das epische Werk von Paul Thomas Anderson als Beispiel für Hyperlink-Cinema
"Wir haben mit der Vergangenheit abgeschlossen, aber die Vergangenheit nicht mit uns."
Bevor wir uns tiefer mit dem Film "Magnolia" von 1999 beschäftigen stellt Flo als zweiten Teil der Reihe "Filmbewegungen der 90er, die das Kino revolutionierten" das Genre des Hyperlink-Cinemas vor. Das beschreibt die Art von Episodenfilmen, die die Kontinuität von klassischen Erzählungen aufbrechen, indem multilineare Geschichten von verschiedenen Figuren und Charaktergruppen präsentiert werden. In solchen Filmen können Räume auftauchen oder sich Charaktere treffen, die vorher in eigenen unabhängigen Erzählsträngen entwickelt wurden. Aus der Vielzahl von Handlungssträngen wird ein ganzes Handlungsnetz aufgebaut. Hierin finden sich auch soziologische Betrachtungsweisen, die das Hyperlink-Cinema auszeichnet. Wir spekulieren darüber, ob Serien dieses Kino-Genre verdrängt haben oder ob durch die Gagen der hochrangigen Schauspieler:innen diese Art von Filmen nicht mehr produziert werden konnten. Im zweiten Teil der Episode stellt Flo den Film Magnolia von Paul Thomas Anderson vor. Die Geschichte spielt innerhalb eines Tages in Los Angelos. Im Zentrum stehen um die 10 Figuren, die sich zwei Ensemblesträngen zuordnen lassen, die parallel und unabhängig voneinander im Film aufgebaut werden. In beiden Strängen steht sterbender Patriarch im Mittelpunkt, der sich, den Tod vor Augen, mit seiner Familie aussöhnen möchte. Darum reihen sich mehrere miteinander verflochtene Geschichten und Charaktere, deren Leben durch Zufall und Schicksal auf überraschende Weise miteinander verbunden sind. Wir sind uns einig, dass dies vor allen Dingen durch die großartigen Schauspielerinnen und Schauspieler getragen wird. Viele Szenen von dem Film bleiben im Kopf hängen. Auch das fulminante Ende des Films geht nicht mehr aus dem Kopf: ein Regen aus Fröschen prasselt auf LA in den frühen Morgenstunden nieder, ein unerklärliches Phänomen, das alle Geschichten der einzelnen Figuren zu einem vorläufigen Ende führt. Das Ende unserer Tour hat uns zur Warschauer Brücke geführt, wo wir noch kurz über die Veränderung dieses Ortes und den neuen Amazon-Tower resümieren.
Shownotes
Lauftrack zur Episode
EGL040 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
Episodenfilm – Wikipedia
Short Cuts - Wikipedia
Pulp Fiction - Wikipedia
Hyperlink cinema - Wikipedia
Magnolia (film) - Wikipedia
Category:Hyperlink films - Wikipedia
What Is Hyperlink Cinema? The Essential Guide
Alejandro González Iñárritu – Wikipedia
Babel (film) - Wikipedia
Traffic (2000 film) - Wikipedia
Syriana – Wikipedia
Kognitive Karte – Wikipedia
Geostatistik – Wikipedia
Spatial analysis - Wikipedia
Henri Lefebvre – Wikipedia
David Harvey (Geograph) – Wikipedia
Novel of circulation - Wikipedia
Hyperlink Cinema and the Prevalence of Intertwining Stories | The Artifice
Breaking Bad - Wikipedia
How I Met Your Mother - Wikipedia
Paul Thomas Anderson - Wikipedia
There Will Be Blood – Wikipedia
John C. Reilly – Wikipedia
Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty - Wikipedia
We Need to Talk About Kevin (film) - Wikipedia
Tom Cruise – Wikipedia
Philip Seymour Hoffman – Wikipedia
Twister (Film) – Wikipedia
Julianne Moore - Wikipedia
Magnolia movie review & film summary (1999) | Roger Ebert
Aimee Mann - Wikipedia
Watchmen (TV series) - Wikipedia
Magnolien – Wikipedia
Warschauer Brücke – Wikipedia
Mitwirkende
Florian Clauß
(Erzähler)
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Verwandte Episoden
EGL040 Magnolia: das epische Werk von Paul Thomas Anderson als Beispiel für Hyperlink-Cinema
Der Begriff Hyperlink-Cinema wurde als Genrebegriff eingeführt, um die Episodenfilme der 90er und 00er Jahre besser zu spezifizieren. Hyperlink-Cinema zeichnet sich durch komplexe, multilineare Erzählstrukturen aus, die mehrere Figuren unter einem einheitlichen Thema vereinen. Das Herzstück dieses Genres liegt in der Darstellung der Vernetzung einzelner Handlungsstränge und Charaktere, die oft als „ineinandergreifende Erzählungen“ beschrieben werden. Filme dieses Stils enthüllen nach und nach, wie Charaktere aus verschiedenen Geschichten miteinander verbunden sind.Im Hyperlink-Cinema wird die Erzählung dem Zuschauer durch eine nichtlineare Reihe von miteinander verknüpften Ereignissen präsentiert. Dieser Ansatz umfasst mehrere Handlungsstränge, die verschiedene Charaktere oder Gruppen verfolgen. Die Idee, dass Filme nicht nur einen Handlungsstrang, sondern ein ganzes Handlungsnetz enthalten, wurde von David Bordwell geprägt.Hyperlink-Cinema greift dabei die Diskontinuität von Texten und Medien auf, die in der Philosophie der Postmoderne theoretisch bestimmt wurde. Die Betonung der Relativität von Wahrheit und die Vielfalt von Perspektiven spiegelt sich in der Fragmentierung der Erzählungen wider. Auch die räumliche Ausprägung der Erzählung im Film folgt dem individuellen Verhalten und den sozialen Beziehungen, wobei Momente der Kontinuitätsbrüche im Hyperlink-Cinema eine besondere Rolle spielen.Serien haben zunehmend dieses Format übernommen. Die Frage, ob das Genre seinen Höhepunkt erreicht hat oder Raum für eine evolutionäre Weiterentwicklung bietet, bleibt offen. Trotzdem hinterlässt das Hyperlink-Kino einen bleibenden Eindruck als eine kreative Form, die die Grenzen der narrativen Struktur und filmischen Darstellung erweitert hat.
„Magnolia“ von Paul Thomas Anderson, aus dem Jahr 1999, ist ein komplexer Ensemblefilm, der mehrere miteinander verbundene Geschichten an einem einzigen Tag in Los Angeles erzählt. Der Film präsentiert mehrere Hauptcharaktere, deren Schicksale und Lebensfragen sich in einer Vielzahl von Erzählsträngen entfalten.Die Handlung des Films spielt sich innerhalb eines Tages ab und behandelt Themen wie Schuld, Vergebung, Liebe, Zufall und das undurchsichtige Netzwerk des Lebens. Die Charaktere durchlaufen individuelle Konflikte, Geheimnisse werden aufgedeckt, und die Handlungsstränge verschmelzen zu einem komplexen Geflecht menschlicher Schicksale. Der Film erforscht die Grenzen menschlichen Verhaltens und die Unvorhersehbarkeit des Lebens.Das Ensemble umfasst etwa zehn Hauptcharaktere, von denen jeder mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert ist. Zu den Schlüsselfiguren gehören Jim Kurring, ein ethisch agierender Polizist; Claudia Wilson Gator, eine junge Frau mit Drogenproblemen; Jimmy Gator, der Gastgeber einer erfolgreichen Quizshow; Frank T.J. Mackey, ein selbsthilfegeführter Motivationssprecher; und Earl Partridge, ein vermögender Mann im Sterben.Die Handlung entwickelt sich durch mehrere ineinandergreifende Erzählstränge, die anfangs unabhängig voneinander erscheinen. Dabei erforscht der Film die Verbindungen zwischen den Charakteren und deren individuellen Konflikten. Die Erzählung geht über die Oberfläche der Handlungsstränge hinaus und behandelt tiefergehende Themen wie Vater-Kind-Konflikte, die Auswirkungen von Traumata und die Suche nach Liebe und Anerkennung.Das Intro des Films betont die Idee der Zufälligkeit und wie scheinbar bedeutungslose Ereignisse das Leben der Charaktere beeinflussen. Der Film nutzt verschiedene stilistische Elemente, darunter lange Kamerafahrten, um die komplexe Raumdynamik und die Emotionen der Charaktere einzufangen. Zitate wie „Wir haben mit der Vergangenheit abgeschlossen, aber die Vergangenheit nicht mit uns“ und „Dieses dumme, verdammte Denken“ unterstreichen die tieferen philosophischen Aspekte des Films.Die Bedeutung der Magnolienblume als Symbol für Schönheit und Zerbrechlichkeit wird herangezogen, um die inneren Zerbrüchlichkeiten der Charaktere zu reflektieren. Der Froschregen am Ende des Films dient als kathartisches Ereignis, das die Geschichten der Charaktere vorläufig abschließt und einen tiefen Einfluss auf ihre Weltanschauung hat.„Magnolia“ wird als Film über Trauer, Verlust und die Übertragung von Sünden von Eltern auf Kinder betrachtet. Der Film zeigt, wie das Verhalten jeder Person weitreichende Auswirkungen hat, die über die unmittelbare Wahrnehmung hinausgehen. Paul Thomas Anderson beeindruckt mit seinen damals 28 Jahren mit seiner Weisheit und Sympathie sowie der filmischen Erzählweise, die den Zuschauer durch Emotionen leitet und zum Nachdenken über das Leben anregt. Der Film hinterlässt einen bleibenden Eindruck durch seine eindringliche Darstellung von menschlichen Beziehungen und den unerklärlichen Wendungen des Lebens.

Nov 23, 2023 • 1h 12min
EGL039 Lars von Trier ‚Idioten‘: Parabel auf Psychiatrie, Filmindustrie oder engagierte Bürger:innen?
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen" hieß zuerst: "Es läßt sich privat nicht mehr richtig leben."
Wir starten unsere Tour der Idioten am Kotti mit einem kleinen Verweis auf den Film "Herr Lehmann" (2003) und ziehen die Parallele, dass es hier genauso wie in Idioten darum geht, dass eine Welt zerbricht, wenn sie mit ihrer Umgebung in Berührung kommt. Aber bevor wir in die Tiefe gehen, werfen wir noch ein paar Ideen zu "Das Fest" (1998) ein, den wir am gleichen Tag und in der letzten Episode behandelt haben. Micz versucht, vier Parabeln auf "Idioten" (1998) anzuwenden. Zuerst die von "Jacob's Ladder" (1990): Karen landet dekompensiert in der Psychiatrie nach dem Tod ihres Kindes. Das Finale des Films zeigt sie wieder zuhause, medikamentös stabilisiert. Alles dazwischen ist eine verschwommene Erinnerung an ihre zwei Wochen in der Psychiatrie. Dann wagen wir uns an die Parabel "Das Kino in der Gesellschaft", gefolgt von "DOGMA 95 in der Filmindustrie", nur um schließlich 2000 Jahre zurückzublicken und aus der Trickkiste zu ziehen: "Idioten" leitet sich vom altgriechischen "idiotes" ab, was so viel wie "Privatperson" bedeutet. Es bezeichnete in der Polis Personen, die sich aus öffentlich-politischen Angelegenheiten heraushielten und keine Ämter übernahmen. Das hat unter anderem Tocqueville in "Der alte Staat und die Revolution" (1856) beschrieben. (Dogville == Tocqueville? Weiß Lars von Trier, was er tut?) Und hier stoßen wir auf genauso viele Fundstücke wie bei den anderen drei Parabeln: Das Private ist Politisch. Stoffer möchte den inneren Idioten in die Welt entlassen und damit die zurückgezogene Kommune mit der Gesellschaft verbinden, um Veränderungen herbeizuführen.
Shownotes
Lauftrack zur Episode
EGL039 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
SANDOR FERENCZI: SPRACHVERWIRRUNG ZWISCHEN DEN ERWACHSENEN UND DEM KIND, XII. Internationaler Psychologischer Kongress in Wiesbaden, 1932
Dogma 95 - zehn Jahre danach
Jacob's Ladder (1990) Drehbuch: Bruce Joel Rubin, Regie: Adrian Lyne
The Village (2004) Drehbuch und Regie: M. Night Shyamalan
Die Truman Show (1998) Drehbuch: Andrew Niccol, Regie: Peter Weir
Wahnsinn und Gesellschaft
Ronald David Laing, britischer Psychiater, Mitbegründer der antipsychiatrischen Bewegung
Antipsychiatrie
Dynamische Psychiatrie
Das Wort 'Idiot' leitet sich aus dem Altgriechischen 'idiotes' ab, das in etwa „Privatperson“ bedeutet
Alexis de Tocqueville: Der alte Staat und die Revolution (1856)
Mitwirkende
Micz Flor
(Erzähler)
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Florian Clauß
(Der Flo)
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
In der Welt von „Das Fest“ weigert sich das Thema hartnäckig einer klaren Parabel zuzuordnen. Die Dramaturgie des Zwillingsthemas durchzieht den Film, wobei die Abspaltung als tote Schwester eine düstere Note einbringt. Dabei betont die Notwendigkeit, den Film nicht als Vehikel für den Missbrauch zu verwenden, um Missbrauch zu reflektieren. Ein immer noch wertvoller Blick auf das Thema ’sexueller Missbrauch‘ von Sándor Ferenczi, der bereits 1932 über Sprachverwirrung schrieb (Link siehe Shownotes).
Beachtlich ist, dass „Das Fest“ nicht nur der erste, sondern auch der einzige Film ist, der nach den Prinzipien von DOGMA95 entstanden ist. Dieses Jahr war für den Film auch von besonderer Bedeutung, da sowohl „Das Fest“ als auch „Idioten“ 1998 in Cannes vertreten waren. Lars von Trier selbst hatte zuvor mit „Breaking the Waves“ in Cannes für Furore gesorgt.
DOGMA 95 diskutieren wir detailliert in der EGL038, also gerne noch einmal in die vergangene Folge reinhören, während wir an die Kinos an der Skalitzer Straße vor dem Mauerbau denken.
Nicht zu übersehen sind die expliziten Sexszenen in „Idioten“. Flo erklärt, dass von Trier sogar Pornos für Frauen produzierte. Das gesamte Team, angefangen vom Schnitt bis zu den Darsteller:innen, wird beleuchtet. Interessanterweise gibt es zwei Versionen von „Jacob’s Ladder“.
Die kürzeste Zusammenfassung des Films „Das Fest“ offenbart, dass Karen in der Psychiatrie war und nun wieder zu Hause ist. Bei „Idioten“ wird die Handlung detailliert aufgedröselt – der Mut, den inneren Idioten in die Welt zu tragen, führt zum Zerfall der Gruppe und einem Showdown mit Karen.
Ein zeitgenössischer Blick hinterfragt, ob das Mimen von Idioten heute noch möglich ist. Der GPS-Track zeigt, dass wir scheinbar stillstehen, während der Film „Sweet Movie“ von Dusan Makavejev auf die Leinwand tritt. Lars von Trier bricht dreimal mit den DOGMA 95-Prinzipien und wir werfen einen Blick auf die Parabeln des Kinos in der Gesellschaft, DOGMA in der Filmindustrie und der Rolle der Bürger:innen in der Gesellschaft.
Adorno kommt ins Spiel – kein richtiges Leben im falschen, Filme mit zwei Welten, die sich berühren, werden in Erwägung gezogen. Von „Stranger Things“ über „Existenz“ bis zu „Matrix“ und „Die Truman Show“, sowie „The Village“ – alles Filme, die das Thema berühren.
Die letzte Parabel ist die, die uns am meisten Konzentration abverlangt: Idiot bedeutet hier, sich nicht politisch zu engagieren, und die Frage bleibt, ob von Triers Definition die altgriechische ist. Die Verbindung von „Dogville“ und Tocqueville wird thematisiert, ebenso wie Adorno und der Bruch zwischen Regierenden und Regierten. Die Idee, dass man als Idiot geboren wird und die Partizipation der Weg heraus ist, ist die Erklärung, die Tocqueville Mitte des 19ten Jahrhunderts in Worte fasst. Die Überlegung, dass Idioten diejenigen sind, die sich bewusst heraushalten wollen, führt zu einer tieferen Diskussion über Adornos ursprüngliche Idee – es lässt sich privat nicht mehr richtig leben.
Der Druck, den Stoffer in der Kommune erlebt, wird beleuchtet. Die Frage, ob der Idiot privat ist und das Politische draußen, wird aufgeworfen. Eine faszinierende Reise durch die Psychiatriegeschichte und eine Zusammenfassung von Flo runden die Diskussion ab, während er bereits auf seine Idioten-Besprechung von 1998 vorausblickt. Und damit schließen wir – eigentlich.

Nov 9, 2023 • 1h 5min
EGL038 Dogma 95: Das Fest - wie Authentizität auf der Leinwand sehr real wirken kann…
"Cheers to my dad; a rapist and a murderer."
Flo startet eine neue Reihe im Eigentlich Podcast: Revolutionäre Filme und Filmbewegungen aus den 1990ern, die ihn und die Filmgeschichte maßgeblich prägten – Teil I: Dogma 95 mit "Das Fest" und "Idioten", Teil II: Hyperlink Cinema und Episodenfilm mit Pulp Fiction von Quentin Tarantino und Short Cuts von Robert Altman, 3. Teil: Asian New Wave – Filme aus Hongkong, Südkorea, Taiwan und Japan aus den 90ern. Micz stellt in seiner nächsten Episode den Dogma-Film "Idioten" von Lars von Trier vor, die wir gleich im Anschluss aufnehmen. In dieser Episode präsentieren wir zunächst das legendäre Manifest von Dogma 95, das Lars von Trier und Thomas Vinterberg am 13. März 1995 vorstellten: "The Vow of Chastity" - die zehn Keuschheitsgelübde. Das Dogma 95 Manifest fordert filmische Authentizität durch die Nutzung einfacher Techniken, Handheld-Kameras, natürlicher Beleuchtung und ohne nachträgliche Bearbeitung. Flo überrascht Micz mit der Adaption des Manifestes durch den Comiczeichner FIL mit dem Dogma Comic von Didi&Stulle, der damals in der Stadtzeitung Zitty erschien und für viel Furore sorgte. Bevor wir inhaltlich tiefer in den ersten Dogma-Film "Das Fest" von Thomas Vinterberg aus dem Jahr 1998 einsteigen, gehen auf unserer Laufstrecke rund um den Urbanhafen den Fragen nach: was ist Dogma 95, warum hat sich die Filmbewegung gegründet, was ist der Autorenfilm, woran ist Dogma gescheitert und was sind die Auswirkungen von Dogma 95. Wir entdecken in dem Zusammenhang auch mehrere Filmgenres, die wir vorher nicht kannten: Mumblecore, Mumblegore und the German Mumblecore. Manchmal wird der Ton in einigen - sehr kurzen - Passagen etwas "mumblelig", weil die zu Anfang angepriesene neue Aufnahmetechnik dann doch nicht funktionierte und wir den Ton aus einer anderen Spur mit Deep Learning Technologie recovern mussten. Bitte seht es uns nach, wir lernen auch noch dazu. Nichtdestotrotz viel Spaß beim Hören.
Shownotes
Lauftrack zur Episode
EGL038 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
Dogma 95 – Wikipedia
Dogme95.dk - A tribute to the official Dogme95
Thomas Vinterberg – Wikipedia
Das Fest (Film) – Wikipedia
Lars von Trier – Wikipedia
Idioten – Wikipedia
Hyperlink cinema - Wikipedia
Pulp Fiction – Wikipedia
Quentin Tarantino – Wikipedia
Short Cuts – Wikipedia
Robert Altman – Wikipedia
Hong Kong New Wave – Wikipedia
Chungking Express – Wikipedia
Takeshi Kitano – Wikipedia
Matrix (Film) – Wikipedia
Computer Generated Imagery – Wikipedia
Actionfilme der 1990er Jahre – Wikipedia
Splatterfilm – Wikipedia
35 Millimeter - Quellentexte - Dogma 95 Manifest
Normalbild – Wikipedia
Releases · upscayl/upscayl · GitHub
FIL
Team Deakins: Thomas Vinterberg - Director, Screenwriter
Ingmar Bergman – Wikipedia
Nouvelle Vague – Wikipedia
François Truffaut – Wikipedia
Eine gewisse Tendenz im französischen Film – Wikipedia
Cahiers du cinéma – Wikipedia
Autorenfilm – Wikipedia
Mise en Scène (Film) – Wikipedia
Alfred Hitchcock – Wikipedia
Jean-Luc Godard – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Filmfestspiele_von_Cannes_1998
Digitales Kino – Wikipedia
Breaking the Waves – Wikipedia
Internationale Filmfestspiele von Cannes 1996 – Wikipedia
Blair Witch Project – Wikipedia
Mumblecore - Wikipedia
It’s All About Love – Wikipedia
Dicke Mädchen – Wikipedia
Axel Ranisch – Wikipedia
Traffic – Macht des Kartells – Wikipedia
Flußfahrt mit Huhn – Wikipedia
Frederiksberg Kommune – Wikipedia
Interview with Thomas Vinterberg - Director, Screenwriter
Den Danske Filmskole – Wikipedia
Joaquin Phoenix – Wikipedia
Die Jagd (2012) – Wikipedia
Mads Mikkelsen – Wikipedia
Sexueller Missbrauch von Kindern – Wikipedia
Anthony Dod Mantle – Wikipedia
Die Hamlet-Sexmaschine - DER SPIEGEL
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz – Wikipedia
Mitwirkende
Florian Clauß
(Erzähler)
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Verwandte Episoden
EGL081 28 Years Later – Heart of Kindness: Eine Befreiung aus der deterministischen Apokalypse
The Vow of Chastity
I swear to submit to the following set of rules drawn up and confirmed by DOGMA 95:
Shooting must be done on location. Props and sets must not be brought in (if a particular prop is necessary for the story, a location must be chosen where this prop is to be found).
The sound must never be produced apart from the images or vice versa. (Music must not be used unless it occurs where the scene is being shot).
The camera must be hand-held. Any movement or immobility attainable in the hand is permitted. (The film must not take place where the camera is standing; shooting must take place where the film takes place).
The film must be in colour. Special lighting is not acceptable. (If there is too little light for exposure the scene must be cut or a single lamp be attached to the camera).
Optical work and filters are forbidden.
The film must not contain superficial action. (Murders, weapons, etc. must not occur.)
Temporal and geographical alienation are forbidden. (That is to say that the film takes place here and now.)
Genre movies are not acceptable.
The film format must be Academy 35 mm.
The director must not be credited.
Furthermore I swear as a director to refrain from personal taste! I am no longer an artist. I swear to refrain from creating a “work”, as I regard the instant as more important than the whole. My supreme goal is to force the truth out of my characters and settings. I swear to do so by all the means available and at the cost of any good taste and any aesthetic considerations.
Thus I make my VOW OF CHASTITY
Copenhagen, Monday 13 March 1995
On behalf of DOGMA 95
Lars von Trier, Thomas Vinterberg
https://web.archive.org/web/20091114042542/http://www.35millimeter.de/inhalte/quellentexte.php?id=6
Die Dogma 95-Bewegung, von den dänischen Regisseuren Lars von Trier und Thomas Vinterberg Ende der 1990er Jahre ins Leben gerufen, wurde durch das „Dogma 95 Vow of Chastity“ Manifest formalisiert, das eine Reihe von Regeln und Einschränkungen festlegte, um einen als rein und unverfälscht betrachteten Stil des Filmemachens zu fördern. Die Bewegung zielte darauf ab, eine radikale Rückkehr zu den Wurzeln des Filmemachens zu fördern, weg von der Überproduktion und dem technologischen Glanz, um die Authentizität und Einfachheit der Geschichten zu betonen.
Die Kritik an Dogma 95 wurzelt in seiner Abgrenzung sowohl vom Auteurs-Kino der 60er Jahre als auch vom damaligen Hollywood-Kino. Die Autorenkino-Bewegung, wie die Nouvelle Vague, hatte eine Zeitlang funktioniert, brachte jedoch keine nachhaltige Veränderung, da die zentrale Stellung des Autors das Kino als dekadent und bourgeois empfand. Dogma 95 entstand aus der Unzufriedenheit mit dem damaligen Mainstream-Filmemachen, das als übermäßig kommerziell und technisch anspruchsvoll empfunden wurde.
Die Bewegung betonte die Rückkehr zu den Grundlagen des Filmemachens, um Authentizität und menschliche Erfahrung in den Vordergrund zu stellen. Inmitten der Dominanz von Spezialeffekten und großem Budget im Mainstream-Filmemachen, suchte Dogma 95 nach Wegen, Filme zu schaffen, die sich auf die Geschichte und die Charaktere konzentrieren, anstatt auf aufwändige visuelle Effekte oder stilisierte Inszenierungen.
Die Herausforderung für Filmemacher bestand darin, strenge Regeln und Einschränkungen zu befolgen, um künstlerische Kreativität und Experimente zu fördern. Die Bewegung wandte sich gegen den Autorenfilm und schuf eine Schaffensrichtlinie, bei der kein eindeutiger Stil eines Autors entstehen konnte. Die Komponenten Regie, Kamera und Drehbuch waren lose gekoppelt und sollten im Filmemachprozess nicht hierarchisch organisiert sein.
Jedoch war Dogma nicht frei von Kritik. Die Bewegung war zu erfolgreich und wurde zu einer Marke, die den Fokus auf den Autor wieder ins Zentrum rückte. Das Festsetzen auf das 35mm Normalbild im Manifest schloss Filmschaffende aus, die im unabhängigen Filmsektor mit digitalen Mitteln arbeiteten. Dies führte zu einer Diskrepanz zwischen den Idealen von Dogma und den Entwicklungen in der Filmindustrie.
In der Retrospektive wird Dogma 95 als ein Experiment betrachtet, das dazu beigetragen hat, die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche des Filmemachens zu lenken. Es hat jedoch auch seine Grenzen und Schwächen offenbart, was zu einer Vielzahl von Weiterentwicklungen wie dem Mumblecore-Genre und anderen experimentellen Ansätzen geführt hat. Trotz seines Scheiterns, als es zu erfolgreich wurde und seine eigenen Prinzipien untergrub, bleibt Dogma 95 ein wichtiger Meilenstein in der Filmgeschichte, der die Diskussion über Authentizität und Kreativität im Filmemachen weiter vorantreibt.

Oct 26, 2023 • 56min
EGL037 Der Gedankenstrich: Wo sich Grammatik, Schriftsatz, Poesie und Design 'Gute Nacht' sagen
Dass hier "die Phantasie des Lesers tätig werden muß" (J. Stenzei 1966, zitiert nach Dalmas 1994 : 56)
Der Gedankenstrich ist ein heimlicher Riese mit unheimlicher Wirkmacht im Text, die unsichtbare Nuance, die alles verändert. Als Stilmittel kann er Gedanken einrahmen, Spannung erzeugen, Schweigen ausdrücken, eine Kehrtwende einleiten, Dialoge strukturieren und -- Pausen erzeugen. In der Welt der Schriftgestaltung versteckt sich der Gedankenstrich als stiller -- wir sind ja *eigentlich* ein Filmpodcast -- Regisseur und ich möchte ihm eine Episode widmen.
Shownotes
Lauftrack zur Episode
EGL037 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
Viertelgeviertstrich – Wikipedia
Gedankenstrich-Krieg – Wikipedia
Pandoc – Wikipedia
Auszeichnungssprache – Wikipedia
Geviert (Typografie) – Wikipedia
Halbgeviertstrich – Wikipedia
Die Marquise von O.... – Wikipedia
Mitwirkende
Micz Flor
(Erzähler)
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
In dieser Episode versuchen wir einen profanen, aber einflussreichen Vertreter der Zunft der Interpunktion vorzustellen, den — hier ist er schon doppelt — Gedankenstrich. Wir werden über Typografie sprechen — und damit an die letzte Folge anknüpfen –, aber auch über Grammatik, Design und als Stilmittel, also seine poetische Magie ansprechen.
Schriftsatz und das Halbgeviert
Der Gedankenstrich, auch bekannt als der Halbgeviertstrich, ist in der Welt der Typografie ein wahres Mysterium. Doch warum gerade „Halbgeviert“? Die Antwort führt uns in die Tiefen der Druckhistorie. Das „Geviert“ ist ein Begriff aus der Zeit des Bleisatzes und bezeichnet ein Quadrat — eine Form, die den Buchstaben gleicht. Der Halbgeviertstrich hat die Dicke eines halben Quadrats, also eines Halbgevierts. Diese archaische Bezeichnung hat sich bis heute gehalten. So erweist sich die Welt der Typografie nicht nur als kunstvoll, sondern auch als eine Zeitreise in die Vergangenheit, die uns mit faszinierenden Geschichten wie dieser überrascht.
Poesie und — Spannung
Der einfache waagerechte Strich, dessen berühmteste — und berüchtigste — Erscheinungsform sich in der Marquise von O. befindet, wo er wohl eindeutig als Verstummungszeichen leer und empfängnisbereit (!) steht, wo also der Autor etwas verschweigen will und den Leser zum Weiterdenken animieren möchte, hat aber noch andere Funktionen, die es auch mit dem „Abbruch der Rede“ zu tun haben, die zwar einen Wink an den Leser bedeuten, jedoch nicht im Sinne eines „Gedankenmangels“. Daß der Gedankenstrich etwas thematisiert, ohne es sprachlich auszudrücken, steht außer Frage. Der erhobene Zeigefinger markiert einen Bruch im Ablauf der Rede und führt einen Inhalt ein, der somit einen Sonderstatus einnimmt.
Dalmas, Martine. Gedankenstriche: Zum Streichen oder Unterstreichen? Wozu Gedankenstriche?.In: Cahiers d’Études Germaniques, numéro 27, 1994, S. 56.
Interpunktion und Grammatik
Martine Dalmas, die wir schon oben zitiert haben, beschreibt die Diskussion um den Gedankenstrich so schön in ihrem Artikel „Gedankenstriche: Zum Streichen oder Unterstreichen? Wozu Gedankenstriche?“ von 1994, dass ich das einfach so –, sie wissen schon, einfach mal —
Obwohl er ein relativ spätes Mittel der Interpunktion ist, dessen allzu häufiger Gebrauch bzw. Mißbrauch schnell verpönt war (vgl. Braun 1775), was seine Sonderstellung noch mehr verstärkt, wird der Gedankenstrich schon in älteren Abhandlungen erwähnt: Braun (1775) und Adelung (1788) verweisen auf seine englische Herkunft; letzterer versucht eine Unterscheidung der Verwendungen und kritisiert den verschwenderischen Umgang mit diesem Zeichen. Selbst Werther, der aus seiner Abneigung keinen Hehl machte, verwendet ihn über 200 Mal! Auch die vermeintlich „unüberschaubare Mannigfaltigkeit“ dieses Zeichens, das „das Sprachlose“ hinzufügen soll, hat manchen Kritiker zu dem m.E. falschen Schluß geführt, daß hier „die Phantasie des Lesers tätig werden muß“ (J. Stenzei 1966, zitiert nach Garbe 1983 : 255).
Dalmas, Martine. Gedankenstriche: Zum Streichen oder Unterstreichen? Wozu Gedankenstriche?.In: Cahiers d’Études Germaniques, numéro 27, 1994, S. 56.

Oct 12, 2023 • 1h 39min
EGL036 Webfonts – wie die Schriften eigentlich ins Internet gekommen sind...
Von den ersten Schriftdrücken auf Papier bis zu variable Fonts im Internet
Diese Episode wird wieder von einem Gast präsentiert: Marc Tobias Kunisch. Tobs und Flo haben zusammen schon früh Podcast-Erfahrungen gemacht: von 2007 - 2009 haben sie den Mindgarden-Podcast aufgenommen, der damals Themen rund um Internettechnologien und Netzkultur präsentierte. Tobs arbeitet seit 2010 bei Google und mit Unterbrechung im Google Fonts Team. Dort hat er die Position des Design Leads übernommen. Als Thema für unseren Eigentlich Podcast hat sich dann auch "Webfonts" angeboten. Wir treffen uns im Gleisdreieck-Park und steigen erstmal tiefer in die Geschichte des Buchdrucks und Typographie ab. Mit der Entwicklung von technologischen Bedingungen haben sich Schriftarten und Druckverfahren verändert. Ein großer Schritt in Richtung digitaler Typographie waren Erfindungen wie das Fotosatzverfahren und das Postscript-Format. Als dann auch noch das Internet dazukam und hochauflösende Bildschirme waren die Bedingungen reif, um Schrift in diesem Medium neu denken zu können. Schrift ist heutzutage Software, die sich flexibel den Leser- und Lesebedingungen anpassen kann. Tobs stellt dazu das Google Projekt variable Fonts vor und auch die Errungenschaften im Lizenzbereich, die mit Google Fonts eingeführt wurden.
Shownotes
Laufroute
EGL036 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
About Tobias Kunisch
Google Fonts – Wikipedia
https://fonts.google.com/
Geschichte der Typografie – Wikipedia
Web typography - Wikipedia
HTML5 – Wikipedia
Cascading Style Sheets – Wikipedia
Webbrowser – Wikipedia
Park am Gleisdreieck – Wikipedia
Grotesk (Schrift) – Wikipedia
Serife – Wikipedia
Times New Roman – Wikipedia
Fraktur (Schrift) – Wikipedia
Lateinisches Alphabet – Wikipedia
Geschichte des Alphabets – Wikipedia
Trajanssäule – Wikipedia
Westliche Kalligrafie – Wikipedia
Kalligrafie – Wikipedia
Johannes Gutenberg – Wikipedia
Buchdruck – Wikipedia
Textura – Wikipedia
Buchschrift – Wikipedia
Syllabary - Wikipedia
Geschichte des Buchdrucks – Wikipedia
Gutenberg-Bibel – Wikipedia
Lesbarkeit – Wikipedia
Anatomie der Buchstaben – Wikipedia
Zeilendurchschuss – Wikipedia
Nichtproportionale Schriftart – Wikipedia
Dickte – Wikipedia
Schriftgrad – Wikipedia
Linotype – Wikipedia
Monotype-Setzmaschine – Wikipedia
Arbeiterbewegung – Wikipedia
Gewerkschaften: Geschichte der Gewerkschaften - Organisationen - Gesellschaft - Planet Wissen
GAG310: Arbeitskampf, Streik und das Leben der Gewerkschaftspionierin Paula Thiede - Geschichten aus der Geschichte
Fotosatz – Wikipedia
Das Interview mit dem letzten Schriftgießer – Blog zur Druck- und Mediengeschichte
Ausbreitung des Buchdrucks – Wikipedia
Geschichte der Typografie – Wikipedia
Han-Vereinheitlichung – Wikipedia
Unicode-Konsortium – Wikipedia
Unicode – Wikipedia
Core fonts for the Web – Wikipedia
Adobe GoLive - Wikipedia
Adobe Dreamweaver – Wikipedia
Desktop-Publishing – Wikipedia
PostScript – Wikipedia
Vektorfont – Wikipedia
Computermonitor – Wikipedia
Bitmap-Schrift – Wikipedia
Antialiasing (Computergrafik) – Wikipedia
OpenType – Wikipedia
Variable font - Wikipedia
https://fonts.google.com/variablefonts
Variable fonts support in Figma
https://creativecloud.adobe.com/de/discover/article/variable-fonts-are-the-future-of-web-type
https://en.wikipedia.org/wiki/Shantell_Martin
https://fonts.google.com/specimen/Shantell+Sans
Lese- und Rechtschreibstörung – Wikipedia
Creative Commons – Wikipedia
Open Source – Wikipedia
SIL Open Font License – Wikipedia
Apache-Lizenz – Wikipedia
MIT-Lizenz – Wikipedia
Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin
Science Spectrum - Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin
Science Museum – Wikipedia
Font-Lizenz-Einmaleins | Monotype.
FontShop – Wikipedia
Helvetica (Schriftart) – Wikipedia
OH no Type Company
Noto Fonts – Wikipedia
Barriers to entry - Wikipedia
Mitwirkende
Tobias Kunisch
(Erzähler)
mastodon
website
linkedin
twitter
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Verwandte Episoden
EGL085 Eigentlich Keyboards – der mechanische PodcastEGL087 Eigentlich Keyboards 2 – Von den Teilen zum Ganzen
Bei der Entwicklung von Schriftarten wurden metallische Schablonen für die einzelnen Buchstaben erstellt. Aus diesen Schablonen wurden durch das Zusammenstellen der Buchstaben viele Duplikate erstellt, um Wörter zu bilden. Dies nennt man Moveable Types, bei denen Buchstaben verschoben und umgruppiert werden können, um die richtigen Wörter und Sätze zu bilden. Jeder Buchstabe hat eine unterschiedliche Breite, daher mussten das „Fleisch“, das jeden Buchstaben umgibt, ebenfalls unterschiedliche Breiten haben. In CSS gibt es immer noch Elemente dieses Systems, wie z.B. die Verwendung von Bleistücken, um Zeilenhöhen zu erzeugen (ledding). Selbst in digitalen Schriftarten hat jeder Buchstabe eine unsichtbare Box um ihn herum, um sicherzustellen, dass alle Buchstaben genügend Platz haben, um ihr individuelles Design beizubehalten, während sie in einer Linie zusammenpassen. Verschiedene Schriftarten nutzen diesen Raum unterschiedlich, so dass einige Schriftarten größer erscheinen als andere, wenn sie in derselben Größe gesetzt werden. Dieses Konzept der individuellen Buchstabenkästen stammt aus den Prinzipien des Buchdrucks, der auf beweglichen Typen und der Herstellung von Bleiformen beruhte. Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Druckprozess mit der Einführung von Maschinen wie der Linotype und Monotype, die das Setzen von Typen effizienter machten. Ebenso ermöglichte die fotomechanische Belichtung experimentelle Techniken im Grafikdesign, bei denen Fotografie zur Anordnung von Buchstaben verwendet wurde. In den 60er und 70er Jahren wurde die Schriftgestaltung zu einem integralen Bestandteil des kreativen Ausdrucks in der Hippie-Bewegung. Bei der arabischen Typographie dauerte die Entwicklung aufgrund des Mangels an Drucktechnologien jedoch länger. Die Verbreitung der Drucktechnologie wurde durch den Kolonialismus beeinflusst, da europäische Techniken bestimmte Schreibpraktiken formten und verbreiteten. In der digitalen Welt traten Einschränkungen hinsichtlich der Zeichensätze in frühen Computern auf. Unicode wurde eingeführt, um diese Probleme anzugehen und verschiedene Schriftarten darzustellen. Das Unicode-Konsortium hat eine umfangreiche Tabelle mit Zeichen erstellt, die alle lebenden Schreibweisen repräsentieren sollen und jedem Zeichen einen eindeutigen Unicode-Punkt zuweisen. Bei der Verwendung von Computern und Telefonen verwenden wir oft Unicode-Zeichencodes, um bestimmte Schriftarten anzuzeigen. Die Geräte sind jedoch auf Standardschriften angewiesen, um diese Zeichen auf Bildschirmen anzuzeigen. Früher waren Webdesigner auf „websichere Schriften“ beschränkt, die auf den meisten Geräten vorinstalliert waren. Mit der Einführung von Webeditoren und den Fortschritten bei skalierbaren Vektorfonts und PostScript hat sich die Flexibilität und Skalierbarkeit der Schriftdarstellung erheblich verbessert.
Dazu kommt in jüngster Vergangenheit, dass die Schriften nicht mehr gedruckt, sondern ausschließlich auf Bildschirmen dargestellt werden. Die unterschiedlichen Pixel erzeugen das Bild auf dem Bildschirm. Unsere Bildschirme sind erst in letzter Zeit so gut geworden. Früher mussten Buchstaben auf unterschiedliche Größen skaliert werden. Bei dem Google Projekt „Variable Fonts“ können nun auch Zwischenwerte ausgewählt werden. Die Schriften sind individuell anpassbar und bieten auch Vorteile für Menschen mit Leseschwierigkeiten. Google Fonts hat über 1.500 Schriftfamilien im Katalog und versucht, alle stilistischen Richtungen und Sprachen abzudecken. Das Noto-Projekt zielt darauf ab, eine Schrift für jede Sprache in Unicode zu haben. Schrift ist wichtig für die Bewahrung von Kultur.

Sep 28, 2023 • 42min
EGL035 Rotkäppchen als Über-Ich-Mädchen-Wolf-Monster und ein Wolf der Schwangerschaft vorspielt: Gebärmutterneid, Neopsychoanalyse, Märchen Teil 5
"Biologisch betrachtet, verschafft aber die Mutterschaft, beziehungsweise die Fähigkeit zu ihr, der Frau eine ganz unbestreitbare und nicht geringe physiologische Überlegenheit." Karen Horney 1926
Was passiert, wenn das Wolfmädchen namens *Rotkäppchen* das Über-Ich in Form der Großmutter schluckt? Das erfahrt ihr in dieser Episode, deren Ausgangspunkt Erich Fromms Interpretation des Märchens ist. Fromms Deutung gibt uns die Möglichkeit auch Karen Horney, der Neopsychoanalyse und dem Gebärmutterneid Raum zu geben. Diese Episode bezieht sich auf Erich Fromms Buch "Märchen, Mythen, Träume", das wir in Folge 33 vorstellen und in dem es unter anderem darum geht, das verlorene Verständnis für die symbolische Sprache in Mythen, Märchen und Traumdeutung wiederzuentdecken. Fromm bezeichnet diese als die einzige universale Sprache der Menschheit und vergleicht auch Traumdeutungstheorien von Freud und Jung. Doch entsteht während unseres Spaziergangs eine eigene Interpretation, in der wir Mädchen und Wolf als ein und dieselbe Person betrachten. Ein Schelm wer monströses dabei denkt.
Mitwirkende
Micz Flor
(Erzähler)
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Florian Clauß
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Der folgende Text wird auf der Website des Goethe Instituts als Text der Brüder Grimm vorgestellt. Andere Fassungen oder Variationen stammen z.B. von Charles Perrault oder Ludwig Bechstein.
Es war einmal ein kleines, süßes Mädchen, das hatten alle lieb, die es nur ansahen, am allerliebsten aber hatte es seine Großmutter; die wusste gar nicht, was sie alles dem Kind geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen aus rotem Samt, und weil ihm das so gut stand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur noch das Rotkäppchen.
Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm: „Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein, bring das der Großmutter hinaus; sie ist krank und schwach und wird sich daran erfreuen. Sei artig und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und zerbrichst die Flasche, und die Großmutter hat nichts. Und wenn du in ihre Stube kommst, so vergiss nicht guten Morgen zu sagen, und guck nicht erst in allen Ecken herum.“
„Ich will schon alles gut machen“, sagte Rotkäppchen zur Mutter und gab ihr die Hand darauf. Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Als Rotkäppchen nun in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war, und fürchtete sich nicht vor ihm.
— „Guten Tag, Rotkäppchen“, sprach er. — „Schönen Dank, Wolf.“ — „Wo hinaus so früh, Rotkäppchen?“ — „Zur Großmutter.“ — „Was trägst du unter der Schürze?“ — „Kuchen und Wein; gestern haben wir gebacken, damit soll sich die kranke und schwache Großmutter stärken.“ — „Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?“ — „Noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei großen Eichbäumen, da steht ihr Haus; unten sind die Nusshecken, das wirst du ja wissen“, sagte Rotkäppchen.
Der Wolf dachte bei sich: „Das junge, zarte Ding, das ist ein fetter Bissen, der wird noch besser schmecken als die Alte. Du musst es listig anfangen, damit du beide schnappst.“ Da ging er ein Weilchen neben Rotkäppchen her, dann sprach er: „Rotkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die rings umher stehen, warum guckst du dich nicht um? Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vöglein so lieblich singen! Du gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gingst, und es ist so lustig draußen im Wald.“
Rotkäppchen schlug die Augen auf, und sah, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume hin und her tanzten und alles voll schöner Blumen stand. Da dachte es: „Wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, wird sie sich darüber freuen. Es ist noch früh am Tag, so dass ich doch zur rechten Zeit ankomme“, lief vom Weg ab in den Wald hinein und suchte Blumen. Und wenn es eine gepflückt hatte, meinte es, weiter hinaus stünde eine schönere, und lief danach und geriet immer tiefer in den Wald hinein.
Der Wolf aber ging geradewegs zum Haus der Großmutter und klopfte an die Tür.
— „Wer ist draußen?“ — „Rotkäppchen, das bringt Kuchen und Wein, mach auf.“ — „Drück nur auf die Klinke“, rief die Großmutter, „ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen.“
Der Wolf drückte auf die Klinke, die Tür sprang auf, und er ging ohne ein Wort zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter und verschluckte sie. Dann zog er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge zu.
Rotkäppchen aber war nach den Blumen herumgelaufen und erst als es so viele zusammen hatte, dass es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die Großmutter wieder ein, und es machte sich auf den Weg zu ihr. Es wunderte sich, dass die Tür offen stand, und wie es in die Stube kam, sah es so seltsam darin aus, dass es dachte: „Ei, du mein Gott, wie ängstlich wird es mir heute zumute, und bin sonst so gern bei der Großmutter!“ Es rief: „Guten Morgen!“, bekam aber keine Antwort. Darauf ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurück. Da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus.
— „Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren?“ — „Dass ich dich besser hören kann!“ — „Ei, Großmutter, was hast du für große Augen?“ — „Dass ich dich besser sehen kann!“ — „Ei, Großmutter, was hast du für große Hände?“ — „Dass ich dich besser packen kann.“ — „Aber, Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul?“ — „Dass ich dich besser fressen kann.“
Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bett und verschlang das arme Rotkäppchen.
Als der Wolf den fetten Bissen verschlungen hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und fing an, laut zu schnarchen. Der Jäger ging eben an dem Haus vorbei und dachte: „Wie die alte Frau schnarcht! Du musst doch einmal nach ihr sehen.“ Da trat er in die Stube, und als er vor das Bett kam, sah er, dass der Wolf darin lag. „Finde ich dich hier, du alter Sünder“, sagte der Jäger, „ich habe dich lange gesucht.“ Nun wollte er sein Gewehr anlegen, da fiel ihm ein, der Wolf könnte die Großmutter verschlungen haben, und vielleicht ist sie noch zu retten. Er schoss nicht, sondern nahm eine Schere und fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden. Als er ein paar Schnitte gemacht hatte, sah er das rote Käppchen leuchten, und noch ein paar Schnitte, da sprang das Mädchen heraus und rief:
„Ach, wie war ich erschrocken, wie war‘s so dunkel in dem Bauch des Wolfes!“ Und dann kam die Großmutter auch noch lebendig heraus und konnte kaum atmen. Rotkäppchen aber holte große, schwere Steine, damit füllten sie dem Wolf den Leib, und als er aufwachte, wollte er fortlaufen, aber die Steine waren so schwer, dass er gleich niedersank und tot umfiel. Da waren alle drei glücklich, der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab, die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen gebracht hatte, und erholte sich wieder, Rotkäppchen aber dachte: „Du willst dein Lebtag nicht wieder allein vom Weg ab in den Wald laufen, wenn es dir die Mutter verboten hat.“

Sep 14, 2023 • 1h 33min
EGL034 Schneewittchen: vom Narzissmus bis zur Selfie-Culture
"Spieglein, Spieglein an der Wand..."
Wir begeben uns mal wieder in die Welt der Märchen. Flo hat das Märchen Sneewittchen der 1. Fassung von 1812 aus dem KHM (Kinder- und Hausmärchen) der Gebrüder Grimm mitgebracht. Flo hat das Märchen vorher eingesprochen, weil im Laufen Vorlesen nicht zu seinen Kernkompetenzen gehört. Wir hören uns das an, während wir über den samstäglichen Kreativ- und Fressmarkt am Maybachufer spazieren. Unsere Route führt uns am Kanal am Weigandufer entlang zur Neuköllner Kolonie "Freiheit". Wir sprechen über die Unterschiede von der 1. und letzten Fassung von Schneewittchen (KHM 6. Auflage 1850). Micz hat da einiges vorbereitet, was aus einem psychoanalytischen Blickwinkel sehr spannend ist. Wir kommen auch auf die narzisstische Persönlichkeit der Mutter / Stiefmutter zu sprechen und steigen tiefer in eine Narzissmus-Betrachtung ein. Flo hebt die Kulturgeschichte des Spiegels hervor und die astronomischen Aspekte des Märchens Schneewittchen. Die sieben Zwerge stellen mit Schneewittchen eine kosmologische Ordnung dar, wie die Planeten mit der Erde auf der Eklipse um die Sonne wandern. Eine böse Entität stört diese Raum- und Zeiteinheit, das muss wiederhergestellt werden. Wir steigen auch kurz in die Welt der Farben in diesem Märchen ab, die Farben Weiß, Rot, Schwarz machen die komplette dramatische Erzählung aus, wobei Weiß für die Unschuld, das Reine, das Gute steht und Schwarz für das Böse und Vergängliche. Rot verbindet die Anziehung, den Aufbruch, das (sexuell) Attraktive, die Leidenschaft und das Leben, was eben diese Ordnung von Schwarz und Weiß stören kann. Letztlich kommen wir auf gesellschaftlich erwartete Rolle der Frau zu sprechen, die Schneewittchen einnehmen muss, um von den Zwergen und dem Prinzen akzeptiert zu werden. Sie muss vor allen Dingen schön sein und haushälterische Tätigkeiten übernehmen. Selbst wenn sie vom Apfel beißt und in einem todesähnlichen Zustand verharrt, ist sie so schön, dass der Prinz sie überall hin mitträgt wie eine Instakachel im Smartphone. Flo spricht noch über die Geschichte der Fotografie und Selfie-Culture. Am Ende sind sich Flo und Micz einig, dass das Märchen Schneewittchen unglaublich viele Interpretationsansätze bietet und in der Komplexität und Ambivalenz einen sehr verdienten Platz in der Popkultur gefunden hat.
Shownotes
Laufroute
EGL034 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
Grimms Märchen – Wikipedia
Schneewittchen – Wikipedia
Aarne-Thompson-Uther-Index – Wikipedia
"Kobuto": Dokumentarfilm über das "Zentrum Kreuzberg"
Zentrum Kreuzberg – Wikipedia
Von Schneewittchen bis zum Sohn des Pilzkönigs. Märchen- und Mythenstrukturen in den Werken Marie Hermansons | Katrin Alas
Aschenputtel und ihre Schwestern – Frauenfiguren im Märchen | Gerda-Elisabeth Wittmann
Über: Bruno Bettelheim: Kinder brauchen Märchen | Heike vom Orde 2012
Medea – Wikipedia
Medea (1988) – Wikipedia
Der kaukasische Kreidekreis – Wikipedia
Selbstliebe – Wikipedia
Narzissmus – Wikipedia
Narziss – Wikipedia
Farben in Märchen | Kulturding
Zahlen im Märchen: Die Drei (Symbolik, Beispiele) - Märchenatlas
Die Zahl Sieben im Märchen (Symbolik, Beispiele) - Märchenatlas
Märchenhaftes Siebengebirge: Wie Schneewittchen hinter die sieben Berge kam | National Geographic
Ekliptik – Wikipedia
Geschichte der Astronomie – Wikipedia
Sesshaftigkeit – Wikipedia
Shiva – Wikipedia
GAG389: Spieglein, Spieglein an der Wand - Geschichten aus der Geschichte
Spiegel – Wikipedia
Spiegelsaal von Versailles – Wikipedia
Narzisstische Persönlichkeitsstörung – Wikipedia
Masturbation – Wikipedia
primärer Narzißmus - Lexikon der Psychologie
Übertragung (Psychoanalyse) – Wikipedia
ICD-10 – Wikipedia
ICD-11 – Wikipedia
Kolonie Freiheit - Anfahrt mit dem Auto oder den "Öffis"
Quartiersmanagement Weiße Siedlung: Die Weiße Siedlung
Alan Turing – Wikipedia
Selfie – Wikipedia
Geschichte und Entwicklung der Fotografie – Wikipedia
Mitwirkende
Florian Clauß
(Erzähler)
Bluesky
Mastodon
Soundcloud
Website
Micz Flor
Instagram
Twitter
YouTube (Channel)
Website
Das Märchen Schneewittchen trägt bei Grimm den Index KHM 53. Nach dem Aarne-Thompson-Uther-Index (ATU) ordnet sich Sneewittchen mit der Nummer ATU 709 in die Gruppe „Andere übernatürliche Geschehnisse ATU 700–749“ ein, gleich neben den Sagen „Der Vater, der seine Tochter heiraten wollte“ und „Die Schwester von neun Brüdern“. Der ATU schafft mit der Sammlung von europäischen Sagen und Märchen noch mal eine bessere Vergleichbarkeit über die einzelnen Ländergrenzen hinaus.
In diesem Gespräch geht es um das Märchen Schneewittchen und verschiedene Interpretationen und Veränderungen im Laufe der Zeit. Wir erfahren, dass die Gebrüder Grimm eine niederdeutsche Version des Märchens veröffentlicht haben, in der eine Königin eifersüchtig auf die Schönheit von Schneewittchen ist und einen Jäger beauftragt, sie zu töten. Schneewittchen entkommt jedoch und findet Zuflucht bei den sieben Zwergen. Die Königin unternimmt mehrere Versuche, Schneewittchen zu töten, aber jedes Mal wird sie gerettet. Schließlich vergiftet die Königin Schneewittchen mit einem Apfel und sie fällt in einen todesähnlichen Schlaf, aus dem sie nur durch einen Kuss eines Prinzen erwacht.
Es gibt interessante Unterschiede in den verschiedenen Versionen des Märchens, zum Beispiel die verschiedenen Rollen der Zwerge. In einigen Versionen sind sie Diebe, Räuber, Riesen oder Elfen. Es ist auffällig, dass die Rolle der Stiefmutter erst später ins Märchen eingeführt wurde und dass in älteren Versionen die leibliche Mutter Schneewittchen misshandelt.
Die Rolle der Frau in Schneewittchen spiegelt das traditionelle Gesellschaftsbild wider, in dem Frauen erwartet wird, sich um den Haushalt zu kümmern, schön zu sein und eine bestimmte Rolle auszufüllen. Schneewittchen erfüllt diese Erwartungen während ihres Aufenthalts bei den Zwergen. Sie wird gewissermaßen als ein Accessoire betrachtet, das geduldet wird, solange es seine vorgegebene Rolle erfüllt. Dies erinnert an die Vorstellung der Frau als dienendes Wesen und verdeutlicht den männlichen Blick auf Frauen in der Gesellschaft.
Der magische Spiegel im Märchen hat eine tiefere Bedeutung, die in der modernen Welt relevant ist. Der Spiegel wird zum einen mit der Selbstreflexion und der Entwicklung von Eigenliebe in Verbindung gebracht. In diesem Zusammenhang werden die verschiedenen Ausprägungen des Narzissmus besprochen. Zum anderen kann er als eine Art Vorläufer der modernen Medien und der Selfie-Kultur angesehen werden. Der Spiegel scheint eine objektive Instanz zu sein, die die Wahrheit sagt. Er symbolisiert die Art und Weise, wie moderne Medien Informationen über das äußere Erscheinungsbild liefern und damit die Selbstwahrnehmung beeinflussen. Dies wird durch die Motivation der Königin, ihre Tochter umzubringen, um ihre eigene Schönheit zu bewahren, verdeutlicht. Dies erinnert an die heutige Praxis des Filterns und Retuschierens von Selfies in sozialen Medien, um ein idealisiertes äußeres Bild darzustellen.
Die Entwicklung der Fotografie und das Porträtieren sind weitere Aspekte, die in Schneewittchen reflektiert werden. Die Einführung der Fotografie um 1850 revolutionierte die Porträtmalerei und demokratisierte die Möglichkeit, gesellschaftliche Bilder zu fixieren. Dies erinnert an den gläsernen Sarg, der Schneewittchen im Märchen einfriert. In der heutigen Zeit kann der gläserne Sarg als eine Art Instagram-Fotografie angesehen werden.
Die Liebesgeschichte zwischen Schneewittchen und dem Prinzen wirft die Frage nach der wahren Natur der Liebe und Erkenntnis auf. Der Prinz verliebt sich nur in ein Spiegelbild, genauso wie die Königin, die sich selbst im Spiegel betrachtet. Beide verhaften einer äußeren Schönheit. Erst durch körperlichen Kontakt wird Schneewittchen wieder zum Leben erweckt, und sie akzeptiert bereitwillig die gesellschaftliche Rolle, die von ihr erwartet wird.
Hier der orginale Text des Märchens Sneewittchen aus dem Jahre 1812:
Sneewittchen (Schneeweißchen).
Es war einmal mitten im Winter, und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel, da saß eine schöne Königin an einem Fenster, das hatte einen Rahmen von schwarzem Ebenholz, und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger, und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rothe in dem Weißen so schön aussah, so dachte sie: hätt ich doch ein Kind so weiß wie Schnee, so roth wie Blut und so schwarz wie dieser Rahmen. Und bald darauf bekam sie ein Töchterlein, so weiß wie der Schnee, so roth wie das Blut, und so schwarz wie Ebenholz, und darum ward es das Sneewittchen genannt.
Die Königin war die schönste im ganzen Land, und gar stolz auf ihre Schönheit. Sie hatte auch einen Spiegel, vor den trat sie alle Morgen und fragte:
„Spieglein, Spieglein an der Wand:wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land?“
da sprach das Spieglein allzeit:
„Ihr, Frau Königin, seyd die schönste Frau im Land.“
Und da wußte sie gewiß, daß niemand schöner auf der Welt war. Sneewittchen aber wuchs heran, und als es sieben Jahr alt war, war es so schön, daß es selbst die Königin an Schönheit übertraf, und als diese ihren Spiegel fragte:
„Spieglein, Spieglein an der Wand:wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land?“
sagte der Spiegel:
„Frau Königin, Ihr seyd die schönste hier,aber Snewittchen ist noch tausendmal schöner als Ihr!“
Wie die Königin den Spiegel so sprechen hörte, ward sie blaß vor Neid, und von Stund an haßte sie das Sneewittchen, und wenn sie es ansah, und gedacht, daß durch seine Schuld sie nicht mehr die schönste auf der Welt sey, kehrte sich ihr das Herz herum. Da ließ ihr der Neid keine Ruhe, und sie rief einen Jäger und sagte zu ihm: „führ das Sneewittchen hinaus in den Wald an einen weiten abgelegenen Ort, da stichs todt, und zum Wahrzeichen bring mir seine Lunge und seine Leber mit, die will ich mit Salz kochen und essen.“ Der Jäger nahm das Sneewittchen und führte es hinaus, wie er aber den Hirschfänger gezogen hatte und eben zustechen wollte, da fing es an zu weinen, und bat so sehr, er mögt ihm sein Leben lassen, es wollt nimmermehr zurückkommen, sondern in dem Wald fortlaufen. Den Jäger erbarmte es, weil es so schön war und gedachte: die wilden Thiere werden es doch bald gefressen haben, ich bin froh, daß ich es nicht zu tödten brauche, und weil gerade ein junger Frischling gelaufen kam, stach er den nieder, nahm Lunge und Leber heraus und bracht sie als Wahrzeichen der Königin mit, die kochte sie mit Salz und aß sie auf, und meinte sie hätte Sneewittchens Lunge und Leber gegessen.
Sneewittchen aber war in dem großen Wald mutterseelig allein, so daß ihm recht Angst ward und fing an zu laufen und zu laufen über die spitzen Steine, und durch die Dornen den ganzen Tag: endlich, als die Sonne untergehen wollte, kam es zu einem kleinen Häuschen. Das Häuschen gehörte sieben Zwergen, die waren aber nicht zu Haus, sondern in das Bergwerk gegangen. Sneewittchen ging hinein und fand alles klein, aber niedlich und reinlich: da stand ein Tischlein mit sieben kleinen Tellern, dabei sieben Löfflein, sieben Messerlein und Gäblein, sieben Becherlein, und an der Wand standen sieben Bettlein neben einander frisch gedeckt. Sneewittchen war hungrig und durstig, aß von jedem Tellerlein ein wenig Gemüs und Brod, trank aus jedem Gläschen einen Tropfen Wein, und weil es so müd war, wollte es sich schlafen legen. Da probirte es die sieben Bettlein nach einander, keins war ihm aber recht, bis auf das siebente, in das legte es sich und schlief ein.
Wie es Nacht war, kamen die sieben Zwerge von ihrer Arbeit heim, und steckten ihre sieben Lichtlein an, da sahen sie, daß jemand in ihrem Haus gewesen war. Der erste sprach: „wer hat auf meinem Stühlchen gesessen?“ Der zweite: „wer hat von meinem Tellerchen gegessen?“ Der dritte: „wer hat von meinem Brödchen genommen?“ Der vierte: „wer hat von meinem Gemüschen gegessen?“ Der fünfte: „wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen?“ Der sechste: „wer hat mit meinem Messerchen geschnitten?“ Der siebente: „wer hat aus meinem Becherlein getrunken?“ Darnach sah der erste sich um und sagte: „wer hat in mein Bettchen getreten?“ Der zweite: „ei, in meinem hat auch jemand gelegen?“ und so alle weiter bis zum siebenten, wie der nach seinem Bettchen sah, da fand er das Sneewittchen darin liegen und schlafen. Da kamen die Zwerge alle gelaufen, und schrieen vor Verwunderung, und holten ihre sieben Lichtlein herbei, und betrachteten das Sneewittchen, „ei du mein Gott! ei du mein Gott! riefen sie, was ist das schön!“ Sie hatten große Freude an ihm, weckten es auch nicht auf, und ließen es in dem Bettlein liegen; der siebente Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen, bei jedem eine Stunde, da war die Nacht herum. Als nun Sneewittchen aufwachte, fragten sie es, wer es sey und wie es in ihr Haus gekommen wäre, da erzählte es ihnen, wie seine Mutter es habe wollen umbringen, der Jäger ihm aber das Leben geschenkt, und wie es den ganzen Tag gelaufen, und endlich zu ihrem Häuslein gekommen sey. Da hatten die Zwerge Mitleiden und sagten: „wenn du unsern Haushalt versehen, und kochen, nähen, betten, waschen und stricken willst, auch alles ordentlich und reinlich halten, sollst du bei uns bleiben und soll dir an nichts fehlen; Abends kommen wir nach Haus, da muß das Essen fertig seyn, am Tage aber sind wir im Bergwerk und graben Gold, da bist du allein; hüt dich nur vor der Königin und laß niemand herein.“
Die Königin aber glaubte, sie sey wieder die allerschönste im Land, trat Morgens vor den Spiegel und fragte:
„Spieglein, Spieglein an der Wand:wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land?“
da antwortete der Spiegel aber wieder:
„Frau Königin, Ihr seyd die schönste hier:aber Sneewittchen, über den sieben Bergen istnoch tausendmal schöner als Ihr!“
wie die Königin das hörte erschrack sie und sah wohl, daß sie betrogen worden und der Jäger Sneewittchen nicht getödtet hatte. Weil aber niemand, als die sieben Zwerglein in den sieben Bergen war, da wußte sie gleich, daß es sich zu diesen gerettet hatte, und nun sann sie von neuem nach, wie sie es umbringen könnte, denn so lang der Spiegel nicht sagte, sie wär die schönste Frau im ganzen Land, hatte sie keine Ruh. Da war ihr alles nicht sicher und gewiß genug, und sie verkleidete sich selber in eine alte Krämerin, färbte ihr Gesicht, daß sie auch kein Mensch erkannte, und ging hinaus vor das Zwergenhaus. Sie klopfte an die Thür und rief: „macht auf, macht auf, ich bin die alte Krämerin, die gute Waare feil hat.“ Sneewittchen guckte aus dem Fenster: „was habt ihr denn?“ – „Schnürriemen, liebes Kind,“ sagte die Alte, und holte einen hervor, der war von gelber, rother und blauer Seide geflochten: „willst du den haben?“ – Ei ja, sprach Sneewittchen, und dachte die gute alte Frau kann ich wohl hereinlassen, die meints redlich; riegelte also die Thüre auf und handelte sich den Schnürriemen. „Aber wie bist du so schlampisch geschnürt, sagte die Alte, komm ich will dich einmal besser schnüren.“ Sneewittchen stellte sich vor sie, da nahm sie den Schnürriemen und schnürte und schnürte es so fest, daß ihm der Athem verging, und es für todt hinfiel. Darnach war sie zufrieden und ging fort.
Bald darauf ward es Nacht, da kamen die sieben Zwerge nach Haus, die erschracken recht, als sie ihr liebes Sneewittchen auf der Erde liegen fanden, als wär es todt. Sie hoben es in die Höhe, da sahen sie, daß es so fest geschnürt war, schnitten den Schnürriemen entzwei, da athmete es erst, und dann ward es wieder lebendig. „Das ist niemand gewesen, als die Königin, sprachen sie, die hat dir das Leben nehmen wollen, hüte dich und laß keinen Menschen mehr herein.“
Die Königin aber fragte ihren Spiegel:
„Spieglein, Spieglein an der Wand:wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land?“
der Spiegel antwortete:
„Frau Königin, Ihr seyd die schönste hier,aber Sneewittchen bei den sieben Zwergelchenist tausendmal schöner als Ihr.“
Sie erschrack, daß das Blut ihr all zum Herzen lief, da sie sah, daß Sneewittchen wieder lebendig geworden war. Darnach sann sie den ganzen Tag und die Nacht, wie sie es doch noch fangen wollte, und machte einen giftigen Kamm, verkleidete sich in eine ganz andere Gestalt, und ging wieder hinaus. Sie klopfte an die Thür, Sneewittchen aber rief: „ich darf niemand hereinlassen;“ da zog sie den Kamm hervor, und als Sneewittchen den blinken sah und es auch jemand ganz fremdes war, so machte es doch auf, und kaufte ihr den Kamm ab. „Komm ich will dich auch kämmen,“ sagte die Krämerin, kaum aber stack der Kamm dem Sneewittchen in den Haaren, da fiel es nieder und war todt. „Nun wirst du liegen bleiben,“ sagte die Königin, und ihr Herz war ihr leicht geworden, und sie ging heim. Die Zwerge aber kamen zu rechter Zeit, sahen was geschehen, und zogen den giftigen Kamm aus den Haaren, da schlug Sneewittchen die Augen auf, und war wieder lebendig, und versprach den Zwergen, es wollte gewiß niemand mehr einlassen.
Die Königin aber stellte sich vor ihren Spiegel:
„Spieglein, Spieglein an der Wand:wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land!“
der Spiegel antwortete:
„Frau Königin, Ihr seyd die schönste hier,aber Sneewittchen, bei den sieben Zwergelchenist tausendmal schöner als Ihr!“
Wie das die Königin wieder hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn: „so soll das Sneewittchen noch sterben, und wenn es mein Leben kostet!“ Dann ging sie in ihre heimlichste Stube, und niemand durfte vor sie kommen, und da machte sie einen giftigen, giftigen Apfel, äußerlich war er schön und rothbäckig, und jeder der ihn sah, bekam Lust dazu. Darauf verkleidete sie sich als Bauersfrau, ging vor das Zwerghaus und klopfte an. Sneewittchen guckte und sagte: „ich darf keinen Menschen einlassen, die Zwerge haben mirs bei Leibe verboten.“ „Nun, wenn Ihr nicht wollt, sagte die Bäuerin, kann ich euch nicht zwingen, meine Aepfel will ich schon los werden, da, einen will ich euch zur Probe schenken.“ – „Nein, ich darf auch nichts geschenkt nehmen, die Zwerge wollens nicht haben.“ – „Ihr mögt Euch wohl fürchten, da will ich den Apfel entzwei schneiden und die Hälfte essen, da den schönen rothen Backen sollt Ihr haben;“ der Apfel war aber so künstlich gemacht, daß nur die rothe Hälfte vergiftet war. Da sah Sneewittchen, daß die Bäuerin selber davon aß, und sein Gelüsten darnach ward immer größer, da ließ es sich endlich die andere Hälfte durchs Fenster reichen, und biß hinein, kaum aber hatte es einen Bissen im Mund, so fiel[1] es todt zur Erde.
Die Königin aber freute sich, ging nach Haus und fragte den Spiegel:
„Spieglein, Spieglein an der Wand:wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land?“
da antworte er:
„Ihr, Frau Königin, seyd die schönste Frau im Land!“
„Nun hab ich Ruhe“ sprach sie, „da ich wieder die schönste im Lande bin, und Sneewittchen wird diesmal wohl todt bleiben.“
Die Zwerglein kamen Abends aus den Bergwerken nach Haus, da lag das liebe Sneewittchen auf dem Boden und war todt. Sie schnürten es auf, und sahen, ob sie nichts giftiges in seinen Haaren fänden, es half aber alles nichts, sie konnten es nicht wieder lebendig machen. Sie legten es auf eine Bahre, setzten sich alle sieben daran, weinten und weinten drei Tage lang, dann wollten sie es begraben, da sahen sie aber daß es noch frisch und gar nicht wie ein Todter aussah, und daß es auch seine schönen rothen Backen noch hatte. Da ließen sie einen Sarg von Glas machen, legten es hinein, daß man es recht sehen konnte, schrieben auch mit goldenen Buchstaben seinen Namen darauf und seine Abstammung, und einer blieb jeden Tag zu Haus und bewachte es.
So lag Sneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, war noch so weiß als Schnee, und so roth als Blut, und wenns die Aeuglein hätte können aufthun, wären sie so schwarz gewesen wie Ebenholz, denn es lag da, als wenn es schlief. Einmal kam ein junger Prinz zu dem Zwergenhaus und wollte darin übernachten, und wie er in die Stube kam und Sneewittchen in dem Glassarg liegen sah, auf das die sieben Lichtlein so recht ihren Schein warfen, konnt er sich nicht satt an seiner Schönheit sehen, und las die goldene Inschrift und sah, daß es eine Königstochter war. Da bat er die Zwerglein, sie sollten ihm den Sarg mit dem todten Sneewittchen verkaufen, die wollten aber um alles Gold nicht; da bat er sie, sie mögten es ihm schenken, er könne nicht leben ohne es zu sehen, und er wolle es so hoch halten und ehren, wie sein Liebstes auf der Welt. Da waren die Zwerglein mitleidig und gaben ihm den Sarg, der Prinz aber ließ ihn in sein Schloß tragen, und ließ ihn in seine Stube setzen, er selber saß den ganzen Tag dabei, und konnte die Augen nicht abwenden; und wenn er aus mußte gehen und konnte Sneewittchen nicht sehen, ward er traurig, und er konnte auch keinen Bissen essen, wenn der Sarg nicht neben ihm stand. Die Diener aber, die beständig den Sarg herumtragen mußten, waren bös darüber, und einer machte einmal den Sarg auf, hob Sneewittchen in die Höh und sagte: „um so eines todten Mädchens willen, werden wir den ganzen Tag geplagt,“ und gab ihm mit der Hand einen Stumpf in den Rücken. Da fuhr ihm der garstige Apfelgrütz, den es abgebissen hatte, aus dem Hals, und da war Sneewittchen wieder lebendig. Da ging es hin zu dem Prinzen, der wußte gar nicht, was er vor Freuden thun sollte, als sein liebes Sneewittchen lebendig war, und sie setzten sich zusammen an die Tafel und aßen in Freuden.
Auf den andern Tag ward die Hochzeit bestellt, und Sneewittchens gottlose Mutter, auch eingeladen. Wie sie nun am Morgen vor dem Spiegel trat und sprach:
„Spieglein, Spieglein an der Wand:wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land!“
da antwortete er:
„Frau Königin, Ihr seyd die schönste hier,aber die junge Königin ist tausendmal schöner als Ihr!“
Als sie das hörte, erschrack sie, und es war ihr so Angst, so Angst, daß sie es nicht sagen konnte. Doch trieb sie der Neid, daß sie auf der Hochzeit die junge Königin sehen wollte, und wie sie ankam, sah sie, daß es Sneewittchen war; da waren eiserne Pantoffeln im Feuer glühend gemacht, die mußte sie anziehen und darin tanzen, und ihre Füße wurden jämmerlich verbrannt, und sie durfte nicht aufhören bis sie sich zu todt getanzt hatte.
https://de.wikisource.org/wiki/Sneewittchen_(Schneewei%C3%9Fchen)_(1812)

Aug 31, 2023 • 58min
EGL033 Märchen, Mythen, Träume: Erich Fromms Ansatz zur Traumdeutung in Abgrenzung von S. Freud und C. G. Jung (Märchen Teil 3)
Wir sind der Autor, es ist unser Traum, wir haben die Handlung erfunden.
In dieser Episode betrachten wir Erich Fromm und sein Buch “Märchen, Mythen, Träume” als Teil der Eigentlich-Serie über Märchen. Erich Fromm betrachtet in seinem Text die Verbindung zwischen Traumdeutung und Märcheninterpretation. Er beginnt mit einer Betrachtung des Symbolismus und unterscheidet zwischen manifesten und latenten Inhalten in Mythen und Märchen. Dies führt ihn zur Traumdeutung, bei der ebenfalls Symbole und latente Inhalte gedeutet werden. Fromm stellt die Ansätze von Sigmund Freud und Carl Gustav Jung zur Traumdeutung vor, grenzt sich jedoch von beiden ab. Er argumentiert, dass weder Jungs mythische Ansätze noch Freuds Fokus auf irrationale libidinöse Kräfte ausreichend sind. Stattdessen betont er, dass das Denken und Fühlen durch unser Handeln beeinflusst wird. Zuletzt wollten wir Fromms Interpretation des Rotkäppchen Märchens vorstellen, die haben wir dann aber um einen Monat in die Zukunft verschoben.
Shownotes
Laufroute
EGL033 | Wanderung | Komoot
Links zur Episode
Helmut Johach: 'Erich Fromms Einfluss auf die Humanistische Psychologie' (Auszug)
'Erich Fromms Einfluss auf die Humanistische Psychologie' rezensiert von Prof. Dr. Manfred Gerspach
Erwähnt: Erich Fromms 'Haben oder Sein'
Erwähnt: Erich Fromms 'Die Kunst des Liebens'
Das Buch Jona und der Bauch des Fisches
Inception, der Film
Erich Fromms Plakette am Bayrischen Platz 1 verweist mittels QR auf mehr Informationen
Perlentaucher-Besprechung: Der Ego-Tunnel - Vom Mythos des Selbst zur Ethik des Bewusstseins
Half-Brained Ducks in a Row - science.org
Freuds Traumdeutung erschien am 4. November 1899 und wurde auf das Jahr 1900 vordatiert.
Supernova im Orion? Was Beteigeuzes Verdunkelung bedeutet - nationalgeographic.de
Sensationsfund: Der Schauplatz der biblischen Sintflut - Tagesspiegel
Die Sintflut in der Bibel. Von der Strafe zur Gnade Gottes - DLF
Mitwirkende
In Schöneberg teilten sich die Wolken und diese Episode: Der Besprechung des Buchs „Märchen, Mythen, Träume: Eine Einführung in das Verständnis einer vergessenen Sprache“ von Erich Fromm sollte auch Fromms Interpretation des Märchens Rotkäppchen beigefügt werden. Das haben wir dann kurzerhand gesplittet und zwei Episoden daraus gemacht. Die vorliegende Episode reflektiert das Buch und zitiert Erich Fromm. (Rotkäppchen ist eine eigene Episode mit der Nummer 35.)
Wenn wir schlafen, erwachen wir zu einer anderen Daseinsform. Wir träumen. Wir erfinden Geschichten, die sich nie ereignet haben und für die es im wirklichen Leben manchmal keine Entsprechung gibt. Manchmal sind wir der Held, manchmal der Bösewicht; manchmal erleben wir die herrlichsten Dinge und sind glücklich; oft werden wir in höchsten Schrecken versetzt. Doch welche Rolle wir auch immer im Traum spielen, wir sind der Autor, es ist unser Traum, wir haben die Handlung erfunden.
Erich Fromm: Märchen, Mythen, Träume (2007) Seite 12
Verwandtschaft der Traumdeutung und der Interpretation von Märchen
Fromm bekommt schnell die Kurve Traumdeutung und Interpretation von Märchen gemeinsam zu betrachten. Seine Ausführungen beginnt er mit einem Blick auf Symbolismus, gefolgt von der Unterscheidung manifester und latenter Inhalte in Mythen und Märchen. Daraus baut er zügig eine Brücke in die Traumdeutung, werden dabei doch ebenso Symbole und latente Inhalte gedeutet. Fromm stellt Sigmund Freuds und Carl Gustav Jungs Ansätze zur Traumdeutung vor, um sich anschließend von beiden abgrenzt wenn er schreibt:
Es ist weder Jungs mythisches Reich mit seinen aus der Gattungsgeschichte ererbten Erfahrungen, noch Freuds Sitz irrationaler libidinöser Kräfte. Wir müssen es vielmehr gemäß dem Grundsatz verstehen: ‚Was wir denken und fühlen, wird von dem beeinflusst, was wir tun.‘
Erich Fromm: Märchen, Mythen, Träume (2007) Seite 29
Damit gibt er uns auch eine schöne Zusammenfassung, bevor wir jetzt — auch wieder mit Zitaten Fromms — etwas mehr ins Detail gehen.
Sigmund Freud: Das Unbewusste als treibende, drängende Kraft
Fromm erinnert uns:
Es war Freud, der zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts die alte Auffassung neu bestätigte, dass die Träume sinn- und bedeutungsvoll sind, dass wir nichts träumen, was nicht ein wichtiger Ausdruck unseres Innenlebens ist, und dass man alle Träume verstehen kann, wenn man nur den Schlüssel dazu besitzt.
Erich Fromm: Märchen, Mythen, Träume (2007) Seite 26
Sigmund Freuds Theorien betont die Verbindung zwischen verdrängten Wünschen und symbolischen Trauminhalten. Freud interpretiert Träume als Kanäle, durch die verbotene oder unterdrückte Wünsche ans Licht kommen, oft verpackt in verschlüsselte Bilder. Sein Ansatz ist stark psychoanalytisch geprägt und konzentriert sich auf die Entschlüsselung latenter Bedeutungen hinter den manifesten Trauminhalten.
Die Kritik an Freuds Konzeption besteht vor allem auch darin, dass sich alles auf das alte bezieht, auf verdrängtes, un- und vorbewusstes, was nach oben drängt und im Traum nicht gut in Schach gehalten werden kann. Aber haben Träume nicht auch das Potential nach vorne zu Blicken, Pläne und Lösungen anzuregen? Carl Gustav Jung schreibt dazu: „Die Seele ist Durchgangspunkt, daher notwendigerweise nach zwei Seiten bestimmt. Sie gibt einerseits ein Bild vom Niederschlag alles Vergangenen, und in diesem andererseits ein Bild der keimenden Erkenntnis alles Kommenden, insofern die Seele selber die Zukunft schafft.“ (C. G. Jung, 1968, S. 205, vgl. Erich Fromm: Märchen, Mythen, Träume (2007) Seite 68)
Carl Gustav Jung: Archetypen und individuelle Entwicklung
Jungs Ansatz zur Traumdeutung ist geprägt von seiner Theorie des kollektiven Unbewussten und der Bedeutung von Archetypen. Er argumentiert, dass Träume nicht nur persönliche, sondern auch universelle, kulturelle und symbolische Elemente enthalten. Für Jung sind Träume eine Art, sich mit tiefen Schichten des Selbst und dem kollektiven Erbe der Menschheit zu verbinden.
Fromm streut Salz direkt in Jungs spirituelle Öffnung (oder Wunde?). Ich finde den folgenden Text sehr hilfreich, um neben C. G. Jungs transzendentem Ansatz vor allem auch Erich Fromms Abgrenzung von dieser zu verstehen. Deshalb lasse ich die längere Textpassage aus Fromms Buch mal laufen:
Aber Jung geht noch weiter und behauptet, diese Tatsache sei „ohne Zweifel ein grundlegendes religiöses Phänomen“, und die Stimme, die in unseren Träumen spreche, sei nicht unsere eigene, sondern komme aus einer Quelle, die uns transzendiere. Auf den Einwand, „dass die von der Stimme vertretenen Gedanken nichts anderes seien als die Gedanken des Individuums selbst“, antwortete er (C. G. Jung, 1937, S.41f.):„Das mag sein; aber ich würde einen Gedanken nur dann meinen eigenen nennen, wenn ich ihn gedacht habe, ebenso wie ich Geld nur dann als mein eigenes bezeichnen würde, wenn ich es bewusst und legitim erworben habe. Wenn jemand mir das Geld als Geschenk gibt, werde ich zu meinem Wohltäter sicherlich nicht sagen: „Ich danke dir für mein Geld“, obwohl ich nachher zu einer dritten Person sagen könnte: „Dies ist mein eigenes Geld.“ Mit der Stimme bin ich in einer ähnlichen Lage. Die Stimme gibt mir gewisse Inhalte, genau so, wie ein Freund mir seine Ideen mitteilen würde. Es wäre weder anständig noch wahrheitsgemäß, sondern ein Plagiat, zu behaupten, dass, was er sagt, ursprünglich und zuerst meine eigenen Ideen gewesen seien.“
Erich Fromm: Märchen, Mythen, Träume (2007) Seite 68
Erich Fromm: Träume mit Potential im umgebender Gesellschaft
Erich Fromm bring eine sozialere Dimension in die Traumdeutung ein. Er betont, dass Träume nicht nur individuelle, sondern auch soziale und kulturelle Bedeutung haben. Fromm sieht Träume als Reflektion der gesellschaftlichen Umstände und als Ausdruck von individuellen Anpassungen an die soziale Realität. Sein Ansatz legt Wert auf Authentizität und Selbstverwirklichung, während er gleichzeitig die Wechselwirkungen zwischen dem persönlichen und dem gesellschaftlichen Kontext betont.
Und dann ist die Zeit auch schon um! Die letzten Schleifen liefen wir in einem Park, denn Flo rechnete bei der Planung der Route nicht mit Überstunden. Deshalb verschieben wir die Rotkäppchen-Interpretation in die übernächste Episode.


