
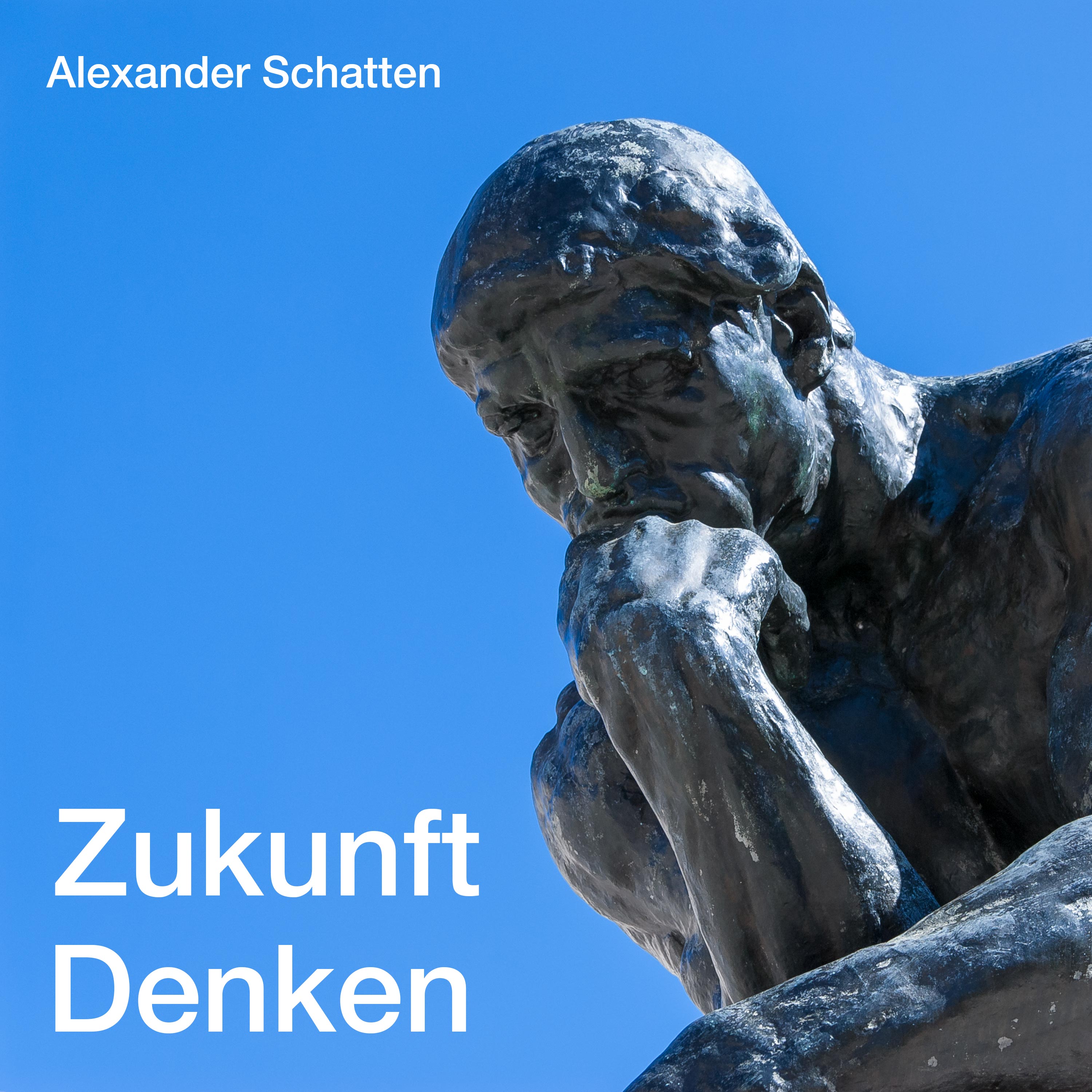
Zukunft Denken – Podcast
Alexander Schatten
Woher kommen wir, wo stehen wir und wie finden wir unsere Zukunft wieder?
Episodes
Mentioned books

Oct 26, 2023 • 1h 14min
082 – Smart Communities, ein Gespräch mit Ulrich Ahle
Mein heutiger Gast ist Ulrich Ahle, und diese Episode hat einen für mich sehr spannenden Hintergrund: Ich war zu Beginn des Jahres auf der LEAP-Konferenz in Riad, Saudi-Arabien, und das war ein in vielerlei Hinsicht äußerst eindrucksvolles Erlebnis. Eine der Reisen, wo fast alle meine Vorurteile auf den Prüfstand gestellt wurden.
Auf dieser Konferenz hat Ulrich einen Vortrag zu Smart Cities gehalten, und dieser Vortrag war einer der interessantesten, die ich auf dieser Konferenz gehört habe. Daher freut es mich besonders, dass sich Ulrich für ein Podcast-Gespräch zum Thema Smart Cities, oder besser: Smart Communities zur Verfügung gestellt hat.
Ulrich hat eine lange und erfolgreiche Karriere in der Fertigungsindustrie und Industrie 4.0 hinter sich und gründet 2016 die FIWARE-Foundation, deren deren CEO er wird. In dieser Rolle hat Ulrich eine entscheidende Rolle beim Ausbau der FIWARE Foundation gespielt, die heute auf allen Kontinenten vertreten ist und mehr als 600 Mitglieder zählt. FIWare ist eine der führenden Lösungen für SmartCity/Community-Projekte, und noch dazu eine Open-Source. Warum das wichtig ist, werden wir im Gespräch diskutieren. Ulrich wird nun CEO von Gaia X, einer europäischen Initiative, deren Ziel es ist, , ein Ökosystem zu schaffen, in dem Daten gemeinsam genutzt und in einer vertrauenswürdigen Umgebung zur Verfügung gestellt werden.
Ich wünsche Ulrich bei dieser neuen und sehr wichtigen Herausforderung viel Erfolg. Wenn FIWare als Maßstab gelten darf, können wir von Gaia X in den nächsten Jahren viel erwarten!
In dieser Episode beginnen wir mit der Frage, was eine Stadt oder Gemeinde eigentlich »smart« macht? Ist der Begriff überhaupt sinnvoll? Der Begriff Smart Communities wird als Oberbegriff für Projekte in Städten aber auch ländliche Regionen verwendet. Dies ist im Gespräch auch insofern relevant, als Ulrich auch Ortsvorsteher der Gemeinde Etteln ist und in dieser Gemeinde ebenfalls zahlreiche Smart Community Projekte umgesetzt wurden und werden.
Wer sind primäre Gruppen, die von Smart Communities profitieren? Ist Industrie und Tourismus Teil der Smart City? Was ist mit Industrie 4.0?
Was ist der Unterschied zwischen Digitalisierung in der Verwaltung und Smart City?
Die führenden »digitalen Gesellschaften« in Europa sind Estland, Finnland, Malta, Niederlande, Spanien? Was passiert in diesen Nationen und was können wir davon lernen?
Beispiele für Smart City Anwendungen über die wir in der Episode sprechen sind:
Parkraumbewirtschaftung
Beleuchtung
Müll-Management, Abfallbewirtschaftung
dynamische City-Maut
intelligente Wasserwirtschaft
Hochwasserfrühwarnsystem
autonom fliegende Drohnen zur Unterstützung der Feuerwehr im Dorf
Predictive Maintenance vs. vorbeugende Wartung
Stabilisierung des Energienetzes
Wie sieht es mit systemischen Effekten (auch unerwünschten Nebeneffekten) aus, z.B. beim Smart Parking? Führt dies nicht letztlich zu mehr Verkehr?
Wie Skalieren die Smart Community Konzepte auf mehreren Ebenen — vom Dorf bis zur Großstadt wie Berlin —, aber auch innerhalb einer Stadt, vom Kiez/Viertel bis zur gesamten Stadt und dies sowohl technisch wie funktional und politisch?
Welche Formen der Datenvisualisierung und Dashboards gibt es für Verwaltung und politische Entscheidungsträger?
In den letzten Jahren wird häufig von digitalen Zwillingen gesprochen. Was ist das und wird das im Smast City Umfeld genutzt? Wie ist das Wechselspiel zwischen digitaler und realer Welt abgebildet?
Wie geht man einen solchen digitalen Transformationsprozess am besten an? Top Down? Bottom Up? Middle In? Unterschiedliche Zielkonflikte können drohen, vom Überdesign, das die Menschen am Weg verliert, bis zum Gegenteil, digitalen Silos und Insellösungen, die nicht miteinander kommunizieren, weil zu wenig strukturiert wurde.
Wie gehen wir mit den Daten um? Daten haben in einer digitalen Welt ökonomischen und politischen Wert, gleichzeitig bedroht Digitalisierung die Privatsphäre, lässt sich das unter einen Hut bringen oder bekommen wir Smart Big Brother statt Smart Community? Was ist das Once Only Principle, das in Estland zur Anwendung kommt?
Es gibt nicht nur erfolgreiche Projekte, die Stadt Toronto hat ein großes Smart City Projekt abgebrochen, was kann man daraus lernen?
Welche Abhängigkeiten gibt es bei Smart Community Projekten — ökonomisch, politisch, technisch — und führen diese zu einer höheren Fragilität der Gesellschaft oder gar zu höherer Resilienz?
Wie sieht es mit Smart Communities rund um die Welt aus, von Saudi Arabien bis Indien? Können diese Projekte Menschen helfen (etwa in Afrika) aus der Armut zu kommen?
Referenzen
Andere Episoden
Episode 77: Freie Privatstädte, ein Gespräch mit Dr. Titus Gebel
Episode 70: Future of Farming, a conversation with Padraic Flood
Episode 61: Digitaler Humanismus, ein Gespräch mit Erich Prem
Episode 58: Verwaltung und staatliche Strukturen — ein Gespräch mit Veronika Lévesque
Data Science und Machine Learning, Hype und Realität: Episode 53 und Episode 54
Episode 40: Software Nachhaltigkeit, ein Gespräch mit Philipp Reisinger
Episode 35: Innovation oder: Alle Existenz ist Wartung?
Episode 31: Software in der modernen Gesellschaft – Gespräch mit Tom Konrad
Offene Systeme: Gespräch mit Lukas Lang und Christoph Derndorfer: Episode 19 und Episode 20
Ulrich Ahle
Ulrich Ahle auf LinkedIn
FiWare Foundation
Gaia-X
Gemeinde Etteln
Fachliche Referenzen
LEAP Conference
Toronto wants to kill the smart city forever, MIT Technology Review (2022)

Oct 13, 2023 • 56min
081 — Energie und Ressourcen, ein Gespräch mit Dr. Lars Schernikau
Der Gast der heutigen Episode ist Dr. Lars Schernikau. Er ist Energieökonom und Rohstoffhändler und befasst sich seit vielen Jahren mit Energiethemen. Er veröffentlichte in diesem Jahr ein wichtiges Buch mit dem Titel: Unbequeme Wahrheiten: über Strom und die Energie der Zukunft veröffentlicht.
Energie und Energiewende wurde in früheren Episoden schon thematisiert. In dieser Episode fokussieren wir uns neben Energiethemen auch auf die Frage der Abhängigkeit von Energie und Ressourcen, die unsere Gesellschaft am laufen halten.
Was sind die vier Säulen der modernen Gesellschaft nach Vaclav Smil und wie stehen diese in Zusammenhang mit Energie? Werden wir in den nächsten Jahrzehnt weniger oder gar drastisch mehr Energie benötigen? Welchen Einfluss hat die Bevölkerungsentwicklung in unterschiedlichen Regionen und das Betreben der Ärmsten Menschen aus der Armut zu gelangen?
"Armut und Energie stehen in einem sehr engen Zusammenhang."
Das sehen wir am Beispiel des Haber-Bosch-Verfahrens, das moderne Landwirtschaft und auch die Grüne Revolution in den 1960er Jahren ermöglicht und Milliarden Menschen das Leben gerettet hat.
Wie viel Material entnehmen die Menschen jährlich der Erde und wofür? Wie hoch ist der Rohstoffeinsatz pro erzeugter Energieeinheit?
Wo steht sich die deutsche Energiewende aktuell, i.B. auch hinsichtlich der selbst-gesteckten Ziele? Welcher Energie- und Rohstoffeinsatz ist mit »erneuerbaren« Energien verbunden? Was ist der EROEI (Energy Returned on Energy Invested) und warum ist diese Maßzahl fundamental wichtig in der Beurteilung von Energieformen.
Die Geschichte der Menschheit kann als Energiegeschichte geschrieben werden. Der Wechsel zu stetig Energie-dichteren Energieträgern ermöglicht erst unseren Fortschritt:
Römer: 2:1 (menschliche und tierische Arbeitskraft); Holz und Essens-Nachschub (EROEI) begrenzt Stadtgröße auf ca. 1 Mio Menschen. Schernikau: »Wir haben 5 von 7 Tagen damit verbracht uns am Leben zu erhalten.«
Kohle 15-30:1
Gas ähnlich wie Kohle
Kernkraft 70-90:1
Wind/Solar im einstelligen Bereich
Biomasse im geringen einstelligen Bereich
Energiedichten unter 10:1 werden sehr kritisch für die moderne Gesellschaft!
Was ineffizient ist, ist auch eine teure (und meist nicht-ökologische) Form der Energieproduktion. Daher sind Wind und Solar teurer als alle anderen Energieformen (Kohle, Gas, Öl, Kernkraft, Wasserkraft) und sie werden umso teurer je mehr man davon zum Einsatz bringt. Die Energiekrise hat daher in Deutschland auch schon vor dem Ukraine-Krieg angefangen und wurde durch den Krieg nur verstärkt.
Commodities werden weltweit gehandelt. Wenn Deutschland aufgrund der gescheiterten Energiewende Gas (und Kohle) am Weltmarkt zu immer höheren Preisen kauft, können sich etwa Bangladesch und Pakistan diese Preise nicht mehr leisten. Was sind die Konsequenzen für diese Nationen?
»Wir nehmen den Entwicklungländern Jahre in ihrer Entwicklung weg wenn wir sie zwingen, auf ineffiziente Wind- und Solaranlagen für die Stromerzeugung umzusteigen. Hunderte Millionen Menschen bleiben dadurch länger arm.«
Dazu kommt eine geopolitische Perspektive: wo kommen die Ressourcen her und wo werden sie verarbeitet? Der Flächenbedarf, der mit Energieproduktion verbunden ist, gehört zu einer der wesentlichsten ökologischen Größen und ist natürlich durch die Energiedichte bestimmt.
Wie kann es sein, dass in den meisten Medien und von einigen einflussreichen Experten immer noch behauptet wird, Wind und Solar wären die billigsten Formen der Stromproduktion? Was ist der Unterschied zwischen Grenzkosten und Gesamtkosten einer Energieform? Warum ist das häufig zitierte LCOE-Maß (Levelised Cost of Electricity) irreführend? Relevant sind letztlich nur die Gesamtkosten. Was macht den Unterschied aus?
Gibt es eine Economy of Scale bei Wind und Solar? Gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen Produktion der Solarzellen/Windräder und der Produktion von Strom?
Schernikau: »Jede kWh die aus Solar und Wind kommt, hat einen geringeren Wert als die vorherige kWh.«
Aber Wasserstoff als Speicher wird dieses Problem lösen (wie schon vor ca. 25 Jahren versprochen), oder? Es stellt sich heraus, dass ca. 65-80 % der Energie über den Umweg des Wasserstoffes verloren gehen. Und das nach der Nutzung von bereits wenig effizienter Produktion. Hat das eine Zukunft?
Schernikau: »Wasserstoff zur Strom-Speicherung ist ein energieökonomisches Disaster.«
Warum macht es einen wesentlichen Unterschied ob man Energiedichte pro Volumen oder pro Gewicht rechnet?
Außerdem: Strom ist nicht gleich Energie, denn Strom macht nur einen Teil der Gesamtenergie aus, die wir als Menschheit für unser Leben benötigen. Was bedeutet dies für eine »Energiewende«?
Vom Prototypen zur wirkungsvollen Technologie vergehen in der Regel Jahrzehnte, sofern es sich überhaupt skalieren lässt. Was bedeutet diese Erkenntnis für die »Elektrifizierung« der Industrie? Fast 90 % der Gesamtenergie kommen weltweit aus Kohle, Gas, Öl und Kernkraft.
Schernikau: »Der Kohleverbrauch steigt trotz Energiewende weiter, weltweit.«
»fast 60% des Energiewachstums kamen im starken Wachstumsjahr 2021 (laut IEA) aus Kohle.«
Welche Rolle spielt Kernkraft in dieser Gemengelage? Es scheint einen politischen Richtungswechsel zu geben, etwa in Ontario Kanada, Polen, Frankreich, Schweden, Finnland, Japan, Südkorea, China und zahlreichen anderen Nationen.
Schernikau: »Energiepreiserhöhung kostet Menschenleben«
Spielt es überhaupt eine Rolle, was wir in Deutschland, Frankreich, Großbritannien machen, wenn in den nächsten Jahrzehnten Nationen mit Milliarden Menschen dramatisch mehr Energie benötigen werden als heute (China, Indien, Afrika, ...) und hunderte Millionen Menschen noch gar keinen Strom haben?
Während aber Deutschland Südafrika erklärt, wie man aus Kohle aussteigt, gibt es in Südafrika Blackouts und Deutschland importiert Kohle aus Südafrika:
Schernikau: »Deutschland könnte vielleicht von Südafrika lernen, wie man mit Stromabschaltungen umgeht.«
Wie können uns eine Menge wünschen, aber die Physik lässt sich durch Wünsche und Träume einfach nicht aus den Angeln heben.
»Ich bin optimistisch dahingehend, dass wir in den nächsten Jahren unsere Energiepolitik ändern werden und wieder auf den richtigen Weg bringen.«
Referenzen
Andere Episoden
Episode 73: Ökorealismus, ein Gespräch mit Björn Peters
Episode 70: Future of Farming, a conversation with Padraic Flood
Episode 62: Wirtschaft und Umwelt, ein Gespräch mit Prof. Hans-Werner Sinn
Episode 59: Wissenschaft und Umwelt — Teil 1
Episode 60: Wissenschaft und Umwelt — Teil 2
Episode 46: Activism, a Conversation with Zion Lights
Episode 42: Gesellschaftliche Verwundbarkeit, ein Blick hinter die Kulissen: Gespräch mit Herbert Saurugg
Episode 36: Energiewende und Kernkraft, ein Gespräch mit Anna Veronika Wendland
Lars Schernikau
Lars Schernikau auf X/Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram
Lars Schernikau auf Unpopular Truth
Lars Schernikau, The Unpopular Truth about Electricity and the Future of Energy: Website
Lars Schernikau, William Hayden Smith, Unbequeme Wahrheiten: über Strom und die Energie der Zukunft (2022)
Tom Nelson, Lars Schernikau: “The Unpopular Truth..about Electricity & Future of Energy”
Auswahl wissenschaftlicher Artikel
Fachliche Referenzen
Vaclav Smil, Wie die Welt wirklich funktioniert: Die fossilen Grundlagen unserer Zivilisation und die Zukunft der Menschheit, C.H.Beck (2023)
Vaclav Smil, Innovationen und Erfindungen: Eine kurze Geschichte des Hypes und des Scheiterns, FinanzBuch Verlag (2023)
Tim Morgan, Life after Growth, Harriman House (2013)
Robert Bryce, The Power Of Power Density
Expensive energy may have killed more Europeans than covid-19 last winter, Economist May 10th 2023

Sep 26, 2023 • 33min
080 — Wissen, Expertise und Prognose, eine Reflexion
Ich denke seit ein paar Wochen über die Begriffe »Expertise« und »Wissen« nach. Wie stehen diese zueinander und in Bezug zu Prognostik. Dazu irritiert die übliche oder alltägliche Verwendung der Begriff »Expertise« beziehungsweise »Experte«. Regelmäßig werden in Medien Experten präsentiert oder von Politikern auf Experten verwiesen, die die Welt erklären und Prognosen komplexer Systeme mit großem Selbstvertrauen darlegen. Wenn dann aber regelmäßig von Experten oder Institutionen schwere Fehler in der Einschätzung gemacht werden, dann hat das negative Effekte für alle Menschen, für unser Vertrauen in Politik und in wesentliche Institutionen.
Was ist die Aussage eines Experten wert?
Was ist von Prognosen zu halten?
Zum Einstieg werden einige Beispiele schwerwiegender Fehleinschätzungen von Experten über die Jahrzehnte diskutiert, und was noch schlimmer ist, Fehleinschätzungen aus denen offenbar systemisch nichts gelernt wurde:
Es ist unmöglich die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren (Paul Ehrlich, 1960er Jahre)
Bevölkerungsexplosion oder -implosion (1960er Jahre bis heute)?
Peak Oil (1980er bis 2000er Jahre)
Eiszeit oder kochender Planet?
Versagen der deutschen Energiewende
Prognosen über den Ukraine Krieg
Verschiedenste Wirtschaftsprognosen
»Voraussagen der Euro-Dollar-Wechselkurse sind wertlos. Jedes Jahr im Dezember sagen internationale Banken die Wechselkurse für das Ende des folgenden Jahres vorher. Meistens liegt der tatsächliche Kurs außerhalb des gesamten Prognosebereichs.«, Gerd Gigerenzer
Sind das alles nur Anekdoten, oder wurde die Qualität von Expertenprognosen systematisch untersucht?
»Der Durchschnittsexperte hatte bei vielen der von mir gestellten politischen und wirtschaftlichen Fragen kaum besser abgeschnitten als hätte er geraten […] «
»je berühmter ein Experte war umso schlechter war die Leistung«, Phil Tetlock
Mit anderen Worten: je öfter sie den »Experten« im Fernsehen sehen, desto schlechter sind wahrscheinlich seine Prognosen.
Was ist nun tatsächlich Expertise? Was ist Wissen? Versuchen wir eine Definition:
»Expertise ist die Fähigkeit, Veränderungen in der Welt konsistent vorauszusagen oder herbeizuführen.«
Schon in der Antike gab es unterschiedliche Begriffe für verschiedene Formen des Wissens:
episteme (gr) oder scientia (lat) für Wissen um seines selbst Willen sowie
techne (gr) oder ars (lat) für angewandtes Wissen; vielleicht vergleichbar damit, was ich Expertise nenne.
Gibt es Kompetenz, Expertise ohne Tun? Welche Beispiele für Bereiche gibt es, in denen man von Expertise sprechen kann, welche, in denen keine Expertise in diesem Sinne möglich ist? Gibt es Expertise an der Universität?
Dazu kommt die Frage des Vertrauens, wie in der letzten Episode betont wurde:
»Vertrauen ist ein sozialer Prozess, und Expertise ist sozial bestimmt. [...] Du musst der Wissenschaft folgen heißt, du musst mit meinen Werturteilen übereinstimmen.[...] Eine Entscheidung kann niemals wissenschaftlich fundiert sein. […] «
»Letztendlich ist die Definition eines Experten die eines Menschen, dessen Urteile man bereit ist, als das eigenen zu akzeptieren«
Was fangen wir nun mit diesem Befund an? Was tun? Eine Zusammenfassung in vier Punkten:
(1) Sind wir im Zeitalter der Post-Expertise angelangt?
»In den meisten Teilen der Gesellschaft wird man ermutigt, sich auf Experten zu verlassen — wir alle tun das mehr als wir sollten«, Noam Chomsky
(2) Das Tun nicht vergessen — Expertise lässt sich nicht virtualisieren
»Ich glaube nicht, dass man ein guter Erfinder sein kann, wenn man nicht weiß, wie das Zeug gebaut wird, dass man designed«, Walter Isaacson über Elon Musk
(3) Mit Unsicherheit leben lernen — die Herausforderung unserer Zeit
»Die Menschen neigen dazu, Unsicherheit verstörend zu empfinden.«, Phil Tetlock
(4) Evolution, oder: meine Arbeits-These zum Fortschritt
»Seed — Select — Amplify«
Diese Episode ist eine Reflexion und ich freue mich wieder besonders über kritisches Feedback!
»Dumme Menschen können Probleme verursachen, aber es braucht häufig geniale Menschen um eine wirkliche Katastrophe auszulösen«, Thomas Sowell
Referenzen
Andere Episoden
Episode 92: Wissen und Expertise Teil 2
Episode 13: (Pseudo)wissenschaft? Welcher Aussage können wir trauen? Teil 1
Episode 14: (Pseudo)wissenschaft? Welcher Aussage können wir trauen? Teil 2
Episode 36: Energiewende und Kernkraft, ein Gespräch mit Anna Veronika Wendland
Episode 42: Gesellschaftliche Verwundbarkeit, ein Blick hinter die Kulissen: Gespräch mit Herbert Saurugg
Episode 59: Wissenschaft und Umwelt — Teil 1
Episode 60: Wissenschaft und Umwelt — Teil 2
Episode 62: Wirtschaft und Umwelt, ein Gespräch mit Prof. Hans-Werner Sinn
Episode 73: Ökorealismus, ein Gespräch mit Björn Peters
Episode 74: Apocalype Always
Episode 76: Existentielle Risiken
Fachliche Referenzen
Leonard Nimoy, Ice Age 1979
Vorsicht, wer die Konjunktur prophezeit, Der Standard (8.2.2020)
Spectator Inflation Prediction (17.8.2022)
Stuart Ritchie, Michael Story, How the experts messed up on Covid, UnHerd (2020)
Gerd Gigerenzer, Risiko – Wie man die richtigen Entscheidungen trifft, Pantheon (2020)
Karl Popper, The Myth of the Framework
Daniel Yankelovich, Wicked Problems, Workable Solutions, Rowman & Littlefield (2014)
Neil Gershenfield, Lex Fridman #380
Walter Isaacson, Lex Fridman #395
Nassim Taleb, What do I mean by Skin in the Game? My Own Version, Medium (2018)
Scott Adams, Prediction and Forecast
Thomas Sowell on “Social Justice Fallacies”, Uncommon Knowledge (2023)

Sep 12, 2023 • 1h 4min
079 — Escape from Model Land, a Conversation with Dr. Erica Thompson
Todays guest is Dr. Erica Thompson who wrote the excellent book "Escape from Model Land", which I strongly recommend for reading.
Dr. Thompson is Associate Professor of Modelling for Decision Making at UCL’s Department of Science, Technology, Engineering and Public Policy. She is also a Fellow of the London Mathematical Laboratory, where she leads the research programme on Inference from Models, and a Visiting Senior Fellow at the LSE Data Science Institute.
She is working on the appropriate application of mathematical modelling in supporting real-world decisions, including ethical and methodological questions. For instance, what is the best use of models in climate change, public health and economics.
Making and using models in the real world is — as it turns out — quite a tricky business and in our conversation we go deep into the question: what constitutes model land and how can we escape model land to achieve good results for our society from what we learned in model land.
I covered similar topics in other podcast episodes, because this question can be tackled from a number of different perspectives.
The first question I ask Dr. Thompson is the obvious one: What is model land?
“Nobody actually cares at all about what happens in your model. […] unless you make a claim that what happens within that model land has some relationship to what happens in the real world. So, how to transfer your judgement about the model to the judgement about the real world, is the key question?”
What does Steven Wolfram mean with irreducibility of nature? Why do we have to treat different types of models differently?
What is the difference between interpolation and extrapolation, and why is this crucially important? Many models of complex systems incorporate significant amounts of expert judgement, especially when models are extrapolating. How should we deal with such models?
“All of these decisions about model construction imply value judgements about what we think to be important.”
Value judgements per se are not the problem — but are they shared by the people affected by the model? How did you get to those judegements? Are the transparent enough? Do the decision makers know and agree with these judgements?
Under what conditions can we assess the reliability of a model? In which category do models that are discussed in public fall, for instance climate models? What are the butterfly and hawkmoth effect? What is the difference between data driven vs. “expert driven” models and what role does data quality play in practice?
Most models also are partial models. What is incorporated in a model? What is left out? What conclusions are we allowed to draw from complex models? Do they highly successful data driven models distort our expections in the more assumption driven ones?
“The model is then very much part of the story. It is not just a prediction engine.”
There are models that influence the world and the world feeds back opposed to models that “just” describe the world, and performative models that actually create the reality they describe and counter-performative models. Why is it important to distinguish among these different types?
“Those [counter-performative models] were not made with the aim to be accurate models and correctly predicting the future. They were made with the aim of showing what could happen if we didn't action which would then avoid these worst case scenarios.”
What is the difference between a (conditional or unconditional) prediction and a scenario?
Models are tools and cannot replace judgement. But did we use these tools accordingly? Or did models in the recent past (e.g. Covid) inflict more harm than good on our society?
“This is exactly what models are for—to serve as working hypotheses for further research.”, Ludwig von Bertalanffy
and
“Build a society that is resistant to model errors”, Nassim Taleb
Is this true?
Models as narrative generating devices and communication tools and collective thinking — do we want that? Under what conditions — like flatten the curve? And, how to avoid group think and be captured by models?
“Plans are worthless but planning is everything”, Dwight D. Eisenhower
“Kein Plan überlebt die erste Feindberührung”, Helmuth Graf von Moltke
So, there is a significant amount of expert judgement in building models, but do people know that and which expert do we trust?
“Trust is a social process and expertise is socially determined. […]
You must follow the science is saying you must agree with my value judgements.[…]
A decision can never be science based.”
Thus, science is never value free.
Finally we talk about regulation in complex systems and how those relate to models, the long and short term perspectives and what skin in the game means. Is Niall Ferguson right when he says:
“Surely, once we have written a regulation for every possible misdeed, then good behaviour will ensue. This is just an amazing illustration of our ability as human beeings to keep doing the wrong thing in the face of all experience. […] the big players are actually protected by complex regulation. […]
Regulation is the disease of which it pretends to be the cure.”
Then, how should we regulate complex systems? Should every politician be a scientist in the Platonic sense?
»Ultimately the definition of an expert is somebody who's judegements you are willing to accept as your own.«
References
Other Episodes
Episode 68: Modelle und Realität, ein Gespräch mit Dr. Andreas Windisch
Episode 67: Wissenschaft, Hype und Realität — ein Gespräch mit Stephan Schleim
Episode 53: Data Science und Machine Learning, Hype und Realität — Teil 1
Episode 54: Data Science und Machine Learning, Hype und Realität — Teil 2
Episode 39: Follow the Science?
Episode 37: Probleme und Lösungen
Episode 2: Was wissen wir?
Dr. Erica Thompson
Personal Website of Dr. Thompson
UCL’s Department of Science, Technology, Engineering and Public Policy
London Mathematical Laboratory
LSE Data Science Institute
Other References
Erica Thompson, Escape from Model Land, Basic Books (2022)
Lex Fridman #376 in conversation with Steven Wolfram (2023)
Ludwig von Bertalanffy, General Systems Theory (1969)
Cathy O’Neil, Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy, Penguin (2017)
Niall Ferguson on Regulation in conversation with John Anderson (2023)

Aug 28, 2023 • 27min
078 — Was ist in der Wurst? Podcasten im Zeitalter künstlich generierter Inhalte
In den letzten Jahren gab es bemerkenswerte Entwicklungen im Bereich des Machine Learning und der sogenannten künstlichen Intelligenz. Wie bei fast allen neuen Technologien, sind sehr nützliche aber auch sehr gefährliche Anwendungen zu erwarten. In dieser Episode spreche ich über drei Aspekte, die mit neuen KI-Tools auf uns zu kommen, oder bereits verfügbar sind:
Beantwortung von Fragen / Recherche
Generierung von Text mit Large Language Models (gegebenenfalls ergänzt mit Sprachsynthese)
Generierung oder Manipulation von Bildern und Videos
Ich habe mich mit Aspekten dieses Themas schon vor mehr als zwei Jahren in Episode 43: Deep Fakes beschäftigt. Diese Episode ist heute noch aktueller als damals.
Die Frage ist: welchen Inhalten im Internet können wir in Zukunft trauen? Und in dieser Episode liegt der Fokus auf der Frage: was bedeutet diese Entwicklung für Personen und Organisationen, die Inhalte erzeugen und anbieten, im Besonderen für Podcasts sowie Konsumenten dieser Produkte.
Welche Verantwortung haben wir als Produzenten?
Wie können wir Konsumenten vertrauen in unsere Inhalte geben, in einer Welt, die immer mehr von generierten und manipulativen Artefakten geflutet sein wird? Wie kann also mündigen Konsumenten geholfen werden, die Spreu vom Weizen zu trennen und dies ohne Schichten von Zensur einzuführen.
»Nicht zu viel Macht — das ist die Grundidee der Demokratie. Die Macht muss verteilt sein, sodass nicht zu viel Macht in einer Hand ist.«, Karl Popper
Wie verändert sich möglicherweise das Verhältnis zu den Konsumenten?
In dieser Episode diskutiere ich zwei wesentliche Aspekte:
Bin ich die Person (oder Organisation), die ich behaupte zu sein, beziehungsweise wer sind die Personen, die an einer Episode teilnehmen?
Woher stammen die Materialien (z.B. Texte, Bilder, Videos), die ich auf meinem Kanal präsentiere
Wie können wir auch als »kleine« und unabhängige Produzenten in Zukunft das Vertrauen in unser Produkt gewährleisten, ohne uns von wenigen Medien-Monopolisten abhängig zu machen und warum spielen gerade Podcasts eine so wesentliche Rolle in der heutigen, und hoffentlich auch zukünftigen Medienlandschaft?
Zuletzt mache ich meinen Produktionsprozess transparent:
Vorbereiten von Episoden (Recherche, Inhalte zusammenstelle)
Aufnahme
Nachbearbeitung (Post-Production)
Wie werden verschiedene Artefakte erstellt (Audio-File, Shownotes, Transkripte)
Werbung und Interaktion mit Hörern
An welchen Stellen wird mit welcher Art von Tools gearbeitet?
Wie können wir als unabhängige Podcaster in der Zukunft gewährleisten, das Vertrauen der Hörer nicht zu verlieren und gleichzeitig nicht unter die Räder einzelner Medien-Monopolisten zu geraten?
Referenzen
Andere Episoden
Episode 61: Digitaler Humanismus, ein Gespräch mit Erich Prem
Episode 43: Deep Fakes: Wer bist du, und – was passiert da eigentlich?
Episode 2: Was wissen wir?
Fachliche Referenzen
Karl Popper - "Lasst Theorien sterben, nicht Menschen!" (1990)
Transparenz-Erklärung für diesen Podcast

Aug 8, 2023 • 1h 32min
077 — Freie Privatstädte, ein Gespräch mit Dr. Titus Gebel
In der heutigen Episode freue ich mich Dr. Titus Gebel begrüßen zu dürfen. Wir sprechen über sein Konzept der »Freien Privatstädte«.
Titus Gebel ist Unternehmer und promovierter Jurist. Er war Mitgründer der Deutsche Rohstoff Gruppe sowie des Startups Dual Fluid, deren CFO Björn Peters, in Episode 73 zu Gast war. Dr. Gebel spielt auch eine wesentliche Rolle in der Etablierung einer ambitionierten Sonderentwicklungszone mit dem Namen Prospera in Honduras und berät andere Sonderwirtschaftszonen weltweit.
Aber das Thema des Gesprächs ist breiter: wir beginnen mit der Frage, was modernes Staatswesen ausmacht, was Freiheit bedeutet, was die Rolle von Bürger und Staat sind, wo die Ursprünge und philosophischen Ideen liegen und was bis zum heutigen Zeitpunkt in verschiedenen Nationen daraus geworden ist.
Wir beginnen mit einem Blick in die Geschichte, was ist die Rolle des Staates nach Thomas Hobbes und John Stuart Mill? Was ist der Begriff der Freiheit?
»Struggle between Liberty and Authority«
»By liberty, was meant protection against the tyranny of the political rulers.«, John Stuart Mill
Wie hat sich die Rolle des Staates verändert?
»Der moderne Staat hat sich etabliert, um seinen Bürgern vor allem zwei Grundpfeiler des Lebens zu garantieren: Freiheit und Sicherheit.«, K. P. Liessmann
Wie kommt es zu einem Mehr an Freiheit? Aus philosophischen Überlegungen und Ideen, oder aus pragmatischeren Aspekten? Führt der Weg von der göttlichen Bestimmung zur Freiheit? Wie wird der Wille des Volkes überhaupt bestimmt und was bedeutet dies für Minderheiten?
Wir beide stimmen darin überein, dass wir eine beginnende, schwere Krise in den westlichen Demokratien, beziehungsweise Verwaltung erkennen. Die Frage ist: wie ist diese zu erklären und wie könnten Wege heraus aussehen?
»Heute haben wir es mit einer Überdehnung des modernen Staates zu tun, und zwar sowohl wohlfahrtsstaatlich wie ökologisch. Mit dem Wohlfahrtsstaat, der eigentlich schon in der traditionellen Gemeinwohlformel angelegt ist, kehrt das summum bonum zurück: das größte Glück der größten Zahl; der gehobene Lebensstandard wird als politisches Recht definiert.«, Norbert Bolz
Bismarck gilt als Erfinder des Sozialstaats, was war die damalige Motivation? Wie hat sich der Sozialstaat seit damals entwickelt? Führen falsche Anreizsysteme für Politiker in die Krise, denn Gratisleistungen des Staates erscheinen nur gratis, sind es aber natürlich nicht?
»Es gibt in westlichen Demokratien keine klassisch liberalen Parteien mehr, das sind alles Umverteilungsparteien geworden«
»Die Gruppe der Menschen, die tatsächlich produktiv und wertschöpfend tätig ist, wird immer kleiner.«
Dazu passt auch der Gedanke des mittlerweile 93 jährigen Thomas Sowell:
»You have people making [political] decisions, for which they pay no price when they are wrong. No matter how high a price other people pay.«
Dr. Gebel hat ein Konzept entwickelt, das er Freie Privatstädte nennt und wir diskutieren über das Konzept, welche Rolle Verwaltung und Regierung einnehmen sollen, wie Anreizsysteme verbessert werden können und vergleichbare andere Ansätze, die in eine ähnliche Richtung gehen. Kann es so etwas wie Verwaltung als Dienstleistung geben?
» Der Staat sollte aus meiner Sicht theoretisch kein Monopol auf das Staatsgebiet haben. In Liechtenstein haben wir das verwirklicht. So zwingt man den Staat, ein guter Dienstleister zu sein.«, Hans Adam II von Liechtenstein
Wir sprechen dann über die zwiespältige Entwicklungen des 19. Jahrhundert, Engels und den Manchester-Kapitalismus. Welche Rolle spielt Solidarität, Menschwenwürde? Wer soll diese Gewährleisten, und in welcher Form? Welche Rolle spielt Selbstorganisation (bottom up) im Gegensatz zu staatlichen Top Down Mechanismen?
Ab wann gleitet ein Sozialstaat in einen »Nanny-State« ab, ganz nach dem alten sozialistischen Motto »Von der Wiege bis zur Bahre« in der Hand des Staates? Gibt es in Deutschland nur mehr vier Grüne und eine rechte Partei, und sind letztlich alle auf dem Pfad des »Rent Seeking«?
»Aus dem Recht der Bürger, nach ihrem Glück zu streben, wurde längst die Pflicht des Staates, für dieses Glück zu sorgen. Dass in einer Demokratie die Bürger diesen Staat ausmachen und deshalb solche Forderungen an sich selbst adressieren müssten, wird gerne vergessen«, Konrad Paul Liessmann
Machen wir den Fehler einen vermeintlichen Idealzustand mit dem Ist-Zustand zu vergleichen? Warum gelingt es auch nicht mehr — nach Cicero — dass die Begabtesten in die Politik gehen, sondern wir heute eher eine negative Auslese erleben?
»Wenn man merkt, dass man ein totes Pferd reitet, sollte man absteigen.«
Titus Gebel erklärt dann sein Konzept der freien Privatstädte genauer, auch die Abgrenzungen zu Charter Cities und Sonderwirtschaftszonen im Allgemeinen. Warum sind seiner Ansicht nach die Anreizsysteme in diesen Konzepten besser?
Welche Rolle spielt der Markt — als Entdeckungsverfahren — und wie können wir evolutionäre Prinzipien auch in Verwaltung und Staatswesen etablieren mit Mutation, Nachahmung, Reproduktion, beziehungsweise dem »Seed, Select, Amplify« (Meyer, Davis) Prinzip? Probieren und Scheitern sollte wieder möglich werden, sonst gibt es auch weiterhin keinen Fortschritt.
»Es wäre besser, wir würden in einer Welt von 2.000 Liechtensteins leben, die alle ein veschiedenes System haben als in 200 Staaten.«
Aber ist es realistisch, dass sich Koordination von viele kleine Einheiten global bei wesentlichen Fragen umsetzen lässt?
Wie könnte ein solches System überhaupt umgesetzt werden, wo doch alle Landflächen von existierenden Nationen kontrolliert werden? Gibt es eine reale Chance der Umsetzung? Oder gibt es schon exisitierende Beispiele? Dr. Gebel spricht über Beispiele in China, dem Nahen Osten, Saudi Arabien und Südamerika?
Sind diese Ansätze nicht nur Gated Communities für die Elite? Was macht ein Gemeinwesen? Ich fühle ja auch keine Gemeinschaft zu anderen Gästen in einem Hotel?
»Es gibt zwei Arten von Menschen: die einen, die ihre Meinungen anderen aufzwingen wollen, und die anderen, die das nicht wollen und die sagen, Leben und Leben lassen. Die erste Gruppe strebt natürlich in die Politik.«
Findet der wirkliche politische Konflikt heute nicht, wie so oft behauptet, zwischen links und rechts, sondern vielmehr zwischen autoritär und (klassisch) liberal statt?
»Leben und Leben lassen in unterschiedlichsten Formen des Zusammenlebens.«
Referenzen
Andere Episoden
Episode 73: Ökorealismus, ein Gespräch mit Björn Peters
Episode 58: Verwaltung und staatliche Strukturen — ein Gespräch mit Veronika Lévesque
Episode 57: Konservativ und Progressiv
Episode 29: Fakten oder Geschichten? Wie gestalten wir die Zukunft?
Episode 26: Was kann Politik (noch) leisten? Ein Gespräch mit Christoph Chorherr
Episode 17: Kooperation
Titus Gebel
Webseite von Dr. Titus Gebel
Deutsche Rohstoff AG
Dual Fluid
Titus Gebel, Freie Privatstädte: Mehr Wettbewerb im wichtigsten Markt der Welt (2023)
Free Cities Foundation
Liberty in Our Lifetime Konferenz 2023
Fachliche Referenzen
Honduran ZEDEs: Their Past and Future
Reason TV: A private libertarian city in Honduras (2023)
Franz Oppenheimer, Der Staat (1907)
Austrian Institute, „Der Staat soll nicht nur einer privilegierten Schicht dienen, sondern allen Menschen“ – Interview mit Fürst Hans-Adam II. von Liechtenstein (2017)
John Stuart Mill, On Liberty (1859)
Thomas Sowell im Gespräch mit Peter Robinson, Uncommon Knowledge(7.9.2023)
Konrad Paul Liessmann, Lauter Lügen, Paul Zsolnay Verlag (2023)
Norbert Bolz, Keine Macht der Moral, Politik jenseits von Gut und Böse, Matthes & Seitz Berlin (2021)
Christopher Meyer, Stan Davis, It's Alive, Texere Publishing (2004)
Karl Popper, Die Offene Gesellschaft
Karl Popper - Ein Gespräch (1974)
Roger Scruton, How to be a Conservative, Bloomsbury Continuum (2014)

Jul 17, 2023 • 26min
076 — Existentielle Risiken
»Wird die Zivilisation mit einem Knall oder einem Winseln untergehen? Der aktuelle Trend ist ein Winseln in Erwachsenen-Windeln.«, Elon Musk
Existentielle Risiken sind ein Thema, das in diesen Podcast passt, auch weil es eine interessante historische und zukünftige Dimension hat. Zur Zukunft später, zuerst zur Vergangenheit: Zwar gab es auch in der Vergangenheit für die Menschheit oder den Planeten existentielle Risiken, etwa Asteroiden-Einschläge, aber es waren Risiken, die der Mensch weder beeinflussen noch herbeiführen konnte. Die Wirkmacht der Menschen war über den größten Zeitraum menschlicher Geschichte eine lokale.
Das ändert sich zunächst langsam mit der industriellen Revolution und dann schlagartig ab der Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Atomwaffen waren die erste Technologie, die ganz offensichtlich gezeigt haben, dass wir nun in der Lage sind nicht nur ganze Landstriche zu verwüsten, sondern tatsächlich die ganze Welt.
"Wir waren immer verrückt, aber wir hatten nicht die Fähigkeiten die Welt zu zerstören. Jetzt haben wir sie.", Nassim Taleb
Was sind existentielle Risiken? Versuch einer Definition:
»Ein 'existenzielles Risiko' (X-Risiko) ist ein Ereignis, das die Möglichkeiten der Menschheit dauerhaft und drastisch einschränken könnte, indem es zum Beispiel das Aussterben der Menschheit verursacht«, CamXRisk
Meine erweiterte Definition:
Ein existenzielles Risiko für die Menschheit ist eine Bedrohung, die große Teile des Planeten oder menschlicher Strukturen zerstört oder große Teile der Menschheit in einem Ausmaß oder auf eine Weise töten könnte, dass eine Wiederherstellung eines modernen Gesellschaftsniveaus innerhalb eines Zeitrahmens von Jahrhunderten nicht wahrscheinlich ist.
Macht das Auflisten existentieller Risiken, das Ranken Sinn? Mit welchen Einschränkungen, unter welchen Rahmenbedingungen? Ist es überhaupt möglich, die Risiken sinnvoll einzuschätzen und wovon hängt das Risiko ab?
»Eine Pandemie besteht aus einem neuen Erreger und den sozialen Netzwerken, die er angreift. Wir können das Ausmaß der Ansteckung nicht verstehen, wenn wir nur das Virus selbst untersuchen, denn das Virus wird nur so viele Menschen infizieren, wie es die sozialen Netzwerke zulassen. Gleichzeitig legt eine Katastrophe die Gesellschaften und Staaten offen, die sie angreift.«, Niall Ferguson
Daher sind die Auswirkungen von Effekten komplexer Bedrohungen oft auch schwer einzuschätzen. So sind etwa trotz Klimawandel:
»Die jährlichen Todesfälle durch Tornados in den USA sind seit 1875 um mehr als das Zehnfache zurückgegangen« […]
"Die Zahl der wetterbedingten Todesfälle ist in den letzten hundert Jahren drastisch zurückgegangen, obwohl sich die Erde um 1,2 °C erwärmt hat; sie sind heute etwa 80-mal seltener als noch vor einem Jahrhundert. […]
Das liegt vor allem an der besseren Verfolgung von Stürmen, dem besseren Hochwasserschutz, der besseren medizinischen Versorgung und der verbesserten Widerstandsfähigkeit der Länder, die sich entwickelt haben. Ein aktueller UN-Bericht bestätigt den Trend der letzten zwei Jahrzehnte", Steven Koonin
Anhand von drei existentiellen Bedrohungen stelle ich die Schwierigkeit dar, Risiken, Auswirkungen und Rankings zu beurteilen: Atomwaffen, Bevölkerungskollaps und Klimawandel.
Welche Rolle spielen systemische Effekte? Wechselbeziehungen zwischen Bedrohungen, beziehungsweise sind einzelne Risiken als Folge anderer zu sehen? Wie damit umgehen?
»Für jede mögliche Katastrophe gibt es mindestens eine plausible Kassandra. Nicht alle Prophezeiungen können beherzigt werden. In den letzten Jahren haben wir vielleicht zugelassen, dass ein Risiko - nämlich der Klimawandel - unsere Aufmerksamkeit von den anderen ablenkt«, Niall Ferguson
Das Leben in einer modernen, komplexen Gesellschaft — im Anthropozän — hat positive Auswirkungen: wir sind weiter von der Natur entfernt, sind sicherer und haben einen viel höheren Lebensstandard als je zuvor. Wir sterben nicht mehr im Einklang mit der Natur, wie Hans Rosling es ausdrückte. Aber sie hat eben auch negative Auswirkungen, die leider existentielle Risiken darstellen können.
Die Konzentration auf die Eindämmung eines einzigen Risikos (z. B. des Klimawandels) kann dazu führen, dass wir andere Risiken unterschätzen oder sogar andere Risiken dramatisch erhöhen.
»Wir sind immer gut vorbereitet auf die falsche Katastrophe. [...] Aber die Geschichte warnt uns, dass man nicht die Katastrophe bekommt, auf die man sich vorbereitet.«, Niall Ferguson
Wie können wir aber mit einer Vielzahl an miteinander verknüpften Risiken umgehen? Was könnten wir unternehmen um unsere Gesellschaft in einem breiteren Sinne resilienter, widerstandsfähiger zu machen? Welche Fehler haben wir in der Covid-Pandemie gemacht und was können wir daraus lernen?
Und nicht zuletzt — was ist die Liste der existentiellen Bedrohung in meiner Reihenfolge (die unbedingt kritisiert werden sollte!):
Atomwaffen
Natürliche oder künstlich erzeugte Pathogene (»Demokratisierung« der Wissenschaft)
Zusammenbruch kritischer Infrastrukturen (Energie, Finanz, IKT, ...)
Solarer Supersturm (auch Carrington-Ereignis genannt)
Außer Kontrolle geratene Automatisierung/Robotik ("AI", aber auf einer allgemeineren Ebene)
Klimawandel (insbesondere für den Fall, dass Kipppunkte und ein unkontrollierbarer Klimawandel auftreten)
Nanotechnologie oder andere Möglichkeiten zur drastischen Veränderung von Herstellung und Chemie, die zu Nanomaschinen führen
Bevölkerungskollaps beziehungsweise starkes globales Ungleichgewicht
Ökosystemkollaps mit »Domino-Effekten«
Unbekannte Unbekannte (»Unknown unknowns«)
Grüne Gentechnik die außer Kontrolle gerät
Politischer/religiöser Extremismus
Asteroideneinschlag auf der Erde
Geoengineering (auch als Konflikt-Auslöser, -Verstärker)
Diese Liste ist als Anregung gedacht, dieses Thema zu diskutieren. Ist die Reihenfolge richtig? Wahrscheinlich nicht. Fehlt etwas?
Die Kluft zwischen Nutzen und Katastrophe scheint durch moderne Technologie immer schärfer zu werden. Wir sind also gut beraten, diese Bedrohungen ernst zu nehmen. Aber um einen Punkt zu wiederholen: es ist ein großer Fehler, sich hauptsächlich auf eine Bedrohung in dieser Liste zu konzentrieren, welche auch immer das sein mag, und zu glauben, wir könnten so unser gesellschaftliches Risiko verringern.
Das werden wir nicht.
Referenzen
Andere Episoden
Episode 74: Apocalype Always
Episode 60: Wissenschaft und Umwelt — Teil 2
Episode 59: Wissenschaft und Umwelt — Teil 1
Episode 55: Strukturen der Welt
Episode 51: Vorbereiten auf die Disruption? Ein Gespräch mit Herbert Saurugg und John Haas
Episode 45: Mit »Reboot« oder Rebellion aus der Krise?
Episode 44: Was ist Fortschritt? Ein Gespräch mit Philipp Blom
Episode 37: Probleme und Lösungen
Episode 33: Naturschutz im Anthropozän – Gespräch mit Prof. Frank Zachos
Episode 27: Wicked Problems
Episode 21: Der Begriff der Natur – oder: Leben im Anthropozän
Fachliche Referenzen
Cambridge Existential Risks Initiative (CERI)
Hans Rosling, Factfulness: Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist, Ullstein (2019)
Niall Ferguson, Doom, The Politics of Catastrophe, Penguin (2022)
Steven E. Koonin, Unsettled, BenBella Books (2021)
Climate Change Debate: Bjørn Lomborg and Andrew Revkin | Lex Fridman Podcast #339
Niall Ferguson on disaster preparation, Triggernometry
Near Miss: The Solar Superstorm of July 2012, NASA (2014)
Lloyds, Solar storm risk to the North American electric grid (2013)
The Economist Briefing, It’s not just a fiscal fiasco: greying economies also innovate less (2023)
The five biggest threats to human existence, The Conversation (2014)
Elon Musk on artificial intelligence, Conversation with Tucker Carlson (2023)

Jun 30, 2023 • 2h 1min
075 — Gott und die Welt, ein Gespräch mit Werner Gruber und Erich Eder
In der heutigen Episode freue ich mich einerseits, dass mein Haus und Hof Biologie Prof. Erich Eder sich wieder die Zeit für ein Gespräch nimmt, und nicht nur das, er bringt den Physiker Werner Gruber mit — wie man früher gesagt hat: bekannt (unter anderem) aus Rundfunk und Fernsehen, Kabarett sowie Autor mehrerer Bücher.
Der Titel der heutigen Episode ergibt sich gleich daraus, dass wir nur ca. ein bis zwei der von mir überlegten Fragen überhaupt angegangen sind: »Gott und die Welt«. Ich beginne das Gespräch mit einem Zitat des britischen Philosophen Roger Scruton:
»The Enlightenment had replaced mystery with mastery.«, Roger Scruton?
Was ist Aufklärung? Wer ist Verantwortlich für Fortschritt und Rückschritt? Was ist die Aufgabe der Wissenschaft, welche Rolle spielt Galileo bei der Frage nach dem Warum und nach dem Wie? Welche epistemologische Rolle spielt das Messgerät, die Technik in Wechselwirkung mit Wissenschaft?
Was ist der Unterschied zwischen Wissenschaftern und Technikern? Und... ist die Medizin eine Wissenschaft? Erich hat da in der Ansprache zu Medizinstudenten einen pragmatischen Zugang:
»Ihr seid eh auch irgendwie Biologen, ihr beschäftigt euch halt nur mit einer Affenart. und da nur mit den Krankheiten und wie man sie heilen kann«
In diesem Zusammenhang gibt Werner Gruber auch einen wesentlichen Tipp: was sollten Sie tun, wenn Sie von Außerirdischen entführt werden und auf dieser Reise erkranken?
Welche Rolle spielt der Nobelpreis für die Wissenschaft und was ist notwendig um einen Nobelpreis zu gewinnen? Der Österreicher Anton Zeilinger hat zuletzt den Nobelpreis für Physik erhalten, was steckt da fachlich und methodisch dahinter?
Ohne die Freiheit, "Sachen zu machen die nicht Mainstream waren", sei seine Forschungsarbeit nicht möglich gewesen, Anton Zeilinger
Der in Österreich geborene Physiker Max Perutz, der in den 1930er Jahren vor den Nazis nach England fliehen musste und dort im berühmten Cavendish Laboratorium arbeiten könnte, erhielt einen Nobelpreis mit John Kendrew für seine Arbeiten am Haemoglobin.
Später leitete er selbst das Labor und in dieser Zeit erhielten neun (!) seiner Mitarbeiter ebenfalls Nobelpreise. Auf die Frage, wie er das Labor führt und diesen Erfolg ermöglicht hat:
»no politics, no committees, no reports, no referees, no interviews; just gifted, highly motivated people, picked by a few men of good judgement.«
Sind wir an unseren Universitäten für Forschung und Lehre richtig aufgestellt? Was könnten und sollten wir verändern? Welche Rolle spielen schräge Vögeln in der Forschung und erlauben wir diese überhaupt noch an den Unis und Forschungseinrichtungen?
»Quantität in der Wissenschaft hat massiv zugenommen, aber nicht die Qualität«
Welche Rolle spielt die Ruhe und Nachdenken in Bildung und Wissenschaft? Schule kommt immerhin vom griechischen σχολή (scholē) was Muße bedeutet. Nutzen wir die Strukturen, die wir eingeführt haben (Universität, Fachhochschule) richtig?
»Ich würde heute nicht mehr studieren wollen«
Was ist die wichtigste Erfindung des 20. Jahrhunderts?
Wie grenzen sich Wissenschaft und Aktivismus ab, und welche Rolle spielt Wissenschaft und Expertise in politischen Entscheidungsprozessen? Warum halten sich so viele Menschen heute für Experten einer Sache (z.B. der Physik) ohne auch nur die relevanten Grundkenntnisse zu besitzen — wer ist nun ein Experte? In den Medien ist jeder Wissenschafter (oder jemand der wie ein solcher wirkt) Experte (für eh alles)?
»Wir forcieren in der Politik nicht die Personen, die auch Mut zum Versagen haben«
Gefühl oder Zahlen? Wie ein Statistiker die Küche des Schweizerhauses optimiert.
Wie haben wir die Covid-Pandemie bewältigt? Was den Bürgermeister von Rostock geleitet hat und welche Kritik aktuelle Cochran Studie aufwerfen.
Was hat es mit Plagiatsjägern und Betrug in der Ausbildung auf sich? Hat die höhere Bildung überhaupt den Wert den wir ihr zuschreiben, oder ist sie im Wesentlichen Signalisierung?
»Es ist eigentlich wurscht wo es hinführt, ich persönlich will es wissen.«
Korrektur: In der Episode wird angesprochen, dass der österreichische Nobelpreisträger Erwin Schrödinger Frauen oder gar Jugendliche sexuell missbraucht hätte. Dies wäre deckt sich nicht mit aktuellen Forschungsergebnissen und dürfte die Folge einer einzelnen schlechten Biografie sein.
Referenzen
Andere Episoden
Episode 67: Wissenschaft, Hype und Realität — ein Gespräch mit Stephan Schleim
Episode 50: Die Geburt der Gegenwart und die Entdeckung der Zukunft — ein Gespräch mit Prof. Achim Landwehr
Episode 48: Evolution, ein Gespräch mit Erich Eder
Episode 47: Große Worte
Episode 44: Was ist Fortschritt? Ein Gespräch mit Philipp Blom
Episode 41: Intellektuelle Bescheidenheit: Was wir von Bertrand Russel und der Eugenik lernen können
Episode 38: Eliten, ein Gespräch mit Prof. Michael Hartmann
Episode 28: Jochen Hörisch: Für eine (denk)anstössige Universität!
Episode 2: Was wissen wir?
Werner Gruber
Werner Gruber auf Wikipedia
Erich Eder
Erich Eder an der SFU
fachliche Referenzen
Roger Scruton, Fools, Frauds and Firebrands, Bloomsbury (2019)
Physik Nobelpreis für österr. Quantenphysiker Anton Zeilinger (2022)
Max Perutz: Geoffrey West, Scale: The Universal Laws of Life and Death in Organisms, Cities and Companies, W&N (2018)
Mark Alan Smith, Masking Uncertainty in Public Health, Quintette (2023)
Bryan Caplan, The Case against Education — Why the Education System Is a Waste of Time and Money, Princeton University Press (2019)
»Plagiatsjäger« Stefan Weber
Neue Fakten im „Schrödinger Skandal“ Ö1 Dimensionen (Nov 2025)

Jun 8, 2023 • 15min
074 — Apocalypse Always
Ich habe mich schon in früheren Episode mit der Frage auseinandergesetzt, wie man in schwierigen, potentiell kritischen Situationen entscheiden und handeln soll. Kürzlich bin ich auf einen Artikel des australischen Philosophen Michael Barkun, Thinking About The End in Contemporary America aus dem Jahr 1983 aufmerksam geworden.
Ich lese ältere Artikel der 50er bis 80er Jahre mit immer größerem Interesse, weil ich auch hier feststelle, dass viele der Beobachtungen und Erkenntnisse dieser Zeit, obwohl sie 40-70 Jahre zurückliegen, immer noch zutreffen und diese Artikel häufig viel besser geschrieben sind als heutige. Die fundamentalen Dinge ändern sich offenbar doch nicht ganz so schnell, wie von vielen behauptet...?
Diese Episode wird eine kurze Reflexion über Katastrophismus und apokalyptische Prognosen und Aktivisten sein. Wie immer bei solchen Reflexionen, freue ich mich auf kritische Zuschriften.
In dieser kurzen Reflexion stelle ich die Frage, woher Katastrophismus und Untergangsglaube kommt, dass er nahezu eine Konstante der menschlichen Geschichte ist, aber auch, dass wir deutliche Unterschiede im 20. und 21. Jahrhundert wahrnehmen, nämlich eine Verschiebung von religiösen zu säkularen Ideen.
»Speculations about the end of history form an almost unbroken chain over two and a half millenia«, Michael Barkun
Auch in früheren Gesprächen, etwa mit Prof. Achim Landwehr haben ich sehr ähnliche Aspekte bereits thematisiert. Ein Nachhören dieser älteren Episoden zahlt sich aus:
»Wenn Apokalypse nie ausstirbt, dann heißt das aber auch: Die Welt geht nie unter. Das ist dann vielleicht die positive Konsequenz, die man daraus ableiten könnte.«
Ich zitiere später in der Folge den britischen Philosophen John Gray, der sich in seinem hervorragenden Buch Black Mass sehr kritisch mit milleniaristischen und utopistischen Strömungen auseinandersetzt:
»The world in which we find ourselves at the start of the new millennium is littered with the debris of utopian projects. […] The alteration envisioned by utopian thinkers has not come about, and for the most part their projects have produced results opposite to those they intended.«
Die Tatsache, dass wir die Trümmer vergangener Utopien links und rechts um uns herum sehen, hindert aber neue Utopisten nicht daran wieder ihre reine Lehre allen anderen aufzwingen zu wollen:
»The use of inhumane methods to achieve impossible ends is the essence of revolutionary utopianism.«
Wir erleben gerade eine Vielzahl an katastrophistischen, fast religionsartigen Bewegungen wie etwa Just Stop Oil, Extinction Rebellion oder die Letzte Generation. An dieser Stelle Screenshots von zwei Webseiten, die im Podcast erwähnt werden:
Extinction Rebellion
Letzte Generation
Das Pamphlet endet mit den bescheidenen Worten:
»Und wir stehen auf der richtigen Seite der Geschichte.«
Am Ende stelle ich die Frage, wie wir als Gesellschaft nun mit solchen apokalyptischen Vorhersagen und kultartigen Strömungen umgehen sollen, besonders in Bezug auf Klimawandel, um den sich die meisten heute drehen. Diese Verengung ist für sich genommen bemerkenswert, denn denkt man über existentielle Bedrohungen der Menschheit nach, fallen mir ohne lange Überlegungen fast ein Dutzend Bedrohungen ein, der Klimawandel ist da nur eine unter vielen.
Dies merkt auch der britischen Historiker Niall Ferguson an; aus seinem ebenfalls sehr lesenswerten Buch Doom zitiert:
“For every potential calamity, there is at least one plausible Cassandra. Not all prophecies can be heeded. In recent years we may have allowed one risk — namely climate change — to draw our attention away from the others.”
Dazu kommt noch die wesentliche Frage, ob diese Probleme, die hier angesprochen werden, überhaupt eine Lösung in einem traditionellen Sinn hat, wie diese Aktivisten behaupten. Dazu empfehle ich die Episode Probleme und Lösungen nachzuholen.
“There are no solutions, only tradeoffs.”, Thomas Sowell
Am Ende noch ein Zitat aus dem herausragenden Buch von Jacob Bronowski aus dem Jahr 1956, das im Grunde meine Episode über den Irrtum der »Follow the Science« vorwegnimmt (allerdings bin ich erst nach meiner Episode auf dieses Buch gestossen):
»There is no more threatening and no more degrading doctrine than the fancy that somehow we may shelve the responsibility for making the decisions of our society by passing it to a few scientists armoured with a special magic.«
Referenzen
Andere Episoden
Episode 76: Existentielle Risiken
Episode 62: Wirtschaft und Umwelt, ein Gespräch mit Prof. Hans-Werner Sinn
Episode 60: Wissenschaft und Umwelt — Teil 2
Episode 59: Wissenschaft und Umwelt — Teil 1
Episode 51: Vorbereiten auf die Disruption? Ein Gespräch mit Herbert Saurugg und John Haas
Episode 50: Die Geburt der Gegenwart und die Entdeckung der Zukunft — ein Gespräch mit Prof. Achim Landwehr
Episode 47: Große Worte
Episode 46: Activism, a Conversation with Zion Lights
Episode 45: Mit »Reboot« oder Rebellion aus der Krise?
Episode 39: Follow the Science?
Episode 37: Probleme und Lösungen
Fachliche Referenzen
Apocalypse Always, Blog Artikel (2023)
Existential Threats, Blog Article (2023)
Michael Barkun, Syracuse University
Michael Barkun, Thinking about the end in contemporary America, Soundings: An Interdisciplinary Journal Vol. 66, No. 3 (Fall 1983), pp. 257-280
Andrea Wulf, Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur, Bertelsmann (2016)
John Gray, Black Mass, Penguin (2008)
Just Stop Oil
Extinction Rebellion, Citizens Assembly, Climate Change (2021)
Letzte Generation, Berlin zum Stillstand bringen (April 2023)
Niall Ferguson, Doom, Deutsche Verlagsanstalt (2021)
Jacob Bronowski, Science and Human Values, Faber and Faber (1956)
Michael Crichton, Why Speculate? (2002)

May 17, 2023 • 1h 22min
073 — Ökorealismus, ein Gespräch mit Björn Peters
In dieser Episode führe ich ein Gespräch mit Dr. Björn Peters über ökologischen Realismus:
Björn ist Physiker und hat seine Karriere als Management-Berater bei McKinsey begonnen. Er war dann im Management verschiedener DAX-Konzerne im Finanzbereich tätig, und hat wirtschaftliche und strategische Bewertungsmethoden entwickelt. Eine besondere Expertise ist dabei die Speicherfinanzierung, die er in vielen internationalen Konferenzen präsentierte. Weiters fungierte er als Vorsitzender des Energy Storage World Forums.
2016 hat er ein privates Forschungs- und Beratungsunternehmen gegründet, das sich auf Rohstoff-, Finanz- und Energiemärkte spezialisiert hat. Er berät Politiker in Fragen von Nachhaltigkeit und Energie-Strategie und ist seit 2021 Finanzchef beim kerntechnischen Startup Dual Fluid Energy Inc. in Vancouver / Kanada.
In diesem Gespräch schlagen wir einen weiten Bogen, beginnend von den großen Herausforderungen der Zeit und wie wir als Gesellschaft mit ökologische Probleme konstruktiv und faktenbasiert umgehen sollten. Dabei sprechen wir über Energieversorgung, Kybernetik, politische Strategien, sowie geopolitische Aspekte dieser Themen.
Was ist vom immer wieder aufflammenden Malthusianismus zu halten? Welche Rolle spielen globale Stoffkreisläufe? Mit einem Blick nach China, Indien, Afrika: welche Rolle können Nationen wie Deutschland bei Fragen des Klimawandels überhaupt spielen?
»Wir tragen unsere Energieproblem auf dem Rücken der Hungernden der Welt aus.«
Wie kommen wir von einer »Gartenzwerperspektive« zu wirksamen Strategien? Welche Rolle spielt Technologie? Finden wir einen Weg, der keinen komplexen Plan benötigt, sondern sich selbst ergibt?
Dann sprechen wir über die Problematik der »erneuerbaren« Energie: aus dem Versprechen einer dezentralen Energieversorgung wird in der Realität eine dezentrale Energieerzeugung mit enormen Folgekosten für die Integration, denn keine Technologie ist zentraler als »Erneuerbare«.
Kybernetik ist ein Begriff, der in den 1980er Jahren langsam an Bedeutung verloren hat —sollten wir ihm nicht wieder mehr Aufmerksamkeit schenken? Z.B. bei der Frage, ob komplexe Herausforderungen besser top-down oder bottom-up angegangen werden sollten? Oder über die Rolle des Staats etwa bei Technologieentscheidungen?
Aktuell steht es um Forschung und Entwicklung in vielen Bereichen nicht sehr gut: Wissenschaft wird eingeengt um »Lösungen« zu finden, die die Politik bereits vorgegeben hat.
Zuletzt interessieren mich die Möglichkeiten, die in der Renaissance der Kernkraft mit fast 100 neuen Startups liegt. Hat die Kerntechnik aufgrund des Aktivismus der 1970er und 1980er Jahre Jahrzehnte der Pause eingelegt? Wo stehen wir heute? Was hat sich bei bestehenden Anlagen verändert? Wie sieht es mit der Sicherheit aus und welche Rolle können diese neuen Startups in den nächsten Jahren spielen? Und natürlich muss ich die Frage stellen: wie gehen wir mit dem Atommüll um, der in der öffentlichen Wahrnehmung wie ein apokalyptisches Problem wirkt?
Welche Rolle kann Serienproduktion und Skaleneffekte für Kosten, Geschwindigkeit und Qualität spielen? Was bedeutet Dekarbonisierung der Energieversorgung wirklich, vor allem wenn man nicht nur das 1/5 Elektrizität sondern auch die 4/5 der restlichen Energie betrachtet?
»Auf globaler Ebene ist die Offenheit für Kernkraft enorm.«
Björn ist bei diesen Zukunftsfragen, wie sich herausstellen wird, aus einer globalen Perspektive optimistisch:
»Global bin ich sehr optimistisch, lokal — für Deutschland und Österreich — wird noch ein sehr tiefes Tal der Tränen vor uns liegen, bis die Leute merken, dass man eine zuverlässige Energieversorgung braucht, die auch günstig ist.«
Die Physik (oder allgemeiner: die Realität) gewinnt am Ende immer, gegen jede noch so gut gemeinte, aber sachlich falsche Idee.
Referenzen
Andere Episoden
Episode 70: Future of Farming, a conversation with Padraic Flood
Episode 62: Wirtschaft und Umwelt, ein Gespräch mit Prof. Hans-Werner Sinn
Episode 59: Wissenschaft und Umwelt — Teil 1
Episode 60: Wissenschaft und Umwelt — Teil 2
Episode 57: Konservativ UND Progressiv
Episode 50: Die Geburt der Gegenwart und die Entdeckung der Zukunft — ein Gespräch mit Prof. Achim Landwehr
Episode 46: Activism, a Conversation with Zion Lights
Episode 37: Probleme und Lösungen
Episode 36: Energiewende und Kernkraft, ein Gespräch mit Anna Veronika Wendland
Episode 33: Naturschutz im Anthropozän – Gespräch mit Prof. Frank Zachos
Björn Peters
Forschungs- und Beratungsinstitut für Energiewirtschaft und Politik
Deutscher Arbeitgeberverband: Artikel zu Energiefragen
Dual Fluid
Björn Peters auf Twitter


