
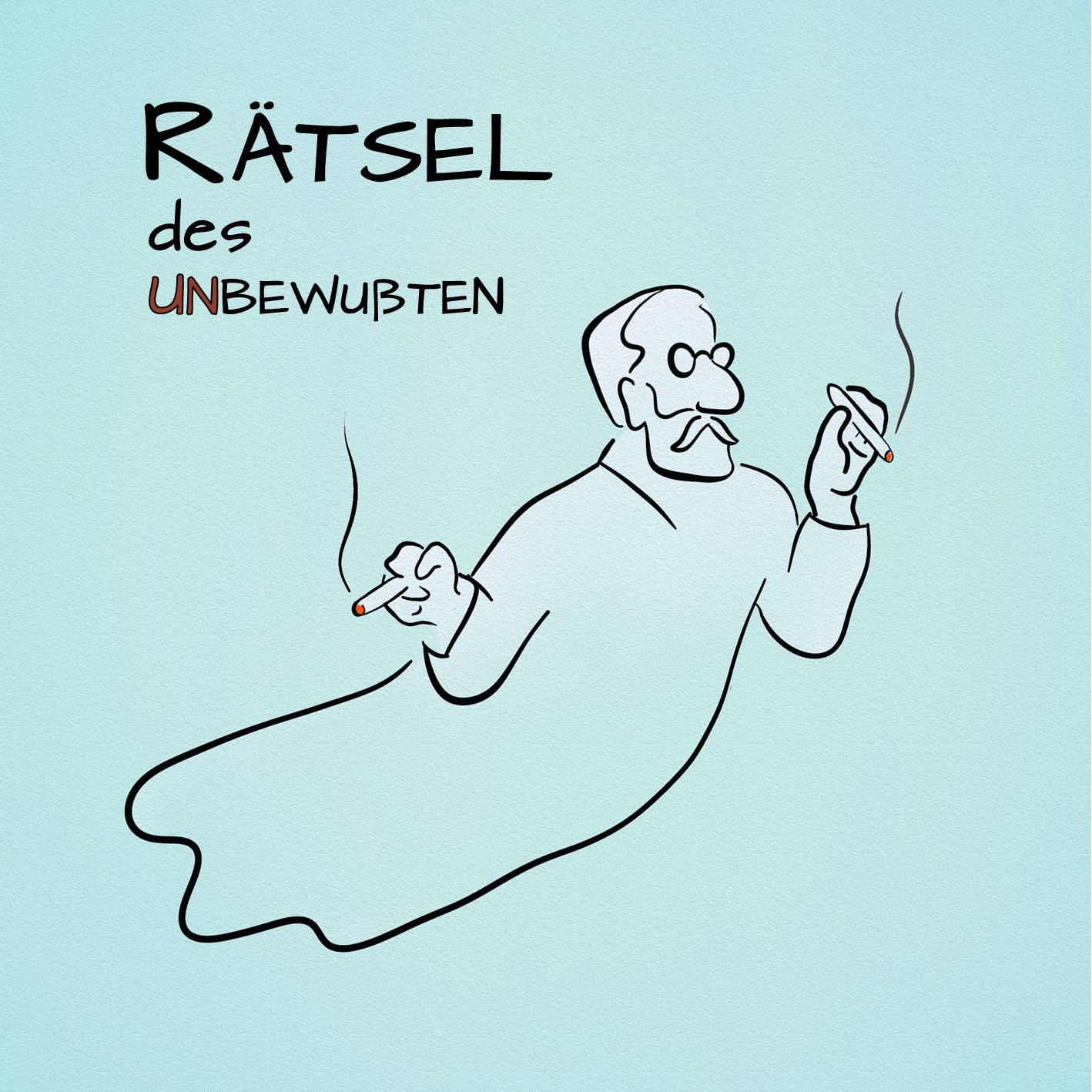
Rätsel des Unbewußten. Psychoanalyse & Psychotherapie.
Dr. Cécile Loetz & Dr. Jakob Müller
Unterstütze unseren Podcast und erhalte mehr als 60 zusätzliche Bonusfolgen, Autorengespräche und Vertiefungen: www.patreon.com/raetseldesubw
Wir widmen uns der Erforschung des Unbewussten, der modernen Psychoanalyse, Tiefenpsychologie und den Verfahren der Psychotherapie. Zudem erzählen wir Fallgeschichten aus der Praxis in unserer Reihe "Tales of Therapy".
Unser Buch mit neuen Fallgeschichten: "Mein größtes Rätsel bin ich selbst" (erscheint im Hanser Verlag) -- überall, wo es Bücher gibt.
Kontakt: Lives@psy-cast.org
Top 10 der Wissenschafts-Podcasts (Spotify) im deutschsprachigen Raum mit über 300.000 Abonnenten
Unser "Heimatinstitut" in Heidelberg: http://www.psychoanalytisches-institut-heidelberg.de/
Deutsche Psychoanalytische Vereinigung: https://www.dpv-psa.de
Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft: https://dpg-psa.de/
Netzwerk Freier Psychoanalytischer Institute: https://dgpt.de/ueber-uns/fachgesellschaften-freie-institute/netzwerk-freie-institute-fuer-psychoanalyse-und-psychotherapie
G-06T4LRH6G4
Wir widmen uns der Erforschung des Unbewussten, der modernen Psychoanalyse, Tiefenpsychologie und den Verfahren der Psychotherapie. Zudem erzählen wir Fallgeschichten aus der Praxis in unserer Reihe "Tales of Therapy".
Unser Buch mit neuen Fallgeschichten: "Mein größtes Rätsel bin ich selbst" (erscheint im Hanser Verlag) -- überall, wo es Bücher gibt.
Kontakt: Lives@psy-cast.org
Top 10 der Wissenschafts-Podcasts (Spotify) im deutschsprachigen Raum mit über 300.000 Abonnenten
Unser "Heimatinstitut" in Heidelberg: http://www.psychoanalytisches-institut-heidelberg.de/
Deutsche Psychoanalytische Vereinigung: https://www.dpv-psa.de
Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft: https://dpg-psa.de/
Netzwerk Freier Psychoanalytischer Institute: https://dgpt.de/ueber-uns/fachgesellschaften-freie-institute/netzwerk-freie-institute-fuer-psychoanalyse-und-psychotherapie
G-06T4LRH6G4
Episodes
Mentioned books

Oct 25, 2020 • 2min
In eigener Sache...
Rätsel des Unbewußten
Zur Spende via Paypal: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=VLYYKR3UXK4VE&source=url
Der Link zur Förderplattform Patreon: https://www.patreon.com/raetseldesubw
Liebe Rätselfreundinnen und -freunde,
unser Podcast besteht mittlerweile schon seit über 2 Jahren und wir freuen uns, daß wir mit unserem Projekt so eine unerwartete Reichweite gefunden haben: Mittlerweile zählen die »Rätsel des Unbewußten« zu den 20 meistgehörten Wissenschaftspodcasts im deutschsprachigen Raum. Das haben wir Euch, Eurem Interesse und Eurer treuen Zuhörerschaft zu verdanken!
Der Podcast ist eine Herzensangelegenheit. Unser Ziel ist, Wissen über psychische Erkrankungen, Psychotherapie und Psychoanalyse allen frei zugänglich zu machen.
Wir verzichten dabei bewußt auf Werbespots oder andere Formen der Kommerzialisierung innerhalb unserer Podcastfolgen, da wir das Gefühl haben, daß das nicht zum Inhalt und einem konzentrierten Zuhören paßt. Das möchten wir auch so beibehalten.
Wenn Ihr unser Projekt zusätzlich fördern wollt, so findet Ihr jetzt im Anhang der Folgen und auf unserer Homepage zwei Möglichkeiten: Einen Spendenbutton oder alternativ die Möglichkeit, ein Fördermitglied unseres Podcasts auf der Plattform Patreon zu werden. Mit einem monatlichen Förderbeitrag unterstützt ihr die Infrastruktur unseres Podcasts, die Produktion neuer Folgen sowie ein Übersetzungsprojekt. Als kleines Dankeschön stellen wir dort das Skript zur jeweils aktuellen Folge zur Verfügung sowie Neuigkeiten zum Podcast und Hintergrundinformationen zu den Themen (z.B.: woran wir gerade schreiben, was wir gerade lesen und empfehlen). Wenn Ihr Lust habt, unser Projekt auf diese Weise zu unterstützen, freuen wir uns sehr und danken Euch!
Unabhängig davon: Unsere nächste Folge erscheint wie immer für alle frei zugänglich am: Freitag, den 6. November 2020.
Herzliche Grüße aus Heidelberg, Eure
Cécile Loetz & Jakob Müller

Oct 16, 2020 • 38min
Dissoziative Identitätsstörung – Verborgene Leben (55)
RÄTSELWISSEN
Unterstütze uns auf Patreon und erhalte die Skripte zu den Folgen:
Episodenbeschreibung:
Auch wenn es sich mittlerweile um eine anerkannte Diagnose handelt: die Dissoziative Identitätsstörung, manchmal auch Multiple Persönlichkeit genannt, bezeichnet nach wie vor eine sehr rätselhafte Form des psychischen Erlebens. Was eine Dissoziative Identitätsstörung ist, wie sie entsteht und therapeutisch behandelt werden kann – und warum sie auch etwas über das Wesen von Psyche und Identität verrät – davon handelt diese Folge.
Download (mp3)
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org
Literaturempfehlungen:
Brand, Bethany L et al. “Separating Fact from Fiction: An Empirical Examination of Six Myths About Dissociative Identity Disorder.” Harvard review of psychiatry vol. 24,4 (2016): 257-70. Full text online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4959824/#bib48
Brenner, I. (2009). A New View from the Acropolis: Dissociative Identity Disorder. Psychoanalytic Quarterly, 78(1):57-105
Dalenberg CJ, Brand BL, Gleaves DH, Dorahy MJ, Loewenstein RJ, Cardeña E, Frewen PA, Carlson EB, Spiegel D. Evaluation of the evidence for the trauma and fantasy models of dissociation. Psychol Bull. 2012 May;138(3):550-88. doi: 10.1037/a0027447. Epub 2012 Mar 12. PMID: 22409505.
Hart, C. (2013). Held in mind, out of awareness. Perspectives on the continuum of dissociated experience, culminating in dissociative identity disorder in children. Journal of Child Psychotherapy, 39(3):303-318
Kluft, R. P. (2000). The Psychoanalytic Psychotherapy of Dissociative Identity Disorder in the Context of Trauma Therapy. Psychoanalytic Inquiry, 20(2):259-286
Saakvitne, K. (2000). Some Thoughts About Dissociative Identity Disorder as a Disorder of Attachment. Psychoanalytic Inquiry, 20(2):249-258
Waiess, E. (2006). Treatment of Dissociative Identity Disorder: “Tortured Child Syndrome” Psychoanalytic Review, 93(3):477-500
Autobiographisches:
Jamieson, A. (2009). Today I'm Alice: A young girl's splintered mind, a father's evil secret. Pan
Noble, K. (2011). All of me. My incredible true story of how I learned to live with the many personalities sharing my body. Piatkus
Sizemore, C. (1989) A mind of my own. The Women Who Was Known As "Eve" Tells the Story of Her Triumph over Multiple Personality Disorder. William Morrow & Co
Film-Empfehlung:
Sybil (1976; Daniel Petrie)
Youtube:
Multiplicity and Me
The Entropy System
Chris Sizemore / "Eve"
DISDing
Interview mit Michaela Huber
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal

Sep 25, 2020 • 28min
Wie entstehen psychische Erkrankungen? (54)
RÄTSELWISSEN
Unterstütze uns auf Patreon und erhalte die Skripte zu den Folgen:
Episodenbeschreibung
Wie entstehen psychische Erkrankungen? Dies zählt wohl zu den schwierigsten Rätseln, nicht nur des Unbewußten, sondern der ganzen Psychologie. Denn damit verbunden ist die Frage: Was ist die Psyche überhaupt, die so sehr leiden kann? Ist hier der Begriff »Krankheit« überhaupt zutreffend? Nach psychoanalytischem Modell ist psychisches Leiden immer auch Ausdruck der Beziehungsgeschichte eines Menschen – wir sind immer auch das, was unsere soziale Welt ist: weshalb die Häufung psychischen Leids immer auch das Symptom einer gesellschaftlichen Krise ist.
Download (mp3)
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org
Literaturempfehlungen
Benedetti, Gaetano (1983). Todeslandschaften der Seele: Psychopathologie, Psychodynamik und Psychotherapie der Schizophrenie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Ermann, Michael (2020). Psychotherapie und Psychosomatik. Ein Lehrbuch auf psychoanalytischer Grundlage. 7. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 2020
Damasio, Antonio R. (2004). Descartes' Irrtum: Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn. Berlin: List.
Mentzos, Stavros (2009). Lehrbuch der Psychodynamik: Die Funktion der Dys-funktionalität psychischer Störungen. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015.
Nissen, Bernd (2009). Die Entstehung des Seelischen. Psychoanalytische Per-spektiven. Gießen: Psychosozial.
Reichmayer, Johannes (2013). Ethnopsychoanalyse. Geschichte, Konzepte, An-wendungen. Gießen: Psychosozial.
Werbik, Hans & Benetka, Gerhard (2016). Kritik der Neuropsychologie. Eine Streitschrift. Gießen: Psychosozial.
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal

Jul 17, 2020 • 2min
Sommerpause 2020
Rätsel des Unbewußten
Liebe Rätselfreunde,
mit der Folge über zeitgenössische Konzepte der Psychoanalyse verabschieden wir uns in die Sommerpause. Die letzten Wochen waren für uns alle sicherlich sehr ungewöhnliche und stehen im Zeichen eines gesellschaftlichen Umbruches, dessen Ende oder Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt kaum in Gänze absehbar sind. Auch unser Podcast kam an Corona nicht ganz vorbei und von denkwürdiger Aktualität waren einige unserer (ursprünglich prä-Corona geschriebener) Folgen, so etwa die zur Krankheitsangst oder der Angst vor dem Zusammenbruch. Etwas nachdenklich gehen wir deshalb in den Podcast-Urlaub.
Im September wird es zunächst mit klinischen Themen weitergehen, wie etwa Sucht und Dissoziation; auch werfen wir einen Blick in die reiche Welt der Kinderpsychoanalyse und befassen uns mit dem neuen Psychotherapiestudiengang bzw. der Direktausbildung. Wir nehmen eure Themenwünsche alle auf und haben auch schon einiges davon umgesetzt, während anderes noch offen ist. Wir danken euch überhaupt für die vielen Zuschriften und bitten um Entschuldigung, wenn wir nicht alle gleich beantworten können. Es sind so viele schöne Ideen dabei und wir freuen uns, wenn Ihr uns weiter eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken zukommen laßt! Wir danken euch sehr für euer Zuhören und euer reges Interesse und wir freuen uns auch, wenn wir im Herbst dann wieder gemeinsam den verschlungenen, unabsehbaren Pfaden des Unbewußten folgen.
Herzlich, Eure
Cécile & Jakob
<a href=" mailto:CJ@psy-cast.de?subject=Anmeldung Newsletter:%20Podcast Psychoanalyse&body= Herzlich Willkommen und vielen Dank für die Anmeldung zum Newsletter. %0d%0a %0d%0a Bitte bestätigen Sie Ihre Anmeldung, indem Sie die vorliegende E-Mail versenden. %0d%0a %0d%0a Verwendung der Daten: %0d%0a %0d%0a
Die erhobenen Daten (Emailadresse) dienen nur der Versendung des Newsletter und der Dokumentation Ihrer Zustimmung. Eine andere Verarbeitung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. %0d%0a %0d%0a Widerrufsrecht: Sollten Sie diese E-Mail Adresse nicht registriert haben oder wollen Sie den Newsletter doch nicht erhalten, betrachten Sie diese E-Mail bitte als gegenstandslos. %0d%0a Sie können den Newsletter und die Einwilligung zur Speicherung der Daten jederzeit widerrufen. %0d%0a Sollten Sie diese E-Mail Adresse nicht registriert haben oder wollen Sie den Newsletter doch nicht erhalten, betrachten Sie diese E-Mail bitte als gegenstandslos. %0d%0a Sie können sich jederzeit von dem Newsletter abmelden, indem Sie eine E-Mail mit dem Betreff: Abmeldung Newsletter an lives(at)psy-cast.org versenden %0d%0a %0d%0a Mit freundlichen Grüßen %0d%0a %0d%0a Cécile Loetz & Jakob Müller, www.psy-cast.de%0d%0a >Newsletter</a>

Jul 3, 2020 • 30min
Konzepte der zeitgenössischen Psychoanalyse (53)
RÄTSELWISSEN
Unterstütze unser Projekt auf Patreon und erhalte die Skripte zu den Folgen
Episodenbeschreibung:
Psychoanalyse wird häufig mit dem Wirken Sigmund Freuds gleichgesetzt. Zeitgenössische Denkweisen und Therapieansätze wie die Relationale Psychoanalyse oder die Mentalisierungsbasierten Therapieverfahren sind häufig weniger bekannt, obwohl sie für die aktuelle Praxis von zentraler Bedeutung sind. Die Folge gibt eine Einführung in die Konzepte der zeitgenössischen Psychoanalyse.
Download (mp3)
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org
Literaturempfehlungen:
Bateman, A, Fonagy, P (2016). Mentalization Based Treatment for Personality Disorders: A Practical Guide. Oxford University Press.
Chodorow, N (2012). Individualizing Gender and Sexuality: Theory and Practice. New York: Routledge
Ermann, M (2010/2017). Psychoanalyse heute. Entwicklungen seit 1975 und aktuelle Bilanz. Stuttgart: Kohlhammer.
Küchenhoff, J (2010). Der Wandel psychoanalytischer Therapiekonzepte. Klini-sche Herausforderungen und theoretischer Fortschritt. In: Münch, K, Munz, D & Sringer, A (Hg.). Die Psychoanalyse im Pluralismus der Wissenschaften, 83–108. Gießen: Psychosozial.
Mertens, W (2010). Psychoanalytische Schulen im Gespräch (3Bd.). Bern: Huber.
Mitchell, SA, Greenberg, JR (1983). Object Relations in Psychoanalytic Theory. Cambridge (MA): Harvard University Press.
Mitchell SA (1988). Relational Concepts in Psychoanalysis. Cambridge (MA): Harvard University Press.
Potthoff, P, Wollnik, S (Hg., 2014). Die Begegnung der Subjekte. Die intersubjektiv-relationale Perspektive in Psychoanalyse und Psychotherapie. Gießen: Psychosozial.
Stern, D (1992). Die Lebenserfahrung des Säuglings. Stuttgart: Klett-Cotta.
Schultz-Venrath, U, Felsberger, H (2016). Mentalisieren in Gruppen: Mentali-sieren in Klinik und Praxis. Klett-Cotta Verlag.
Stolorow RD, Orange DM, Atwood GE (2002). World horizonts. An alternative to the Freudian unconscious. Selbstpsychologie, 3, 24—60.
Stolorow, RD (1997). Dynamic, dyadic, intersubjective systems: An evolving paradigm for psychoanalysis. Psychoanalytic Psychology, 14, 337—346.
Taubner, S (2013). Erklären Mentalisierungsfähigkeiten den Zusammenhang zwischen traumatischen Erfahrungen und aggressivem Verhalten in der Adoleszenz? Psychoanalyse–Texte zur Sozialforschung 16 (3/4), 494-502.
Taubner, S, Sevecke, K & Rossouw, T (2015). Mentalisierungsbasierte Therapie bei Jugendlichen (MBT-A) mit Persönlichkeitsstörungen. Persönlichkeitsstörungen–Theorie und Therapie19 (1), 33-43.
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal

Jun 19, 2020 • 33min
Maschinendenken & Alexithymie (52)
RÄTSELWISSEN
Unterstütze unser Projekt auf Patreon und erhalte die Skripte zu den Folgen
Episodenbeschreibung:
»Abspeichern, löschen, umstrukturieren«, Redewendungen die man häufig hört, wenn es um Computer geht – oder aber um unser Gedächtnis. Unser aktuelles Menschenbild ist technizistisch geprägt, das »Maschinendenken« durchdringt unseren Alltag, oft genug auch unsere Vorstellung von Psychotherapie. In der Psychoanalyse gibt es eine spezifische Tradition, sich mit dieser Art des Selbstbezugs auseinanderzusetzen, vor allem in Zusammenhang mit psychosomatischen Erkrankungen. Bekannt ist etwa die sogenannte Alexithymie oder die »pensée opératoire«, das »operationale Denken«.
Download (mp3)
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org
Literaturempfehlungen:
Ahrens, S. Die instrumentelle Forschung am instrumentellen Objekt. Psy-che – Zeitschrift für Psychoanalyse, 42(3):225-241
Aisenstein, M. (2006) The indissociable unity of psyche and soma: A view from the Paris Psychosomatic School. Int J Psychoanal 87:667–80
Aisenstein, M. (2008). Beyond the Dualism of Psyche and Soma. Journal of The American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry, 36(1) 103–123
Aisenstein, M. (2019). Eine Einführung in das Denken von Michel Fain. Internationale Psychoanalyse, 14:287-309
Cremerius, J. (1977). Ist die „psychosomatische Struktur“ der französischen Schule krankheitsspezifisch? Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse, 31(4):293-317
Fuchs, T. (2008). Das Gehirn – ein Beziehungsorgan: Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption. Stuttgart: Kohlhammer
Mitscherlich, A. (1965). Über die Behandlung psychosomatischer Krankheiten. Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse, 18(11):643-663
de M'Uzan, M. (1977). Zur Psychologie der psychosomatisch Kranken. Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse, 31(4):318-332
Nietzsche, F. (1999). Unzeitgemäße Betrachtungen. Kritische Studienausgabe, Band 1. Berlin, New York: Deutscher Taschenbuch Verlag de Gruyter
Overbeck, G. (1977). Das psychosomatische Symptom: Psychische Defizienzerscheinung oder generative Ichleistung? Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse, 31(4):333-354
Schneider, P.-B. (1973). Zum Verhältnis von Psychoanalyse und psychosomatischer Medizin . Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse, 27(1):21-49
Storck, T. (2017). »Als ich eins war …« Psychoanalytische Psychosomatik und Anderes verstehen. Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse, 71(2):95-122
Zepf, S. & Gattig, E. (1982). »Pensée opératoire« und die Todestrieb-Hypothese. Kritische Anmerkungen zum theoretischen Konzept der französischen psychosomatischen Schule. Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse, 36(2):123-138
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal

Jun 5, 2020 • 30min
Hat die Psychoanalyse etwas mit Sexualität zu tun? (51)
RÄTSELWISSEN
Unterstütze unser Projekt auf Patreon und erhalte die Skripte zu den Folgen
Episodenbeschreibung:
Entgegen eines gängigen Vorurteils, daß es in der Psychoanalyse letztlich »immer nur um das Eine« gehe: In der Psychoanalyse selbst scheint der einstmals so prominente Platz der Sexualität von den Konzepten wie Mentalisierung, Bindung, frühe Störungen eingenommen worden. Ist die Psychoanalyse also ohne Trieb? Vernachlässigt sie gar die Sexualität? In einer ersten einführenden Folge nähern wir uns dem weiten und komplexen Themenfeld der Sexualität und ihrer Bedeutung für die moderne Psychoanalyse.
Download (mp3)
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org
Links:
NZZ: Jean Laplanche. Die unvollendete kopernikanische Revolution
Literaturempfehlungen:
Fonagy, P., Krause, R., Leuzinger-Bohleber, M. (2006). Identity, Gen-der, and Sexuality. 150 Years after Freud. London: International Psycho-analytic Association.
Freud (1905/1999): Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Gesammelte Werke, Bd., 27–145. Frankfurt a.M.: Fischer.
Green, A. (1996). Has Sexuality Anything To Do With Psychoanalysis? International Journal of Psycho-Analysis, 76, 871—883.
Laplanche, J. (1988). Die allgemeine Verführungstheorie und andere Aufsätze. Tübingen: edition diskord.
Lemma, A., Lynch, P.E. (Hg.) (2015). Sexualities. Contemporary Psy-choanalytic Perspectives. London: Routledge.
Reiche, R. (2000). Geschlechterspannung. Gießen: Psychosozial.
Sigusch, V. (2015). Sexualitäten. Eine kritische Theorie in 99 Fragmenten. Frankfurt a.M.: Campus.
Storck, T (2018). Sexualität und Konflikt. Stuttgart: Kohlhammer.
Spendenlink via Paypal

May 22, 2020 • 26min
Zur Psychoanalyse der Verschwörungstheorien (50)
RÄTSELWISSEN
Unterstütze unser Projekt auf Patreon und erhalte die Skripte zu den Folgen
Episodenbeschreibung:
Verschwörungstheorien – wenn man sie denn Theorien nennen will – haben im Grunde immer Konjunktur; mal mehr im Hintergrund schwelend, mal, insbesondere in Krisenzeiten, laut hervortretend. Tatsächlich sind sie ein sozialpsychologisches Phänomen von außerordentlichem Ausmaß: und ein Fall für die Tiefenpsychologie. Welche Funktionen Verschwörungstheorien für die Psyche einnehmen können, damit befaßt sich diese Folge.
Download (mp3)
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org
Literaturhinweise:
Adorno, T. W. (1997). Aberglaube aus zweiter Hand. Gesammelte Schrif-ten, Band8, S. 147ff., Frankfurt a.M.: Suhrkamp
Bion, W. (2009). Aufmerksamkeit und Deutung. Frankfurt a.M.: Brandes & Apsel
Blass, H. (2019). Ich hasse, also bin ich. Dienstagsreihe des Psychoanalytischen Instituts Heidelberg https://psychoanalyse-mitschnitt.podigee.io/1-hass4
Böök, V. (2002). »Negative Capability« bei Keats und bei - Bion. Jahrbuch der Psychoanalyse, 44, 224–230
Green, R. & Douglas, K.M. (2018). Anxious attachment and belief in conspiracy theories. Personality and Individual Differences. Volume 125, 15, 30-37 https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.12.023
Blum, H. (1981). Object Inconstancy and Paranoid Conspiracy. Journal of the American Psychoanalytic Association, 29:789-813
Kröll, F. (1995). Das Verhör: Carl Schmitt in Nürnberg 1947. Edelmann Verlag
Lantian, A. et al. (2017). »I Know Things They Don’t Know!« The Role of Need for Uniqueness in Belief in Conspiracy Theories. Social Psychology, 48, pp. 160-173. Hogrefe Publishing. https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1027/1864-9335/a000306
Luy, M., Hessel, F., Chakkarath, P. (2020) Verschwörungsdenken. 43. Jg., Nr. 159, 2020, Heft I. Psychosozial-Verlag
Rosenfeld, H. (1971). Contribution to the psychopathology of psychotic states: The importance of projective identification in the ego structure and the object relations of the psychotic patient. In: Doucet, P. & Lau-rin, C. (eds.): Problems of Psychosis. Amsterdam: Excerpta Medica
Rosenfeld, H. (1981). Bemerkungen zur Psychoanalyse des Über-Ich-Konfliktes bei einem akut schizophrenen Patienten. In: Zur Psychoanalyse psychotischer Zustände. Frankfurt am Main: Suhrkamp
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal

May 8, 2020 • 29min
Postpartale Depression. Der schwere Weg in ein neues Leben (49)
RÄTSELWISSEN
Unterstütze unser Projekt auf Patreon und erhalte die Skripte zu den Folgen
Episodenbeschreibung:
Tränen der Verzweiflung statt Mutterglück, Gefühle der Fremdheit statt der Bindung zum Kind. Postpartale Depressionen treten an einer Schwelle des Lebens auf, die wir mit einer hohen Bedeutung belegen: Geburt und frühe Elternschaft. Doch wie entsteht diese Form der Depression? Können auch Väter betroffen sein? Die Folge versucht, ein psychodynamisches Verständnis Postpartaler Depressionen zu eröffnen.
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org
Beratungsstellen und Hilfsangebote
https://schatten-und-licht.de
https://www.fruehehilfen.de/
https://www.mutter-kind-behandlung.de/
Literaturhinweise
Blum, L. D. (2007). Psychodynamics of postpartum depression. Psychoanalytic Psychology, 24(1), 45–62.
Bradley & Slade (2011). A review of mental health problems in fathers following the birth of a child. Journal of Reproductive and Infant Psychology, Vo 29, No 1, 19-42.
Davies, J., Slade, P., Wright, I., & Stewart, P. (2008). Posttraumatic stress symptoms following childbirth and mothers' perceptions of their infants. In-fant Mental Health Journal, 29, 18 S.
Halberstadt-Freud, H. C. (1993). Postpartum depression and symbiotic illusion. Psychoanalytic Psychology, 10, 407-423.
Hornstein, C., Trautmann-Villalba, P. (2007). Infantizid als Folge einer post-partalen Bindungsstörung. Nervenarzt 78, 580–583.
Kim, P. (2007). Sad Dads. Paternal Postpartum Depression. Psychiatry. 4(2), 35–47.
Salomonsson, B. (2013). An infant's experience of postnatal depression. To-wards a psychoanalytic model. Journal of Child Psychotherapy, 39, 137-155.
Stern, D. N. (1998). Die Mutterschaftskonstellation : eine vergleichende Dar-stellung verschiedener Formen der Mutter-Kind-Psychotherapie. Stuttgart: Klett-Cotta.
van Gennep, A (1909/2005): Übergangsriten. Campus, Frankfurt/New York.
Spendenlink via Paypal

Apr 24, 2020 • 31min
Depression (48)
RÄTSELWISSEN
Unterstütze unser Projekt auf Patreon und erhalte die Skripte zu den Folgen
Episodenbeschreibung:
Ob eher romantisch »Melancholie«, modern und sozialverträglich »Burnout« oder doch eher klinisch-trocken »Depression« genannt: Um was geht es eigentlich, wenn wir von dieser spezifischen Form des Erlebens sprechen, die immerhin zu einer der »Volkskrankheiten« unseres Zeitalters gerechnet wird? Diese Folge ist eine Einführung in das große und tiefe Themenfeld der Depression.
Download (mp3)
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org
Literaturhinweise:
Abraham, K. (1912). Ansätze zur psychoanalytischen Erforschung und Behandlung des manisch-depressiven Irreseins und verwandter Zustände. Zentralblatt für Psychoanalyse II, 6
Benedetti, G. (1987). Analytische Psychotherapie der affektiven Psychosen, Psychiatrie der Gegenwart 5, Affektive Psychosen. S. 369–386. Hrsg.: Kisker, K.P. et al. Berlin: Springer
Bibring, E. (1953). The mechanism of depression. S. 14–47.Hrsg.: Greenacre, P. In: Affective Disorders. New York: Int. Univ. Press
Freud, S. (1917). Trauer und Melancholie. S. 427ff. GW 10. Frankfurt a.M.: Fischer Verlag
Freud, S. (1920). Jenseits des Lustprinzips. S.1ff. GW 13. Frankfurt a.M.: Fischer Verlag
Kohut, H., Wolf, E. (1980). Die Störungen des Selbst und ihre Behandlung. S. 667–682. In: Psychologie des 20. Jahrhunderts, Band 10, München: Kindler
Küchenhoff, J. (2019). Depression. Gießen: Psychosozial-Verlag
Mentzos, S. (2001). Depression und Manie. Psychodynamik und Therapie affektiver Störungen. Göttingen: V&R
Mentzos, S. (1984). Neurotische Konfliktverarbeitung. Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch
Rado, S. (1956). The problem of melancholia. In: Collected papers, Band 1, New York: Grune and Stratton
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal


