
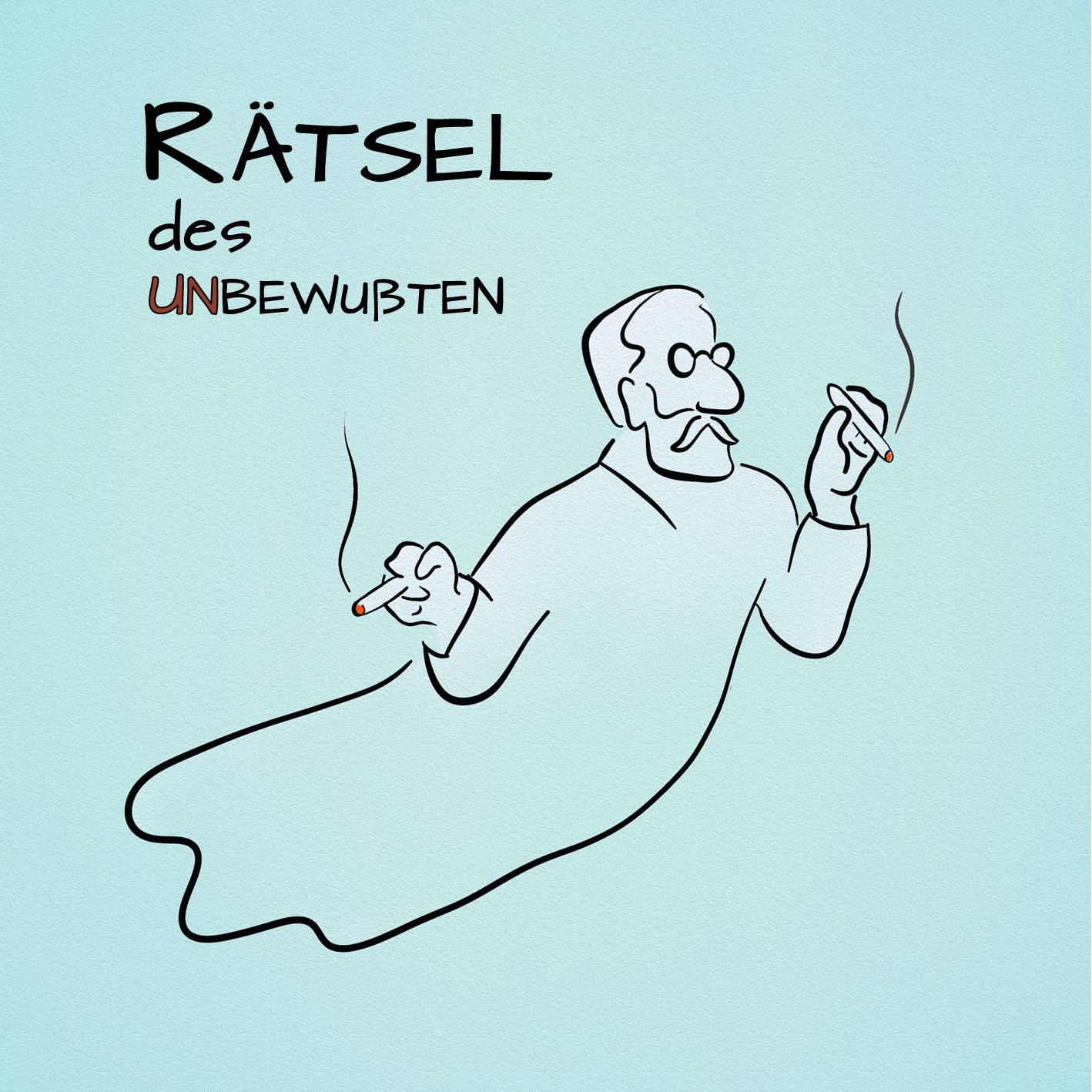
Rätsel des Unbewußten. Psychoanalyse & Psychotherapie.
Dr. Cécile Loetz & Dr. Jakob Müller
Unterstütze unseren Podcast und erhalte mehr als 60 zusätzliche Bonusfolgen, Autorengespräche und Vertiefungen: www.patreon.com/raetseldesubw
Wir widmen uns der Erforschung des Unbewussten, der modernen Psychoanalyse, Tiefenpsychologie und den Verfahren der Psychotherapie. Zudem erzählen wir Fallgeschichten aus der Praxis in unserer Reihe "Tales of Therapy".
Unser Buch mit neuen Fallgeschichten: "Mein größtes Rätsel bin ich selbst" (erscheint im Hanser Verlag) -- überall, wo es Bücher gibt.
Kontakt: Lives@psy-cast.org
Top 10 der Wissenschafts-Podcasts (Spotify) im deutschsprachigen Raum mit über 300.000 Abonnenten
Unser "Heimatinstitut" in Heidelberg: http://www.psychoanalytisches-institut-heidelberg.de/
Deutsche Psychoanalytische Vereinigung: https://www.dpv-psa.de
Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft: https://dpg-psa.de/
Netzwerk Freier Psychoanalytischer Institute: https://dgpt.de/ueber-uns/fachgesellschaften-freie-institute/netzwerk-freie-institute-fuer-psychoanalyse-und-psychotherapie
G-06T4LRH6G4
Wir widmen uns der Erforschung des Unbewussten, der modernen Psychoanalyse, Tiefenpsychologie und den Verfahren der Psychotherapie. Zudem erzählen wir Fallgeschichten aus der Praxis in unserer Reihe "Tales of Therapy".
Unser Buch mit neuen Fallgeschichten: "Mein größtes Rätsel bin ich selbst" (erscheint im Hanser Verlag) -- überall, wo es Bücher gibt.
Kontakt: Lives@psy-cast.org
Top 10 der Wissenschafts-Podcasts (Spotify) im deutschsprachigen Raum mit über 300.000 Abonnenten
Unser "Heimatinstitut" in Heidelberg: http://www.psychoanalytisches-institut-heidelberg.de/
Deutsche Psychoanalytische Vereinigung: https://www.dpv-psa.de
Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft: https://dpg-psa.de/
Netzwerk Freier Psychoanalytischer Institute: https://dgpt.de/ueber-uns/fachgesellschaften-freie-institute/netzwerk-freie-institute-fuer-psychoanalyse-und-psychotherapie
G-06T4LRH6G4
Episodes
Mentioned books

Jun 6, 2021 • 35min
Melanie und die Trauer (II)
TALES OF THERAPY
Episodenbeschreibung:
Melanie, eine junge Frau, kommt nach der Trennung von ihrem Freund in eine tiefe Krise. Sie leidet unter depressiven Symptomen, woraufhin sie eine Therapie bei einer Psychoanalytikerin aufsucht. Im Zuge der Arbeit stellen Therapeutin und Patientin die Verbindung zwischen Melanies Erleben und ihrer Geschichte her. Ein produktiver therapeutischer Prozeß kommt in Gang, die Beziehung zur Therapeutin intensiviert sich. Zugleich ziehen die Wolken der zweiten Coronawelle auch über die psychotherapeutische Praxis. Wie die Behandlung weitergeht, davon handelt diese Folge.
Erster Teil der Fallerzählung
Download als mp3
Link zur Nachbesprechung (zugänglich über eine Fördermitgliedschaft auf den Leveln "Rätselfreund/in" und "Held/in" des Unbewußten). Auf Patreon findet ihr auch Zugang zu dem Skript der Folge. Unser Podcast ist ein Herzensprojekt, das wir in unserer Freizeit gestalten. Wir danken jedem sehr herzlich, der das Projekt über einen kleinen Beitrag unterstützt.
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org ¹
Link zu unserer Website mit weiteren Informationen: www.psy-cast.de
Zur vertieften Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse von Trauerprozessen empfehlen wir auch unsere Folge 44 über Trauer
Alle Fallgeschichten und genannten Details werden nur mit dem persönlichen Einverständnis publiziert und sind vollständig anonymisiert und abgewandelt, sodaß kein Rückschluß auf eine reale Person möglich ist; oder es handelt sich um ein konstruiertes Beispiel. Mögliche Überschneidungen mit realen Personen sind also zufällig.
Fallerzählungen können einem sehr nahe kommen und unerwartet berühren. Bitte entscheidet selbst, was ihr euch zumuten möchtet. In dieser Folge geht es u.a. um Trauer und Verluste.
Hilfsmöglichkeiten bei psychischen Krisen
In psychischen Krisen können auch Hausarzt/ärztin, Psychiater/in und Psychotherapeut/innen Ansprechpartner sein. In Notfällen kann man sich zudem an eine psychiatrische Klinik wenden.
¹Mit der Anmeldung zum Newsletter stimmen Sie unseren Datenschutzbestimmungen zu, die wir konform zur DSGVO behandeln. Eine genaue Erklärung finden sich hier
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal
*Musik: Chelsea McGough, Along the Danube. Licenced via Soundstripe.

May 30, 2021 • 40min
Melanie und die Trauer (I)
TALES OF THERAPY
Episodenbeschreibung:
Eine junge Frau gerät nach der überraschenden Trennung von ihrem Partner in eine tiefe Krise. In den Liebeskummer graben sich immer tiefer die Linien einer Depression, auch, nachdem sie sich während der Corona-Krise zunehmend von sozialen Beziehungen zurückgezogen hat. Sie sucht eine Therapie auf und beginnt gemeinsam mit ihrer Therapeutin, die Verbindung ihrer Trauer mit ihrer unbewältigten Lebensgeschichte zu entdecken.
Link zur Nachbesprechung: https://www.patreon.com/posts/51853135
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org ¹
Link zu unserer Website mit weiteren Informationen: www.psy-cast.de
Link zu unserer Patreon-Plattform, wo ihr u.a. das Skript zur aktuellen Folge finden könnt: www.patreon.com/raetseldesubw
Zur vertieften Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse von Trauerprozessen empfehlen wir auch unsere Folge 44 über Trauer
Bitte beachtet unsere Hinweise, die Erläuterungen zum Hintergrund der Fallgeschichten sowie die Triggerwarnung, die wir an den Anfang der Folge gestellt haben.
Alle Fallgeschichten und genannten Details werden nur mit dem persönlichen Einverständnis publiziert und sind vollständig anonymisiert und abgewandelt, sodaß kein Rückschluß auf eine reale Person möglich ist; oder es handelt sich um ein konstruiertes Beispiel. Mögliche Überschneidungen mit realen Personen sind also zufällig.
Hilfsmöglichkeiten bei psychischen Krisen
In psychischen Krisen können auch Hausarzt/ärztin, Psychiater/in und Psychotherapeut/innen Ansprechpartner sein. In Notfällen kann man sich zudem an eine psychiatrische Klinik wenden.
¹Mit der Anmeldung zum Newsletter stimmen Sie unseren Datenschutzbestimmungen zu, die wir konform zur DSGVO behandeln. Eine genaue Erklärung finden Sie unter:
https://tinyurl.com/d9zvz8ee
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal
*Musik: Chelsea McGough, Along the Danube. Licenced via Soundstripe.

May 7, 2021 • 36min
Wohin die Liebe fällt: Psychoanalyse der Paarbeziehung. (62)
RÄTSELWISSEN
Unterstütze unser Projekt auf Patreon und erhalte das Skript zur aktuellen Folge
Episodenbeschreibung:
Ein Paar streitet sich um die Aufgabenverteilung beim Haushalt. Ein anderes ist in einer Spirale aus Eifersucht und Kontrolle gefangen. Ein anderes sucht nach totaler Harmonie und Einssein – und wird von starken Ängsten geplagt, sobald kleine Differenzen entstehen. Die Folge beschäftigt sich mit dem oftmals konflikthaften Zusammenspiel in Paarbeziehungen, ausgehend von dem berühmten psychodynamischen Konzept der Kollusion. In Paarbeziehungen bilden sich oftmals die Linien unbewußter Sehnsüchte und Ängste ab, die schon bei der Partnerwahl ausschlaggebend sind und in unserer Lebensgeschichte verankert liegen. Themen sind u.a.: Beziehungsdynamik der Eifersucht, narzißtische Beziehungsdynamiken, Helfer-Dynamik
Download der Episode (mp3)
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org ¹
Literaturempfehlungen:
Kernberg, O. (1992). Aggression und Liebe in Zweierbeziehungen. Psyche, 9, 797–820.
Kernberg, O. (1994). Das sexuelle Paar: Eine psychoanalytische Untersuchung. Psyche, 9/10, 866–885.
Reich, G. & von Boetticher, A. (2020): Psychodynamische Paar- und Familientherapie. Stuttgart: Kohlhammer.
Riehl-Emde, A. (2003). Liebe im Fokus der Paartherapie. Stuttgart: Klett-Cotta.
Riehl-Emde, A. (2009). Wenn Erinnerungen die Paarbeziehung belasten. Umgang mit unverarbeiteten Ereignissen aus paartherapeutischer Perspektive. Psychotherapeut 54, 486–490.
Riehl-Emde, A. (2014). Liebe – eine existentielle Beziehungsdimension im Alter. Psychotherapie im Alter, 13,3, 245–257.
Rottländer, P. (2020). Mentalisieren mit Paaren. Stuttgart: Klett-Cotta.
Tietel, E. (2008). Emotion und Anerkennung in Organisationen. Wege zu einer triangulären Organisationskultur. Münster: LIT.
Willi, J. (2002). Psychologie der Liebe. Persönliche Entwicklung durch Partnerbeziehungen. Reinbek: rororo.
Willi, J.(2012/1975). Die Zweierbeziehung: Das unbewusste Zusammenspiel von Partnern als Kollusion. Hamburg: Rowohlt.
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal
¹Mit der Anmeldung zum Newsletter stimmen Sie unseren Datenschutzbestimmungen zu, die wir konform zur DSGVO behandeln. Eine genaue Erklärung finden Sie unter:
https://tinyurl.com/d9zvz8ee

Apr 16, 2021 • 27min
»Auf der Suche nach der verlorenen Zeit.« Psychoanalyse und Lebensgeschichte (61)
RÄTSELWISSEN
Unterstütze unser Projekt auf Patreon und erhalte das Skript zur aktuellen Folge
Episodenbeschreibung:
Das, was isoliert betrachtet sinnlos erscheint, wird oft genug sinnvoll, wenn man es in Bezug zur Geschichte setzt. Das gilt bis hin zu vermeintlich »verrückten« Reaktionen auf gesellschaftliche Krisen, die oftmals vor dem Hintergrund der Lebens- und Familiengeschichte eines Menschen plausibel werden.
Download der Episode (mp3)
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org ¹
Literaturempfehlungen:
Bluck, S. & Habermas, T. (2000). The life story schema. Motiv & Emotion, 24, 121–147.
Boschan, P. (1990). Temporality and Narcissism. Int. Rev. Psycho-Anal., 17, 337–349.
Boothe, B. (2010). Das Narrativ: Biografisches Erzählen im psychotherapeutischen Prozess. Stuttgart: Schattauer.
Buchholz, M. (1993). Metaphernanalyse. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Dornes, M. (1999). Das Verschwinden der Vergangenheit. Psyche, 53, 6, 530–571.
Erikson, Erik H. (1966). Identität und Lebenszyklus. Drei Aufsätze; Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Engster, F. (2010). Zeit bei Marx – Das Maß als Mittel der Verzeitlichung. In: Lethen, H., Schmieder, F., Löschenkohl, B. (Hg.): Der sich selbst entfremdete und wiedergefundene Marx, 207–225. Paderborn: Wilhelm Fink.
Freud, S. (1914 / 1999). Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten.
Weitere Ratschläge zur Technik der Psychoanalyse. GW X, 126-136. Frankfurt a.M.: Fischer.
Fuchs, T. (2020). Depression als Desynchronisierung. Ein Beitrag zur Psychopathologie der intersubjektiven Zeit. In: Fuchs, T.: Randzonen der Erfahrung, 170–193. Freiburg / München: Karl Alber.
Habermas, T. (2011). Identität und Lebensgeschichte heute. Die Form autobiographischen Erzählens. Psyche, 65, 7, 646–668.
Küchenhoff, J. (1996). Zum Stellenwert der Biographie in der Psychoanalyse. Zsch. psychosom. Med., 42, 1–24.
Person, E. S. (2006). Revising our life stories: The role of memory and imagination in the psychoanalytic prcess. Psychoanal Rev, 93, 655–647.
Schafer, R. (1995). Erzähltes Leben. Narration und Dialog in der Psychoanalyse. München: Pfeiffer.
Zwiebel, R. (2005). Zur Dynamik der »lebendigen Erinnerung« in der analytischen Situation. Psyche, 59, 78–90.
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal
¹Mit der Anmeldung zum Newsletter stimmen Sie unseren Datenschutzbestimmungen zu, die wir konform zur DSGVO behandeln. Eine genaue Erklärung finden Sie unter:
https://tinyurl.com/d9zvz8ee

Feb 19, 2021 • 3min
Winterpause und einige Neuerungen
Rätsel des Unbewußten
Winterpause und einige Neuerungen
Liebe Rätselfreundinnen und -freunde,
bevor wir uns in die Faschingspause verabschieden und an neuen Folgen schreiben, wollten wir euch noch über einige Neuerungen in unserem Podcast informieren. Es gibt eine ganze Reihe:
Zunächst die wohl größte Neuerung: die Rätsel des Unbewußten gibt es nun auch auf Englisch. Ab heute erscheinen die Folgen in einem neuen Podcast unter dem Titel "Lives of the Unconscious". Wenn ihr neugierig seid: schaut doch gern einmal rein und abonniert den Podcast, den Link haben wir in den Anhang gestellt
(Abonnieren unter: https://psy-cast.org/en/subscribe/)
Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, vielleicht habt ihr Ideen, wer sich für die englische Version interessieren könnte. Auch über die Abonnements helft ihr uns, den Podcast zu verbreiten.
Wir haben unserem Logo mal wieder einen neuen Anstrich gegeben. Céciles Zeichenhand ist nun ein neuer Freud-Geist zu verdanken, wir hoffen, er gefällt euch.
Damit verbunden ist auch eine neue Homepage, die ihr finden könnt unter: www.psy-cast.org, in englischer und deutscher Fassung.
Noch einmal in eigener Sache: Auf unserer Förderplattform Patreon findet ihr nun ein neues Förderlevel, auf dem es unter anderem die Skripte zu allen bisherigen Folgen, die aktuellen englischen Skripte sowie ein monatliches Q&A "Die Autoren im Gespräch" gibt, das ab Mitte März erscheinen wird.
www.patreon.com/raetseldesubw
Ab April veröffentlichen wir dann wieder wie immer eine neue Staffel von Folgen für den deutschen Podcast. U.a. wollen wir uns befassen mit: Eßstörungen, der weiblichen Perversion, der Bedeutung von Lebensgeschichte und Biographie, dem Thema der Identität, der weißen Depression oder der Übertragungsliebe.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder mit uns rätselt und unsere Reise auf den Grund der Seele mit uns fortsetzt. Wir danken euch außerdem ganz herzlich für eure treue Zuhörerschaft!
Eure
Cécile & Jakob

Jan 29, 2021 • 37min
Neid. Verborgene Triebkraft menschlicher Beziehungen? (60)
RÄTSELWISSEN
Unterstütze unser Projekt auf Patreon und erhalte das Skript zur aktuellen Folge
Episodenbeschreibung:
Neid kann überall dort entstehen, wo es Ungleichheit zwischen den Menschen gibt: in der Gesellschaft und Familien, zwischen Geschwistern, Geschlechtern, Generationen. »Neid ist die Steuer, die aller Unterschied bezahlen muß« (R.W. Emerson). Neid hat einen schlechten Ruf, ist mitunter tabuisiert, zugleich ein allgegenwärtiges Gefühl. Die Folge beschäftigt sich mit einem psychoanalytischen Verständnis von Neid und seinen Folgen für Gesellschaft und therapeutische Prozesse, etwa in der sogenannten negativen therapeutischen Reaktion. Neid ist aber nicht nur Zerstörer, sondern Triebkraft menschlicher Entwicklung.
Lesekreis (Bonusmaterial via Patreon): Melanie Kleins "Neid und Dankbarkeit" gelesen und diskutiert
Download (mp3)
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org¹
Literaturempfehlungen:
Beland, H.(1999). Neid: die systemsprengenden Phänomene. Journal für Psychologie, 7, 3–16.
Britton, R., Feldmann, M., Steiner, J. (1997). Groll und Rache in der ödipalen Situation. Tübingen: edition diskord.
Feldman, M. (2008). Envy and the negative theraputic reaction. In: Roth, P. &Lemma, A. (Hg.): Envy and Gratitude Revisited. London: Karnac.
Focke, I., Pioch, E., Schulze, S. (Hg, 2017). Neid: Zwischen Sehnsucht und Zerstörung. Stuttgart: Klett-Cotta.
Haubl, R. (2001). Neidisch sind immer nur die anderen. Über die Unfähigkeit, zufrieden zu sein. München: C.H. Beck.
Hering, W. (1999). Neid und Psychose. Psyche, 8, 742–771.
Joseph, B. (1986). Neid im Alltagsleben. In: Psychisches Gleichgewicht und psychische Veränderung. Stuttgart: Klett Cotta, 268–284.
Klein, M. (1957). Neid und Dankbarkeit. Psyche, 11, 241–255.
Riviere, J. (1996/1936). Beitrag zur Analyse der negativen therapeutischen Reaktion. Ausgewählte Schriften. Tübingen: edition diskord, 138–158.
Schoeck, H. (1980). Der Neid. Die Urgeschichte des Bösen. München/Wien: Herbig.
Steiner, J. (2014). Wiederholungszwang, Neid und Todestrieb. In: Seelische Rückzugsorte verlassen. Stuttgart: Klett-Cotta, 33–52.
Young, E. (2000). The Role of Envy in Psychic Grwoth. Fort Da, 6, 57—68.
Weiß, H. (2008). Groll, Scham und Zorn. Überlegungen zur Differenzierung narzißtischer Zustände. Psyche, 62, 866–886.
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal
¹Mit der Anmeldung zum Newsletter stimmen Sie unseren Datenschutzbestimmungen zu, die wir konform zur DSGVO behandeln. Eine genaue Erklärung finden Sie unter:
https://tinyurl.com/d9zvz8ee

Jan 8, 2021 • 36min
Zur Psychoanalyse der Suchterkrankungen (59)
RÄTSELWISSEN
Unterstütze unser Projekt auf Patreon und erhalte das Skript zur aktuellen Folge
Episodenbeschreibung:
Süchte bzw. Abhängigkeiten zählen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Sie sind aber auch mit vielen Vorurteilen belegt, Betroffene mitunter stigmatisiert. Ihre Behandlung gilt als schwierig. Doch warum wird jemand süchtig? Kann jeder süchtig werden? Welche psychische Funktion erfüllt süchtiges Verhalten? Die Folge führt in ein psychoanalytisches Verständnis von Suchterkrankungen ein, wobei vor allem der unbewußten Dynamik von Scham und Schuld eine wesentliche Rolle zukommt.
Download (mp3)
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org ¹
Literaturempfehlungen:
Diekmann, A. & Albertini, V. (2008). Psychoanalytisch-interaktionelle Suchttherapie in der Klinik – Erfahrungen mit einer einheitlichen therapeutischen Haltung. In: Psychotherapie der Sucht. Psychoanalytische Beiträge zur Praxis. Hrsg. Bilitza, K.W. Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen
Goethe, J.W. (1778). Der Fischer. https://www.deutschelyrik.de/der-fischer.html
Radó, S. (1926). Die psychischen Wirkungen der Rauschgifte. Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen. 29 (4), S.360–375
Rost, W.-D. (2008). Die ambulante Suchttherapie in der Praxis des Psycho-analytikers. In: Psychotherapie der Sucht. Psychoanalytische Beiträge zur Praxis. Hrsg. Bilitza, K.W. Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen
Voigtel, R. (2006). Sucht als Abwehr. In: Das Unbewußte in der Praxis. Erfahrungen verschiedener Professionen. Hrsg. Buchholz, M., Gödde, G. Psychosozial. Gießen
Voigtel, R. (2019). Sucht. Buchreihe: Analyse der Psyche und Psychothera-pie. Psychosozial-Verlag. Gießen
Wurmser, L. (2008). Übertragung und Gegenübertragung bei Patienten mit Suchtproblemen. In: Psychotherapie der Sucht. Psychoanalytische Bei-träge zur Praxis. Hrsg. Bilitza, K.W. Vandenhoeck & Ruprecht. Göttin-gen
Links:
ICD-10 und DSM-V-Kriterien: Abhängigkeit und schädlicher Gebrauch von Alkohol. Dtsch Arztebl Int 2016; 113: 301-10
Drogenbeauftragte
Filmempfehlung:
The Social Dilemma
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal
¹Mit der Anmeldung zum Newsletter stimmen Sie unseren Datenschutzbestimmungen zu, die wir konform zur DSGVO behandeln. Eine genaue Erklärung finden Sie unter:
https://tinyurl.com/d9zvz8ee

Dec 18, 2020 • 36min
Deutung (58)
RÄTSELWISSEN
Unterstütze unser Projekt auf Patreon und erhalte das Skript zur aktuellen Folge
Episodenbeschreibung:
In der Psychoanalyse stellt sie eine der zentralen Techniken zur Bearbeitung von Konflikten dar: die Deutung. Die Psychoanalyse ist aber keineswegs die Erfinderin der Deutungen – und auch im ganz gewöhnlichen Alltagsleben kommt wohl niemand ohne sie aus. Unsere soziale Welt, aber auch das seelische Innenleben ist in einen Kosmos aus Interpretationen gebettet, die wir täglich vornehmen. Warum die Deutung in der Psychoanalyse eine solche Bedeutung hat und wie psychodynamisch orientierte Therapeuten mit ihr arbeiten, welche Arten der Deutungen es gibt, darum geht es in dieser Folge.
Download (mp3)
Literaturempfehlungen:
Argelander, H. (1981). Was ist eine Deutung. Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse, 35(11):999-1005
de Baranger, M. (1993). Die geistige Arbeit des Analytikers: vom Zuhören zur Deutung. Jahrbuch der Psychoanalyse, 30:26-45
Bion, W. (1962 / 1992). Lernen durch Erfahrung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Körner, J. (2015): Deutung in der Psychoanalyse. Stuttgart: Kohlhammer
Mertens, W. (2015): Psychoanalytische Behandlungstechnik: Konzepte und Themen psychoanalytisch begründeter Behandlungsverfahren. Stuttgart: Kohlhammer.
Nissen, B. & Zeitzschel, U. (Hg., 2020). Deutungen. Jahrbuch der Psychoanalyse, Bd. 80. Stuttgart: frommann-holzboog.
Passmann, R. (2010): Inhaltsdeutung und Prozessdeutung. Prozessorientierte Psychotherapie. Forum der Psychoanalyse, 26, 105–120.
Steiner, J. (1998): Probleme der psychoanalytischen Technik – Patientenzentrierte und analytikerzentrierte Deutung. In: Steiner, J.: Orte des seelischen Rückzugs. Stuttgart: Klett-Cotta. 191–212
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal

Nov 27, 2020 • 34min
Männliche Perversion und sexualisierte Gewalt (57)
RÄTSELWISSEN
Unterstütze unser Projekt auf Patreon und erhalte das Skript zur aktuellen Folge
Episodenbeschreibung:
Vom Catcalling über die Dickpics bis hin zu Upskirting oder andere sexuellen Übergriffen: sexualisierte Gewalt ist nicht nur in den sozialen Medien omnipräsent, wobei die Täter häufig Männer sind. Auch andere Formen sexualisierter Gewalt gehen Studien zu Folge oftmals, wenngleich keineswegs ausschließlich, von Männern aus. Wie sich diese Formen sexualisierter Gewalt verstehen lassen und inwiefern sie mit einem psychoanalytischem Verständnis der Perversion zusammentreffen, davon handelt diese Folge. Mit der Dimension weiblicher Perversion werden wir uns in einer anderen Folge beschäftigen.
Download (mp3)
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org
Literaturempfehlungen:
Berner, W. (2017). Perversion. Gießen: Psychosozial
Chasseguet-Smirgel, J. (1984). Anatomie der menschlichen Perversion. Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt.
Glasser, M. (1979/2010). Zur Rolle der Aggression in den Perversionen. Jahrbuch der Psychoanalyse, 60, 19–53.
Massie, H. & Szainberg, N.M. (1997). The ontogeny of a sexual fetish from birth to age 30 and memory processes. International Journal of Psychoanalysis, 78, 755—771.
Morgenthaler, F. (1974): Die Stellung der Perversionen in Metapsychologie und Technik. Psyche, 28, 1077–1098.
McDougall, J. (1985). Plädoyer für eine gewisse Anormalität. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Nissen, B. (2010). Zur nichtobjektalen, autistoiden Perversion. Jahrbuch der Psychoanalyse, Bd. 60, 55–60.
Reiche, R. (2007). Psychoanalytische Therapie sexueller Perversionen. In: Sigusch, V. (Hg.): Sexuelle Störungen und ihre Behandlung. Stuttgart: Thieme. 276–291
Stoller, R. (1979). Perversion: die erotische Form von Haß. Reinbeck: Rowohlt.
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal

Nov 6, 2020 • 22min
Die Sonntagsneurose (56)
RÄTSELWISSEN
Unterstütze unser Projekt auf Patreon und erhalte das Skript zur aktuellen Folge
Episodenbeschreibung:
Sonntagsneurose – gemeint sind merkwürdige, scheinbar unerklärliche Befindlichkeitsstörungen, die gerade dann auftreten, wenn ein Mensch sich nach gängiger Erwartung besonders gut, entspannt oder frei fühlen sollte: in seiner Freizeit, klassischerweise am Sonntag. Typisch ist ein Gefühl von Lustlosigkeit, Elend und Niedergeschlagenheit, manchmal auch eine seltsame Bangigkeit oder Dünnhäutigkeit bis hin zu einer kaum erträglichen Leere oder Angstzuständen. Manchmal herrscht ein Gefühl unsagbarer Melancholie und Sehnsucht vor, manchmal psychosomatische Symptome, manchmal aber auch ein rastloser Tätigkeitsdrang. Was es damit auf sich hat, davon handelt diese Folge.
Download (mp3)
Anmeldung zum Newsletter: Mail mit Betreff "Anmeldung Newsletter" an: Lives@psy-cast.org
Literaturempfehlungen:
Ferenczi, S. (1919). Sonntagsneurosen. Schriften zur Psychoanalyse. Gießen: Psychosozial.
Frankl, V. (1985). Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. Berlin: Piper.
Maennig, W., Steenbeck, M., Wilhelm, M. (2014). Rhythms and Cycles in Happiness. Hamburg Contemporary Economic Discussions.
Wir freuen uns auch über eine Förderung unseres Projekts via Paypal


