
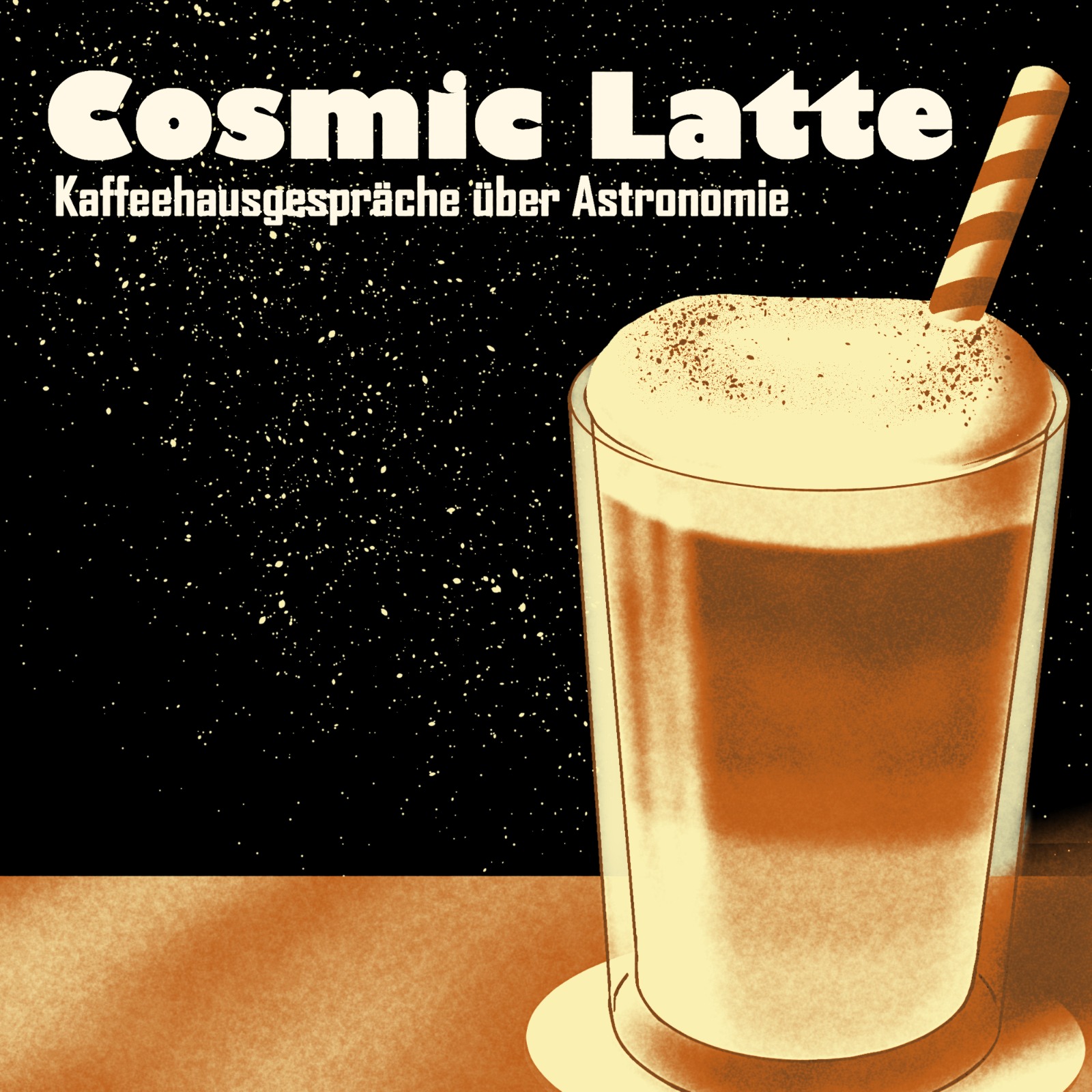
Cosmic Latte
Eva Pech, Jana Steuer, Elka Xharo
Willkommen beim Cosmic Latte Podcast!
Begleite Eva, wenn sie mit Jana und Elka bei einem Kaffeehausgespräch, über Galaxien, Sterne und die faszinierenden Wunder unseres Universums plaudert. Ihre Leidenschaft für Astronomie und Wissenschaftskommunikation verbindet die Podcasterinnen miteinander.
Eva studiert Astronomie an der Universität Wien. Sie hat einen Abschluss in Kommunikationswissenschaften und erst vor kurzem ihre Masterarbeit über Wissenschaftskommunikation geschrieben. Sie ist neben diesem Podcast auch im Podcast „Das Universum“ zu hören, wo sie über Science in Science-Fiction Filmen redet. Sie träumt davon, eines Tages ins Weltall fliegen zu können.
Elka ist zur Zeit FH-Lektorin und hat eine Ausbildung zur Medizinphysikerin abgeschlossen. Außerdem beitreibt sie als @thesciencyfeminist auf Instagram einen erfolgreichen Wissenschaftskommunikationskanal, der vor allem Frauen in der Wissenschaft sichtbar machen soll. Sie träumt davon, eines Tages Evas Weltraumflug programmieren zu dürfen.
Jana ist unser neuer Zugang bei Cosmic Latte. Sie hat nach ihrem Masterabschluss in Astrophysik nach Exoplaneten geforscht, bevor sie in die Wissenschaftskommunikation wechselte. Heute ist sie Redaktionsmitglied des YouTube-Kanals „Terra X Lesch & Co“. Neben Cosmic Latte ist sie auch in den beiden Podcasts „translunar“ und „Ein großer Schritt für die Menschheit“ zu hören.
Tauche in diesem Podcast in spannende astronomische Gespräche ein. Mach es dir gemütlich und erfahre Interessantes über die Geheimnisse des Kosmos!
Falls du Fragen hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, erreichst du uns jederzeit per E-Mail unter: kontakt@cosmiclatte.at.
Du kannst uns gerne unterstützen und zwar bei Steady (https://steadyhq.com/de/cosmiclatte/), Patreon (https://patreon.com/CosmiclattePodcast), Paypal (https://paypal.me/cosmiclattepod)!
Begleite Eva, wenn sie mit Jana und Elka bei einem Kaffeehausgespräch, über Galaxien, Sterne und die faszinierenden Wunder unseres Universums plaudert. Ihre Leidenschaft für Astronomie und Wissenschaftskommunikation verbindet die Podcasterinnen miteinander.
Eva studiert Astronomie an der Universität Wien. Sie hat einen Abschluss in Kommunikationswissenschaften und erst vor kurzem ihre Masterarbeit über Wissenschaftskommunikation geschrieben. Sie ist neben diesem Podcast auch im Podcast „Das Universum“ zu hören, wo sie über Science in Science-Fiction Filmen redet. Sie träumt davon, eines Tages ins Weltall fliegen zu können.
Elka ist zur Zeit FH-Lektorin und hat eine Ausbildung zur Medizinphysikerin abgeschlossen. Außerdem beitreibt sie als @thesciencyfeminist auf Instagram einen erfolgreichen Wissenschaftskommunikationskanal, der vor allem Frauen in der Wissenschaft sichtbar machen soll. Sie träumt davon, eines Tages Evas Weltraumflug programmieren zu dürfen.
Jana ist unser neuer Zugang bei Cosmic Latte. Sie hat nach ihrem Masterabschluss in Astrophysik nach Exoplaneten geforscht, bevor sie in die Wissenschaftskommunikation wechselte. Heute ist sie Redaktionsmitglied des YouTube-Kanals „Terra X Lesch & Co“. Neben Cosmic Latte ist sie auch in den beiden Podcasts „translunar“ und „Ein großer Schritt für die Menschheit“ zu hören.
Tauche in diesem Podcast in spannende astronomische Gespräche ein. Mach es dir gemütlich und erfahre Interessantes über die Geheimnisse des Kosmos!
Falls du Fragen hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, erreichst du uns jederzeit per E-Mail unter: kontakt@cosmiclatte.at.
Du kannst uns gerne unterstützen und zwar bei Steady (https://steadyhq.com/de/cosmiclatte/), Patreon (https://patreon.com/CosmiclattePodcast), Paypal (https://paypal.me/cosmiclattepod)!
Episodes
Mentioned books

Sep 28, 2023 • 40min
CL017 Die Voyager Mission - Part 1
Die Episode über die Voyager Sonden und ihre Erkundung der äußeren Planeten
CL017 Die Voyager Mission - Part 1: Die Erkundung der äußeren Planeten
Die Episode über die Voyager Sonden und ihre Erkundung der äußeren Planeten
Begrüßung und Einleitung
Wir starten die aktuelle Episode mit einem neuen Game von Betheseda: Starfield ist Mitte September erschienen. Angesiedelt im Jahr 2330 ist die Menschheit bereits weit jenseits des Sonnensystems gereist. Zusammen mit einer Gruppe gilt es nun 1000 Planeten nach Artefakten zu durchsuchen. Wir sind neugierig, ob es so gut ist, wie es der Trailer verspricht. Teilt uns gerne eure Erfahrungen und Eindrücke von Starfield!
In the News I: Nachweis außerirdisches Leben auf einem Exoplaneten
In den leztzten Wochen hat eine Publikation für gehörige Aufmerksamkeit in den Medien gesorgt. Bei einem 124 Lichtjahre entfernten Exoplaneten wurde ein Biomarker entdeckt, der auf außerirdische Lebensformen schließen lässt. Warum man die Sektkorken noch nicht knallen lassen sollte, es aber dennoch eine tolle Sache ist, was da passierte, erklärt Eva.
In the News II: Kohlenstoffdioxid auf Jupiter-Mond Europa nachgewiesen
Das James Webb Space Telescope sorgte noch für eine weitere Schlagzeile: auf dem Jupiter-Mond Europa wurde ein wichtiger Baustein des Lebens gefunden: Kohlenstoffdioxid.
Das ist deshalb so toll, weil der Kohlenstoff wahrscheinlich aus dem unterirdischen Ozean auf Europa kam und nicht durch externe Quellen wie Meteoriten. Dadurch könnte der Jupiter-Mond Hinweise darauf geben, habitabel zu sein.
Die Voyager Mission
Das eigentlich Thema dieser Episode, die Voyager Sonden und ihre Mission, bringt Elka mit. Sie startet das Thema mit einer Pub-Quiz-Frage: “Wie heißt der österreichische Politiker, der in diesem Audiofile Grüße an Außerirdische sendet?”.
Es ist der sehr problematische Kurt Waldheim, ehemaliger Bundespräsident von Österreich, der später durch die Aufdeckung seiner nationalsozialistischen Vergangenheit in Verruf gekommen ist. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war er UN-Generalsekretär und durfte deshalb die Grußworte auf der berühmten goldenen Schallplatte sprechen, welche die Voyager- Sonden dabei haben.
Heute sind die Voyager-Sonden die entferntesten, von Menschen gemachten Objekte im Universum. Die beiden Sonden sind baugleich, jedoch mit unterschiedlichen Flugbahnen. Voyager 1 besuchte nur Jupiter und Saturn, während Voyager 2 zusätzlich an Uranus und Neptun vorbeiflog.
Voyager 1 startete 1977 von Florida aus, 16 Tage nach Voyager 2.
Ursprünglich war ihre Mission nur auf 4 Jahre ausgelegt, mit dem Ziel die äußeren Planeten zu untersuchen. Mittlerweile läuft die Mission schon mehr als zehn mal so lang. Es bleiben wahrscheinlich noch 15-20 Jahre, bis den Sonden ihre Energie ausgeht.
Die Stationen der Voyager-Sonden
Jupiter (1979)
17.000 Bilder, zwei neu entdeckte Monde (Metis und Thebe) und ein Sensation: Der “Pizzamond” Io hat vulkanische Aktivität!
Auf dem Mond Europa vermutet man Wasser unter der Eisschicht.
Saturn (1980/81)
Zahlreiche Bilder und viele neue Monde wurden entdeckt. Vor allem der Mond Titan wird untersucht. Man wusste schon von der Methan-Atmosphäre dort und spekulierte, ob es auffgrund dessen Leben geben könnte. Durch neue Erkenntnisse (deutlich zu kalt) wurde es aber ausgeschlossen.
Uranus (1986)
Uranus war nicht sehr “fotogen”, sondern sehr homogen blau. Außerdem ereignete sich am Tag der Uranus Pressekonferenz die Challenger-Katastrophe, bei der die Raumfähre kurz nach dem Start zerbrach und alle sieben Besatzungsmitglieder ums Leben kamen. Die Tragödie stellte die Aufnahmen des Uranus in den Schatten.
Neptun (1989)
Voyager 2 ist bis heute die einzige Sonde, die jemals dem blauen Gasriesen Neptun nahe kam. Die Bilder zeigen spannende Strukturen mit Wolken und Stürmen. Außerdem: Geysire auf dem Mond Triton!
Time to say Goodbye
Als Abschiedsgruß, bevor die Sonden die äußeren Planeten verließen, richtete die Voyager ihre Kameras noch einmal zurück zur Erde und nahm ein „Familienporträt“ unseres Sonnensystems auf (alle Planeten außer Merkur und Pluto sind darauf abgebildet).
Am Valentinstag wurde von der NASA außerdem das berühmte Bild der Voyager namens “Pale Blue Dot” veröffentlicht. Es zeigt die Erde in einer Entfernung von 6 Mrd. Kilometer, kleiner als ein Pixel.
Carl Sagan sagte dazu: „Look again at that dot. That‘s here. That‘s home. That‘s us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives.“ „Diese Perspektive unterstreicht unsere Verantwortung dafür, diesen blauen Punkt zu erhalten und wertzuschätzen. Er ist das einzige Zuhause, das wir haben“
Overview – Effekt
Das Phänomen, das Raumfahrerinnen erleben, wenn sie das erste Mal die Erde aus dem All erleben, können wir gut nachvollziehen und ist als Overview Effekt bekannt.
Der Anblick scheint Einfluss auf ihre politische und gesellschaftliche Einstellungen und Werte haben. Der Autor und Philosoph Frank White beschreibt in seinem gleichnamigen Buch, dass die Raumfahrerinnen nach ihrer Rückkehr “ein tiefes Verstehen der Verbundenheit allen Lebens auf der Erde und ein neues Empfinden der Verantwortung für unsere Umwelt” verspüren.
Der syrische Astronaut Mohammed Faris meinte zum Beispiel: „Aus dem Weltall sah ich die Erde – unbeschreiblich schön, die Wunden durch nationale Grenzen verschwunden.“
Weiterführende Links
Voyager Doku von ARTE
Wo sind die Voyager Sonden? Liveticker
Der Overview Effekt inkl. schöner Animation
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen. Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Redbubble Evi
_
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Sep 14, 2023 • 56min
CL016 Analoge Missionen zum Mars
Die Episode mit Analog-Astronautin Anika Mehlis
CL016 Analoge Missionen zum Mars
Die Episode über Missionen zum Mars mit Analog-Astronautin Anika Mehlis
Ihr könnt uns gerne unterstützen und zwar bei Steady, Patreon, Paypal!
Begrüßung mit Anika Mehlis
Wir sind in dieser Folge nicht zu zweit, sondern haben einen Gast: Anika Mehlis, eine Analog-Astronautin des Österreichischen Weltraumforums mit der wir darüber reden, wie man ins Weltall reist, ohne die Erde zu verlassen.
Das Österreichische Weltraumforum
Das Österreichische Weltraumforum (ÖWF) macht nicht nur analoge Raummissionen, sondern kümmert sich auch um die Weiterbildung in Sachen Raumfahrt in Schulen, baut kleine Satelliten - zum Beispiel Adler 2 der sich um Weltraumschrott kümmern soll - und kooperiert bei diversen Missionen mit der ESA. Und vor allem führt das ÖWF analoge Missionen durch, bei der Menschen auf der Erde testen, was später im Weltraum passieren soll. Aktuell bereitet man sich dort auf Amadee-24 vor, die im Frühjahr 2024 in Armenien durchgeführt werden soll, unter dem Kommando von Anika Mehlis.
Was macht eine Analogastronautin?
Bevor man sich in die feindliche Umgebung des Weltalls begibt, sollte man sicher sein, dass alles funktioniert. Das testet man am besten auf der Erde und genau dafür gibt es Analogmissionen. Zwischen Mars und Erde brauchen Funksignale zum Beispiel um die 20 Minuten und das macht ganz andere Arbeitsabläufe notwendig die man zuerst auf der Erde ausprobiert. Bei einer typischen Analogmissionen leben sechs Menschen auf einer abgeschlossenen Basis auf der Erde, verlassen sie nur in Raumanzugssimulatoren (die aber trotzdem so viel wiegen wie ein echter Anzug auf dem Mars, nämlich circa 50 Kilogram) und macht damit diverse Experimente; genau so wie sie später im All oder auf dem Mars stattfinden sollen. Man steuert Rover und Drohnen, mach medizinische und psychologische Versuche, und so weiter.
Die Grenzen der Simulation
Wie gut kann man den Mars auf der Erde simulieren? Natürlich gibt es Grenzen, aber oft ist es schon sehr nahe an der echten Raumfahrt. Der Kontakt zur Mission Control und der eigenen Familie ist genau so eingeschränkt und verzögert, wie er es bei einer echten Mission wäre und die daraus entstehenden psychologischen Konsequenzen lassen sich sehr gut simulieren. Die Experimente die man durchführt, dienen entweder der Simulation von Experimenten die später im All durchgeführt werden beziehungsweise bereiten und unterstützen solche Experimente. Anika war zum Beispiel bei einem medizinischen Experiment involviert, das zeitgleich auch auf der ISS stattgefunden hat, weil man natürlich immer auch eine Kontrollgruppe braucht.
Wie wird man Analog-Astronautin?
Das ÖWF wird demnächst wieder eine Auswahl durchführen und da kann man sich einfach bewerben. Es gibt aber auch andere Organisationen die ähnliche Missionen veranstalten. Und es muss nicht immer die Analog-Astronautik sein. Man kann sich beim ÖWF auch anders einbringen, in der Mission Control zum Beispiel oder bei ganz vielen anderen Projekten.
Weiterführende Links
Anika Mehlis arbeitet auch als Mediatorin und Beraterin, betreibt den Podcast "Verkopft aber herzlich" und hält Vorträge. Sie hat Mikrobiologie und Ingenieurswissenschaften studiert.
Wer mehr über die Analog-Astronaut:innen des ÖWF wissen möchte, findet hier alle Infos.
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen. Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Redbubble Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Aug 31, 2023 • 33min
CL015 Die Dunkle Energie im Universum
Die Episode über die Dunkle Energie
CL015 - Die Dunkle Energie im Universum
Die Episode über die Dunkle Energie
Die Episode über die Dunkle Energie oder warum sich das Universum immer schneller ausdehnt. Und es gibt Neuerungen bei Cosmic Latte! Unser Podcast erscheint ab nun alle zwei Wochen.
Und: Ihr könnt uns gerne unterstützen und zwar bei Steady, Patreon, Paypal!
Einleitung
Nachdem wir beide nicht die Perseiden im August beobachtet haben, widmen wir uns gleich dem ersten Thema. Es gibt nämlich ein Update zu Cosmic Latte: in einem Paper geht der argentinische Astronom Guillermo Abramson nämlich der Frage nach, welche Farbe die Milchstrasse hat. Dafür verwendet er die Daten von über zwei Millionen Sternen aus dem Gaia Katalog. Sein Ergebnis vergleicht er dann mit der Studie der John Hopkins Universität, die vor zwanzig Jahren die Farbe des Universums feststellten: Cosmic Latte - und wir erinnern uns dabei an die erste Episode von Cosmic Latte.
Das Paper könnt ihr hier nachlesen.
Euclid und das Dunkle Universum - Teil 2
Die ESA Mission Euclid ist im Juli gestarte und hat bereits das erste Bild geliefert. Nachdem Eva in Episode 13 bereits über die Mission und ihre Ziele, im besonderen über die Dunkle Materie gesprochen hat, sehen wir uns dieses Mal den zweiten Teil des Dunklen Universums an: die Dunkle Energie!
Die Entdeckung der Dunklen Energie
Während die Dunkle Materie ganze Galaxien zusammenhält, soll die Dunkle Energie genau anders wirken und der Grund dafür sein, dass das Universum beschleunigt expandiert. Sie wirkt also gegen die Gravitation, die eine anziehende Kraft ist.
Was es genau ist, wissen wir noch immer nicht so genau, sie macht aber 68% der gesamten Energie/Materie im Universum aus.
Dass sich Galaxien immer weiter von uns entfernen beobachtete der amerikanische Astronom Edwin Hubble bereits 1929. Er hat eine Rotverschiebung des Lichts bei weit entfernten Galaxien festgestellt. Das Licht verrät nämlich, ob sich ein Objekt auf uns zu- oder weg bewegt; entfernt es sich von uns, ist es rotverschoben. Die Theorie dazu stellte 1927 George Lemaitre, ein belgischer Kosmologe, anhand der Verteilung der Galaxien und ihrer Rotverschiebung auf.
Aufgrund der Entdeckung der Expansion schloss man, dass das Universum seine Existenz vor 13,8 Mrd Jahren mit dem Urknall begann. Sehr lange hielt sich daher die Vorstellung, dass die Expansion durch die Gravitation gebremst wird, sich also mit der Zeit verlangsamt.
Damals spielte die Dunkle Energie aber noch keine Rolle. Diese wurde erst in den späten 1990er-Jahren entdeckt: 1998 wollten zwei voneinander unabhängige Forscherteams herausfinden, wie die Anziehung zwischen den Galaxien die Expansion bremst, und die Verlangsamung bestimmen.
Die Teams entdeckten nun das Gegenteil von dem was sie erwartet hatten: das Universum die Expansion wird nicht langsamer, sondern sie beschleunigt sich.
Doch was treibt diese Beschleunigung an? So kam die Dunkle Energie ins Spiel, mit der dieser Effekt bezeichnet wurde.
Dabei steht Dunkle Energie jetzt mal als Name für eine Energieform im Universum; die weder baryonischer Natur ist, noch mit der Dunklen Materie identifiziert werden kann.
Als nächstes wurde die Beschleunigungsrate bestimmt, die so genannte Hubble Konstante, welche die Expansions-Rate des Universums angibt. Bei den Messungen tauchten jedoch die ersten Probleme auf: denn je nach Methode bzw. Instrument fiel bzw. fällt die Hubble Konstante unterschiedlich aus und schwankt zwischen den Werten 69,7 km/sMpc und 74,2 km/sMpc. (1 Megaparsec (Mpc) = 3,26 Mio Lichtjahre / Entfernungseinheit in der Kosmologie)
Erklärungsmodelle für die Dunkle Energie
Mittlerweile gibt es einige Theorien bzw. (Erklärungs-)modelle zur Dunklen Energie, die versuchen die Beschleunigung zu erklären.
Die kosmologische Konstante:
Das ist wahrscheinlich das bekannteste Modell, weil es auf Albert Einstein zurück geht. Sie taucht das erste Mal in seinen Gleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie im Jahr 1915 auf. Damals wusste man aber noch nichts von der Ausdehnung des Universums, man hielt es für statisch. Damit das Universum aber statisch ist und es auch bleibt, brauchte es einen Effekt bzw. einer Kraft, die der anziehenden Kraft der Materie entgegenwirkt (die kosmologische Konstante). Einstein verwarf seine Idee der kosmologischen Konstante allerdings wieder, als die Expansion des Universums entdeckt wurde. Allerdings lag er aber nicht ganz daneben damit, denn als man entdeckte, dass sich das Universum sogar beschleunigt ausdehnt, holte man die kosmologische Konstante wieder hervor um den konstant wirkenden Beschleunigungsfaktor in den Modellen abbilden zu können. Es könnte sich dabei um eine Eigenschaft des Raumes selbst handeln, und je mehr Raum entsteht, desto mehr nimmt auch die Beschleunigung zu. Das Problem hier ist allerdings, dass die Berechnungen der Quantentheorie mit den Beobachtungen der Astophysik um 120 Größenordnungen auseinander gehen.
Die Quintessenz:
Der, auf den ersten Blick etwas esoterisch anmutende, Begriff geht auf die antike Naturphilosophie zurück, in der es neben den Elementen Erde, Wasser, Feuer, Luft die Qintessenz als fünftes Element gab. Sie soll wie eine unsichtbare Form den leeren Raum füllen und abstoßend wirken.
Der Unterschied zur Kosmologischen Konstante ist, dass sie dynamisch ist und seit dem Urknall einer zeitlichen Veränderung unterliegen könnte.
Die Phantom Energie:
Bei allen Modellen wird von Quantenfeldern ausgegangen, von denen man aber die Eigenschaften nicht genau kennt. Und genau hier unterscheiden sich die Modelle voneinander; so soll die Phantom Energie (eine Variation der Quintessenz) nicht nur dynamisch sein, sondern mit der Zeit auch stärker werden. Die Beschleunigung ist also nicht konstant sondern wird immer schneller.
Das Problem bei all diesen Modellen ist, dass sie leicht mit dem gängigen Weltmodel der Kosmologie kollidieren und in Konflikt mit Phänomenen der Astrophysik treten, die eigentlich als etabliert gelten.
Vielleicht braucht es aber auch eine neue Theorie der Gravitation weil unser Verständnis von Raumzeit und Gravitation nicht ganz stimmt.
Eventuell könnte aber auch unsere komplette Vorstellung über des Universums auf den Kopf gestellt werden, denn vielleicht haben wir etwas Grundlegendes nicht verstanden oder übersehen.
Hier hofft die Forschung nun, dass wir mit dem James Webb Space Telescope, Euclid und anderen Teleskopen bald Hinweise bekommen, die uns in die richtige Richtung treiben um dieses große Mysterium zu lüften.
Neuerungen bei Cosmic Latte
Zu guter Letzt gibt es auch Neuerungen bei uns im Cosmic Latte Universum: der Podcast wird ab September 14-tägig erscheinen. Aus diesem Anlass haben wir uns dazu entschlossen, dass ihr, unsere Hörerschaft, uns via Steady, Patreon, Paypal unterstützen könnt. Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Weiterführende Links:
Wer nun Lust auf noch mehr Dunkle Energie bekommen hat, dem sei das Special von Spektrum zum Thema ans Herz gelegt: Spektrum Special Dunkle Energie
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Redbubble Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Jul 27, 2023 • 43min
CL014 - Der Urknall und die ersten Sekunden unseres Universums
Die Episode über den Urknall und die Entstehung der Materie
CL014 - Der Urknall und die ersten Sekunden unseres Universums
Die Episode über den Urknall und die Entstehung der Materie
Einleitung
Der Sommer beginnt heiß!
Eva empfiehlt zur Abkühlung einen Besuch im Kino um sich den aktuellen Film von Wes Anderson, "Asteroid City" anzusehen.
Der Juli war ein aufregender Monat für die Astronomie und die Raumfahrt. Gleich zu Beginn, am 01. Juli startete die ESA Euclid Mission von den USA aus ihre Reise. Beinah zeitgleich ließ eine Veröffentlichung die sozialen Netzwerke die Wissenschaftsblase heiß laufen: es wurden Hinweise auf gigantische Gravitationswellen mit Wellenlängen von 10 Lichtjahren entdeckt. Dabei könnte es sich um den Gravitationswellenhintergrund handeln, ein kosmisches Hintergrundrauschen aus der aktiven Frühzeit des Universums!
Es geht heiß weiter: Elka erzählt uns dieses Mal von der Entstehung des Universums und was in der ersten Sekunde nach dem Urknall alles passiert ist - und das ist eine ganze Menge!
Der Urknall
Die Entstehung des Universums ist wohl eines der faszinierendsten Kapitel der Astronomie. Da sich alles in sehr sehr kleinen Maßstäben abspielt, wird bei diesem Thema die Verbindung zwischen Astronomie und Physik (Elkas Background) besonders deutlich.
Doch zuerst zu der offensichtlichsten aller Fragen: "Was war vor dem Urknall?" Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. Die Standard-Antwort von Astrophysiker*innen lautet: "Raum und Zeit entstand erst durch den Urknall. Ein zeitliches DAVOR kann es also nicht gegeben haben". Man kann es sich vielleicht mit der Metapher vorstellen: "Was ist 1m nördlich vom Nordpol?" Nördlicher als der Nordpol geht nicht.
Georges Lemaitres Urknalltheorie
Der Astrophysiker und katholische Priester Lemaitre war in den 1920er Jahren der Erste, der die These vom Anfang des Universums aufgestellt hat, da er durch Rotverschiebung beobachtet hat, dass die Galaxien sich von uns wegbewegen, also das Universum expandiert. Seine Theorie wurde von den Kritikern zunächst spöttisch als "Big Bang" bezeichnet. Auch Einstein war zunächst dagegen, da es zu sehr nach göttlicher Schöpfung klang.
Kurz vor seinem Tod erfuhr Lemaitre noch von der Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung, die seine Theorie erhärtete.
Die Planck-Ära
Am Beginn waren der ganze Raum und die ganze Materie in einem Volumen, das nur 1-Billionstel eines Punktes groß war. Dieses Pünktchen konnte nur expandieren. Hier beginnt eine sehr komplizierte Zeit, für die wir noch keine Berechnungsmodelle haben– die Planck Ära, 10^-43 Sekunden nach dem Urknall .
In der Planck Ära war alles so heiß, dass es nur eine Urkraft gegeben hat. Die 4 fundamentalen Kräfte waren ununterscheidbar (Gravitation, elektromagnetisch, starke/schwache Wechselwirkung). Wir haben bis heute keine Theorie gefunden, die diese Zeit erfassen kann. Es gibt aber Bestreben die Theorie des Kleinen (Quantenphysik) und des Großen (Gravitation) zu vereinen (theory of everything), z.b. mit der Stringtheorie.
1 Billionstel Sekunde nach dem Urknall
Das Universum ist eine Suppe aus Quarks, Leptonen und Bosonen, also subatomare Teilchen. In der Quark-Leptonen Ära waren Materie und Antimaterie fast im Gleichgewicht, aber nur fast. 1 Milliarde zu 1 Millarde und 1.
1 Millionstel Sekunde nach dem Urknall
Die Suppe ist nicht mehr ganz so heiß. Die Quarks schnappen sich Tanzpartnerinnen und es entstehen schwere Partikel – die Hadronen. Die bekanntesten: die im Atomkern, also Neutronen und Protonen.
Das minimale Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie in der Quark-Leptonen Suppe wurde jetzt an die Hadronen weitergegeben. Mit außergewöhnlichen Konsequenzen: Da das Universum nicht mehr heiß genug ist, um neue Quarks zu bilden. Fast alle Hadronen und Antihadronen annihilieren zu Strahlung, aber jedes Milliardste Hadron blieb alleine. Dieses einsame Hadron bildete die Basis zur Entstehung von Sternen, Planeten, Galaxien, Blumen und Menschen. Bei völligem Gleichgewicht wäre alles annihiliert und im Universum nur Strahlung.
1 Sekunde nach dem Urknall
Das Universum ist schon einige Lichtjahre groß.
Mit 1 Milliarde Grad ist es zumindest noch heiß genug um Elektronen zu kochen. Diese poppen auf und verschwinden wieder mit ihrem Counterpart. Es passiert das gleiche wie mit den Hadronen, nur 1 in 1 Milliarden Elektronen bleibt über.
Jetzt entstehen Atomkerne! Protonen verbinden sich mit Neutronen. Das ist die erste Phase der Nukleosynthese.
Was danach geschah
Jetzt kommt eine sehr lange und langweilige Phase. 2 Minuten nach dem Urknall bis 380.000 Jahre danach passiert nichts bedeutendes in unserer Teilchensuppe. Es ist heiß genug dass die Elektronen herumschwirren. Erst nach 380.000 Jahren kommt dieses Rumschwirren zu einem Ende, als die Temperatur auf unter 3000 Grad Kelvin fällt (halb so heiss wie die Sonne). Die Elektronen verbinden sich jetzt mit den Atomkernen. Jetzt können auch Photonen in der "Nebelsuppe" endlich frei herumschwirren. Es wurde Licht im bis dahin dunklen Universum! Heute ist dieses erste Licht als kosmische Hintergrundstrahlung zu sehen.
Milliarden Jahre nach dem Urknall beginnt die 2.Phase der Nukleosynthese: In den ersten Sternen verschmelzen Atomkerne und schwerere Elemente wie Kohlenstoff (wichtig für Leben!) oder Eisen werden gebildet. Durch Explosionen gelangen sie überall hin im Universum. "Wir sind aus Sternenstaub" ist also nicht nur romantisch sondern auch wissenschaftlich korrekt!
Cosmic Latte mit Schuss
Wir haben Post bekommen! Karin, eine fleißige Hörerin seit der ersten Stunde und Christoph haben uns geschrieben. Die beiden betreiben das Café Sitzwohl in Seeboden am Millstätter See und weil Karin unseren Podcast so gerne hört kann man dort einen Cosmic Latte bestellen und bekommt einen Latte Macchiato mit Haselnusslikör serviert!
Zum Schluß macht Eva noch auf die Ignoranz der Medien gegenüber independent Podcasts aufmerksam. Ein Artikel mit Podcast-Empfehlungen in einer Fernsehzeitschrift hat leider wieder mal gezeigt, dass independent oder kleinere Podcasts schlichtweg nicht wahr genommen werden. Daher unser Aufruf: wenn ihr uns oder andere kleine Produktionen gerne hört, die nicht von Medien finanziert werden, spread the word! Erzählt euren Eltern, Freunden, Kindern, Nachbarn und Arbeitskolleginnen davon!
Weiterführende Links
Zeitstrahl des Universums
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Elka|
Redbubble Evi|
Instagram Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Jun 29, 2023 • 26min
CL013 - Die Entdeckung der dunklen Materie
Die Episode über Euclid, Vera Rubin und die Entdeckung der Dunklen Materie
CL013 - Die Entdeckung der dunklen Materie und Euclid
Die Episode über Dunkle Materie, Vera Rubin und Euclid
Einleitung
Wir beginnen die Episode damit, dass wir feststellen, dass wir beim letzten Mal vergessen haben über Elkas Job beim Planetarium Wien zu sprechen, was wir sogleich nachholen.
Eines des Hauptthemen dieser Episode ist aber der Start der aktuellen ESA Mission Euclid und das Dunkle Universum.
Euclid
Am 1. Juli soll Euclid mit einer Falcon-9 Rakete von SpaceX von Florida (USA) aus starten. Ihr Ziel ist der 1,5 Mio. km entfernte Erde-Sonne Lagrange Punkt 2 - ein ganz besonderer Ort im Weltraum, denn dort heben sich die Gravitationskräfte zwischen Erde und Sonne auf. Es ist daher ein beliebter "Parkplatz" für Weltraum-Instrumente, da sie sich hier fast ohne Antrieb in einem Orbit um die Sonne bewegen. Das James Webb Space Telescope etwa befindet sich bereits dort. Wer es genauer wissen möchte, findet hier ein gutes Video dazu von Space Night Science in der ARD Mediathek.
Ist Euclid erst mal angekommen, wird es sich mit dem Dunklen Universum beschäftigen.
Mit seinen beiden Instrumenten wird es im sichtbaren und im Nah-Infrarot Bereich Beobachtungen durchführen. Das Ziel ist die Erstellung der größten und genauesten 3D-Karte des Universums. Dabei wird es Milliarden von Galaxien in einer Entfernung von bis zu 10 Milliarden Lichtjahren durchmustern. Anhand dieser Karte soll erforscht werden, wie sich das Universum ausgedehnt und wie sich großräumige Strukturen im Laufe der kosmischen Geschichte entwickelt haben.
Dabei soll zwei Komponenten besondere Aufmerksamkeit entgegen gebracht werden, über die wir generell noch wenig wissen und die Kosmologie immer noch vor große Fragen stellt.
Dunkle Energie und Dunkle Materie
Das Dunkle Universum macht stattliche 95% des Universums aus, nur 5% sind sichtbare Materie, die wir kennen - das ist all das Material aus dem die Sterne, Planeten und wir Menschen bestehen. Der Rest teilt sich auf in Dunkler Energie (72%) und Dunkler Materie (23%).
Sie beeinflussen die Bewegung und Verteilung der sichtbaren Quellen (was wir eindeutig beobachten können), aber sie emittieren oder absorbieren kein Licht (weswegen wir sie nicht beobachten können), und die Wissenschaft weiß daher noch nicht, was sie sind und woraus sie genau bestehen. Ihre Natur und ihre Eigenschaften zu verstehen sind daher eine der größten Herausforderungen der Kosmologie.
Dunkle Energie und Dunkle Materie sind dabei etwas von Grund auf Verschiedenes. Denn während die Dunkle Energie die Beschleunigung des Universums voranrtreibt, ist es die Dunkle Materie die Galaxien und Galaxienhaufen zusammenhält. Sie wirken also auf ganz unterschiedlichen Ebenen.
Die Geschichte der Dunklen Materie
Hinweise zur Dunklen Materie gab es bereits relativ früh- bis man ihr auf die Schliche gekommen ist, dauerte es aber, wie so oft in der Geschichte, dann doch wieder etwas länger, in diesem Fall gut vierzig Jahre.
Begonnen hat alles in den 1930er Jahren und dem schweizer Astronom Fritz Zwicky, der die Geschwindigkeit von Galaxien im Coma Haufen (der aus 1000 Galaxien besteht) gemessen hat.
So wie Planeten in einem Sonnensystem, sind auch Galaxien in einem Galaxienhaufen gravitativ aneinander gebunden. Wäre es nicht so, dann gäbe es keinen Haufen, keine Galaxie und kein Sonnensystem. Wenn die Gravitationskraft der Sonne die Planeten nicht festhalten würde, dann würden sie ins All entkommen. Die Gravitationskraft steht dabei in direktem Zusammenhang mit der Masse, desto mehr Masse desto stärker ist auch die Gravitationskraft. Würde man zum Beispiel die Masse der Sonne halbieren, dann wäre auch die Kraft, die sie auf die Planeten ausübt, nur noch halb so stark.
Misst man nun die Geschwindigkeit, mit der sich die Planeten um die Sonne bewegen, dann kann daraus ihre Mindestmasse berechnet werden und die Masse, die notwendig ist, um die Planeten am Verlassen des Sonnensystems zu hindern.
Zwickys Berechnungen ergaben nun, dass sich die Galaxien zu schnell bewegten, sie die Fluchtgeschwindigkeit überschritten und sich der Haufen eigentlich auflösen müsste. Da er aber offensichtlich vorhanden war, die sichtbare (also leuchtende) Masse aber um das 400-fache zuwenig war, schloss er, dass es eine, für ihn aktuell nicht sichtbare Materie geben musste, die auf den Haufen wirkte. Er gab ihr den Namen "Dunkle Materie".
Vera Rubin macht Dunkle Materie populär
Das ganze geriet jedoch in Vergessenheit - bis 1970. In diesem Jahr veröffentliche die amerikanische Astronomin Vera Rubin ihre Arbeit, in der sie die Rotationsgeschwindigkeit der Andromeda Galaxie untersucht hatte (“Rotation of the Andromeda Nebula from a Spectroscopic Survey of Emission Regions").
Ähnlich wie bei Zwicky, ergaben nun die Messungen von Rubin, dass sich die Sterne am äußeren Rand der Galaxie zu schnell bewegten. Entgegen den Erwartungen, nahm die Geschwindigkeit der Stern mit zunehmenden Abstand nicht ab. Wir kennen das in unserem Sonnensystem. Je näher ein Planet seinem Stern ist, desto schneller bewegt er sich: Merkur benötigt für eine Umrundung umn die Sonne 88 Tage, die Erde 365 Tage und bei Neptun sind es 165 Jahre.
Das folgt direkt aus dem Newtonschen Gravitationsgesetz bzw. Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie. Je weiter man sich von einem schweren Objekt entfernt, desto geringer ist der Einfluss seiner Gravitationskraft. In einer Galaxie sollte es eigentlich so ähnlich sein. Je weiter entfernt sich ein Stern vom Zentrum befindet, desto schwächer spürt er den Einfluss der Gravitationskraft und desto langsamer sollte er sich bewegen.
In dem Diagramm aus ihrer Arbeit, ist aber deutlich zu sehen, dass die Geschwindigkeitskurve mit zunehmender Entfernung vom Zentrum der Galaxie nicht abflacht, sondern ab einem gewissen Punkt gleichbleibend ist. Die Sterne in den äußeren Bereichen der Galaxie bewegten sich also eindeutig zu schnell.
Das lässt sich nur damit erklären, dass dort noch Materie vorhanden ist, wo die leuchtende Materie längst zu Ende ist. Die Galaxien schienen also von einer großen Wolke aus dunkler Materie umgeben zu sein. Ihr gravitativer Einfluss führte dazu, dass sich die Sterne schneller bewegten, als man erwarten würde.
Man hatte also nun bereits Daten auf zwei verschiedenen Größenskalen: und zwar die Bewegung von Galaxien in Galaxienhaufen, die Zwicky beobachtet hatte, und nun auch noch die Bewegung von Sternen in Galaxien, die von Rubin und diversen anderen Astronomen analysiert wurde. Beide zeigten, dass sich die Himmelskörper so verhielten, als gäbe es neben der normalen, sichtbaren Materie auch noch eine “dunkle Materie”, die nicht leuchtet.
Vera Rubins Arbeit hat unser Verständnis des Universums deutlich verändert. Sie konnte die Existenz eines Phänomens, das gravitativ mit Sternen und Galaxien wechselwirkt und das nicht mit der von der Gravitationstheorie vorhergesagten Bewegung übereinstimmt, klar und deutlich belegen.
Viele Forschende sind sich einig, dass Rubin für ihre Arbeit den Physik-Nobelpreis verdient hätte. Leider ist ihr dieser jedoch bis zu ihrem Lebensende im Jahr 2016 versagt geblieben.
Weiterführende Links
ESA Euclid
Überblicks-Informationen zu Euclid von der ESA
ESA Launch Kit Euclid
Serie über Dunkle Materie von Astrodicticum Simplex
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Redbubble Evi|
Instagram Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

May 25, 2023 • 59min
CL012 - Frauen in der Wissenschaft
Die Episode über Katherine Johnson, Cecilia Payne und andere versteckte Frauen in der Wissenschaft.
CL012 - Frauen in der Wissenschaft
Die Episode über Katherine Johnson, Cecilia Payne und andere versteckte Frauen in der Wissenschaft
Einleitung und Vorstellung Elka
In dieser Episode ist Elka das erste Mal mit dabei, weswegen wir sie näher kennenlernen wollen. Elka ist einigen als The Sciency Feminist auf Instagram bekannt. Sie hat zuerst medizinische Informatik studiert und dann den Master in Biomedical Engineering (Schwerpunkt “Medical Physics and Imaging”) gemacht. Aktuell schließt sie den Universitätslehrgang Medizinphysik ab und hat auch als Medizinphysikerin im Krankenhaus gearbeitet. Was macht eine Medizinphysikerin im Krankenhaus? Sie kann zb. in der Radiologie, Nuklearmedizin oder in der Strahlentherapie arbeiten, überall wo ionisierende Strahlung vorkommt (aber nicht nur dort).
Seit einem halben Jahr arbeitet Elka als FH-Lektorin und hält Vorlesungen rund um das Thema IT.
Frauen in der Informatik
Elka hat ihre Bachelorarbeit über “Frauen in der Informatik” geschrieben. Darum werfen auch wir einen Blick auf den Frauenanteil in der Informatik, der an der TU Wien, bei circa 20% war. Der geringste Anteil war in der Technischen Informatik, der höchste in Medizinische Informatik. Spannend ist, dass der Anteil an ausländischen Studierenden unter den weiblichen Studierenden der Informatik besonders hoch ist.
Frauen in der Wissenschaft
Zufälligerweise haben unsere Kollegen Reini und Nicolas vom “Methodisch inkorrekt”-Podcast in ihrer Episode "Gefühlte Kompetenz" ebenfalls über Frauen bzw. Minderheiten in der Wissenschaft gesprochen. Sie haben dann auch bemerkt, dass sie als Nicht-Betroffene einen reduzierten Einblick in das Thema haben, weswegen wir uns diesem Thema eine ganze Episode lang widmen. Elka war in ihrer Unizeit an der TU Wien auch Frauenreferentin der HTU (Hochschüler*innenschaft der TU Wien) und somit auch eine Anlaufstelle bei Vorfällen mit sexistischer Diskriminierung.
Zudem hat Elka die Initiative "Frauen in die Technik" unterstützt, die Frauen bzw. junge Mädchen in der Berufswahl beraten.
Hidden Figures und Katherine Johnson
Auch wenn es immer noch oft an weiblichen Role Models fehlt, erfahren heutzutage immer mehr Frauen, v.a. aus der jüngeren Geschichte, nun endlich die Anerkennung oder zumindest die Aufmerksamkeit, die ihnen damals oft verwehrt geblieben war.
Ein Beispiel dafür, sind die "human computers" der NASA, die komplexe mathematische Modelle und Berechnungen, etwa für die Mondflüge, aufgestellt haben. Seit dem Film "Hidden Figures" (deutsch: "Unerkannte Heldinnen") sind sie auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.
Der Film porträtiert das Leben und die Arbeit von Katherine Johnson und ihren Kolleginnen Dorothy Vaughan und Mary Jackson.
Katherine Johnson war Mathematikerin bei der NASA und eben Teil der weiblichen "colored computers". Sie arbeitete an verschiedenen Projekten, darunter an der Berechnung der Flugbahnen für die ersten bemannten Raumflüge. Besonders bekannt wurde sie durch ihre Arbeit an der Mission Mercury-Atlas 6, bei der der Astronaut John Glenn als erster Amerikaner 1962 die Erde umkreiste. Katherine Johnson spielte eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Flugbahn und der Kontrolle des Wiedereintritts in die Erdatmosphäre. Sie war auch maßgeblich an der Apollo-11-Mission beteiligt, der ersten Mondlandung im Jahr 1969. Katherine Johnsons berechnete die genaue Flugbahn der Mission, wie sie in die Umlaufbahn des Mondes kommen, wann sie starten sollen, wo der Mond ist, wo sie landen sollen. Sie entwickelte außerdem ein manuelles Navigationsschema, das sich an Fixsternen orientierte, für den Fall eines Computerausfalls. Als die Apollo 13 aufgrund der Explosion eines Treibstofftanks und der daraus resultierenden Abschaltung des Navigationscomputers unplanmäßig zur Erde zurückkehren musste, übernahm Johnson die Berechnungen für den Rückweg.
Insgesamt arbeitete sie 30 Jahre bei der NASA.
Katherine Johnson verstarb 2020 im Alter von 101 Jahren. Sie hinterließ ein beeindruckendes Erbe als Pionierin der Raumfahrt und als Inspiration für junge Frauen und Minderheiten in den MINT-Fächern. In Anerkennung ihrer Arbeit erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter die Presidential Medal of Freedom im Jahr 2015 von Barrack Obama. Außerdem ist ein NASA-Gebäude nach ihr benannt: Katherine G. Johnson Computational Research Facility.
Matilda Effekt
Frauen in der Naturwissenschaft waren lange Zeit unsichtbar. Selbst nachdem Frauen im 20.Jahrhundert endlich an die Universitäten zugelassen wurden, wurde ihre Arbeit meist nicht ernst genommen oder alleinig ihren männlichen Kollegen zugeschrieben. Die Leistungen von Forscherinnen wurden unsichtbar gemacht, indem man grundsätzlich davon ausging, dass die männlichen Kollegen die treibende Kraft der Forschungsergebnisse seien.
Einige Wissenschaftlerinnen, wie Ada Lovelace, die Erfinderin des Programmierens, griffen deshalb auf Pseudonyme zurück, um ihr Geschlecht zu verbergen. Andere forschten mit ihren Ehemännern, um ihren Ergebnissen eine gewisse Legitimation zu geben.
Es gibt viele von diesen unsichtbaren und übersehenen Matildas in der Welt der Technik und Naturwissenschaft. Der Matilda Effekt ist nach der US-amerikanischen Frauenrechtlerin Matilda Joslyn Gage benannt, die als Erste dieses Phänomen beschrieben hat.
Bekannte Beispiele sind Mileva Maric, Ada Lovelace, Lise Meitner, Marietta Blau und Rosalind Franklin, um nur einige zu nennen.
Cecilia Payne
In der Astronomie finden sich leider ebenfalls Geschichten von Frauen, die lange und hart um ihre Rechte, Anerkennung oder schlicht einer Gleichstellung gegenüber ihren männlichen Kollegen kämpfen mussten. Eine von ihnen war Cecilia Payne, eine äußerst begabte Astronomin, der mit ihrer Doktorarbeit bereits bahnbrechendes gelang. Denn in ihrer Arbeit mit dem Titel “Stellar Atmospheres, A Contribution to the Observational Study of High Temperature in the Reversing Layers of Stars”, fand sie heraus, woraus Sterne bestehen!
Zuvor war man allgemein der Meinung, dass Sterne in etwa aus dem gleichen Material bestehen müssten wie die Erde, nur eben viel heißer sind. Payne kam in ihrer Doktorarbeit nun aber zu dem Ergebnis, dass es zwei Elemente in der Sonne gibt die alle anderen komplett dominieren. Vor allem Wasserstoff gab es in der Sonne eine Million mal mehr als all die anderen Elemente und auch Helium war deutlich häufiger. Die Sonne – und auch die anderen Sterne – bestehen fast komplett aus Wasserstoff, mit ein wenig Helium und verschwindend geringen Mengen der restlichen Elemente. Ihre Erkenntnis wurde am Anfang jedoch runter gespielt und sie wurde sogar dazu gedrängt, ihre Schlußfolgerungen zurückzuziehen (was sie zwar nicht tat, aber schließlich abmilderte). Cecilia Payne machte aber dennoch Karriere als Astronomin und wurde 1956 die erste Frau, die an der Harvard Universität eine volle Professur erhielt. Später wurde sie zur Leiterin des Astronomie-Instituts befördert - ebenfalls als erste Frau in Harvard. Sie blieb bis 1966 ein aktiver Teil der Fakultät und selbst nach ihrer Pensionierung forschte und arbeitete sie bis zu ihrem Tod am 7. Dezember 1979 weiter.
Cosmic Latte Musik
Cosmic Latte hat Ben zu einem ganze Album inspiriert, was wir sehr inspirierend finden. Das Album könnt ihr euch hier hören: Starlander
Weiterführende Links
Informationen zur Initiative "Frauen in die Technik" finder ihr hier und hier.
Der Film Hidden Figures basiert auf dem Buch von Margot Lee Shetterly. Wer mehr über die Human Computers erfahren möchte, ist mit diesem Buch auf jeden Fall gut beraten.
Astrodicticum Simplex geht in seinem Blog näher auf die Spektralanalyse ein. Jene Methode, mit der es Cecilia Payne gelang, die Zusammensetzung der Sonne zu identifizieren. Wie sie das genau anstellte, könnt ihr hier lesen.
Weitere Buchempfehlungen:
Reaching for the Moon - The Autobiography of Katherine Johnson
Women in Science - Rachel Ignotofsky
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Redbubble Evi|
Instagram Evi
Instagram Elka
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Apr 27, 2023 • 48min
CL011 - JUICE: Die ESA-Mission zu den Eismonden des Jupiter
Die Episode über JUICE und die Monde des Jupiter
CL011 - Die ESA JUICE Mission zu den Jupiter Eismonden
Die Episode über Juice und die Monde des Jupiter
Einleitung
Eva war im Zuge des #socialspace Event zum Launch der aktuellen ESA Mission JUICE in Darmstadt zu Besuch beim europäischen Satelliten Kontrollzentrum ESOC. Neben einem Besuch im Experimenta, dem Science Center in Heilbronn und zahlreichen Expert:innen Talks zur Mission durfte sie dann auch bei einer Führung durch die ESA ins Kontrollzentrum. Zum Launch gab es dann auch den JUICE Cocktail. Das Rezept dazu findet ihr hier.
Die Reise zum Jupiter
Die Raumsonde JUICE wird 8 Jahre zum Jupiter unterwegs sein und bei seinen Fly-by Manövern mehrmals bei der Erde, aber auch bei der Venus vorbeikommen.
Dabei wird JUICE 2024 bei seinem Mond-Erde Vorbeiflug die Umgebung des Mondes im Magnetfeld der Erde untersuchen - dies findet das erste Mal in dieser Konstellation statt. Der Start war gar nicht so einfach, es gab ein Startfenster von nur einer Sekunde, was nötig war, um den ersten Fly-By an der Erde im Jahr 2024 zu erreichen. Dann können auch das erste Mal Messungen beim Mond durchgeführt werden, wenn er vom Magnetfeld der Erde beeinflusst ist. Die ersten Ergebnisse werden bereits in einigen Wochen vorliegen.
Mit dabei beim Start war übrigens auch ein Faultier.
Das Zielobjekt: Jupiter und seine Eismonde
JUICE steht für "JUpiter ICy Moons Explorer" und genau das ist auch sein Ziel: Die eisigen Mondes Jupiter. 2031 wird die Mission bei Jupiter ankommen und dann bis Ende 2035 die drei Monde Ganymed, Kallisto und Europa erforschen. Es soll einerseits Jupiter selbst untersucht werden, aber vor allem der Mond Ganymed und die eventuell vorhandenen lebensfreundlichen Bedingungen, die dort oder bei den anderen Monden in den unterirdischen Ozeanen herrschen.
Die Galileischen Monde
Die vier Galileischen Monde sind Io, Europa, Ganymed und Kallisto mit Durchmessern zwischen 3.122 und 5.262 km (zum Vergleich: der Erddurchmesser beträgt 12.740 km, der Monddurchmesser 3.475km und der des Merkur 4.880km). Sie wurden 1610 unabhängig voneinander durch Galileo Galilei und Simon Marius entdeckt. Es sind die größten Monde des Jupiter und Ganymed ist zudem der größte Mond des Sonnensystems.
Io ist dem Jupiter von den vier am nächsten und zeigt enorme vulkanische Aktivitäten, wird regelrecht durchgeknetet durch die starken Gezeitenkräfte. Er ist kein Eismond und das Magnetfeld des Jupiters ist auch zu stark als dass JUICE dort sinnvoll forschen könnte.
Bei Europa wird es zwei Vorbeiflüge von Juice geben mit einer Annäherung von bis zu 400km. Er hat eine junge und aktive Oberfläche mit Geysiren und Schwaden (Plumes) von denen Wasserdampf ins All abgelassen wird. Dies wird zumindest vermutet, aber JUICE kann das hoffentlich bestätigen und messen, was das für Partikel sind und woraus die Ozeane bestehen aus denen sie kommen. Im Interview erzählt Mika Holmberg von dieser Forschung.
Kallisto hat eine der ältesten Oberflächen des Sonnensystems mit vielen Einschlagskratern. Die Untersuchungen von JUICE sollen Aufschluss über die Vergangenheit des Sonnensystems geben.
Ganymed ist das Hauptziel der Mission. Dieser Himmelskörper hat nicht nur unterirdische Ozeane sondern auch ein starkes Magnetfeld. Das haben von den Gesteinsobjekten sonst nur noch die Erde und Merkur. Die Vermessung der Ozeane ist schwierig, wie Alexander Stark im Interview erklärt. Er arbeitet am GALA-Instrument, mit dem die Verformung der Oberfläche durch die Gezeiten gemessen werden kann.
Die Forscher:innen gehen davon aus, dass es auf Ganymed eine Gezeitenerwärmung gibt, wenn auch in einem viel geringeren Ausmaß als auf Io und Europa. Diese Wärme könnte tektonische Aktivitäten auslösen und eine der Voraussetzungen für die Entstehung von Leben schaffen: eine Energiequelle.
JUICE wird außerdem die Wechselwirkungen im Detail untersuchen und wie sich etwa Polarlichter auf dem Mond entwickeln.
Ozeane unter der Oberfläche
Aufgrund von Messungen des Magnetfelds von Ganymed deutet alles daraufhin, dass es eine unterirdische Schicht aus Salzwasser geben könnte. Auch neuere Beobachtungen von Ganymeds Polarlichtern geben Hinweise auf die Existenz eines Ozeans unter dem Eis, der möglicherweise mehr Wasser enthält als alles Oberflächenwasser der Erde zusammen.
Janus und die Einschlagskrater
JUICE wird eine hochauflösende Kartierung der Oberfläche der Monde durchführen, vor allem mit dem JANUS-Experiment, von dessen Arbeit Elena Martellato erzählt. Mit diesen Daten kann man das Alter der Oberfläche bestimmen, ihre chemische Zusammensetzung und auch nach möglichen Landeplätzen für die Zukunft nachsehen.
Lebt da was in den Eismonden?
Alexander Stark hat darauf hingewiesen, dass es in den Ozeanen der Eismonde nicht nur Wasser, sondern auch Wärme und damit Energie geben kann. Also alles was man theoretisch für Leben braucht. Wir wissen, dass es auch auf der Erde unter extremen Bedingungen Leben geben kann, aber nicht wie es entstanden ist. Die Erforschung der Eismonde könnte uns dabei helfen, das herauszufinden.
Ein Abschied und eine wichtige Ankündigung!
Die Folge endet mit einem Abschied: Teresa wird Cosmic Latte verlassen und sich ihrer Masterarbeit und dem Abschluss ihres Studiums widmen. Das ist aber nicht das Ende des Podcasts; ab der nächsten Folge wird Evi gemeinsam mit Elka ("The Sciency Feminist" auf Instagram) über Astronomie plaudern.
Danksagung
Vielen Dank an Mika Homberg (Resarch Fellow at the Dublin Institue for advanced Studies, Ireland), Elena Martellato (Assoc. Scientist for Janus Camera am National Institute for Astrophysics, Italien) und Alexander Stark (Beteiligung an GALA (Ganymed Laser Altimeter), DLR Berlin, Deutschland) für ihre Audiokommentare.
Weiterführunde Infos zur Mission findet ihr auf den Websites der ESA:
Website zu JUICE
kurzes Factsheet
frühere Missionen zu Jupiter
Informationen zu den Instrumenten
Where is JUICE
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Redbubble Evi|
Instagram Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Mar 30, 2023 • 27min
CL010 - Das Schwarze Loch im Zentrum der Galaxis
Die Episode über Schwarze Löcher und Sagittarius A*
CL010 - Das Schwarze Loch im Zentrum der Galaxis
Die Episode über Schwarze Löcher und Sagittarius A* im Herzen der Milchstrasse
Einleitung
"Wozu braucht Gott ein Raumschiff?" (James T. Kirk)
Diese Frage stellte Kirk in dem Film "Star Trek V: The Final Frontier" (USA, 1989, deutsch: Am Rande des Universums). Darin flog die Enterprise ins Zentrum der Galaxis und findet dort den Gott-Planeten Shakaree.
Heute wissen wir, dass sich im Zentrum der Milchstrasse ein supermassereiches Schwarzes Loch befindet. Aber wie so oft in der Geschichte der Wissenschaft war es ein langer Weg bis dahin. Die Vermutung gab es schon früher, beweisen konnte man es erst vor kurzem. In dieser Episode wollen wir uns daher der Entdeckung Schwarzer Löcher und besonders jenem in unserer Milchstrasse widmen.
Was ist ein Schwarzes Loch?
Wortwörtlich gesprochen ist der Begriff "Schwarzes Loch" etwas irreführend, denn es ist ja kein Loch in das man hineinfallen könnte. Denn per Definition ist ein Loch ja eine offene Stelle, in der etwas fehlt, wo keine Substanz ist - und ein Schwarzes Loch ist gerade das Gegenteil davon, denn es enthält sehr viel Masse. Genau wissen wir es allerdings nicht, weil wir nicht hineinschauen können.
Gemäß seiner Definition, ist ein Schwarzes Loch ein extrem kompaktes Objekt, dessen Masse auf ein sehr kleines Volumen konzentriert ist. Deswegen erzeugt es in seiner direkten Umgebung eine so starke Gravitation, dass selbst Licht diesen Bereich nicht mehr verlassen kann, weswegen es visuell als schwarzes und undurchsichtiges Objekt erscheint bzw. nicht zu sehen ist. Diese Grenze wird Ereignishorizont genannt und ist wie eine Einbahnstrasse: Nichts kann den Ereignishorizont von innen nach außen überschreiten.
Dieser Bereich kann mit dem Schwarzschild-Radius berechnet werden. Rein rechnerisch lässt sich dieser Radius für jeden Körper bzw. jede Masse leicht feststellen und sagt uns, ab welchen Radius ein Objekt (das auf ein Kugelvolumen zusammengedrückt wird) zu einem Schwarzen Loch wird. Er lässt sich mit dieser Formel berechnen:
Die unterschiedlichen Klassen von Schwarze Löcher
Je nachdem wie Schwarze Löcher entstehen kann man sie unterschiedlich klassifizieren:
Stellare SL: Sie entstehen, wenn ein ausreichend großer Stern (mit mindestens mehr als 2,5 Sonnenmassen) am Ende seines Lebens keinen Brennstoff mehr hat und unter seiner eigenen Gravitation kollabiert. Unsere Sonne kann also kein SL werden; würde sie trotzdem eines werden, dann hätte sie einen Schwarzschildradius, also einen Ereignishorizont von nur 5 Kilometern Durchmesser.
mittelgroße SL: Sie haben circa die 100.000fache Sonnenmasse, aber genau kann man es nicht sagen, weil man sie noch nicht eindeutig nachgewiesen hat. Eventuell gibt es sie in Kugelsternhaufen, wo sie durch Sternkollisionen entstehen können.
primordiale SL: Auch diese SL hat man noch nicht nachgewiesen. Aber man vermutet seit den 1960er Jahren dass sich direkt nach dem Urknall in bestimmten Regionen des Raums so viel Masse zusammengeballt hat, dass SL entstehen können. Solche SL wären extrem klein, kleiner als Atome und hätten eine Masse die ungefähr der eines Berges entspricht.
Supermassereiche SL: Diese gigantischen Objekte haben das Millionen- bis Milliardenfache der Sonnenmasse. Man findet sie in den Zentren von Galaxien und es wird immer noch erforscht, welche Rolle sie bei der Entwicklung von Galaxien spielen. Das supermassereiche SL im Zentrum unserer Galaxie heißt "Sagittarius A* (Sgr A*)" und ist knapp 27.000 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Sein Schwarzschildradius ist so groß, dass es gerade in die Umlauf des Merkur passen würde und es hat die 4-Millionenfache Masse der Sonne. Es gibt aber auch weitaus größere SL; das massereichste, das wir kennen ist TON 618, ein Quasar der bis zu 70 Milliarden Sonnenmassen hat. Es wäre so groß, dass es im Sonnensystem bis zur Neptunbahn reichen würde.
Die Entdeckung von Sgr A*
Es hat gedauert, bis man das SL im Zentrum der Galaxis eindeutig nachweisen konnte. Der Blick ins Zentrum der Milchstraße wird durch Staub verstellt und wir können nicht direkt dorthin schauen. Dort ist auch alles voll mit Sternen - aber Radiowellen können den Staub durchdringen. Schon in den 1960er Jahren hat man vermutet, dass da ein SL ist; 1974 haben die US-Astronomen Bruce Blick und Robert Brown eine starke Radioquelle im Sternbild Schütze (lat. Sagittarius) gefunden, die ziemlich genau im Zentrum der Milchstraße lag. Sie haben sie "Sgr A*" genannt und der Name ist geblieben.
Warum Radioquelle?
SL geben keine Strahlung ab, aber in ihrer Umgebung kann es jede Menge Gas und Staub geben. Das Material kann eine Scheibe um das SL bilden und wenn das wirbelnde Zeug durch die schnelle Bewegung aufgeheizt wird, gibt es jede Menge Strahlung ab und gerade die Radiowellen kann man sehr gut beobachten. Die Menge an Strahlung ist auch ein Hinweis, dass da ein Objekt mit enormer Gravitationskraft sein muss, das das Material so enorm beschleunigen kann.
Was helfen Sternbahnen?
Später haben dann Arbeitsgruppen um Reinhard Genzel (La Silla Observatorium) und Andrea Ghez (Keck Observatorium), die Bahnen von Sternen um das Zentrum der Milchstraße beobachtet. Weiß man, wie groß die Umlaufbahn eines Sterns ist und wie lange es dauert für eine Runde, kann man daraus abschätzen, welche Masse der Stern umkreist und weiß auch, in welchem Raum diese Masse konzentriert sein muss.
Der verräterische Stern S2
Ein wichtiger Stern bei diesem Beobachtungsprogramm war ein Stern mit der Bezeichung "S2". Aus seiner Beobachtung konnte man zeigen, dass die Masse maximal eine Sphäre mit 120 AE Durchmesser einnimmt. Am schnellsten Punkt seiner Bahn bewegt sich der Stern mit 7650 km/s. Für die Autofahrer: das sind 27 540 000 km/h! Oder 2% der Lichtgeschwindigkeit! Die Erde bewegt sich nur mit 30 km/s um die Sonne.
Das erste Bild
Wir wissen also jetzt, dass da ein SL im Zentrum der Milchstraße ist. Aber erst 2019 konnt man ein Bild eines schwarzen Lochs machen, allerdings in einer anderen Galaxie (M87); in unserer Galaxis haben wir das SL im Jahr 2022 fotografiert.
Wobei natürlich nicht das SL selbst fotografiert wurde. Aber man kann die Strahlung aus der Umgebung des SL abbilden, die sehr hell ist und in der Mitte muss es einen Bereich geben, wo es dunkel ist und darin ist das SL.
Das Ziel war also die hochauflösende Beobachtung der Umgebung eines SL. Das geht nur mit Radioeteleskopen, weil die Radiostrahlung durch den Staub hindurch kann und vor allem weil man Radioteleskope als Interferometer zusammenschalten kann.
Das geht natürlich auch mit anderen Teleskopen, aber nur Radiowellen sind so langwellig, dass man das auch mit weit entfernten Teleskopen machen kann. Optische Lichtwellen zum Beispiel schwingen viel zu schnell, um die Daten speichern und später am Computer zusammenführen zu können.
Genau darum geht es bei der Interferometrie: Man nimmt zwei (oder mehr) Teleskope und tut so, als wäre es ein großes. Das ist ein wenig so, als würde man ein Loch in ein Teleskop machen; dann funktioniert es immer noch mit gleichem Auflösungsvermögen, nur die Lichtsammelfläche sinkt ein wenig. Und zwei Teleskope sind quasi ein großes Teleskop mit einem sehr großen Loch. Dann muss man die empfangenen Radiowellen "nur" mit extrem exakter Zeitinformation aufzeichnen und später am Computer alles zusammenführen und daraus ein Bild rekonstruieren.
Event Horizon Telescope
Das erste Bild eines schwarzen Lochs wurde mit dem "Event Horizon Telescope (EHT)" gemacht; ein virtuelles Teleskop von der Größe der gesamten Erde. Im April 2017 haben 8 Radioteleskope auf der ganzen Welt (u.a. auf Grönland, Antarktis, Hawaii, Europa, Süd- und N-Amerika) - zur gleichen Zeit die gleiche Gegend am Himmel beobachtet. 1024 8-Terabyte Festplatten wurden vollgeschrieben und dann hat man fünf Jahre lang an der Auswertung gearbeitet. Am Ende konnte man den Schatten des SL auf dem Bild sehen! Und ein paar Jahre später auch das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße:
Genzel und Ghez haben den Nobelpreis für den Nachweis der Existenz schwarzer Löcher bekommen und zwar im Jahr 2020. Das EHT-Projekt für das 1. Bild eines SL ist bis jetzt noch ohne Nobelpreis, aber das kann sich ändern.
weiterführende Links und Literaturempfehlungen
Video des DLR Astroseminar mit Heino Falcke über das erste Foto des Schwarzen Loches M87 sowie über Sagittarius A*
Bücher:
Boblest, S. Müller, Th., Wunner, G.: "Spezielle und allgemeine Relativitätstheorie, Springer, 2. Auflage, 2022"
Falcke, Heino: "Licht im Dunkeln: Schwarze Löcher, das Universum und wir", Klett-Cotta, 2020
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Redbubble Evi|
Instagram Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Feb 23, 2023 • 26min
CL009 - Spektrakuläre Sternenvielfalt im Hertzsprung-Russell Diagramm
Die Episode über die Klassifikation der Sternspektren und dem wichtigen Hertzsprung-Russell Diagramm
CL009 - Spektralklassen und das Hertzsprung-Russell Diagramm
Die Episode über die Klassifikation der Sternspektren und dem wichtigen Hertzsprung-Russell Diagramm
In dieser Folge reden wir über die Klassifikation von Sternen anhand ihres Spektrums, sogenannte Spektralklassen, von Leuchtkraftklassen und dem phänomenalen Hertzsprung-Russell Diagramm.
Einleitung und Begrüßung
Die Semesterferien neigen sich dem Ende zu und die beiden freuen sich schon aufs kommende Semester, wo sie wieder neue Sachen über die Astronomie lernen können.
Das Thema dieser Folge ist das Hertzsprung-Russel Diagramm, aber die HörerInnen müssen sich bis zum Ende gedulden, denn vorab werden noch die Spektral- und Leuchtraftklassen von Sternen geklärt.
Spektralklassen
Sterne werden nach ihren Spektren klassifiziert in sogenannte Spektralklassen. Die Oberflächentemperatur und chemischen Zusammensetzung eines Sternes bestimmen sein Spektrum. Das Spektrum eines heißen Sternes weist ganz andere spektrale Merkmale auf als ein kühler Stern und so wurden sie in verschiedene Klassen eingeteilt. Je nachdem welches Merkmal sie in ihrem Spektrum haben, gehören Sie zu einer anderen Spektralklasse.
Ein Spektrum ist ein Farbband, das man sich wie einen Regenbogen vorstellen kann. In dieser Folge betrachten wir nur das visuelle Spektrum, also jener Lichtanteil des elektromagnetischen Spektrums, das wir mit dem Auge auch sehen können. Durch ein Prisma kann das Licht, z.B. der Sonne, aufgespaltet werden und man sieht dann einen Regenbogen, man sieht also die einzelnen Farben separat aufgespaltet. Sieht man schwarze Linien in diesem Farbband, so sind das Absorptionslinien. Moleküle und Atome absorbieren bestimmte Energien des gesamten Energiespektrums eines Sternes, wodurch dann Lücken an bestimmten Stellen im Spektrum entstehen. Die Absorptionslinien sind an unterschiedlichen Stellen, je nachdem welche chemische Zusammensetzung und Temperatur der Stern hat.
Die Spektralklassifizierung von Sternen geht zurück ins Jahr 1813 auf Herrn Joseph von Fraunhofer. Er hat das Sonnenspektrum aufgenommen und im Spektrum dunkle Linien gesehen, konnte diese jedoch noch nicht so richtig zuordnen. Ein paar Jahrzehnte später (1859) haben dann Robert Wilhelm Bunsen und Gustav Robert Kirchhoff festgestellt, dass diese dunklen Linien im Spektrum Absorptionslinien von Elementen in der Sonne sind.
Morgan-Keenan System
Beobachtet man das Spektrum eines Sternes, so vergleicht man sein Spektrum immer zu sogenannten Standardspektren von Standardsternen. Dieses Standardsternspektrum repräsentiert die Merkmale der jeweiligen Spektralklasse sehr gut und sie wurden im Laufe der Zeit auch immer wieder erneuert und verbessert, da sich mit der Zeit auch die Instrumente und somit die Auflösung verbessert haben. Manche Standardsterne haben sich auch als nicht geeignet herausgestellt und wurden durch andere repräsentativere Sterne ersetzt.
Das Morgan-Keenan System teilt die Spektren von Standardsternen in zehn verschiedene Klassen von O-Y. Das ursprüngliche war von O-M und wurde im Laufe der Zeit noch erweitert. Dabei unterscheidet man zwischen den frühen (O-A), mittleren (F,G) und späten (K-Y) Spektralklassen. Diese zehn Klassen werden dann noch unterteilt in Unterklassen von 0-9, also zum Beispiel O3 oder K7. Mittlerweile wurden sogar noch weitere Zwischenklassen eingefügt, nämlich 0.2, 0.5 und 0.7.
Die Klassen werden vor allem durch Merkmale charakterisiert, die in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet sind.
Klasse
Charakteristik
Farbe
Temperatur [K]
typ. Masse [M_Sonne]
O
ionisiertes Helium (He II)
blau
30 000 - 50 000
>18
B
neutrales Helium (He I), Balmer- Serie, Wasserstoff
blau - weiß
10 000 - 30 000
5
A
Wasserstoff, Calcium (Ca II)
weiß (leicht bläulich)
7 500 - 10 000
>1,9
F
Calcium (Ca II), Auftreten von Metallen
weiß-gelb
6 000 - 7 500
>1,4
G
Calcium (Ca II), Eisen und andere Metalle
gelb
5 300 - 6 000
>1
K
starke Metalllinien, später Titan(IV)-oxid
orange
3 900 - 5 300
>0,7
M
Titanoxid
rot-orange
2 300 - 3 900
>0,3
Braune Zwerge
L
rot
1300 - 2300
T
rot - IR
500 - 1300
Y
IR
200 - 500
Es gibt auch noch weitere Klassen, die so genannten Kohlenstoffklassen der roten Riesen, nämlich R, N und S, aber auf die wird in der Folge nicht näher eingegangen.
Unser Heimatstern die Sonne gehört zur Spektralklasse G2.
Damit man sich das alles besser merken kann gibt es gibt es tolle Merksprüche, wie:
„Oh Be A Fine Girl/Guy Kiss Me (my Lips Tonight)“
„Offenbar Benutzen Astronomen Furchtbar Gerne Komische Merksätze“
„Ohne Bier aus’m Fass gibt’s koa Maß“
Falls Ihr eine tolle Idee für einen Merkspruch habt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr den mit uns teilt. Ihr könnt zum Beispiel auf unserer Website ein Kommentar hinterlasst, oder uns eine Nachricht auf Instagram oder Twitter schreiben.
Die Spektralklassen können dann noch mal unterteilt werden, je nachdem, ob sie irgendwelche speziellenBesonderheiten in ihrem Spektrum aufweisen. Das wird dann durch einen Suffix oder Präfix gekennzeichnet, zum Beispiel
pec (peculiar) für Besonderhieten bei Linienintensitäten (Suffix)
w (white dwarf) für Weißer Zwerg
g für giant, normaler Riese (Präfix)
sd (subdwarf) für Unterzwerg (Präfix)
d (dwarf) für Zwergstern (Präfix, aber auch Suffix)
Leuchtkraftklassen
Neben den Spektralklassen gibt es auch noch Leuchtkraftklassen. Diese werden nach römischen Buchstaben von null bis sieben in folgende Klasssen unterteilt:
0: Hyperriesen
I: Überriesen
II: helle Riesen
III: normale Riesen
IV: Unterriesen
V: Hauptreihensterne (Zwerge)
VI: Unterzwerge
VII: Weiße Zwerge
Die Sonne ist aktuell ein Hauptreihenstern der Leuchtkraftklasse V.
Hertzsprung-Russel Diagramm
Das Hertzsprung-Russel Diagramm, kurz HRD, ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt (Cite Richard Powell).
Dabei werden zwei verschiedene Größen gegeneinander dargestellt. Auf der x-Achse (horizontale Achse) wird der Spektraltyp oder die Oberflächentemperatur, auch Effektivtemperatur genannt, aufgetragen und auf der y-Achse (vertikale Achse) die absolute Helligkeit.
Es wurde von den Astronomen Einar Hertzsprung und Henry Norris Russel im Jahr 1913 entwickelt und ist aktuell ein sehr bedeutendes Werkzeug in der Astronomie.
Die sehr markante von oben links nach unten rechts verlaufende Linie ist die Hauptreihe. Links oben auf der Hauptreihe befinden sich die hellsten und lichtstärksten Sterne, die O und B Sterne, die frühen Spektraltypen, und die lichtschwachen rötlichen Sterne befinden sich ganz rechts unten. Würde man die braunen Zwerge auch noch dazu darstellen, so würden die sich ganz rechts unten nach den roten Zwergen befinden. Dazu könnt ihr euch ein erweitertes HRD auf dieser Website ansehen.
Durch die bekannte, empirisch bestimmte Masse-Leuchtkraftbeziehung (L ~ M3,5), sind die massereichsten Sterne links oben im Diagramm und die masseärmsten Sterne rechts unten.
Weiters gibt es im Diagramm auch die Riesenäste, die horizontalen Linien im HRD. Am Ende ihres Lebens, wenn die Sterne den Treibstoff (Wasserstoff) aufgebraucht haben, entwickeln sie sich von der Hauptreihe auf die Riesenäste.
Neben den Riesenästen und der Hauptreihe gibt es auch die weißen Zwerge, die sich links unten im Diagramm befinden. Sie haben hohe Oberflächentemperaturen, eine sehr geringe Leuchtkraft und einen kleinen Radius und sind das Endstadium der Entwicklung der meisten Sterne (alle Sterne unter 1,44 Sonnenmassen). Auch unsere Sonne wird einmal so enden. Weiße Zwerge sind allerdings keine Sterne mehr, da sie nicht mehr Wasserstoff zu Helium in ihrem Inneren verbrennen.
Die Gebiete auf dem Diagramm sind aufgrund der Sternentwicklung unterschiedlich dicht besetzt. Entlang der Hauptreihe befinden sich die meisten Sterne, da Sterne einen Großteil ihres Lebens dort verbringen und ihre Helligkeit wird dabei im Laufe der Zeit nur minimal größer. In der Milchstraße befinden sich 90% aller Sterne auf der Hauptreihe. Am Ende ihres Lebens, wenn ihr Treibstoff aufgebraucht ist und sie nicht mehr Wasserstoff zu Helium umwandeln, blähen sie sich auf und wandern zu den Riesenästen. Die verschiedenen Riesenäste werden nach den verschiedenen Leuchtkraftklassen klassifiziert. Die oberste horizontale Linie ist die Klasse 0, die Hyperriesen, die nächste horizontale Linie sind dann die Überriesen, die Klasse I. Darunter befindet sich die Klasse II, die hellen Riesen, danach die Klasse III, die normalen Riesen und die zum Schluss die Klasse IV, die Unterriesen. Auch unsere Sonne wird sich am Ende ihres Lebens aufblähen und einen der Riesenäste entlangwandern. Ihr Endstadium ist dann ein weißer Zwerg, der sich links unten im Diagramm befinden. Hier sei noch kurz erwähnt, dass Sterne, je nach Masse unterschiedlich enden. Nicht alle Sterne enden als weiße Zwerge, massereichere Sterne enden beispielsweise in einem Neutronenstern oder einem schwarzen Loch. Die weißen Zwerge findet man weniger häufig im HRD, da man sie sehr schwer sehen kann, da sie so leuchtschwach sind.
Dann gibt es da noch die Hertzsprung Lücke. Diese befindet sich etwas oberhalb der Hauptreihe, etwa von den Spektralklassen mittleres A bis spätes F. Die Sterne entwickeln sich dort sehr schnell und daher sind dort auch sehr wenige Sterne.
Auf der Hauptreihe sind die Sterne sehr stabil und verbringen einen Großteil ihres Lebens. Die Sonne verbringt zum Beispiel ca. 10 Milliarden Jahre dort, bevor sie sich zum Roten Riesen wird. Sie ist zurzeit ungefähr 5 Milliarden Jahre alt, hat also noch mal so lange bis sie zu einem Roten Riesen wird.
Auf der Hauptreihe ist das linke Ende die Nullalterhauptreihe, auch ZAMS (Zero Age Main Sequence) genannt. Sobald sich das Wasserstoffbrennen in ihrem Inneren entzündet, sind sie auf der Hauptreihe und man beginnt zum zählen des Sternenalters. Also hat ein Stern das Alter 0, wenn er auf der Hauptreihe ankommt und Wasserstoffbrennen in seinem Inneren entzündet. Davor entwickelt sich ein Stern jedoch auch schon, das ist aber ein anderes Thema.
Auf der Hauptreihe wird er im Laufe der Zeit etwas heller, bis er bei der Endalterhauptreihe, der TAMS (Termination Age Main Sequence) angelangt ist. Da hat ein Stern dann sein ganzes Material aufgebraucht und sie gehen über zu den Riesenästen.
Literatur
Ein Buch, das ich zum Nachlesen empfehlen kann ist zum Beispiel "Die Physik der Sterne. Aufbau, Entwicklung und Eigenschaften" von Mathias Scholz. Das wurde auch als Grundlage für diese Folge verwendet.
Allgemein ist in vielen grundlegenden Astronomiebüchern mehr Information zu den Themen dieser Folge zu finden.
Falls Ihr mehr weiterführende Literatur wollt, dann schreibt uns am besten eine Email an kontakt@cosmiclatte.at.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Redbubble Evi|
Instagram Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Jan 26, 2023 • 1h
CL008 - Asteroiden und Planetare Verteidigung
Die Episode über Asteroiden, Asteroidenabwehr und den Dinokiller
CL008 - Asteroiden und Planetare Verteidigung
Die Episode über Asteroiden, Asteroidenabwehr und den Dinokiller
Ö3 Podcast-Award
Ihr könnt den Podcast unter https://oe3.orf.at/podcastaward/ nominieren. Vielen Dank!
Einleitung
Der Besuch in der Meteoritensammlung des Naturhistorischen Museum in Wien hat Eva dazu inspirierte, sich in dieser Folge den Asteroiden zu widmen.
Da es hier einige Begrifflichkeiten gibt, die besonders im deutschsprachigen Raum herumschwirren, sehen wir uns zunächst an was was ist und warum es so heißt, wie es heißt.
Klassifikation
Die ganzen Kleinkörper sind von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) geregelt und in Klassen eingeteilt.
Asteroiden: (synonym mit Planetoiden oder Kleinplaneten)
haben eine Größe von wenigen Metern bis ca. 500km;
Es gibt drei unterschiedliche Typen:
die kohlenstoffreichen, die felsigen aus Silikatverbindungen und
jene aus Metallen.
Bei einigen hat man auch Begleiter, also Asteroidenmonde, gefunden, wie etwa der Asteroid Ida mit dem Mond Dactyl.
Asteroiden kommen zu Millionen bevorzugt zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter vor, dem Asteroidengürtel. Dort befinden sich 75% aller Kleinplaneten. Ihr mittlerer Abstand beträgt aber trotzdem mehr als 1 Million km. Eine Raumsonde kann sich also gefahrlos durchbewegen und eigentlich muss man sich schon sehr bemühen, wenn man mit einem Teil dort kollidieren möchte.
Dennoch ist die Gesamtmasse des hauptgürtels wesentlich weniger als die unseres Mondes.
Sie stammen aus der Zeit der Entstehung des Sonnensystems vor 4,6 Mrd. Jahren und haben sich seitdem kaum verändert (im Gegensatz zum Planeten wie etwa die Erde); Die Forschung kann durch sie viel über die Entstehung des Sonnensystems lernen.
Kometen:
wegen ihrem Schweif auch Schweifstern benannt, sind wohl die bekanntesten. Kennt man auch schon seit dem Altertum. Einer der bekanntesten ist der Halley’sche Komet, benannt nach seinem Entdecker.
Sie stammen aus dem äußeren Sonnensystem jenseits von Neptun, im Kuiper Gürtel oder der Oortschen Wolke. Bestehen aus kohlenstoffhaltigem Material, organischen Molekülen und silikatischen Material in Form von Staub.
Meteore und Meteoroide:
Ein Meteor ist nur die Lichterscheinung, wenn der Körper in die Erdartmosphäre eindringt; Sternschnuppen sind kleine Meteore, Feuerkugeln sind große Meteore.
Meteoroiden sind alles Materie, die die Sonne im interplanetaren Raum umkreist; Laut Definition der Internationalen Astronomischen Union (IAU) handelt es sich hierbei um interplanetare Festkörper, die deutlich größer als ein Atom und deutlich kleiner als ein Asteroid sind.
Meteorite: sind Meteoroiden, die auf die Erdoberfläche treffen. Hier unterscheidet man zwischen planetarischen M., die Fragmente aus dem Asteroidengürtel sind und ca. 50% ausmachen, anderen M. aus dem Sonnensystem (30%) und 20% machen die kometarischen M. aus, die aus der Auflösung von Kometen sind. Manchmal gibt es auch lunare M. oder Marsmeteoriten.
Bei den Meteoriten unterscheidet man auch noch nach ihren Bestandteilen:
Eisenmeteoriten und Steinmeteoriten.
Interstellare Objekte:
Im Herbst 2017 entdeckte man auf Hawaii einen Himmelskörper, der sich sehr schnell bewegte und die Entweichgeschwindigkeit für unser Sonnensystem hatte. Es war ein Besucher auf der Durchreise durch unser System. Oumuamua, wie er genannt wurde, war der erste bekannte Himmelskörper aus einem anderen System. Der Name heißt soviel wie “der Erste der uns erreicht hat” bzw. “der erste Botschafter”.
Er ist recht klein und hat nur eine Länge von ca. 250m und ist sehr lang gestreckt
Die Entdeckung kam zwar spontan aber nicht ganz unerwartet. Aus Modellrechnungen weiß man, dass auch aus unserem System immer wieder Asteroiden und Kometen geschleudert werden, warum sollte das dann also nicht auch bei anderen passieren?
NEOs/NEAs:
Für uns sind die erdbahnkreuzenden Asteroiden und die NEOs (Near Earth Objects / Asteroids) spannend. Man weiß aus Berechnungen, dass etwa ein Drittel der bekannten erdbahnkreuzenden Kleinplaneten auf die Erde stürzen wird (aller Wahrscheinlichkeit nach). Die wahrscheinlich bekannteste Begegnung ist jene mit dem Dinokiller.
Der Dinokiller
Der Geologe Walter Alvarez untersuchte zusammen mit seinem Vater Luis Alvarez in den 1970er Jahren, die so genannte Kreide-Tertiär Grenze. Das ist eine mit Iridium angereicherte Tonschicht, die vor etwa 65 Mio Jahren entstanden war. Damals musste eine enorme Menge Iridium auf die Erde gelangt sein, was nur durch einen Asteroiden mit einem Durchmesser von 10km erklärbar war. Die Auswirkungen eines Asteroiden in der Größe sind auch gewaltig: Die Folge sind neben der gewaltigen Explosion die Hitze- und Druckwelle (tötet im Umkreis von bis zu 10 000 km alles), Beim Einschlag werden Teile wieder ins All geschleudert, Teile regnen wieder hinab oder verglühen und heizen die Atmosphäre auf. Staub verteilt sich in den oberen Atmosphärenschichten, der das Licht der Sonne verdeckt.
Ein Großer Asteroideneinschlag gleicht tatsächlich einer Apokalypse und könnte also dass Massensterben vor 65 Mio Jahren verursacht haben.
Turiner Skala
Für die Gefährlichkeit von Asteroiden gibt es eigene Skalen, die ähnlich wie eine Richertskala funktionieren und eine Abschätzung geben, was ein Impact auslösen kann:
Die Bewertung kann sich dabei, je nach Datenlage, ändern und eine Entdeckung kann dann sowohl hinab- als auch hinaufgestuft werden.
Die Turiner Skala hat 10 Stufen; 10 ist am gefährlichsten mit katastrophalen globalen Klimaauswirkungen.
Der Dinokiller ist eine 10 gewesen, die meisten sind 0 und 1.
Planetary Defense
Es gibt einen Haufen Programme zur Space Situational Awareness, also zur aktuellen Weltraum-Situation. Dabei geht es darum, dass man Bescheid weiß, was so im nahem Weltraum passiert: dazu zählen neben dem Weltraumwetter, vorhandene Objekte in Erdumlaufbahnen und erdnahe Asteroiden.
Die NASA hat auch ein eigenes Planetary Defense Coordination Office. Dafür gibt es verschiedene Weltraumüberwachungssysteme, die sowohl auf Satelliten- als auch auf erdgebundene Beobachtungen basieren.
Da ist das Militär auch dabei und gibt einen Teil ihrer Daten frei, verschweigt aber naturgemäß auch viel. Neben dem US-Militär, haben auch Frankreich, Russland und China solche Programme laufen, wobei es da auch um die Katalogisierung künstlicher Objekten (Satelliten und Weltraumschrott) geht.
Zur Asteroidenabwehr hat die Europäische Weltraumorganisation (ESA) seit 2009 mit dem SSA-Programm ein eigenes Projekt in Europa laufen. Damit wollte man unabhängiger von den USA werden. Mit 2020 wurde das SSA Programm abgelöst und erweitert und läuft jetzt unter Space Safety.
Es gibt einiges auf internationaler Ebene zur Himmelsüberwachung, wie die Asteroiden-Abwehrmission AIDA (Asteroid Impact & Deflection Assessment), das NASA und ESA zusammen, aber mit unabhängigen Missionen voneinander, betreiben.
Die NASA hat mit DART (Double Asteroid Redirection Test) 2022 den Impactor erprobt und die Sonde DART auf Dimorph, dem Begleiter des Asteroiden Didymos einschlagen lassen. Didymos ist dabei nicht gefährlich für die Erde. Es ging darum, den kinematic impact zu testen, um für den Fall der Fälle besser vorbereitet zu sein. Es sollte untersucht werden, wie stark sich die Umlaufbahn von Dimorphos von Didymos durch den Einschlag der Sonde verändert. Dies konnte in der Zwischenzeit bereits bestätigt werden: die Umlaufzeit von Dimorphos wurde um 32 Minuten verkürzt - man hatte also den kleineren Asteroiden näher an Didymos herangebracht.
Wie wird man ein Planetary Defender?
Wer sich seinen Traum erfüllen und ebenfalls Planetary Defender werden möchte, kann hier den Test machen:
Become a planetary defender
Weiterführende Links
Über Oumuamua hat Florian Freistetter in seinem Blog geschrieben.
Wikpipedia-Seiten zu folgenden Themen:
Turiner Skala,
Apophis,
Planetare Verteidigung
Center for Near Earth Objects - JPL
ESA Space Safety Aida Collaboration
NASA Planetary Defense Coordination
ESA Asteroids: Assessing the risk
Buchempfehlung von Eva
The Calculating Stars: A Lady Astronaut Novel von Mary Robinette Kowal
Serien-Tipp von Eva
Akte-X, Staffel 4, Episode 8-9, Tunguska (aktuell bei mehreren Streaminganbietern erhältlich, bei Disney+ in der flatrate)
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Redbubble Evi|
Instagram Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!


