
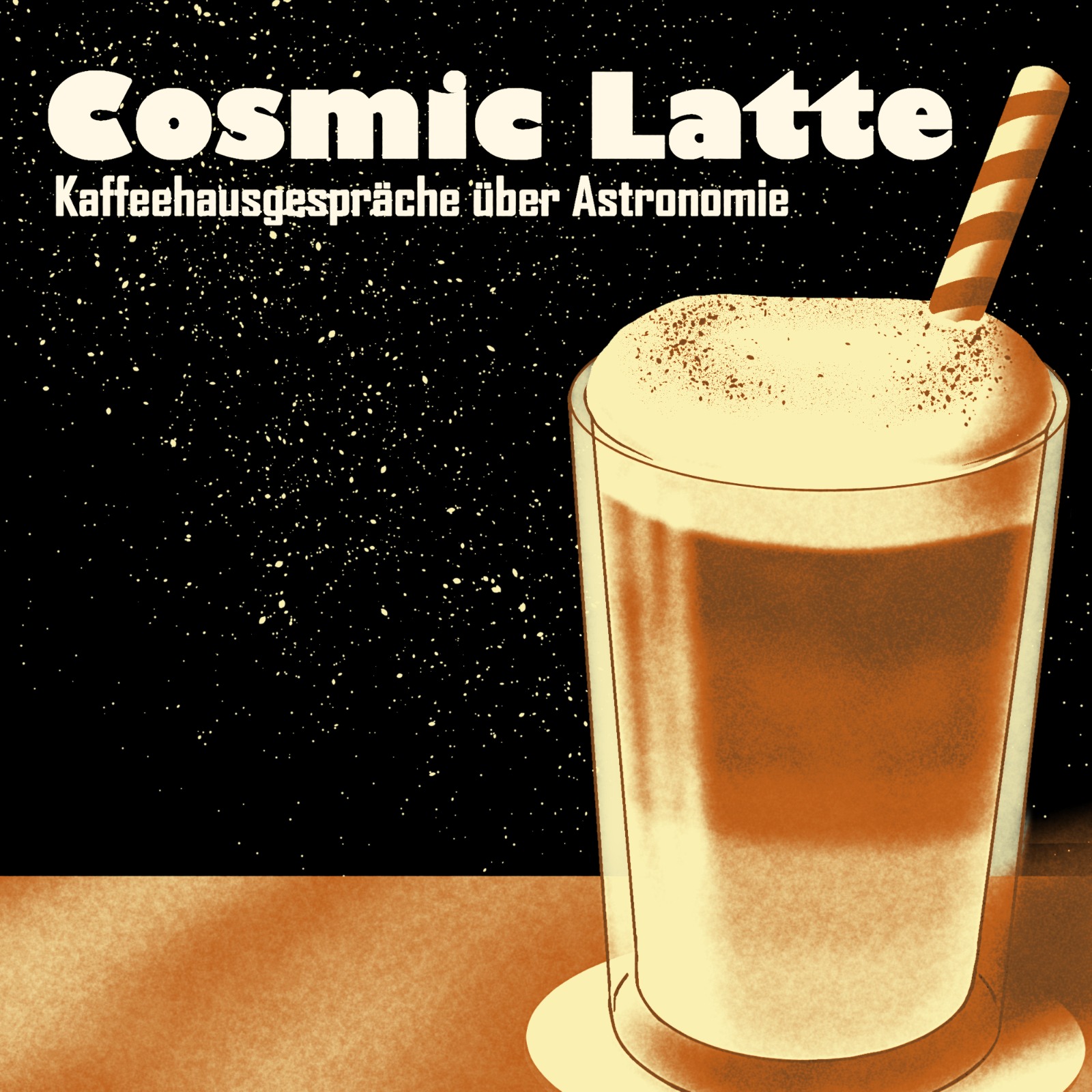
Cosmic Latte
Eva Pech, Jana Steuer, Elka Xharo
Willkommen beim Cosmic Latte Podcast!
Begleite Eva, wenn sie mit Jana und Elka bei einem Kaffeehausgespräch, über Galaxien, Sterne und die faszinierenden Wunder unseres Universums plaudert. Ihre Leidenschaft für Astronomie und Wissenschaftskommunikation verbindet die Podcasterinnen miteinander.
Eva studiert Astronomie an der Universität Wien. Sie hat einen Abschluss in Kommunikationswissenschaften und erst vor kurzem ihre Masterarbeit über Wissenschaftskommunikation geschrieben. Sie ist neben diesem Podcast auch im Podcast „Das Universum“ zu hören, wo sie über Science in Science-Fiction Filmen redet. Sie träumt davon, eines Tages ins Weltall fliegen zu können.
Elka ist zur Zeit FH-Lektorin und hat eine Ausbildung zur Medizinphysikerin abgeschlossen. Außerdem beitreibt sie als @thesciencyfeminist auf Instagram einen erfolgreichen Wissenschaftskommunikationskanal, der vor allem Frauen in der Wissenschaft sichtbar machen soll. Sie träumt davon, eines Tages Evas Weltraumflug programmieren zu dürfen.
Jana ist unser neuer Zugang bei Cosmic Latte. Sie hat nach ihrem Masterabschluss in Astrophysik nach Exoplaneten geforscht, bevor sie in die Wissenschaftskommunikation wechselte. Heute ist sie Redaktionsmitglied des YouTube-Kanals „Terra X Lesch & Co“. Neben Cosmic Latte ist sie auch in den beiden Podcasts „translunar“ und „Ein großer Schritt für die Menschheit“ zu hören.
Tauche in diesem Podcast in spannende astronomische Gespräche ein. Mach es dir gemütlich und erfahre Interessantes über die Geheimnisse des Kosmos!
Falls du Fragen hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, erreichst du uns jederzeit per E-Mail unter: kontakt@cosmiclatte.at.
Du kannst uns gerne unterstützen und zwar bei Steady (https://steadyhq.com/de/cosmiclatte/), Patreon (https://patreon.com/CosmiclattePodcast), Paypal (https://paypal.me/cosmiclattepod)!
Begleite Eva, wenn sie mit Jana und Elka bei einem Kaffeehausgespräch, über Galaxien, Sterne und die faszinierenden Wunder unseres Universums plaudert. Ihre Leidenschaft für Astronomie und Wissenschaftskommunikation verbindet die Podcasterinnen miteinander.
Eva studiert Astronomie an der Universität Wien. Sie hat einen Abschluss in Kommunikationswissenschaften und erst vor kurzem ihre Masterarbeit über Wissenschaftskommunikation geschrieben. Sie ist neben diesem Podcast auch im Podcast „Das Universum“ zu hören, wo sie über Science in Science-Fiction Filmen redet. Sie träumt davon, eines Tages ins Weltall fliegen zu können.
Elka ist zur Zeit FH-Lektorin und hat eine Ausbildung zur Medizinphysikerin abgeschlossen. Außerdem beitreibt sie als @thesciencyfeminist auf Instagram einen erfolgreichen Wissenschaftskommunikationskanal, der vor allem Frauen in der Wissenschaft sichtbar machen soll. Sie träumt davon, eines Tages Evas Weltraumflug programmieren zu dürfen.
Jana ist unser neuer Zugang bei Cosmic Latte. Sie hat nach ihrem Masterabschluss in Astrophysik nach Exoplaneten geforscht, bevor sie in die Wissenschaftskommunikation wechselte. Heute ist sie Redaktionsmitglied des YouTube-Kanals „Terra X Lesch & Co“. Neben Cosmic Latte ist sie auch in den beiden Podcasts „translunar“ und „Ein großer Schritt für die Menschheit“ zu hören.
Tauche in diesem Podcast in spannende astronomische Gespräche ein. Mach es dir gemütlich und erfahre Interessantes über die Geheimnisse des Kosmos!
Falls du Fragen hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, erreichst du uns jederzeit per E-Mail unter: kontakt@cosmiclatte.at.
Du kannst uns gerne unterstützen und zwar bei Steady (https://steadyhq.com/de/cosmiclatte/), Patreon (https://patreon.com/CosmiclattePodcast), Paypal (https://paypal.me/cosmiclattepod)!
Episodes
Mentioned books

Feb 22, 2024 • 1h 5min
CL027 Zeitmaschinenbau in Science und in Fiction
Die Episode über Zeitreisen, Schrödingers Katze und Zeitmaschinen in der Wissenschaft - mit Peter Koller
CL027 Zeitmaschinenbau in Science und in Fiction
Die Episode über Zeitreisen, Schrödingers Katze und Zeitmaschinen in der Wissenschaft - mit Gast Peter Koller
Science-Fiction Special mit Drehbuchautor Peter Koller
In dieser Episode trifft Eva den Drehbuchautor und Regisseur Peter Koller um mit ihm über Science-Fiction-Filme zu sprechen. Zusammen werfen sie einen besonderen Blick auf Zeitreisen in Filmen.
Wie wird man Drehbuchautor?
Peter hat seine Liebe zum Film und zum Genre bereits als Kind in den Star Wars Filmen entdeckt. Schnell war für ihn klar, dass er zum Film und Geschichten erzählen will.
Doch dies gelang ihm erst über einige Umwege. Nach einem erfolgreich abgebrochenen Wirtschaftsstudium, studierte Peter drei Semester lang Physik und Astronomie an der Universität Wien. Doch der Ruf des Films war größer und er beschloß die Uni wieder zu verlassen und drehte stattdessen seinen ersten Film, den Horrorfilm "Auf bösen Boden".
Peter schaffte es ohne Filmakademie und Ausbildung eine Karriere als Drehbuchautor aufzubauen - dies verlangte Ausdauer, aber er hatte auch das notwendige Quäntchen Glück.
Mittlerweile hat er sich im deutschsprachigen Raum als Drehbuchautor von Krimis etabliert und zeichnete sich zuletzt für das Drehbuch von "Der Metzger traut sich" auf Servus TV verantwortlich.
Die Liebe zum Horror und zur Science-Fiction ist ihm bis heute geblieben - auch wenn diese Genres in Deutschland und Österreich kaum vorhanden sind - von Highlights wie "Rubikon", "Welt am Draht" und "AINOA" abgesehen.
Wie schaut ein Regisseur Filme?
Peter outet sich als leicht zufriedenstellenden Zuseher im Kino. Wenn er jedoch gelangweilt und die Geschichte mies ist, schlägt der Regisseur durch, dann werden Schnitt, Kameraführung und Lichtsetzung genauestens unter die Lupe genommen.
Es ist im Übrigen nicht das Budget, das über einen guten Film entscheidet, sondern die Idee - hier können Low-Budget Filme mit großen Produktionen durchaus Schritt halten, oder sich sogar durchsetzen.
Zeitreisen im Film
"Die Zeitmaschine" von 1960 basierend auf den Roman von H.G. Wells ist DER Zeitreisefilm schlechthin und wo auch am weitesten in die Zukunft gereist wird, nämlich bis ins Jahr 802701. Der Film ist ein Beispiel für eine stringente Erzählweise. Während in neueren Zeitreisefilmen Paradoxen entstehen und ein Mindfuck den nächsten jagt, unterscheidet "Die Zeitmaschine" sich v.a. dadurch, dass der Erfinder im Film keine neuen Probleme schafft, die Vergangenheit nicht ändert, sondern nur in die Zukunft reist.
In "Twelve Monkeys" hingegen begegnen wir einem deterministischen Universum, das sich nicht ändern lässt. Im Gegensatz zu "Terminator", wo Sarah Connor ihr Schicksal in die Hand nimmt und einen freien Willen hat.
In "Back to the Future" erkennen Eva und Peter, dass Änderungen der Zeitlinie im Grunde bedeuten, dass ein Paralleluniversum entsteht.
Peter stellt zudem fest, dass Marty McFly eigentlich eine Schrödinger-Katze ist und Eva versucht den Logikfehler in Teil 2 zu erklären.
Die Wissenschaft von Zeitreisen
Zeitreisen hat immer auch schon die Wissenschaft beschäftigt. So stellte etwa Stephen Hawking die "Chronological Protection Hypothesis" auf, wodurch es eine natürliche Schranke geben soll, die Zeitreisen verhindert.
Eine Art von Zeitreisen ist auch ein bekannter Effekt aus der Relativitätstheorie, die Zeitdilatation. In der speziellen Relativitätstheorie taucht die Zeitdilatation aufgrund relativer Bewegung zu etwas auf, während in der Allgemeinen Relativitätstheorie die Zeitdilatation in einem starken Gravitationsfeld auftritt. Dieser Effekt wurde bereits bei Astronauten nachgewiesen und mit Atomuhren gemessen.
Der Film "Planet der Affen" (1968) zeigt den Effekt sehr gut. Während der 11 Monate dauernden Reise im Raumschiff bei sehr hoher Geschwindigkeit, vergehen 700 Jahre auf der Erde.
Die Theorien und Erklärungsmodelle von Zeitreisen in der Physik können dabei nur in eine Richtung gehen, nämlich in die Zukunft. Eine Reise in die Vergangenheit ist demnach nicht möglich. Eine Lösung könnten Wurmlöcher bieten. Allerdings sind diese immer noch theoretische Konstrukte und nicht nachgewiesen.
Jemand, der sich ernsthaft und schon seit Jahrzehnten mit Zeitreisen beschäftigt ist der amerikanische Physiker Ronald Mallett. Er baut bereits an einer Maschine, die die Raumzeit krümmen und so Zeitreisen auch in die Vergangenheit ermöglichen soll.
Hier sind einige Links zu Dokumentationen mit Ron Mallett:
How to build a time machine
Ron Mallett time travel documentary
Ronald Mallett im Interview in Profil
Wie viel Wissenschaft braucht ein Film?
Bei "Guilty Pleasure"-Filmen, wie "Armageddon" mit Bruce Willis drückt Peter beide Augen zu was die Wissenschaft betrifft, und lobt die Filme von James Cameron, die kompakt inszeniert und gut recherchiert sind, so dass ihnen kaum Angriffsfläche geboten wird. Eva hingegen ärgert sich über schlampig gemachte Filme, bei denen Fehler leicht zu korrigieren gewesen wären, wie in "Melancholia".
Aufrufe
Eva ist auf der Suche nach einer Anleitung für ein Zeitmaschine-Modell aus Lego bzw. Klemmbausteinen. Die verzweifelte Suche nach "Moebius" hat sich in der Zwischenzeit gelöst.
Eine (unvollständige) Liste der besprochenen Filme:
Donnie Darko
Twin Peaks: Fire walk with me
Die Zeitmaschine (1960)
Twelve Monkeys
Terminator 1 und 2
Planet der Affen (1968)
Armageddon
Melancholia
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen.
Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Redbubble Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Feb 8, 2024 • 41min
CL026 Auf der Suche nach Exoplaneten mit Jana Steuer
Die Episode über Exoplanetenforschung und Frustration im Astronomiestudium
CL026 - Auf der Suche nach Exoplaneten mit Jana Steuer
Die Episode über Exoplanetenforschung und Frustration im Astronomiestudium
Einleitung
Cosmic Latte hat Zuwachs bekommen! Die Astronomin Jana Steuer hat sich zu uns an den Kaffeetisch gesellt. Während Elka noch in Argentinien ist, erzählt Jana wie es unerwarteterweise und zur Freude ihres Vaters dazu kam, dass sie Astronomie studierte und sich den Sternen zuwandte.
Wer ist Jana?
Nach ihrem Studium verbrachte Jana zahllose Nächte am Wendelstein Observatorium und vergrub sich in den Daten von TESS um nach Exoplaneten Ausschau zu halten.
Vor ein paar Jahren schließlich hing sie ihre akademische Laufbahn an den Nagel und ist nun in der Wissensvermittlung tätig. Zuerst bei der Volkssternwarte München und jetzt als Redaktionsmitglied und Autorin beim ZDF für "Terra X". Die Faszination an der Astronomie hat sie dabei mitgenommen und macht sie in ihren Podcasts "Translunar" und "Ein großer Schritt für die Menschheit" öffentlich.
Wie man einen Exoplaneten entdeckt
In den Medien wurde wieder die Entdeckung eines Exoplaneten gefeiert. Das Besondere: HD 63433 d ist ein erdgroßer Planet, der um einen sonnen-ähnlichen Stern kreist. Allerdings ist er so nah an seinem Stern, dass er ihm immer dieselbe Seite zuwendet, was ihn zu einer regelrechten Hölle mit Lavaozeanen macht. Mit Leben ist dort nicht zu rechnen, aber vielleicht ja anderswo.
Seit Mitte der 1990er Jahre, als man den ersten Exoplaneten entdeckte, wurden bereits über 5000 detektiert.
Die meisten wurden mit der Transitmethode gefunden. Diese Methode beruht auf der Beobachtung der Helligkeitsabnahme eines Sterns, die eintritt, wenn ein Planet von der Erde aus gesehen vor seinem Stern vorbeizieht (Transit). Die Helligkeit des Sterns nimmt geringfügig ab, während der Planet den Stern teilweise verdeckt. Diese Methode ist besonders effektiv bei der Entdeckung von großen Planeten, die nahe um kleine Sterne kreisen, da diese Konstellation häufigere und deutlichere Transits erzeugt.
Eine weitere Möglichkeit zur Entdeckung ist die Messung der Radialgeschwindigkeit: Diese Technik misst die Geschwindigkeitsänderungen eines Sterns aufgrund der gravitativen Wechselwirkung mit einem umkreisenden Planeten. Wenn ein Planet einen Stern umkreist, führt die gegenseitige Anziehungskraft dazu, dass der Stern sich in einer kleinen, kreisförmigen oder elliptischen Bahn bewegt. Diese Bewegung verursacht Dopplerverschiebungen im Licht des Sterns, die mit Spektrographen gemessen werden können.
Neue Möglichkeiten mit dem JWST
Das James Webb Space Telescope (JWST) ermöglicht es nun, die Atmosphäre der fernen Planeten zu untersuchen. Ein spannender Zeitpunkt für die Forschung. Denn erstmals ist man in der Lage, Elemente wie Wasser, CO2 oder Methan nachzuweisen. Es scheint nur mehr eine Frage der Zeit zu sein, bis wir auch Bio-Signaturen entdecken. Dies wäre eine wahre Sensation, denn die könnten den Nachweis nach außerirdischen Lebens liefern. Beim Stern K2-18b soll das angeblich schon gelungen sein, aber das sehen nur die Medien so; die Wissenschaft ist noch ein wenig zurückhaltender. Aber die Chancen stehen gut, dass es in naher Zukunft bald tatsächlich gelingt.
Weiterführende Links:
Planethunters: Das aktuelle Projekt ist leider bereits abgelaufen. Aber bis es neue Daten gibt, kann man sich trotzdem die älteren Lichtkurven selbst ansehen und ein Gefühl dafür bekommen, wie Signale dort aussehen!
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen.
Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Fast Forward Science Award
Mit dieser Podcast-Folge nehmen wir beim Multimedia-Wettbewerb Fast Forward Science von Wissenschaft im Dialog in der Kategorie #AudioAward #BestesDebütAudio teil. https://fastforwardscience.de/
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Redbubble Evi |
Instagram Jana
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Jan 25, 2024 • 49min
CL025 Jocelyn Bell Burnell und die Entdeckung von Pulsaren
Die Episode über Jocelyn Bell Burnell und die Entdeckung von Pulsaren
CL025 - Jocelyn Bell Burnell und die Entdeckung von Pulsaren
Die Episode über die Astrophysikerin Jocelyn Bell Burnell und die Entdeckung von Pulsaren.
Einleitung
In Folge 25 feiern wir nicht Silberne Hochzeit, dafür aber den Sonnenzyklus 25.
Anfang 2024 erreicht die Sonne ihren Höhepunkt im aktuellen Sonnenzyklus, dem 25. seit Beginn der Aufzeichnung von Sonnenfleckenaktivitäten im Jahr 1755. Dieser Zyklus zeichnet sich durch ein Maximum an Sonnenstürmen und -flecken aus, was Ende des Jahres zu Polarlichtern auch in Deutschland und Österreich führte.
Sonnenstürme voraus!
Der Sonnenzyklus, der durchschnittlich 11 Jahre dauert, zeigt eine variable Dauer zwischen 9 und 14 Jahren. Derzeitige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es auch langfristige Variationen der Sonnenintensität über mehrere Jahrhunderte geben könnte, jedoch fehlen hierzu langfristige Aufzeichnungen zur Bestätigung.
Der aktuelle Zyklus, der 2019 begann, zeigt die typische Verschiebung der Sonnenflecken von mittleren Breiten hin zum Äquator. Diese Verschiebung ist bei starken Zyklen schneller und der Anstieg zum Maximum kürzer und steiler. Die Entdeckung dieses Musters und die Erstellung des sogenannten Schmetterlingsdiagramms, das die Verteilung und Ausdehnung der Sonnenflecken über die Zeit visualisiert, geht auf die irischen Astronomen Annie und Edward Maunder zurück, wobei Annie Maunder in der wissenschaftlichen Veröffentlichung von 1904 nicht als Autorin genannt wurde.
Neue Forschungen, wie die eines indischen Teams unter der Leitung von Priyansh Jaswal, beziehen die Entwicklung des solaren Magnetfelds mit ein, um das Maximum des Sonnenzyklus vorherzusagen. Sie analysierten Daten der letzten 50 Jahre und prognostizierten, dass das Maximum des Zyklus 25 bereits im Januar 2024 erreicht sein könnte - allerdings mit einer Spannbreite bis September. Ob sie richtig liegen, kann daher erst im Nachhinein gesagt werden.
Die Nummerierung der Sonnenzyklen, die mit Zyklus 25 fortgesetzt wird, geht auf den Schweizer Astronomen Rudolf Wolf zurück, der 1749 mit der fortlaufenden Zählung begann. Die Entdeckung der regelmäßigen Schwankungen der Sonnenfleckenaktivität wird jedoch Samuel Heinrich Schwabe zugeschrieben, der diese Periodizität in den Jahren 1826 bis 1843 beobachtete.
Jocelyn Bell Burnell
In dieser Folge geht es um eine lebende Ikone der Astrophysik - Jocelyn Bell Burnell. Sie wurde dadurch bekannt, dass sie bei ihrer Doktorarbeit als erster Mensch einen Pulsar entdeckte (den Nobelpreis bekam jedoch ihr Supervisor). Sie war außerdem Präsidentin der Royal Society of Edinburgh und wurde von der Queen geadelt. Und am wichtigsten: Sie ist eine große Advokatin und Unterstützerin von Frauen in der Wissenschaft.
Bell Burnell wurde 1943 in Nordirland geboren.
Sie studierte Physik in Glasgow, wo sie es wegen ihren sporadischen Vorkenntnissen und dem sexistischen Verhalten ihrer Kommilitonen nicht leicht hatte. Sie schaffte es jedoch und begann ein Doktoratsstudium in Radioastronomie in Cambridge.
Ihre Entdeckung
1967 forschte sie während ihres PhD mit einem riesigen Radioteleskop, das täglich 30 Meter Datenblätter ausspuckte, die Jocelyn manuell auswertete.
Ihre Aufgabe war es, Quasare zu suchen. Diese waren damals sehr rätselhaft. Man kannte nur 20 Stück, Jocelyn entdeckte weitere 120. Sie suchte dabei nach Unregelmäßigkeiten in der Strahlungsintensität, um diese Objekte aufzuspüren.
Ihr fiel jedoch eine Unregelmäßigkeit auf, ein “Pulsieren”, das immer wieder auftauchte. Sie und ihr Supervisor Antony Hewish glaubten zunächst an eine Signalstörung oder an Artefakte. Sogar außerirdisches Leben als Ursache wurde kurzzeitig diskutiert.
Obwohl ihr Supervisor dem Phänomen nicht mehr Aufmerksamkeit schenken wollte, blieb sie hartnäckig und konnte zeigen, dass etwas anderes dahinter stecken musste.
Die Daten wurden im Februar 1968 veröffentlicht, aber es war noch immer nicht klar, was es genau ist. Die Astronomen Franco Pacini und Thomas Gold konnten schließlich nachweisen, dass es sich um einen pulsierenden Neutronenstern handelt.
Pulsar - “pulsating source of radio emission”
Pulsare sind schnell rotierende Neutronensterne, die in Folge einer Supernova entstehen.
Sie sind extrem dichte Objekte. Nur schwarze Löcher haben eine noch höhere Dichte.
Wieso pulsieren sie? Wegen ihres Magnetfelds schießen Pulsare zwei entgegengesetzte Beams/Strahlen aus, so genannte Jets. Durch die Rotation wirkt es auf die Beobachterin wie ein pulsierendes Signal - wie bei einem Leuchtturm. Mittlerweile kennt man 1700 Pulsare, Bell Burnell hat die ersten 4 entdeckt. Der erste entdeckte Pulsar bekam die Bezeichnung PSR J1921+2153.
Nobelpreis
1974 bekommt ihr Supervisor Antony Hewish den Physik-Nobelpreis. Jocelyn wird nicht erwähnt.
Sie ist eine sehr diplomatische Person und weist zwar darauf hin, dass es ihre Entdeckung war, aber meint auch, dass sie deswegen nicht erzürnt ist. Sie betont, dass sie glücklich über die vielen anderen Preise ist, die es ihr ermöglicht haben, Frauen in der Wissenschaft zu fördern, wie z.B. der Breakthrough-Award mit einem Preisgeld von 2.3 Millionen Pfund (doppelt so viel wie der Nobelpreis). Dieses Geld hat sie benutzt, um einen Fonds zu stiften, der Frauen und Minderheiten in der Fakultät der Astronomie fördert.
Weiterführende Links:
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, 2023; doi: 10.1093/mnrasl/slad122: Discovery of a relation between the decay rate of the Sun’s magnetic dipole and the growth rate of the following sunspot cycle: a new precursor for solar cycle prediction
Der Tiefentakt des Universums, Jocelyn Bell Burnell wird 80, faz.net, 15.07.2023
Podcast-Folgen mit Jocelyn Bell Burnell:
Talks at Google: Jocelyn Bell Burnell: "She Discovered the Pulsar, but the Nobel Went to Her Supervisor", Zeitgeist 2019
BBC Radio 4: The Life Scientific - Dame Jocelyn Bell Burnell
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen. Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Redbubble Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Jan 11, 2024 • 42min
CL024 Beteigeuze Superstar - Über das Leben von Überriesen
Die Episode über den Überriesen Beteigeuze und die Entwicklung massereicher Sterne
CL024 Beteigeuze Superstar - Über das Leben von Überriesen
Die Episode über den Überriesen Beteigeuze und die Entwicklung massereicher Sterne
Dieser Beitrag nimmt am Wettbewerb Fast Forward Science 2024 teil. #FFSci #AudioAward
Einleitung
Wir starten das neue Jahr mit spannenden News von Enceladus.
Blausäure auf Enceladus
Auf dem sechstgrößten Mond des Saturns, Enceladus, wurden durch die Auswertung alter Cassini-Daten (Cassini-Huygens war eine Mission zweier Raumsonden zum Saturn und seine Monden von 1997 bis 2017) Blausäurespuren entdeckt. Blausäure ist zwar ein tödliches Gift, aber auch eine wichtige Vorbedingung für die Entstehung von Leben!
Enceladus ist von einem dicken Eispanzer umhüllt, unter dem man aber flüssiges Wasser vermutet. Aus dem Eispanzer schießen riesige Eisfontänen, in denen man bereits zuvor organische Moleküle gefunden hatte, ins All. Die Blausäure ist zwar noch kein Hinweis auf Leben, aber man versteht immer besser, wie sich dort komplexe Biomoleküle bilden könnten. Eva merkt an, dass die Saturnmonde heiße Kandidaten für spannende Entdeckungen sein werden!
True Crime Astronomy: Verschwundene Sterne
Es kommt immer wieder vor, dass Lichtpunkte in unserem Nachthimmel einfach verschwinden. Sie werden also beobachtet und sind dann aber nicht mehr zu finden. Das Projekt Vasco (Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations) hat sich zur Aufgabe gemacht, diese "vermissten" Sterne zu katalogisieren und zu untersuchen. Zigtausende Sterne wurden untersucht. Bei manchen waren es nur Kamerafehler, andere wurden von Molekülwolken verdeckt. Aber bei circa 100 Objekten fand man keine logische Erklärung für ihr Verschwinden. Es gibt jedoch einige Erklärungsversuche:
Sind die Sterne an ihr Lebensende gekommen? Supernovae wären jedoch zu beobachten gewesen.
Eine weitere Erklärung ist der Gravitationslinsen-Effekt, wodurch manche Objekte temporär heller erscheinen.
Oder waren es gar Außerirdische, die eine Dyson Sphäre gebaut haben?
Der britisch-US-amerikanische Physiker Freeman Dyson formulierte bereits in den 1960er Jahren die Vermutung, dass hochentwickelte Zivilisationen die Möglichkeit haben könnten, einen Stern vollständig mit einer Schalenkonstruktion (zb mit Einzelhabitaten) zu umgeben, um ihre Energiegewinnung zu optimieren, der nach ihm benannten Dyson-Sphäre. Dadurch könnte das Licht des Sterns abgeschirmt werden, wodurch er für uns "verschwindet". Diese Erklärung wird aber als unwahrscheinlich angenommen.
Beteigeuze: Ein Sternenleben
Der Stern Beteigeuze, auch bekannt als α Orionis (obwohl er der zweithellste Stern im Sternbild ist) und international als Betelgeuse, hat seinen Namen aus dem Arabischen yad al-ǧauzāʾ, was „Hand der Riesin” bedeutet. Der ursprüngliche arabische Name wurde schon im 10. Jahrhundert vom Astronomen Abd ar-Rahman as Sufi verwendet; irgendwann im Mittelalter wurde das yad als bad übersetzt zu “Bait al Dschauza”, und so wurde aus der Hand die "Achsel der Riesin".
Beteigeuze ist mit freiem Auge am Nachthimmel gut sichtbar. Er ist der rötlich leuchtende linke „Schulterstern“ im Sternbild Orion.
Obwohl er 640 Lichtjahre weit weg ist, sehen wir seine rötliche Farbe, was darauf schließen lässt, dass er “kühler” ist. Mit einer Oberflächentemperatur von 3450 Kelvin hat er nur etwa die Hälfte der Temperatur unserer Sonne.
Aber er ist erheblich heller!
Die Oberflächentemperatur bestimmt die Lichtmenge, die pro Einheitsfläche abgestrahlt wird, d.h. dass heißere Sterne mehr strahlen pro Fläche als kühlere; Für Beteigeuze bedeutet das, dass wir ihn deshalb so gut sehen weil er so groß ist.
Und er ist mit 900 Sonnenradien tatsächlich groß! Im Millimeterwellenbereich ist er 1400 mal so groß wie die Sonne. Die Sonne würde ein halbe Mrd. mal hineinpassen und würde man ihn in unser Sonnensystem an die Stelle der Sonnen setzen, würde er bis zur Jupiterbahn reichen!
Beteigeuze verändert zudem seine Helligkeit. Mit einer Periode von etwa 2070 Tagen wird er ein wenig heller und dunkler.
Astronomisch gesehen ist er ein Roter Überriese und somit schon quasi am Ende seines kurzen Lebens, und das obwohl er erst 10 Millionen Jahre alt ist.
Im Hertzsprung-Russel Diagramm (HRD) befindet sich die Überriesen rechts oben.
Das HRD ist ein grundlegendes Werkzeug in der Astronomie, das verwendet wird, um die Eigenschaften von Sternen zu klassifizieren und zu verstehen. Es zeigt die Beziehung zwischen der Leuchtkraft (oder absoluten Helligkeit) von Sternen und ihrer Oberflächentemperatur (oder Farbe). Das Diagramm hilft, die Lebenszyklen von Sternen zu verstehen. Sterne bewegen sich auf diesem Diagramm, während sie altern. Ein Stern wie unsere Sonne wird beispielsweise eines Tages die Hauptreihe (das diagonale Band in der Mitte; hier befinden sich Sterne im Gleichgewicht und verbringen und die meiste Zeit ihres Lebens) verlassen und sich zu einem Roten Riesen entwickeln, bevor sie zu einem Weißen Zwerg (unten im Bild) wird.
Beteigeuze hat die Hauptreihe bereits verlassen. Er hat seinen Vorrat an Wasserstoff aufgebraucht und fusioniert bereits Helium und Kohlenstoff. Durch diese neue Energiequelle dehnte sich Beteigeuze noch stärker aus.
Um seine Entwicklung zu verstehen, sehen wir uns die Entwicklung von massereichen Sternen an.
Denn ob ein Stern zu einem Überriesen wird hängt von seiner Masse ab: nur Sterne mit einer anfänglichen Masse, die mindestens 8-10 Mal größer ist als die Masse unserer Sonne, entwickeln sich zu Überriesen. Diese hohe Masse ermöglicht es dem Stern, nach dem Verbrauch seines Wasserstoffvorrats im Kern schwerere Elemente zu fusionieren.
Massereiche Sterne entwickeln sich in frühen Stadien noch ähnlich wie massearme Sterne aber viel schneller und ihre Kerne erreichen extrem hohe Temperaturen besonders am Ende ihrer Entwicklung. Dadurch fusionieren sie nacheinander immer schwerer Elemente bis alle Energiequellen aufgebraucht sind.
Ein Stern wird zu einem Überriesen in einer späten Phase seines Lebens, nachdem er die Hauptreihe des Hertzsprung-Russell-Diagramms verlassen hat - was Beteigeuze bereits getan hat. Er nähert sich dem Ende seines Lebenszyklus. Aufgrund des Mangels an Helium, Kohlenstoff und anderen fusionierbaren Atomen in seinem Kern wird seine Energieproduktion bald aufhören. Dies führt dazu, dass der Stern unter seiner eigenen Gravitationskraft kollabiert und eine gigantische Explosion, eine Supernova, auslöst - Orion muss dann ohne Schulter auskommen.
Im astronomischen Sinne bedeutet "bald" jedoch, dass dieses Ereignis noch einige Tausend Jahre in der Zukunft liegen könnte. Aufgrund der Entfernung von 640 Lichtjahren zu Beteigeuze könnte die Explosion allerdings auch bereits stattgefunden haben. Wenn wir es jetzt sehen würden, wäre das vor einem halben Jahrtausend passiert, so lange braucht das Licht zu uns.
Das Endschicksal von Überriesen hängt ebenfalls von ihrer Masse ab. Während die massereichsten Überriesen nach einer Supernova zu einem Neutronenstern oder einem Schwarzen Loch kollabieren, werden weniger massereiche Überriesen zu einem Weißen Zwerg, wobei ihre äußeren Schichten in den Weltraum abgestoßen werden.
Ist das Ende nah?
Im Dezember 2019 erlebte Beteigeuze eine ungewöhnliche Veränderung: Er begann, merklich dunkler zu werden. Für Astronom:innen war dies besonders interessant, da Beteigeuze zwar für seine variierende Helligkeit bekannt ist, aber eine so rasche und starke Verdunkelung bisher nicht beobachtet wurde. Dieses Phänomen gab Rätsel auf und zog die Aufmerksamkeit auf sich.
Eine umfassende Beobachtungskampagne brachte Licht in die Angelegenheit: es stellte sich heraus, dass Beteigeuze, regelmäßig große Mengen an Material aus seinen äußeren Schichten ins All schleudert - sozusagen Sternenstaub.
Dieser Sternenstaub ist allerdings von großer Bedeutung für das Universum. Er besteht aus komplexen Molekülen und chemischen Verbindungen, die von einem Stern wie Beteigeuze am Ende seines Lebenszyklus in den Weltraum geschleudert werden. Dieser Staub dient wiederum als Grundmaterial für die Bildung von Planeten und Asteroiden. Tatsächlich sind die chemischen Elemente, aus denen wir und unsere Welt bestehen, einst im Inneren von Sternen wie Beteigeuze entstanden und wurden als Sternenstaub in das All ausgestoßen.
Quellen und weiterführende Links:
Astrodicticum Simplex: Das Rätsel um die Dunkelheit von Beteigeuze ist gelöst.
Andromedagalaxie.de: Beteigeuze
Spektrum.de: Könnte der Riesenstern Beteigeuze bereits explodiert sein?
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen. Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Fast Forward Science Award
Mit dieser Podcast-Folge nehmen wir beim Multimedia-Wettbewerb Fast Forward Science von Wissenschaft im Dialog in der Kategorie #AudioAward #BestesDebütAudio teil. https://fastforwardscience.de/
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Redbubble Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Dec 21, 2023 • 58min
CL023 Cosmic Latte trifft Das Universum in einer Keksdose
Die Episode über astronomische McMoments und viele unterschiedliche Wege zur Astronomie
CL023 Cosmic Latte trifft Das Universum in der Keksdose
Die Episode über astronomische McMoments und viele unterschiedliche Wege zur Astronomie
Weihnachtsspecial: Cosmic Latte x Das Universum in einer Keksdose
Der Podcast "Das Universum in einer Keksdose" wird von Galatea, Neso und Psamathe produziert. So heißen drei Neptunmonde, so nennen sich aber die drei Hosts des Keksuniversums. Die Kombination Keks und Astronomie klingt zwar seltsam, passt aber sehr gut und vor allem sehr gut zu einem schönen Cosmic Latte. Mit Kaffee und Keksen haben wir uns über Astronomie unterhalten. Wir haben die "McMoments" identifiziert, die uns zur Astronomie gebracht haben und die haben sich als überraschend unterschiedlich herausgestellt.
Wir haben Geschichten über inspirierende Menschen erzählt, zum Beispiel Maria Mitchell, die im 19. Jahrhundert sehr viel dafür getan hat, das Frauen Naturwissenschaften studieren konnten. Oder über Henriette Leavitt, die herausgefunden hat, wie man das Universum vermisst. Oder von Lise Meitner die die Kernspaltung entdeckt, aber keinen Nobelpreis dafür bekommen hat. Oder, etwas moderner, die Astronomin Becky Smethurst mit ihren tollen YouTube-Videos, Dianna Cowern, die als Physics Girl Millionen Menschen mit Physik unterhält. Oder Conny Aerts, eine Pionierin der Asteroseismologie.
Noch mehr Inspiration kann man sich bei der Ausstellung "Forscherinnen entdecken" in der Akademie der Wissenschaften in Wien ansehen, noch bis 31. Januar 2024 (der Eintritt ist frei).
Außerdem reden wir über JUICE, die europäische Mission zu den Jupitermonden, bei deren Start Eva live dabei war und worüber sie schon in Folge 11 von "Cosmic Latte" berichtet hat. Nächstes Jahr soll sich auch die NASA-Mission "Europa Clipper" auf den Weg zum Jupiter machen. Und wir sind mit dabei! Zumindest unsere Podcastnamen, die wir live auf Sendung mit dem Projekt "Message in a Bottle" mit der Raumsonde mitschicken.
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen. Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Bei Steady kann man jetzt auch noch Mitgliedschaften verschenken, was ein deutlich besseres Weihnachtsgeschenk ist, als eine "Sterntaufe". Die kriegt man auch immer wieder angeboten - sie sind aber trotzdem Quatsch. Man kann keine Sternnamen kaufen! Der Himmel gehört niemandem.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Redbubble Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Dec 7, 2023 • 41min
CL022 Astrologie vs. Astronomie
Die Episode über Astrologie und warum Zwillinge doch nicht das schlimmste Sternzeichen ist
CL022 Astrologie vs. Astronomie - Wissenschaft gegen Sternzeichen-Mythen
Die Episode über Astrologie und warum Zwillinge doch nicht das schlimmste Sternzeichen ist
Einleitung
Es ist wieder viel passiert in der Welt der Wissenschaft und der Astronomie speziell. Da Eva aber mit ihrer Prüfung in theoretische Physik 3, Quantenmechanik beschäftigt war und sich gefragt hat, wofür sie das Alles lernen soll, hat sie sich die Bedeutung von Quanteneffekten für die Astronomie zur Lernmotivation angesehen. Denn tatsächlich spielt die Quantenmechanik eine entscheidende Rolle in der Erklärung verschiedener Phänomene in der Astronomie. Hier nur einige Beispiele.
Bedeutung von Quanteneffekten in der Astronomie
Kernfusion in Sternen: Generell erzeugen Sterne ihre Energie hauptsächlich durch Kernfusionsprozesse. Der bekannteste Prozess ist die Fusion von Wasserstoff zu Helium, das passiert etwa auch in unserer Sonne. Aufgrund der enormen elektrostatischen Abstoßung zwischen den positiv geladenen Atomkernen (Protonen) wäre die Fusion bei den Temperaturen und Drücken, die im Inneren von Sternen herrschen, eigentlich unwahrscheinlich. Hier kommt die Quantenmechanik ins Spiel. Durch den quantenmechanischen Tunneleffekt können Protonen die Energiebarriere „durchtunneln“ und fusionieren, obwohl sie nach den Gesetzen der klassischen Physik nicht genügend Energie dafür haben.
Durch diese Prozesse wird verständlich, wie Sterne über Milliarden von Jahren stabil bleiben und kontinuierlich Energie abgeben können.
Schwarze Löcher und die Ereignishorizonte: hier werden Quantenmechanische Effekte relevant, wenn man die Umgebung von Schwarzen Löchern betrachtet. Theorien wie die Hawking-Strahlung, die auf quantenmechanischen Prinzipien basiert, beschreiben, wie Schwarze Löcher unter bestimmten Umständen Energie abstrahlen können.
Quantenfluktuationen im frühen Universum: Quantenmechanische Fluktuationen in der sehr frühen Phase des Universums könnten für die Bildung der ersten Strukturen im Universum, wie Galaxien und andere großräumige Strukturen, verantwortlich sein.
Spektrallinien und Atomstruktur: Die Quantenmechanik erklärt, wie Atome Licht absorbieren und emittieren, was für die Astronomie grundlegend ist, um die chemische Zusammensetzung und physikalischen Eigenschaften von astronomischen Objekten zu bestimmen. Um die chemische Zusammensetzung von Sternen zu untersuchen nutzte Cecilia Payne-Gaposchkin die Spektroskopie und die theoretischen Rahmenbedingungen der Quantenmechanik. Sie hat dann damit gezeigt, dass Wasserstoff das bei weitem häufigste Element in Sternen ist und Helium das zweithäufigste. Dies stand im Widerspruch zur damaligen Annahme, dass Sterne eine ähnliche Zusammensetzung wie die Erde haben. Über Cecilia Payne-Gaposchkin hat Eva übrigens auch schon CL12-Frauen in der Wissenschaft erzählt.
21cm Linie (Emissionslinie von Wasserstoffatomen): Wasserstoffatome im All können durch einen so genannten “Hyperfeinstrukturübergang” Strahlung aussenden. Dem liegt ein Quantenmechanischer Prozess zugrunde, bei dem sich der Spin des Atoms ändert. D.h. wenn man Licht bei 21cm beobachtet, kann man sehen, wo im All der ganze Wasserstoff ist.
Debunking Astrology
Es ist wieder so weit. Die Zeit der Jahreshoroskope steht an. Manche sehen es als lustigen Partygag, andere finden, dass da “ja doch etwas dran sein könnte”.
Die Astrologie hat eine alte Geschichte, genau so alt wie die Geschichte der Astronomie. Zu Beginn haben sich die zwei Hand in Hand entwickelt. Bis klar wurde, dass die Astrologie genau so wissenschaftlich ist wie Kaffeesatz-Lesen.
Die Ursprünge der “Himmelskunde” liegen im Zweistromland Mesopotamien, etwa 1250 v.Chr. Die Region zeichnete sich durch vorhersehbare Wetterlagen, die je nach Jahreszeiten variierten, aus. Da die beobachteten Sternbilder am Himmel ebenfalls von den Jahreszeiten abhängig waren (z.B. andere Sternbilder im Frühling als im Winter), führte dies zu einem Glauben an Zusammenhänge. Die Vorhersagen bezogen sich jedoch stets auf ganze Länder oder Herrscherfamilien, nicht auf Einzelpersonen. Persönliche Horoskope gab es in Mesopotamien noch nicht.
In der Antike entwickelten sich erstmals individuelle Horoskope mit neu eingeführten pseudowissenschaftlichen Begriffen wie Aszendent (Aszendent=das Sternbild, das im Geburtsort und Geburtszeit genau im Osten am Horizont aufgeht). Die Berechnungen wurden komplexer, und die Deutung der Sternzeichen entwickelte sich zu einem Geschäftsmodell. Mit dem Buchdruck im 15. Jahrhundert nahm die Bekanntheit von Horoskopen weiter zu, begleitet von Betrügereien auf Jahrmärkten.
Insbesondere während der Aufklärung verlor die Astrologie jedoch ihre Anerkennung als Wissenschaft. Und das zurecht.
Hier einige Punkte der “astrologischen Lehre”, die wissenschaftlichen Realitäten widersprechen:
Das 13. Sternzeichen - Schlangenträger:
Die gängige Vorstellung von 12 Sternzeichen entspricht nicht den wirklichen Tierkreis-Sternbildern. Es gibt nämlich 13 Sternbilder im Tierkreis. Menschen, die zwischen Ende November und Mitte Dezember geboren sind, würden eigentlich dem Sternzeichen "Schlangenträger" zugeordnet werden. Dieses alte Sternbild Ophiuchus wurde in der Antike ignoriert, möglicherweise aufgrund der mathematisch angenehmeren Zwölfzahl.
Die Sternbilder sind nicht gleich lang:
Obwohl der Tierkreis in der Astrologie in 12 gleich lange Monatsphasen unterteilt ist, variieren die tatsächlichen Größen der Sternbilder erheblich. Zum Beispiel steht das Sternbild Skorpion nur sieben Tage hinter der Sonne, während die Jungfrau 45 Tage sichtbar ist.
Die Erde wackelt:
Die westliche Astrologie basiert auf der Annahme einer festen Rotationsachse der Erde. Allerdings hat sich die Achse im Laufe der letzten 3000 Jahre seit der Entstehung der Astrologie verschoben, was zu einer Verschiebung der Tierkreiszeichen geführt hat. Die Sternzeichen sind also eigentlich um eins verschoben. Wer Zwilling “ist”, ist also eigentlich Stier, usw. Diese Änderungen, einschließlich der Aberkennung von Plutos Planetenstatus, wurden nicht in die astrologische Theorie integriert.
Der Barnum-Effekt
Horoskope sind deshalb so beliebt, da sie sehr vage sind und man immer das herauslesen kann, was man möchte. In einer französischen Studie wurde Astrologie-begeisterten Menschen eine persönliche astrologische Analyse zugeschickt. Die Teilnehmer*innen berichteten alle, dass die Analyse sehr gut passte. Es war jedoch bei allen dieselbe. Nämlich die eines Serienkillers.
Mercury retrograde
In der Astrologie wird immer wieder von Phasen gesprochen, in denen Merkur "rückläufig" bzw. "in retrograde” ist. Merkur ist der römische Gott, der für Kommunikation und Nachrichten zuständig ist. Deswegen sollte man laut Astrologie in diesen Phasen darauf achten, dass einiges in der Kommunikation schief gehen kann und deswegen bspw. keinen Vertrag unterzeichnen.
Plottwist, heute wissen wir: Merkur läuft gar nicht rückwärts, es sieht nur von der Erde so aus, als ob er das tut (die Schleifen, die er am Himmel zieht, sehen für uns wegen der planetarischen Überholmanöver so aus).
Es hat jedoch trotzdem einen Effekt, nämlich einen psychologischen Effekt. In Ländern, die an Astrologie glauben, bleiben die Händler*innen bei rückläufigen Merkur dem Finanzmarkt fern (Selbsterfüllende Prophezeiung).
Hat der Mond einen Einfluss auf uns?
Lange wurde geglaubt, dass der Mond Einfluss auf uns nehmen kann. Der Begriff lunatic leitet sich vom lateinischen Wort für Mond ab. Keine einzige Studie konnte jedoch einen Einfluss des Mondes oder von noch entfernteren Objekten auf unser Verhalten oder Leben nachweisen.
Quellen
National Geographic - Astrologie: Der Ursprung von Horoskopen
Quarks.de - Kann dir Astrologie deine Zukunft vorhersagen?
Science Vs. - Astrology: Are Geminis the Worst?
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen. Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Redbubble Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Nov 23, 2023 • 38min
CL021 Planet Nine oder Planet Nein?
Die Episode über die Suche nach dem unentdeckten Planet Nine
CL021 - Planet Nine oder Planet Nein?
Die Episode über die Suche nach dem unentdeckten Planet Nine
Ein fremder Planet in der Erde
Vor mehr als 4 Milliarden Jahren ist die junge Erde mit einem anderen Protoplaneten kollidiert. Der hat den Namen Theia bekommen, obwohl er nicht mehr exisiert, weil er bei der Kollision zerstört worden ist. Aus den Trümmern von Erde und Theia wurde der Mond - und nun hat man auch ein paar Bruchstücke von Theia im Inneren der Erde entdeckt.
Nicht gendern ist nicht super
Eva hat in Ausgabe 12/2023 von "Sterne und Weltraum" eine Rezension des Buchs "Zurück zum Mond" von Joseph Silk gelesen. Der Rezensent hat das Buch wegen diverser inhaltlicher Fehler verrissen, was ja ok ist. Nicht ok fand Eva die Anmerkung, dass das einzige Gute an dem Buch die Tatsache ist, dass dort nicht gegendert und ausschließlich die männliche Form verwendet wird.
Asteroidenbergbau im Film
Die Hörerinnen und Hörer haben jede Menge gute Hinweise auf Filme gegeben, in denen es um Asteroidenbergbau geht. "The Expanse" wurde sehr oft genannt, außerdem noch "Outland", "Enemy Mine", "Alien 3, "The Mandalorian" und "Raumpatrouille". Vielen Dank dafür.
Auf der Suche nach Planet 9
Das Sonnensystem hat 8 Planeten. Das war aber nicht immer so. Bis 2006 waren es neun Planeten, ab da wurde Pluto zu den Asteroiden gezählt. Vor der Entdeckung Plutos waren es acht Planeten. Und davor? Der wievielte Planet war Neptun, als er 1846 entdeckt worden ist? Nicht der achte, wie man denken könnte. 1801 hat man Ceres entdeckt, der damals als Planet geführt worden ist (siehe CL004 über die Titius-Bode-Reihe). Danach kamen Pallas (1802), Juno (1804), Vesta (1807) und Astrea (1845), die damals auch als Planeten klassifiziert worden sind. Neptun war also Planet Nummer 13. Aber - wie in CL004 erklärt - hat man dann bald festgestellt, dass die Dinger - bis auf Neptun - alle sehr klein waren und ab den 1850er Jahren hat man sie “Asteroiden” genannt und nicht mehr als Planeten bezeichnet - Neptun war dann also tatsächlich Planet Nr. 8.
Das alles zeigt: Die Zahl der Planeten ist nicht fix. Sondern hängt davon ab, wie wir definieren, was “Planet” bedeutet und vor allem davon, was wir über das Sonnensystem rausfinden.
Im inneren Sonnensystem versteckt sich mit Sicherheit kein Planet mehr. Im äußeren Sonnensystem haben wir hinter der Umlaufbahn von Neptun auch nur jede Menge Asteroiden gefunden; im Kuipergürtel, in der “gestreuten Scheibe” die dahinter liegt und darüber hinaus.
Der erste Asteroid den man im Kuipergürtel entdeckt hat, war - nach Pluto - das Objekt 1992 QB1. Und seit den 1990er Jahren haben wir immer mehr und mehr gefunden. Auch welche, die man “Extreme transneptunische Objekte (ETNO)” nennt; also Asteroiden, die so weit hinter der Neptunbahn sind, dass sie definitiv nicht mehr von der Gravitationskraft des Neptun beeinflusst werden (große Halbachse von mehr als 150 AU; Perihel von mehr als 50-60 AU).
Diese ETNOs haben uns aber auch Hinweise darauf geliefert, dass sich NOCH weiter draußen im Sonnensystem vielleicht doch noch ein Planet befindet.
2012 haben Chad Trujillo und Scott Sheppard den Asteroid 2012 VP113 entdeckt (Spitzname “Biden”, weil Biden damals der Vizepräsident der USA - VP - war). Der hat einen Durchmesser von 570 km, eine große Halbachse von 260 AU, entfernt sich bis zu 435 AU von der Sonne und selbst am sonnennächsten Punkt ist er noch 80 AU von der Sonne entfernt. In der Arbeit zur Entdeckung (“A Sedna-like body with a perihelion of 80 astronomical units”) haben Trujillo und Sheppard sich auch die Bahndaten anderer bekannten ETNOs angesehen und der restlichen Asteroiden angesehen, die immer mindestens mehr als 30 AU von der Sonne entfernt sind. Insbesondere haben sie sich das Perihel angesehen (die Distanz des sonnennächsten Punktes der Bahn zur Sonne).
Die Idee war: Asteroiden die so fern der Sonne sind, werden von den Gravitationskräften der Planeten nur noch schwach oder gar nicht direkt beeinflusst. Sie spüren nur den kombinierte Einfluss aller Störungen und deswegen wirken sich die Störungen auch quasi zufällig auf ihre Bahnen aus. Hier ist vor allem relevant, wie die Bahn im Raum orientiert ist und die Daten zeigen, dass die Bahnen dieser fernen Asteroiden eben tatsächlich zufällig gedreht sind. Die Bahnen der Planeten und der meisten anderen Asteroiden im inneren Sonnensystem zeigen, vereinfacht gesagt, alle in die selbe Richtung. Bei den fernen Asteroiden wirken aber eben die Störungen der Planeten nicht mehr gezielt und deswegen sind die Bahnen hier zufällig durch die Gegend gedreht. Das gilt aber nicht für die WIRKLICH weit entfernten Asteroiden, wie 2012 VP113 und die anderen ETNOs. Da waren die Bahnen alle wieder mehr oder weniger gleich orientiert.
Die Interpretation: Es könnte einen unentdeckten Planeten geben, circa so groß wie die Erde und ungefähr 250 AU weit von der Sonne entfernt, der mit seiner Gravitationskraft dafür sorgt, dass die Bahnen der ETNOs entsprechend “geordnet” und nicht wahllos orientiert sind wie die der anderen Asteroiden.
Es gäbe auch noch andere Ursachen um das Phänomen zu erklären (Störungen durch nahe an der Sonne vorbei fliegende Sterne in der Vergangenheit oder einfach zu wenig Beobachtungsdaten).
2016 kam dann die nächste wichtige Arbeit. Mike Brown (der Entdecker von Eris, der Asteroid der die Debatte um Plutos Planetenstatus ausgelöst hat) und Konstantin Batygin haben die Arbeit "Evidence for a distant giant planet in the solar system" veröffentlicht. Sie haben die Bahndaten der ETNOs nochmal im Detail analysiert und festgestellt, dass ein noch unbekannter Planet tatsächlich eine sehr gute Erklärung für die Auffälligkeiten bei den Bahnen der ETNOs wäre. Sie haben diesen hypothetischen Planeten auch “Planet Nine” getauft.
Aber mathematische Untersuchungen sind keine Entdeckungen. Wenn man sich sicher sein will, dass da ein Planet 9 ist, muss man ihn konkret beobachten. Das hat man probiert, aber ohne Erfolg. Auch das muss nix heißen; es kann sein, dass man ihn übersehen hat. Man weiß ja nicht, WO man hinschauen muss. Vielleicht ist er gerade genau da am Himmel, wo auch das Band der Milchstraße ist; dann ist es enorm schwer, da einen bestimmten Lichtpunkt unter vielen zu finden.
Die Bahn von Planet 9 ist ziemlich sicher auch nicht kreisförmig, sondern stark elliptisch. Der sonnennächste Punkt der Bahn könnte bei 300 AE liegen, der fernste bei 900 AE. Wenn er gerade in der Nähe des sonnenfernsten Punkts ist, dann ist er fast unmöglich zu finden. Und es dauert, bis er wieder näher kommt; für eine Runde um die Sonne könnte Planet 9 circa 10.000 Jahre brauchen!
Es wird weiter beobachtet werden und irgendwann finden wir Planet 9 - oder wir haben so lange so ausführlich beobachtet, dass wir ausschließen können, dass er existiert. Man kann dabei auch selbst mithelfen, bei einem Citizen Science Projekt: “Backyard Worlds Planet 9” von der NASA.
Aber es ist vielleicht besser, wenn man sich nicht zu viel Hoffnung macht. 2021 ist eine neue Analyse der ETNO-Daten erschienen (“No Evidence for Orbital Clustering in the Extreme Trans-Neptunian Objects”). Damals gab es schon ein paar neue Daten und neue Objekte und jetzt sieht die Sache eher so aus, als wäre da gar kein Effekt, den man durch Planet 9 erklären muss. Man kann ja nicht alle Bereiche des Himmels gleich gut beobachten, man kann nur zu bestimmten Zeiten beobachten, die Teleskope können nur ausreichend helle Objekte finden, usw. Wenn man das alles berücksichtigt, dann besteht - bei Berücksichtigung der neuen Daten - durchaus die Chance, dass die gefundenen ETNOs einfach zufällig so aussehen, als wäre da was besonderes - obwohl da gar nichts ist.
Das Problem: Wir wissen immer noch zu wenig; es ist schwer, so weit entfernte Asteroiden zu finden und solange wir nicht deutlich mehr ETNOs kennen, werden wir nix verlässliches sagen können.
Klar ist aber auch: Es wäre höchst überraschend, wenn irgendwo weit draußen im Sonnensystem KEIN weiterer Planet mehr wäre. Seit wir in der Lage sind, dank ausreichend guter Computer detaillierte Simulationen zur Planetenentstehung zu machen (ab den späten 1990ern), wissen wir, dass normalerweise deutlich mehr Planeten in einem System entstehen, als später übrig bleiben. Die Frühphase eines Sonnensystems ist extrem chaotisch, lauter kleine und große Protoplaneten beeinflussen sich gegenseitig, kommen einander nahe, kollidieren miteinander (so wie die Erde und Theia, wodurch der Mond entstanden ist) oder werden weit aus dem inneren Sonnensystem hinaus geschleudert. Manche ganz hinaus, bis in den interstellaren Raum (das sind dann die “vagabundierenden Planeten”, ohne Stern, von denen wir auch schon einige entdeckt haben), manche bleiben aber auch an den Stern gebunden, nur halt weit, weit draußen. Das ist auch die einzige Möglichkeit, wie ein Planet da überhaupt hinkommen kann; entstehen können die Planeten nur näher am Stern.
Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun sind die acht, die diese Chaosphase überstanden haben. Aber es wäre überraschend, wenn nicht ein paar Planeten auch im äußersten Sonnensystem gelandet sind. Dort haben wir aber so gut wie keine Chance sie zu finden. Ein erdgroßer Planet mit ein paar hundert AU Abstand, so wie Planet 9, ist noch halbwegs entdeckbar und kann Asteroiden beeinflussen, die wir auch entdecken können. Aber wenn da ein Planet irgendwo in der Oortschen Wolke gelandet ist, ein halbes Lichtjahr weit weg oder ein Lichtjahr - dann ist es so gut wie unmöglich, dass wir das Ding entdecken oder auch nur Spuren seiner Existenz finden.
Was die Astronominnen und Astronomen aber nicht abhalten wird, weiter danach zu suchen. Die Person, die einen noch unbekannten Planeten des Sonnensystems entdecken würde, könnte Mitglied in einem sehr exklusiven Klub werden… bis jetzt sind ja nur Herschel (Uranus) und Urbain LeVerrier bzw. Johann Gottfried Galle (Neptun) dabei.
Auf jeden Fall hat es Planet 9 in die Popkultur geschafft, gibt Planet 9 Merch und sogar ein Musikstück. Von Eduardo Marturet: “Planet 9”, veröffentlicht am 14. März 2021 (Einsteins Geburtstag) und live übertragen zur ISS, mit Konstantin Batygin an der E-Gitarre und hier auf YouTube.
Wieso Pluto kein Planet ist
Seit der Entdeckung von Neptun hat man nach einem “Planet X” gesucht, weil man dachte, dass die Umlaufbahn von Neptun Störungen aufweist, die durch die Existenz eines Planeten erklärt werden muss. Alle möglichen Leute haben danach gesucht und 1930 hat Clyde Tombaugh dann den Pluto gefunden. Alle waren froh, der gesuchte Planet war gefunden.
Aber dann hat man gemerkt, dass man Pluto anfänglich für sehr viel größer gehalten hat, als er wirklich war. Verglichen mit den vier Gasriesen und selbst verglichen mit den vier inneren Planeten war Pluto winzig! Sein Durchmesser beträgt 2370 Kilometer; das ist kleiner als der Erdmond! Und damit war Pluto viel zu klein, um ausreichend große Störungen bei der Neptunbahn zu verursachen. War aber gar nicht nötig. 1989 hat der Astronom Myles Standish die Daten der Voyager 2 benutzt, die ja auch an Neptun vorbei geflogen ist und die Masse von Neptun genauer als vorher bestimmt hat. Und wenn man alles mit der genaueren Neptunmasse durchrechnet, dann stellt sich raus, dass es gar keine unerklärlichen Bahnstörungen gibt "Planet X - No dynamical evidence in the optical observations". Es wäre also nicht nötig gewesen, nach einem “Planet X” zu suchen. Darüber hinaus hat sich Pluto auch ansonsten enorm auffällig verhalten. Seine Bahn war viel elliptischer als die Bahnen der anderen Planeten; sie war viel stärker gegenüber der Ebene des Sonnensystems geneigt als die der anderen Planeten.
Pluto ähnelt in der Hinsicht sehr viel mehr den Asteroiden, für die solche Bahnen normal sind. Und 1992 hat man in unmittelbarer Nähe von Pluto einen Asteroid gefunden (1992 QB1) und dann immer mehr. Und festgestellt: Pluto sitzt inmitten eines Asteroidengürtels, des Kuiper-Asteroidengürtels. Mit über 2000 km ist er zwar sehr groß, aber auch nicht absurd viel größer als viele andere Asteroiden im Kuipergürtel. Deswegen haben viele Astronom:innen auch dafür plädiert, Pluto als Asteroid zu bezeichnen und nicht als Planet. Brian Marsden, DER absolute Experte für Asteroiden, wollte 1998 Pluto daher auch offiziell als Asteroid mit der fortlaufenden Nummer 10.000 einordnen (die war damals gerade an der Reihe bei den Asteroidenentdeckungen). Aber die IAU wollte das aus “historischen Gründen” nicht machen und Pluto weiterhin als Planet klassifizieren.
Dann aber hat Mike Brown 2005 den Asteroid Eris entdeckt; weit hinter der Plutobahn. Und die Daten haben gezeigt: Eris war größer als Pluto. Jetzt hätte man entweder einen Asteroid gehabt, der größer als der Planet Pluto ist. Oder man hätte auch Eris als Planet bezeichnen müssen. Mike Brown - der weltberühmt als Entdecker eines Planeten des Sonnensystems werden hätte können - war aber der Meinung, dass weder Eris noch Pluto Planeten sind, sondern beides große Asteroiden im äußeren Sonnensystem sind.
Es gab Diskussionen und Streit und bei der Konferenz der IAU im Sommer 2006 hat man eine neue Definition des Begriffs “Planet” bestimmt. In der ersten Version wäre Eris tatsächlich ein Planet geworden. Aber auch der Asteroid Ceres und Plutos Mond Charon. Das fanden sehr viele Astronom:innen komisch; wenn das Wort “Planet” für Objekte wie Jupiter bis hin zu kleinen Felsbrocken gilt (und im Laufe der nächsten Jahre wären noch ein paar Dutzend mehr “Planeten” dazu gekommen, weil große Asteroiden die unter diese Planetendefinition gefallen wären, gibt es mit Sicherheit hunderte im Sonnensystem), dann bringt die Definition nix, weil sie völlig beliebig ist.
Also hat man einen neuen Vorschlag ausgearbeitet, nachdem ein “Planet” die Sonne umkreisen muss, ausreichend groß sein muss (so dass seine Eigengravitation ausreicht, dass er eine runde Form annimmt) und vor allem muss er seine “Umgebung bereinigt” haben. Soll heißen: Er muss bei seiner Entstehung schnell genug gewachsen sein, so dass seine Gravitationskraft alles in seiner Umgebung entweder angezogen oder anderswohin geschleudert hat. Pluto hat das nicht geschafft; er ist auf dem Weg zum Planeten nicht weit genug gekommen und nicht schnell genug gewachsen - weswegen er heute immer noch inmitten der anderen Planetenbausteine (aka “Asteroiden”) sitzt.
Die seit 2006 gültige Definition hat viel, das man kritisieren kann, aber sie ist halbwegs ok. Weniger ok ist die gleichzeitig neu eingeführte Klasse der “Zwergplaneten”. Die war ein Zugeständnis an die Astronom:innen aus den USA die sich besonders darüber aufgeregt haben, das Pluto kein Planet mehr sein soll (weil ihn ja ein Amerikaner - Clyde Tombaugh - entdeckt hat). Aber so wie “Zwergplanet” definiert ist, bedeutet der Begriff exakt das selbe wie “großer Asteroid”. Wenn man will, kann man die ruhig “Zwergplanet” nennen und 2006 hat man Ceres, Pluto, Eris, Haumea und Makemake als Zwergplaneten definiert. Alles ok - nur kennt man mittlerweile sehr viel mehr große Asteroiden, die alle die Bedingungen erfüllen würden, um Zwergplanet genannt zu werden. Je nachdem wie man es betrachtet mindestens ein paar Dutzend bis ein paar Hundert. Die IAU ignoriert die Sache aber seit 2006 konsequent und tut so, als wäre da nix. Und Ceres, Pluto, Eris, Haumea und Makemake sind immer noch die einzigen offiziellen Zwergplaneten. Wenn man eine Definition nicht ernst nimmt, kann man sie auch gleich lassen.
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen. Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Redbubble Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Nov 9, 2023 • 42min
CL020 Caroline Herschel, die Kometenjägerin
Die Episode über die Cinderella-Story einer großen Astronomin
CL020 Caroline Herschel
Die Episode über die Cinderella-Story einer großen Astronomin
Die Episode über das schwierige Leben einer großen weiblichen Vorreiterin der Wissenschaft, ihre Entdeckungen und das Happy End!
Einleitung
Wir feiern unsere 20. Folge und wünschen uns noch ganze viele Folgen!
Zudem feiern wir den Start der Raumsonde Psyche, die sich am 13. Oktober zum gleichnamigen Asteroiden aufmachte. Die Sonde soll 2029, nach einer Reise von 3,5 Mrd. km, beim Asteroiden ankommen.
Der 250 km große Asteroid Psyche ist sehr interessant, da es sich um einen Metall-Asteroid handelt. Üblicherweise bestehen sie aus eine Mischung aus Gestein, Metall und Eis - hier handelt es sich allerdings um den seltenen Fall eines Himmelskörpers, der so gut wie ausschließlich aus Eisen und Nickel besteht.
Astronom:innen gehen davon aus, dass er aus dem Kern eines Protoplaneten aus der Frühzeit des Sonnensystems entstanden ist. Dass der Asteroid früher mal Teil des Kerns eines Planeten war, finden wir ziemlich toll!
Weitere Infos zur Raumsonde und zur Mission gibt es bei der NASA.
Psyche machte vor ein paar Jahren bereits Schlagzeilen, als die NASA die Mission der Öffentlichkeit mitteilte und der Asteroid einen monetären Wert von 10 Quadrillionen Dollar erhielt. Damals kamen die ersten Diskussionen und ernsthafte Überlegen in Hinblick auf Asteroidenbergbau auf.
Mehr über die Wirtschaftlichkeit von Asteroiden Bergbau könnt ihr hier lesen.
Wir wollen daher von euch wissen, ob ihr Filme kennt, bei denen Asteroidenbergaubau vorkommt oder eine Rolle spielt. Schreibt uns gerne dazu!
Caroline Lucretia Herschel
geboren am 16. März 1750 in Hannover, gestorben am 9. Januar 1848 in Hannover
Kindheit
Caroline war die jüngste von 10 Kindern und die einzige überlebende Tochter ihrer Eltern Isaac und Anna. Isaac war Militärmusiker und wollte allen Kindern genug Bildung zukommen lassen. Anna sah das etwas anders. Sie sah Caroline nur als Haushaltshilfe und fand Bildung für Mädchen nicht notwendig. Caroline schrieb in ihren Memoiren darüber: „Ich vermochte den Gedanken, dass ich ein Aschenputtel oder eine Hausmagd werden sollte, nicht zu ertragen.“
Die Flucht nach England
Ihr Bruder Wilhelm war bereits in Bath (England) als Musiker tätig (Link zur eingespielten Symphonie siehe unten). Nach dem Tod ihres Vaters will Wilhelm sie nach Bath holen. Sie ist damals 22 Jahre alt. Er schloss ein Abkommen mit ihrer Mutter: Er musste Anna Geld für Carolines Abwesenheit zahlen und wenn sie es in 2 Jahren nicht als Musikerin geschafft hat, musste sie nach Hause zurückkehren. Caroline schaffte es jedoch! Sie wurde eine erfolgreiche Sängerin, die eine große musikalische Karriere vor sich gehabt hätte, wenn sie nicht der Passion ihres Bruders für die Astronomie gefolgt wäre.
Der Planet George
Wilhelm und Caroline verbrachten jede freie Minute mit dem Bau von Spiegelfernrohren und Sternbeobachtungen. Wilhelm gelang zu internationaler Berühmtheit, da er einen neuen Planeten entdeckte, nämlich Uranus. Wilhelm schlug jedoch den Namen “George” vor, benannt nach dem aktuellen König Englands. Der Name setzte sich jedoch nicht durch. Aber König George wurde daraufhin auf sie aufmerksam. Wilhelm wurde als Königlicher Hofastronom in Windsor angestellt und Caroline seine Gehilfin. Ein paar Jahre später bekam sie sogar ein Gehalt für ihre wissenschaftliche Tätigkeit (50 Pfund im Vergleich dazu, erhielt William 200 Pfund).
Carolines Entdeckungen
Caroline zeichnete sich durch ihre äußerst präzise und geduldige Arbeitsweise aus. Im Jahr 1798 erstellte sie einen neuen Sternkatalog, der 500 neue Sterne enthielt, im Vergleich zum vorherigen Katalog von John Flamsteed.
Ihre bekannteste Leistung ist jedoch ihre Entdeckung von Kometen, weshalb sie oft als "Kometenjägerin" bezeichnet wird. Während ihrer Karriere entdeckte Caroline Herschel insgesamt acht Kometen. Ihr erster Kometenfund im Jahr 1786 war 35P/Herschel-Rigollet, ein periodischer Komet mit einer Umlaufzeit von 155 Jahren. Sein nächster Perihel wird im Jahr 2092 erwartet.
Exkurs: Was ist ein Komet? Ein schmutziger Schneeball
Kometen, bestehend aus Wassereis, Gas, Staub und kohlenstoffhaltigen Verbindungen, werden oft als "schmutzige Schneebälle" bezeichnet. Sie bewegen sich auf elliptischen Bahnen um die Sonne, einige auf parabelförmigen Bahnen.
Astronom*innen vermuten, dass Kometen aus dem Kuipergürtel und der Oortschen Wolke stammen, am Rande unseres Sonnensystems. Kometen werden erst sichtbar, wenn sie sich der Sonne nähern und das Eis verdampft, wodurch sie einen Schweif aus Gas und Staub bilden.
Carolines Lebensabend und Vermächtnis
1822 starb ihr Bruder, aber sie forschte mit ihrem Neffen John weiter, dem sie von klein auf sehr vieles beigebracht hatte.
Sie zog später zurück nach Hannover und wurde stolze 97 Jahre alt.
Caroline Herschel erhielt die Ehre, als Namensgeberin für den Kometen 35P/Herschel-Rigollet, den Mondkrater C. Herschel in der Sinus Iridum (Regenbogenbucht) und den Planetoiden (281) Lucretia genannt zu werden.
Links
E-Book: Memoir and Correspondence of Caroline Herschel
LibriVox Hörbuch: Memoir and Correspondence of Caroline Herschel
Planet-Wissen-Artikel: Kometen
Englischer Podcast Who When Wow: Hörspiel über Caroline Herschel
Youtube: Symphony No.14 in D Major - William Herschel
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen. Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Redbubble Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Oct 26, 2023 • 35min
CL019 Doppelsterne und der böse Zwilling der Sonne
Die Episode über Doppel- und Mehrfachsternsyteme und die Nemesis-Hypothese
CL019 Doppelsterne und der böse Zwilling der Sonne
Die Episode über Doppel- und Mehrfachsternsyteme und die Nemesis-Hypothese
Die Episode über Doppel- und Mehrfachsternsysteme und dem hypothetischen Zwillingsstern der Sonne, Nemesis. Außerdem: romantische Vorstellungen in der Forschung.
Einleitung
Wir beginnen die Folge mit einem kurzen Überblick, was sich seit dem letzten Mal getan hat - und das ist eine ganze Menge gewesen!
OSIRIS REx hat Wasser mitgebracht!
Nach der geglückten Rückkehr von OSIRIS-REx im September 2023, bei der eine Materialprobe des Asteroids Bennu auf die Erde abgeworfen worden wurde, haben die Wissenschafter und Forscherinnen der NASA den Staub untersucht und erfreuliches gefunden!
Der Asteroid Bennu enthält Wasser- und Kohlenstoffmoleküle!
Der Staub, der sich auf der Außenseite der Kapsel befunden hat, wurde nun ausgewertet. Und selbst dort fanden die Forscher*innen der NASA schon Wassermoleküle, die in Mineralien eingeschlossen sind. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Wasser unserer Ozeane womöglich auch durch Asteroiden vor 4 Mrd. Jahren auf die Erde gebracht wurden. Außerdem wurden Schwefel (wichtig für geologische Prozesse), Magnetit (Katalysator bei organisch-chemischen Reaktionen) und größere Mengen Kohlenstoff gefunden. Kohlenstoff ist besonders spannend, da es den Grundbaustein des Lebens darstellt.
Jetzt befindet sich die Sonde Osiris Rex auf dem Weg zu ihrem nächsten Ziel: der Asteroid 99942 Apophis.
NASA Press Release
Der größte Sonnensturm!
In Baumringen von Bäumen aus den französischen Alpen wurde der stärkste Sonnensturm aller Zeiten entdeckt. Er soll sich vor 14.300 Jahren, am Ende der Eiszeit, ereignet haben. Durch die starke Intensität der kosmischen Strahlen bei Sonnenstürmen entstehen bestimmte Isotope in der Atmosphäre. Diese können dann in Baumringen oder Eisschichten nachgewiesen werden. Parallel haben nämlich Forscher*innen des “North Greenland Ice Core”-Projekts in der Eisschicht, die sich vor 14.300 Jahren gebildet hat, eine hohe Konzentration des Isotops Beryllium-10 nachgewiesen. Diese starken Sonnenstürme werden als Miyake-Ereignisse bezeichnet, benannt nach der japanischen Physikerin Fusa Miyake. Sie fand 2012 in den Jahresringen von japanischen Zedern Hinweise darauf, dass im Jahr 774 ein solcher “Superflare” die Erde getroffen hat. Mehr zu Sonnenwinden könnt ihr auch in der Folge 1 von Cosmic Latte nachhören!
Doppelsterne und Mehrfachsysteme
Doppelsterne gibt es nicht nur in Star Wars, wenn über Tatooine, dem Heimatplaneten von Luke Sykwalker zwei Sonnen am Himmel aufgehen.
Ein sehr bekanntes Doppelsternsystem ist etwa Sirius AB und in unserer Nachbarschaft befindet sich sogar ein Mehrfachsystem: Alpha Centauri, bestehend aus Alpha Centauri A und B sowie dem entfernten Begleiter Proxima Centauri.
Es gibt auch Systeme mit mehr Sternen. Die meisten Sterne in einem System wurden bei Jabbah und AR Cassiopeiae im Sternbild Kassiopeia mit sieben Sternen gefunden.
Generell spricht man von Doppelsternen, wenn sie gravitativ aneinander gebunden sind und um einen gemeinsamen Schwerpunkt kreisen.
Dabei gibt es welche, die sich weit entfernt voneinander umkreisen und keinen Kontakt haben (kaum Interaktion), und solche, die näher aneinander sind. Dabei kann es vorkommen, dass die engen Doppelsterne nur spektrokopisch und nicht mehr teleskopisch voneinander unterschieden werden können.
Bei denen, die die Roche-Grenze überschreiten, findet sogar ein Materieaustausch statt, der so stark sein kann, dass sie eine gemeinsame Hülle haben; Doppelsterne können sich daher gegenseitig beeinflussen, Materie ab- bzw., anziehen und so in die Entwicklung des Partnersterns eingreifen.
Die Roche-Grenze ist wichtig in einem Binärsystem. Sie gibt die Grenze der Größe der Sterne bei Doppelsternen an, innerhalb derer sie keinen Einfluss auf die Gravitationskräfte des anderen nehmen.
Die Forschung geht von 60 bis 70 % Doppel- oder Mehrfachsternsystemen in der Milchstraße aus. Grund dafür, sind die physikalischen Bedingungen bei der Sternentstehung.
Sterne entstehen in interstellaren Wolken. Innerhalb dieser Molekülwolken, die sehr kalt (10-30K) sind, gibt es dichtere Regionen, in denen die Wolken hauptsächlich aufgrund der Schwerkraft immer mehr verklumpen, bis sie kollabieren.
Sterne entstehen in größeren Wolken gruppenweise und es besteht dabei eine große Wahrscheinlichkeit, dass solche nahe beieinander befindlichen Sterne sich zu einem System verbinden.
Ist die Sonne eine Einzelgängerin?
Wenn jetzt Doppelsterne eher die Regel sind, kann es sein, dass die Sonne auch einen Begleiter hat? Tatsächlich entstand in den 1980er Jahren die Theorie, dass die Sonne einen Zwillingsstern hat.
Damals entdeckten Luis und Walter Alvarez, dass ein Asteroid für das Massensterben der Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren verantwortlich war.
Zwei Paläontolgen, David Raup und John Sepkoski griffen die Idee auf, als sie die Aussterberate von Meerestieren untersuchten. Sie meinten in ihren Daten eine Periodizität von 26 Millionen Jahren in den Massensterben zu erkennen.
Nemesis-Hypothese: “böser Zwilling der Sonne”
Der Physiker Richard Muller, ein früherer Student von Alvarez ging der Sache nach und fragte sich, was für ein Prozess dahinter sein könnte.
Er ging davon aus, dass der Dino-Killer zu einem größeren Verbund gehörte und stellte dann die Theorie auf, dass wohl ein größeres Objekt die Oortschen Wolke in gewisser Regelmäßigkeit (in diesem Fall alle 26 Millionen Jahre) durchquert, dort die Bahnen der Himmelskörper stört und die Kometen Richtung Sonne geschleudert werden.
Die Oortsche Wolke befindet sich am äußersten Rand des Sonnensystems, weit draußen außerhalb von Pluto-Orbit und Kuiper Gürtel.
Muller stellte nun weiter die Hypothese auf, dass es sich bei diesem Objekt um einen unentdeckten Stern handeln könnte, und gab dem hypothetischen Stern den Namen "Nemesis".
Welche Eigenschaften hätte Nemesis?
Wahrscheinlich handelt es sich bei Nemesis um einen braunen Zwerg oder Zwergstern und er wäre somit sehr leuchtschwach. Nemesis müsste sich bei einer Distanz von 1,5 Lichtjahren in einem stark elliptischen Orbit befinden und sich alle 26 Millionen Jahre der Oortschen Wolke nähern.
Allerdings wurde Nemesis bis heute nicht entdeckt und nach aktuellen Himmelsdurchmusterungen scheint es auch eher unwahrscheinlich. Besonders nach Duchmusterungen im Infrarot-Bereich hätte man ihn entdecken müssen.
Mehrere Gründe sprechen gegen die Nemesis-Hypothese, wie Adrian Melott und Richard Bambach in ihrem Paper Nemesis Reconsidered ausführen. Sie betonen, dass durch galaktische Gezeiten und nahe vorbeifliegende Sterne die Stabilität der Umlaufbahn und die Periodizität von Nemesis nicht gegeben wäre.
2011 stellte sich zudem heraus, dass die Daten die aufgestellte Hypothese von Raup und Sepkoski nicht hergeben und es sich dabei um ein statistisches Artefakt handelt.
Könnte die Sonne einen Begleiter gehabt haben?
Auch wenn Nemesis nicht gefunden ist, so kann es durchaus sein, dass die Sonne in ihrer Anfangsszeit einen Begleiter hatte - zumindest lassen das die Ergebnisse der Studie von Sarah Sadavoy und Steven Stahler zu.
Sie untersuchten Daten aus einer Molekülwolke mit vielen jungen Sternen in der 700 Lichtjahre entfernten Perseuswolke und kamen zu folgenden Ergebnissen:
dass junge Sterne in Doppelsystemen entstehen und
dass diese jungen Sterne aber nur sehr schwach aneinander gebunden sind. Doppelsterne, die weit entfernt sind (>500 AE) verlieren sie sich später wieder.
So entstehen sonnenähnliche Sterne eigentlich immer mit Begleiter, verlieren ihn aber meistens innerhalb einer Mio. Jahren.
Die Sonne könnte demnach also einen Begleiter bei ihrer Entstehung vor 4,5 Mrd. Jahren gehabt haben. Allerdings ist Nemesis ihrer Theorie nach innerhalb der ersten Jahrmillion verloren gegangen und wandert jetzt durch die Milchstrasse. Da sie somit bereits auf der anderen Seite der Milchstrasse sein könnte, kann sie auch nicht mehr identifiziert werden.
Das Fazit: Vielleicht exisierte Nemesis vor langer Zeit. Sie war aber jedenfalls nicht der böse Zwilling der Sonne.
(Weitere) Paper zum Thema:
Nemesis reconsidered, Adrian Melott und Richard Bambach, September 2010
Born to Be Wide: The Distribution of Wide Binaries in the Field and Soft Binaries in Clusters, Mor Rozner and Hagai B. Perets, September 2023
Eccentricity dynamics of wide binaries – I. The effect of Galactic tides, Shaunak Modak and Chris Hamilton, Juli 2023
The evolution of wide binary stars, Jiang, Yan-Fei and Tremaine, Scott, Januar 2010
Embedded Binaries and Their Dense Cores, Sarah Sadavoy und Steven Stahler, April 2017
Buch zum Thema
David M. Raup: The Nemesis Affair
November 1999
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen. Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Redbubble Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Oct 12, 2023 • 45min
CL018 Die Voyager Mission - Part 2
Die Episode über die Voyager Sonden, ihre Reise in die Unendlichkeit und außerirdisches Leben
CL018 - Die Voyager Mission - Part 2: Die Reise in die Unendlichkeit
Die Episode über die Voyager Sonden, ihre Reise in die Unendlichkeit und außerirdisches Leben
Einleitung
Bevor wir uns wieder den Voyager-Sonden widmen, erzählt Eva noch von der geglückten Landung der Asteroidenprobe in der us-amerikanischen Wüste.
Denn am 24.September 2023 landete in einem Militärgebiet in Utah (USA) eine Kapsel mit ca. 250 Gramm Material des Asteroiden Bennu.
Asteroidenprobe - Lieferung frei Haus
“OSIRIS-REX“ (die Abkürzung steht für: Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) war 2016 gestartet und nach zwei Jahren beim Asteroiden Bennu angekommen um Gesteinsproben zu entnehmen und diese anschließend zurück zur Erde zu bringen - allerdings ist Osiris-Rex selbst nicht gelandet, sondern hat die Kapsel mit dem Material in einer Höhe von ca. 100 km abgeworfen. Denn Osiris-Rex ist bereits auf den Weg zu seiner nächsten Mission bzw. dem nächsten Asteroiden: er fliegt nun weiter zu Apophis, der besonders interessant ist, weil er 2029 relativ nah an der Erde vorbei fliegen wird (bei ca. 30.000km). Bei seiner Entdeckung war Apophis für einige Zeit als gefährlich eingestuft, da er die Erde treffen könnte. Neuere Berechnungen haben aber ergeben, dass es keine Kollision geben wird (hört dazu gerne auch unsere Cosmic Latte Folge über Asteroiden (CL008)).
Der Asteroid Bennu könnte eventuell gefährlich werden, und wird von der NASA aktuell auch dementsprechend eingestuft - allerdings kommt er erst in 150 Jahren in unsere Nähe. Und auch wenn die Kollisionswahrscheinlichkeit gering ist, lohnt es sich trotzdem ihn zu erforschen.
Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Proben von einem Asteroiden auf der Erde gelandet sind: Japan war mit seinen Hayabusa-1 und -2 Missionen das erste Land, dem es gelang, Bodenproben mit einem Raumfahrzeug zurückzubringen.
Die Voyager Mission Part 2: Wie ging es weiter mit den Sonden?
In der letzten Epsiode (CL017), haben wir die beiden Voyager Sonden bei ihrem Start und auf ihre Reise zu den äußeren Planeten begleitet. Dieses Mal geht es weiter bis an die Grenzen des Sonnensystems in Richtung Unendlichkeit.
Nachdem die Voyager-Sonden die geplanten Planeten besucht haben, flogen sie weiter in Richtung interstellaren Raum. 2012 (Voyager 1) bzw. 2018 (Voyager 2) verließen die Sonden die Heliosphäre. Sie bestätigten mit ihren Sensordaten, dass es keinen fließenden Übergang, sondern eine klare, messbare Grenze zwischen Heliosphäre und interstellarem Raum gibt. Zuvor wussten wir auch nicht, wie groß die Heliosphäre ist. Beide Sonden haben die Veränderung in der Plasmadichte in circa der gleichen Entfernung gemessen, bei 120 AE (1 Astronomische Einheit (AE) = mittlere Abstand Erde-Sonne = 150 mio km).
Außerhalb des Sonnensystems?
Entgegen mancher Medienbehauptungen, verließen die Sonden nicht das Sonnensystem, sondern nur die Heliosphäre. Die Heliosphäre ist der Einflussbereich der Sonnenwinde und deren Magnetfelder. Das ist jedoch nicht die Grenze des Sonnensystems, da es dahinter noch transneptunische Objekte gibt, auf die die Gravitation der Sonne einen Einfluss hat. Das Ende des Sonnensystems ist erst dort, wo die Gravitation der Sonne nicht mehr wirkt bzw. genauer gesagt, die Gravitation eines anderen Sterns stärker ist. Die Grenze des Sonnensystems werden die Sonden erst in vielen tausenden Jahren erreichen, nach der Oortschen Wolke (die Oortsche Wolke endet in einer Entfernung von 10.000 AE, die Voyagers sind bis jetzt 161 AE geflogen!).
Die Voyager Golden Record
Die Golden Record ist eine 30 cm große Scheibe aus Kupfer, die als Schutz vor Korrosion vergoldet wurde. Die Platte ist baugleich auf beiden Voyagers befestigt und soll bis zu 500 Millionen Jahre überleben und somit ein Zeugnis über die menschliche Zivilisation abgeben. Auf dieser analogen Scheibe befinden sich 150 Bilder und 100 min Audio.
Auf der Vorderseite wurde eine Art Gebrauchsanleitung gedruckt, wie auch eine Karte, die die Position unserer Sonne in Relation zu 14 Pulsaren anzeigen soll. Zur Orientierung wurden die Entfernungen und die Rotationsraten der Pulsare in Binärcode angegeben.
Als universeller Decodierungs-Faktor wurde die HI-Wasserstofflinie, 1420 Mhz herangezogen.
Die Drake Gleichung
Wie wahrscheinlich ist es nun, dass es Außerirdische gibt, die mit uns kommunizieren wollen?
Das versucht die Drake-Gleichung des Astronomen Frank Drake zu beantworten.
Sie beinhaltet folgende Faktoren:
mittlere Sternentstehungsrate pro Jahr in unserer Galaxie
Anteil an Sternen mit Planetensystem
durchschnittliche Anzahl der Planeten (pro Stern) innerhalb der Ökosphäre
Anteil an Planeten mit Leben
Anteil an Planeten mit intelligentem Leben
Anteil an Planeten mit Interesse an interstellarer Kommunikation
Lebensdauer einer technischen Zivilisation in Jahren
Vor allem die letzten Faktoren sind sehr unsicher und spekulativ. Es gibt mehrere Modelle mit der Lösung der Drake-Gleichung. Mit der Zeit wurden die Berechnungen jedoch immer pessimistischer. Sie gehen von optimistischen 100 Zivilisationen in unserer Milchstraße bis zu konservativen Annahmen, dass wir die einzige Zivilisation in der Milchstraße sind.
Dass die Voyager Golden Record jemals gefunden wird, ist ohnehin sehr unwahrscheinlich und wenn, dann gibt es die Menschheit wahrscheinlich nicht mehr. In 40.000 Jahren fliegen die Voyagers nämlich erst das erste Mal bei einem Stern vorbei. Und das auch nur in einer Entfernung von 1,7 Lichtjahren von diesem Stern.
Links
Grenze des Sonnensystems
Wo sind die Voyager Sonden? Liveticker
Musik der Voyager Golden Record
Bilder der Voyager Golden Record
Decoding the Golden Record
Die HI Wasserstofflinie
Unterstützt den Podcast
Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns gerne via Steady, Patreon und Paypal unterstützen. Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at vorbei.
Zudem findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Redbubble Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!


