
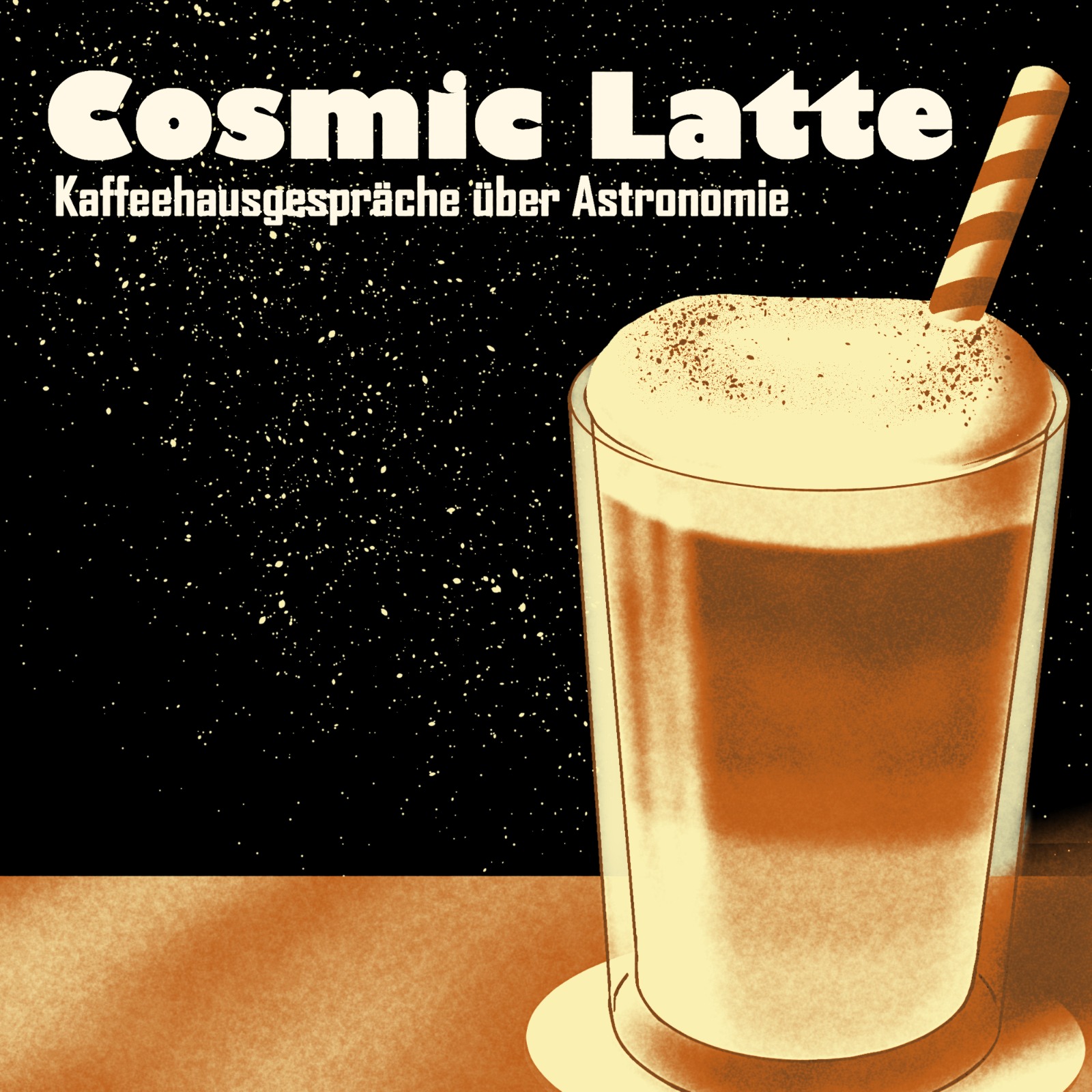
Cosmic Latte
Eva Pech, Jana Steuer, Elka Xharo
Willkommen beim Cosmic Latte Podcast!
Begleite Eva, wenn sie mit Jana und Elka bei einem Kaffeehausgespräch, über Galaxien, Sterne und die faszinierenden Wunder unseres Universums plaudert. Ihre Leidenschaft für Astronomie und Wissenschaftskommunikation verbindet die Podcasterinnen miteinander.
Eva studiert Astronomie an der Universität Wien. Sie hat einen Abschluss in Kommunikationswissenschaften und erst vor kurzem ihre Masterarbeit über Wissenschaftskommunikation geschrieben. Sie ist neben diesem Podcast auch im Podcast „Das Universum“ zu hören, wo sie über Science in Science-Fiction Filmen redet. Sie träumt davon, eines Tages ins Weltall fliegen zu können.
Elka ist zur Zeit FH-Lektorin und hat eine Ausbildung zur Medizinphysikerin abgeschlossen. Außerdem beitreibt sie als @thesciencyfeminist auf Instagram einen erfolgreichen Wissenschaftskommunikationskanal, der vor allem Frauen in der Wissenschaft sichtbar machen soll. Sie träumt davon, eines Tages Evas Weltraumflug programmieren zu dürfen.
Jana ist unser neuer Zugang bei Cosmic Latte. Sie hat nach ihrem Masterabschluss in Astrophysik nach Exoplaneten geforscht, bevor sie in die Wissenschaftskommunikation wechselte. Heute ist sie Redaktionsmitglied des YouTube-Kanals „Terra X Lesch & Co“. Neben Cosmic Latte ist sie auch in den beiden Podcasts „translunar“ und „Ein großer Schritt für die Menschheit“ zu hören.
Tauche in diesem Podcast in spannende astronomische Gespräche ein. Mach es dir gemütlich und erfahre Interessantes über die Geheimnisse des Kosmos!
Falls du Fragen hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, erreichst du uns jederzeit per E-Mail unter: kontakt@cosmiclatte.at.
Du kannst uns gerne unterstützen und zwar bei Steady (https://steadyhq.com/de/cosmiclatte/), Patreon (https://patreon.com/CosmiclattePodcast), Paypal (https://paypal.me/cosmiclattepod)!
Begleite Eva, wenn sie mit Jana und Elka bei einem Kaffeehausgespräch, über Galaxien, Sterne und die faszinierenden Wunder unseres Universums plaudert. Ihre Leidenschaft für Astronomie und Wissenschaftskommunikation verbindet die Podcasterinnen miteinander.
Eva studiert Astronomie an der Universität Wien. Sie hat einen Abschluss in Kommunikationswissenschaften und erst vor kurzem ihre Masterarbeit über Wissenschaftskommunikation geschrieben. Sie ist neben diesem Podcast auch im Podcast „Das Universum“ zu hören, wo sie über Science in Science-Fiction Filmen redet. Sie träumt davon, eines Tages ins Weltall fliegen zu können.
Elka ist zur Zeit FH-Lektorin und hat eine Ausbildung zur Medizinphysikerin abgeschlossen. Außerdem beitreibt sie als @thesciencyfeminist auf Instagram einen erfolgreichen Wissenschaftskommunikationskanal, der vor allem Frauen in der Wissenschaft sichtbar machen soll. Sie träumt davon, eines Tages Evas Weltraumflug programmieren zu dürfen.
Jana ist unser neuer Zugang bei Cosmic Latte. Sie hat nach ihrem Masterabschluss in Astrophysik nach Exoplaneten geforscht, bevor sie in die Wissenschaftskommunikation wechselte. Heute ist sie Redaktionsmitglied des YouTube-Kanals „Terra X Lesch & Co“. Neben Cosmic Latte ist sie auch in den beiden Podcasts „translunar“ und „Ein großer Schritt für die Menschheit“ zu hören.
Tauche in diesem Podcast in spannende astronomische Gespräche ein. Mach es dir gemütlich und erfahre Interessantes über die Geheimnisse des Kosmos!
Falls du Fragen hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, erreichst du uns jederzeit per E-Mail unter: kontakt@cosmiclatte.at.
Du kannst uns gerne unterstützen und zwar bei Steady (https://steadyhq.com/de/cosmiclatte/), Patreon (https://patreon.com/CosmiclattePodcast), Paypal (https://paypal.me/cosmiclattepod)!
Episodes
Mentioned books

Jun 27, 2024 • 1h 8min
CL036 Cosmic Latte hat Geburtstag: Auf der Suche nach dem Astronomy High
Die Episode mit der Partywolke und einem Gewinnspiel
Cosmic Latte hat Geburtstag!
Am 23. Juni 2024 hat Cosmic Latte seinen 2. Geburtstag gefeiert. Die erste Folge ist am 23. Juni 2022 erschienen und seitdem hat sich viel getan. Teresa, mit der Eva den Podcast damals im Rahmen einer Uni-Lehrveranstaltung gestartet hat, ist mittlerweile nicht mehr mit dabei, weil sie sich auf ihre Masterarbeit konzentrieren musste. Dafür sind Elka, Jana und Peter mit dazu gekommen. Seit es Cosmic Latte gibt, sind die Folgen ungefähr 130.000 Mal runtergeladen worden und Podcasts haben sich ganz allgemein gut entwickelt.
Eine Analyse hat ergeben, dass 2022 weltweit circa 4 Millionen Podcasts existiert haben, davon sind aber nur 4% aktiv, nämlich 156.000. Das heißt: Cosmic Latte ist schon mal besser dabei als 96% aller Podcasts weltweit!
Astronomy High: Warum wir Podcasts machen!
Wer läuft, kennt das "Runners High", das von uns aber bis jetzt nur Elka erlebt hat. Was wir aber alle kennen ist das "Astronomy High" und das wollen wir gerne teilen. Astronomie kann einen Perspektivwechsel auslösen; kann neugierig machen und faszinieren und all das wollen wir gerne mit so vielen Menschen wie möglich teilen.
Geburtstagsgeschenk 1: Russells Teekanne
Weil es unsere Geburtstagsfolge ist, haben wir alle Geschenke mitgebracht. Eva möchte gerne eine Teeparty machen und präsentiert deshalb Russells Teekanne. Diese Idee stammt vom Philosophen Bertrand Russell und aus dem Jahr 1952. Stellen wir uns vor, wir würden behaupten, da wäre eine kleine Teekanne, die in einer elliptischen Bahn um die Sonne zwischen Erde und Mars kreist. Niemand könnte das beobachten, auch nicht mit dem größten Teleskop der Erde. Es kann also niemand widerlegen, dass die Kanne NICHT da ist. Aber das ist noch lange kein Grund, an die Existenz der Teekanne zu glauben. Natürlich geht es nicht wirklich um eine Teekanne, Russell hat die Geschichte als Argument dafür gebracht, dass die Beweislast bei der Person liegt, die eine Behauptung aufstellt, und nicht bei denjenigen, die die Behauptung anzweifeln. Russells Teekanne wird oft in Diskussionen über Religion und Wissenschaft zitiert, um zu verdeutlichen, dass es unvernünftig ist, von anderen zu verlangen, den Nichtnachweis von etwas Unbeweisbarem zu liefern.
Das ist natürlich wichtig, wenn es um wissenschaftliche Belege geht, aber auch wenn wir um so etwas wie Astrologie nachdenken…
Geburtstagsgeschenk 2: Der Overview-Effekt
Elka hat zur Party einen Blick von oben mitgebracht. "Raumfahrt macht links" könnte man ihre Geschichte zusammenfassen; tatsächlich geht es um den Overview-Effekt, den Frank White 1987 beschrieben hat: Wer einmal die Erde aus dem All gesehen hat, ändert dadurch auch seine gesamte Einstellung gegenüber dem Planeten. Es entwickelt sich ein Gefühl der "Verbundenheit allen Lebens auf der Erde" und eine Verantwortung für die Umwelt. Der syrische Astronaut Mohammed Faris meinte zum Beispiel: „Aus dem Weltall sah ich die Erde – unbeschreiblich schön, die Wunden durch nationale Grenzen verschwunden.“ Und der erste Mensch im All, Juri Gagarin, sagte: „Ich sah, wie schön unser Planet ist. Leute, lasst uns diese Schönheit erhalten und vermehren, nicht zerstören.“
Geburtstagsgeschenk 3: Apollo 13
Jana hat für die Party die Geschichte von Apollo 13 mitgebracht. Eigentlich wollte man zum Mond fliegen und dort landen. Aber dann explodierte ein Treibstofftank. Die drei Astronauten an Bord konnten nur durch eine sehr aufwendige Operation gerettet werden und waren dabei weiter von der Erde entfernt als alle anderen Menschen bisher. Weltweit erweckte die Mission durch ihre Dramatik natürlich großes Aufsehen. Selbst sowjetische Schiffe näherten sich am 17. April 1970, während des kalten Kriegs der Landestelle im Pazifik, um Hilfe zu leisten, falls nötig. Jack Gould von der New York Times sagte damals, dass Apollo 13, die so nah einer schrecklichen Tragödie kam, womöglich die Welt in gemeinsamer Sorge wohl mehr vereint hat als jede erfolgreiche Mondlandung es jemals gekonnt hätte.
Auf in die Partywolke
Für eine Geburtstagsparty brauchen wir natürlich auch ein bisschen Sekt. Also machen wir uns auf in die Partywolke. Oder besser gesagt: Wir fliegen zu Sagittarius B2, eine riesige Molekülwolke nur 390 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt. Die Wolke hat 3 Millionen Mal so viel Masse wie die Sonne und besteht im Wesentlichen aus Wasserstoff. Dort finden sich aber auch jede Menge komplexe Moleküle, unter anderem Ethanol. Das ist das, was wir als Alkohol kennen und gerne trinken (wenn auch selten pur). Die Zusammensetzung der Wolke wurde mit Hilfe eines Spektrographen entdeckt, als man versuchte, Aminosäuren zu finden. Es wurde auch ein Ester, Ethylformiat, entdeckt, der ein wichtiger Vorläufer der Aminosäuren ist. Dieser Ester ist auch für den Geschmack von Himbeeren verantwortlich und für das typische Rum-Aroma verantwortlich. In der Wolke ist also alles da, was man für einen ordentlichen Party-Cocktail braucht.
Party auf der ISS
Auf der Raumstation herrscht eigentlich Alkoholverbot. Aber kreative Menschen haben es immer wieder geschafft, ein bisschen Cognac oder Vodka ins All zu schmuggeln. Hochoffiziell an Bord gebracht wurde 2019 ein Bordeaux-Wein (Château Petrus, Jahrgang 2000) um herauszufinden, wie die Mikrogravitation den Reifeprozess beeinflusst. Nach 438 Tage im All kehrte der Wein zur Erde zurück und wurde mit einem gleichartigen Wein verglichen, der auf der Erde gealtert war. Tatsächlich stellte sich heraus, dass der Weltall-Wein weiter gereift war, als der auf der Erde. Prost!
Wünsch dir was!
Für die romantische Stimmung erzählt uns Elka noch ein wenig was über die Sternschnuppen. Eine Sternschnuppe entsteht, wenn kleine Partikel aus dem Weltraum in die Erdatmosphäre eintreten und dort verglühen. Diese Partikel, oft nicht größer als ein Sandkorn, werden Meteoroiden genannt. Der sichtbare Lichtstreifen wird als Meteor oder umgangssprachlich als Sternschnuppe bezeichnet. Größere Meteoroiden, die nicht vollständig verglühen und die Erdoberfläche erreichen, werden Meteoriten genannt.
Meteorströme, wie die Perseiden im August, entstehen, wenn die Erde die Bahnen von Kometen oder Asteroiden kreuzt, die große Mengen an Staub und Trümmern hinterlassen haben. Andere Meteorschauer sind zum Beispiel die Geminiden Mitte Dezember, verursacht durch den Asteroiden Phaethon oder die Quadrantiden, Anfang Januar, verursacht durchden Asteroiden 2003 EH1 (der Name stammt vom ehemaligen Sternbild Mauerquadrant).
Luftballons
Jede Party braucht Luftballons und Jana erzählt uns etwas darüber, was sie zum fliegen bringt, nämlich Helium. Helium ist ein geruch-, geschmack- und farbloses Edelgas. Es wird erst nahe 0 Kelvin flüssig und ist die einzige Substanz, die bei 0 K und Normaldruck nicht fest wird, was es für Kühlzwecke, z.B. bei Teleskopen oder in der Supraleitung, unverzichtbar macht. Der Name stammt vom Sonnengott "Helios". Helium wurde am 18. August 1868 von Jules Janssen in Indien bei einer Sonnenfinsternis entdeckt. Helium entstand größtenteils in den ersten drei Minuten nach dem Urknall und macht 23% der Masse der baryonischen Materie aus. In Sternen mittlerer Masse (bis 2,2 Sonnenmassen) kann es zum sogenannten Helium Flash kommen, einem explosionsartigen Fusionsprozess, bei dem Helium zu Kohlenstoff wird. Dies geschieht, wenn im Kern kein Wasserstoff mehr für die Proton-Proton-Reaktion übrig ist, was zu einer Kontraktion des Sterns und einem Anstieg der Kerntemperatur führt. Bei etwa 100 Millionen Kelvin beginnt das Heliumbrennen explosionsartig, erzeugt enorme Energiemengen und stabilisiert schließlich. Bei massereicheren Sternen (über 2,2 Sonnenmassen) zündet das Heliumbrennen ohne diese explosive Phase.
Ein Großteil des Heliums auf der Erde entsteht allerdings ganz anders, und zwar durch den radioaktiven Zerfall von Uran und anderen Elementen. Dabei entstehen Alpha-Teilchen, die Elektronen einfangen und so zu Heliumatomen werden.
Wenn man Helium einatmet, klingt die Stimme etwa 2,5 Oktaven höher, da Helium weniger dicht als Luft ist und Schallwellen sich schneller bewegen, was die Frequenz der Stimme erhöht.
Gewinnspiel
Natürlich gibt es auch für die Hörerinnen und Hörer ein Geschenk. Aber nur, wenn zuerst ein paar Fragen beantwortet werden, die zeigen, ob ihr in den bisherigen 35 Folgen gut aufgepasst habt:
Frage 1: Wie ist der Hex-Wert von Cosmic Latte?
Frage 2: Welche Fernsehserie hat Evi schon früh für Asteroideneinschläge interessiert?
Frage 3: An welchem Tag bekommt Elka "dank Jupiter" alles was sie möchte?
Frage 4: An welchem Observatorium hat Jana Exoplaneten beobachtet?
Schickt uns eure Antworten bis 31. Juli 2024 an kontakt@cosmiclatte.at und mit ein wenig Glück gewinnt ihr das Buch "Alien Earths" von Lisa Kaltenegger.
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen.
Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Instagram Jana|
Redbubble Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Jun 13, 2024 • 1h 7min
CL035 Venus, die böse Zwillingsschwester der Erde
Die Episode über Leben und Tod auf der Venus
Einleitung
In dieser Folge gibt es wieder Neues von der Sternwarte, denn Eva hat ihr Praktikum absolviert und eine Beobachtung am vlt gemacht. Mit dem vlt ist das Vienna Little Telescope gemeint, das 80cm Spiegelteleskop der Universität Wien.
Was es alles zu tun gibt, bevor man mit der eigentlichen Beobachtung loslegt, erzählt sie Jana, die sich an ihre Beobachtungsnächte zurückerinnert.
Venus - Schwesternplanet der Erde?
Gleich und doch verschieden. Die Venus, wird auch als „Schwesternplanet“ der Erde bezeichnet. In dieser Podcastfolge werfen Jana und Eva einen genauen Blick auf die Fakten und die Geschichten rund um den zweite Planeten in unserem Sonnensystem und stellen bald fest, dass Venus und Erde, von Größe und Masse abgesehen, einander nicht sehr ähnlich sind.
Die Venus wurde nach der Liebesgöttin Venus (Aphrodite bei den Griechen) benannt und war schon immer von mythologischer Bedeutung. Verschiedene Kulturen verehrten sie als Göttin der Liebe und des Krieges. Sie ist der zweite Planet von der Sonne und etwa 108 Millionen Kilometer von ihr entfernt. Mit einem Durchmesser von 12.100 km ähnelt die Venus der Erde in Größe, Masse und Gravitation. Der minimale Abstand zur Erde beträgt 38 Millionen Kilometer, und nach Sonne und Mond ist sie das hellste Objekt am Himmel, bekannt als Abend- und Morgenstern.
Die Venus ist ständig von einer dichten Wolkenschicht umhüllt, die ihre Oberfläche nur mit Radar sichtbar macht. Mit durchschnittlichen Temperaturen von 464°C ist sie der heißeste Planet in unserem Sonnensystem, und der Oberflächendruck ist 90-mal höher als auf der Erde. Ihre Atmosphäre besteht zu 96% aus Kohlendioxid und enthält dichte Schwefelsäurewolken.
Früher herrschte die Meinung, unterhalb der Wolken würde sich eine Art Dschungel-Paradies befinden. Die Venus war daher immer wieder Inspriration für Science-Fiction Autoren wie Jules Verne, Edgar Rice Burroughs und Isaac Asimov. Sie haben in ihren Werken bewohnte Welten und Wolkenstädte auf der Venus beschrieben.
Die Venus hat keinen Mond. Zudem weist sie einige Besonderheiten auf:
Mit einer Achsenneigung von 177,36° steht sie sozusagen auf dem Kopf und rotiert retrograd, also mit dem Uhrzeigersinn (von “oben” betrachtet). Auf der Venus geht also die Sonne im Westen auf und im Osten unter. Zudem gibt es keine Jahreszeiten aufgrund der geringen Neigung des Äquators gegen die Bahnebene. Am erstaunlichsten ist aber wahrscheinlich die Tatsache, dass ein Venusjahr kürzer ist als ein Venustag! Die Venus benötigt nur 225 Tage für eine Umrundung um die Sonne, aber 243 Tage für eine Drehung um ihre eigene Achse.
Leben auf der Venus?
Die Diskussion über die Möglichkeit von Mikroorganismen in den Venuswolken wurde immer wieder neu angefacht. Tatsächlich herrschen in 48 bis 80 km Höhe milde Temperaturen und gemäßigter Druck. Könnte es Mikroorganismen in den Wolken geben?
Die Entdeckung des Biomarkers Phosphin durch das ALMA Radioteleskop im Jahr 2020 entpuppte sich leider als falsche Kalibrierung des Teleskops.
Missionen zur Venus
Pioniermissionen wie Mariner 2 im Jahr 1962 und die sowjetischen Venera-Lander lieferten erste Daten und Bilder von der Venusoberfläche. Moderne Erforschung erfolgte durch die ESA-Mission Venus Express von 2005 bis 2014 und den japanischen Orbiter Akatsuki, der seit 2010 im Einsatz ist. Zukünftige Missionen wie EnVision von der ESA, Venera-D von Russland sowie DAVINCI und VERITAS von der NASA werden die Venus weiter erforschen.
Hier gibt es eine Übersicht über alle Bilder, die wir von der Venusoberfläche haben.
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen.
Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Redbubble Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Jun 3, 2024 • 37sec
Ankündigung Hörerinnentreffen im Kino am 06.Juni 2024
Wir gehen ins Kino! Am 06.06. könnt ihr mit Eva und Peter ins Kino gehen und mit ihnen Furiosa ansehen!
Wir gehen ins Kino!
Wollt ihr euch mit uns den neuen Mad Max Film Furiosa ansehen und darüber danach ein wenig plaudern? Dann habt ihr am 06.06. die Gelegenheit dazu!
Filmbeginn ist um 17 Uhr im Cineplexx SCS Westfield!
Wir freuen uns auf euch!
Eva und Peter
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

May 30, 2024 • 1h 12min
CL034 Aliens, fremde Welten und der Schreibtisch von Carl Sagan
Die Episode über die Suche nach Exoplaneten, außerirdischem Leben und Carl Sagans Schreibtisch - Special mit Astrophysikerin Lisa Kaltenegger
Special Guest: Lisa Kaltenegger
Wir haben diesmal einen ganz besonderen Gast: Die Astronomin Lisa Kaltenegger. Sie hat in Graz studiert und nicht nur ein Studium der Astronomie abgeschlossen, sondern auch eines der technischen Physik. Sie hat bei der ESA, der Harvard University und dem Max-Planck-Institut für Astronomy in Heidelberg gearbeitet. Mittlerweile ist sie Professorin an der Cornell Universität und arbeitet dort nicht nur am Carl Sagan Institute sondern sitzt dabei auch tatsächlich an genau dem Schreibtisch, an dem damals Carl Sagan selbst gearbeitet hat.
Ihr Spezialgebiet ist die Suche nach extrasolaren Planeten, aber vor allem auch die Charakterisierung dieser Himmelskörper. Es geht um die Frage, ob da draußen irgendwo noch eine "zweite Erde" ist, also ein Planet, auf dem lebensfreundliche Bedingungen herrschen. Und ob es dort vielleicht sogar Leben geben kann.
Lisa Kalteneggers internationaler Weg
Bevor wir über die Wissenschaft reden, sprechen wir mit Lisa zuerst über ihren eigenen Werdegang. Wie ist es, sich als Frau in gleich zwei eher männerdominierten Studien durchzusetzen und wie ist es, wenn man - wie Lisa - schon früh ins Ausland geht, um dort zu arbeiten? Lisa erzählt von der Unterstützung, die so von ihren Kolleg:innen erhalten hat und auch von dem Mut, den es braucht, sich in der akademischen Welt zu behaupten.
Asteroid Kaltenegger
Lisa Kaltenegger hat jede Menge Preise gewonnen. Und im Jahr 2014 wurde sogar ein Asteroid nach ihr benannt: 7734 Kaltenegger - der zum Glück aber keine Anstalten macht, mit der Erde zu kollidieren.
Auf der Suche nach erdähnlichen Planeten
Lisa war Teil des Teams, das 2013 die Entdeckung der Planeten Kepler 62e und Kepler 62f bekannt gegeben hat. Das waren die ersten Planeten, die das Weltraumteleskop Kepler entdeckt hat und die potentiell erdähnlich sein könnten. Hier gibt es eine Pressekonferenz mit Lisa zur Entdeckung. Aktuell ist sie Teil des Teams der [TESS-Mission (Transiting Exoplanet Survey Satellite)[https://science.nasa.gov/mission/tess) und weiter auf der Suche nach neuen, unbekannten Welten.
Die Erde als Exoplanet
Lisa hat sich nicht nur mit den Planeten anderer Sterne beschäftigt und der Frage, ob es dort Leben geben kann und wie man es entdecken könnte. Sie war auch eine Pionierin auf dem Gebiet der Charakterisierung der Erde als "fremder Planet". Das klingt seltsam, ist aber sehr vernünftig. Die Erde war früher ganz anders als heute; sie hat sich entwickelt und mit ihr das Leben. Lisa hat untersucht, zu welchen Zeiten in der Geschichte der Erde andere Lebewesen die Chance gehabt hätten, das Leben auf unserem Planeten zu entdecken, zum Beispiel in den Arbeiten "Past, present and future stars that can see Earth as a transiting exoplanet" oder "Spectral Evolution of an Earth-Like Planet".
Alien Earths
Lisa hat sich auch mit der Vermittlung ihres Wissens beschäftigt und zwei Bücher geschrieben. Das erste ist 2015 erschienen und heißt "Sind wir allein im Universum? Meine Spurensuche im All". Ihr aktuelles Buch ist erst vor ein paar Wochen erschienen und hat den Titel: "Alien Earths: Auf der Suche nach neuen Planeten und außerirdischem Leben". Und über die "Alien Earths" reden wir auch im Podcast, denn Lisa hat sich als Science Fiction Fan auch mit den fiktiven Welten auseinandergesetzt. Zum Beispiel mit Tatooine aus Star Wars - oder den bewohnbaren Monden aus "Avatar" (zu diesem Thema hat sie auch wissenschaftlich geforscht: "Characterizing Habitable Exo-Moons").
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen.
Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Redbubble Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

May 16, 2024 • 38min
CL033 Das Echo des Urknalls
Die Episode über die kosmische Hintergrundstrahlung - was vom Urknall übrig blieb
Fragen über die Gammablitze und die Zerstörung der Erde
Wir beginnen die Folge mit einem kurzen Rückblick auf Folge 28, in der Jana von den Gammablitzen erzählt hat. Einige von euch hatten da noch Fragen, zum Beispiel wie lange so ein Gammablitz dauert. Die Antwort: Kommt drauf an, ein paar Millisekunden bis ein paar Minuten.
Und wie nahe muss so eine Explosion stattfinden, damit sie uns gefährlich wird? Wenn der Gammablitz weniger als 200 Lichtjahre weit weg ist, dann ist die Energie groß genug, um die Erde zu verdampfen. Ist er weiter weg (bis zu 6500 Lichtjahre) kann die Energie immer noch reichen, um die Ozonschicht zu zerstören, so dass die Erde der UV-Strahlung der Sonne ungeschützt ausgesetzt ist, was für die Lebewesen unangenehme Folgen hätte. Ein typischer Gammablitz würde global im Schnitt 38% der Ozonschicht zerstören, lokal bis zu 74%; die signifikante Reduzierung (min. 10%) würde etwa 7 Jahre andauern.
Die Gammastrahlung kann auch zur Entstehung von Stickstoffdioxid führen, wodurch weniger Sonnenlicht die Erde erreicht, was zu einer globalen Abkühlung führt und saurem Regen.
Mehr dazu könnt ihr in dieser Arbeit lesen.
Tscherenkow-Strahlung
Hans hat uns von seinen Erfahrungen mit Tscherenkow-Strahlung in AKWs erzäht, was zu einer Diskussion des seltsamen AKW Zwentendorf in Österreich geführt hat. Das wurde komplett fertig gebaut, aber nie in Betrieb genommen. Aber immerhin kann man jetzt dort aus nächster Nähe anschauen, wie so ein Ding aussieht.
Das Echo des Urknalls - die kosmische Hintergrundstrahlung
Die kosmische Hintergrundstrahlung (auch "cosmic microwave background - CMB) ist ein Relikt aus der Frühzeit des Universums und füllt das ganze Universum. Sie dient als Beleg für die Urknalltheorie und ist nicht zu verwechseln mit der kosmischen Strahlung.
Etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall kühlte das Universum soweit ab, dass sich neutrale Atome bilden konnten. Vor dieser "Rekombination" war das Universum ein undurchsichtiges Plasma aus Atomkernen, Elektronen und Photonen. Nach dem sich die Elektronen dann aber an die Atomkerne gebunden hatten ("Rekombination") konnten sich die Photonen frei bewegen und in alle Richtungen ausbreiten. Das ist die kosmische Hintergrundstrahlung, die sich von allen Punkten des Universums in alle Richtungen ausbreitet. Diese ursprüngliche hochenergetische Strahlung hat sich durch die Expansion des Universums mittlerweile "abgekühlt" und ist heute langwellige Mikrowellenstrahlung mit einer Temperatur von circa 3 Kelvin.
1964 entdeckten Arno Penzias und Robert Wilson zufällig dieses kosmische Rauschen mit einer Funkantenne. Für ihre Entdeckung erhielten sie 1978 den Nobelpreis. Die Theorie dazu wurde aber bereits in den 1940er Jahren von Wissenschaftlern wie George Gamow und Ralph Alpher entwickelt.
Jeder Kubikzentimeter Weltraum enthält durchschnittlich 400 Photonen der Hintergrundstrahlung und wo immer man sich auch befindet, kann man sie beobachten.
Mit Weltraumteleskopen konnten immer bessere Messungen angestellt werden:
COBE (1989): Erste detaillierte Untersuchung des CMB, entdeckte Temperaturschwankungen und bestätigte das Urknallmodell.
WMAP (2001-2010): Verbesserte die Präzision der CMB-Messungen, bestätigte die Zusammensetzung des Universums und die kosmologischen Parameter.
Planck (2009-2013): Lieferte die genauesten Messungen der CMB, bestätigte das Standardmodell der Kosmologie und enthüllte neue Details über das frühe Universum.
Boden- und ballongestützte Experimente wie BICEP2 und das South Pole Telescope untersuchen die CMB-Polarisation und suchen nach primordialen Gravitationswellen, um mehr über die kosmische Inflation zu erfahren.
Der CMB ist wie ein "Babyfoto" des Universums. Er zeigt minimale Dichtefluktuationen, die zur Bildung von Sternen und Galaxien führten. Diese winzigen Variationen sind der Ursprung aller großen Strukturen, die wir heute sehen.
Die kosmische Hintergrundstrahlung ist ein faszinierendes Fenster in die frühe Geschichte unseres Universums und bestätigt die Theorien zur Entstehung und Entwicklung des Kosmos.
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen.
Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Redbubble Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

May 2, 2024 • 56min
CL032 Das Ende ist nah! Apokalypse in der Science-Fiction
Die Episode über die vielen Möglichkeiten, wie die Welt zu Ende gehen kann - Science-Fiction Special mit Gast Peter Koller
CL032 Das Ende ist nah! Apokalypse in der Science-Fiction
Die Episode über die vielen Möglichkeiten, wie die Welt zu Ende gehen kann - Science-Fiction Special mit Gast Peter Koller
Ihr könnt uns gerne unterstützen und zwar bei Steady, Patreon und Paypal!
Einleitung
Es ist wieder Zeit für ein Science-Fiction Special!
Der Drehbuchautor und Science-Fiction Aficionado Peter Koller ist zum zweiten Mal Gast bei Cosmic Latte. Dieses Mal redet Eva mit ihm darüber, wie die Welt in den Science-Fiction-Filmen untergeht. Welche Szenarien werden im Film am liebsten heraufbeschworen und halten sie einem Science-Check stand?
Die Faszination der Apokalypse
Die Menschheit ist seit jeher vom Ende der Welt fasziniert. Bereits in der Bibel taucht die Apokalypse, wie der Weltuntergang in der religiösen Literatur beschrieben wird, auf. Das Thema begleitet uns schon seit langer Zeit. Jede Generation hat dabei ihr bestimmtes Thema, wie sie damit umgeht. Waren es in den 1950er und 1960er Jahren die atomare Bedrohung und der Kalte Krieg, die Endzeitszenarien beschwören, sind es in den späteren Jahren Umweltkatastrophen und der Klimawandel. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Weltuntergang ein beliebtes Motiv in der Science-Fiction ist.
Der Weltuntergang in der Science-Fiction
Mit der Mad Max Reihe lieferte George Miller einen Entwurf für den Untergang der zivilen Gesellschaft, wie wir sie kennen und baut eine neue brachiale, gewaltvolle und männlich geprägte Welt auf und zeichnet damit einen Gegenentwurf zum modernen Menschen.
Wie passiert nun das Ende der Welt in der Sci-Fi?
Verschiedene Szenarien, von Alien-Invasionen über Naturkatastrophen bis hin zu kosmischen Ereignissen, bietet das Genre eine Vielfalt an möglichen Enden für uns Menschen.
1. Kriege und Atomkatastrophen:
Der kalte Krieg und die Bedrohung durch Atomwaffen sowie der nukleare Rüstungswettlauf dienen hier als Ausgangspunkt. Filme wie "Dr. Strangelove" (1964) nutzen den kalten Krieg für satirische Betrachtungen über die Absurdität des nuklearen Rüstungswettlaufs und die möglichen Folgen einer nuklearen Apokalypse.
2. Naturkatastrophen: "The Day After Tomorrow" (2004) zeigt eine Welt, in der der Klimawandel zu katastrophalen globalen Veränderungen führt. Solche Climate Fiction (Cli-Fi) wirft ein Licht auf die drängenden Umweltprobleme unserer Zeit.
3. Künstliche Intelligenz: In Filmen wie "Terminator" (1984) und "Matrix" (1999) übernehmen Maschinen die Macht. Diese Szenarien erforschen die Grenzen der Technologie und unsere Abhängigkeit von ihr.
4. Alien Invasion: Der Film "Per Anhalter durch die Galaxis" (2005) verwendet das Motiv der Alien-Invasion, um die Erde zu zerstören, damit Platz für eine Hyperraumroute geschaffen werden kann. Dies führt zu humorvollen, doch tiefgründigen Überlegungen über den Platz der Menschheit im Universum.
5. Plagen und Pandemien:
Seit der Covid-19 Pandemie nicht mehr nur Science-Fiction, sind Pandemien ein beliebtes Motiv um die Welt untergehen zu lassen. Bereits 1826 ließ Mary Shelley in "The Last Man" (1826) in einer weltweiten Plage alle Menschen sterben. Eine Mischform zwischen Alien-Invasion und Plagen bildet die Gefahr von Viren aus dem All! In den Filmen "Körperfresser" und "Andromeda" und auch in "Das Ding" werden die Menschen von außerirdischen Organismen bedroht.
In der Wissenschaft forschte Fred Hoyle über die Gefahren dieser Art aus dem Weltall und stellte u.a. die Theorie über die Panspermie (dass das Leben über Asteroiden auf die Erde gelangte) auf.
6. Kosmische Katastrophen: Filme wie "Deep Impact" und "Armageddon" (beide 1998) sowie "Don’t Look Up" (2021) konfrontieren uns mit der Vorstellung, dass kosmische Ereignisse wie Asteroideneinschläge das Ende der Menschheit bedeuten könnten. Wissenschaftliche Programme wie das Near-Earth Object Program der NASA und die ESA’s Space Safety Programme unterstreichen die realen Bemühungen, solche Bedrohungen abzuwenden.
7. Die Vernichtung des Universum
Das Buch, dessen Titel Peter nicht eingefallen ist, ist Schild's Ladder von Greg Egan.
Wissenschaft und Fiktion: Während Sci-Fi oft spekulative Technologien und Szenarien präsentiert, basieren viele der Konzepte auf echten wissenschaftlichen Überlegungen und Forschungen, von der Asteroidenabwehr bis hin zur Untersuchung von Weltraumwetter und sonneninduzierten Katastrophen.
Ein Mission um die Abwehr gefährlicher Asteroiden zu testen war DART von der NASA, wo der Asteroid Dimorphos von einer Raumsonde - absichtlich! - gerammt wurde, um seine Umlaufbahn zu verändern, was erfolgreich gelungen ist. Seine Umlaufbahn um den größeren Asteroid Didymos wurde um 34 Minuten verkürzt.
Mehr zu Asteroiden und planetarer Verteidigung gibt es in CL008.
Der Komet Shoemaker-Levy 9, der 1994 mit dem Jupiter kollidiert ist, war das erste Ereignis dieser Art, das ausführlich wissenschaftlich studiert werden konnte.
Vagabundiere Planeten wie in "Melancholia" (2011) kann es in echt auch geben. Es sind schon jede Menge davon gefunden worden, es ist aber extrem unwahrscheinlich, dass sie mit der Erde kollidieren und wir wüssten auch ein paar hundert Jahre vorher Bescheid.
Eine (unvollständige) Liste der Filme, die besprochen wurden:
Mad Max (1979)
Mad Max Fury Road (2015)
The Terminator (1984)
The Matrix (1999)
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (2005)
Moonfall (2022)
The Day After Tomorrow (2004)
Deep Impact (1998)
Armageddon (1998)
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
The Andromeda Strain (1971)
Invasion of the Body Snatchers (1978)
Invasion of the Body Snatchers (Die Dämonischen) (1956)
28 Days Later (2002)
Evolution (2001)
The Thing (1982)
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen.
Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
X Cosmic Latte
Instagram Evi |
Redbubble Evi
_
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Apr 18, 2024 • 33min
CL031 Keine Rache für Pluto!
Die Episode über Pluto, warum er kein Planet mehr ist und warum das manche nicht wahr haben wollen
CL031 - Keine Rache für Pluto!
Die Episode über Pluto, warum er kein Planet mehr ist und warum das manche nicht wahr haben wollen
Ihr könnt uns gerne unterstützen und zwar bei Steady, Patreon, Paypal!
Einleitung
In Teilen Nordamerikas war vor kurzem eine Sonnenfinsternis zu sehen. Eva und Elka waren zwar nicht vor Ort, aber Elka weiß, wann wir in Europa die nächste Sonnenfinsternis erleben. In Österreich wird dieses Ereignis erst wieder 2081 zu sehen sein - Eva wird dann ihren 100. Geburtstag dementsprechend feiern. 2075 können wir zumindest eine ringförmige Sonnenfinsternis in Österreich erleben. Oder wer nicht so lange warten will: 2027 nach Spanien reisen!
Zuletzt hat uns auch die traurige Nachricht über das Ableben von Peter Higgs erreicht. Schon in den 1960er Jahren hat er die Existenz eines Feldes und dazugehörigen Teilchen vorhergesagt, die allen Teilchen ihre Masse verleihen. 2012 konnte dieses sogenannte Higgs-Boson auch erstmals am CERN nachgewiesen werden! Ein Jahr später erhielt Peter Higgs für seine Theorien den Nobelpreis.
Warum ist Pluto kein Planet mehr?
Bis 2006 war Pluto als einer der neun Planeten unseres Sonnensystems anerkannt. Doch dann verlor er diesen Status. Was war passiert?
Der kleinste Planet im Sonnensystem ist Merkur, der mit einem Durchmesser von 4.880 km, vergleichbar mit den großen Monden einiger anderer Planeten, wie Ganymed und Titan, ist. Doch die Größe allein bestimmt nicht den Planetenstatus.
Pluto selbst hat einen Durchmesser von nur 2.390 km und wurde 1930 am Lowell Observatorium von Clyde Tombaugh entdeckt. Die Entdeckung war das Ergebnis der Suche nach einem unbekannten "Planeten X", der aufgrund unerklärlicher Bahnabweichungen Neptuns postuliert wurde.
Die Entdeckung Neptuns im Jahr 1846 von Johann Gottfried Galle an der Berliner Sternwarte, basierte auf den mathematischen Vorhersagen von Urbain Le Verrier, der damit die Bahnabweichungen von Uranus erklärte. Diese Entdeckung, die erste, die auf theoretischen Vorhersagen basierte und dann visuell bestätigt wurde, markierte einen bedeutenden Meilenstein in der Astronomie und bestätigte die Newtonsche Mechanik.
Die Entdeckung von Pluto 1930 durch Clyde Tombaugh wurde anfangs ähnlich euphorisch aufgenommen worden, obwohl er letztlich zufällig und nicht an der vorhergesagten Position gefunden wurde. Trotz anfänglicher Annahme, Pluto könnte die Bahnstörungen von Neptun verursachen, stellte sich bald heraus, dass seine Größe und Gravitationskraft dafür nicht ausreichten. Allerdings konnten erst die Daten der Voyager-Missionen zeigen, dass gar kein weiterer Planet notwendig war, um die Bahn Neptuns zu erklären - die Berechnung von der Erde aus waren schlicht ungenau gewesen.
Transneptunische Objekte und der Fall Plutos
Ab 1992 führte die Entdeckung weiterer Objekte wie 1992 QB1 zu Diskussionen über den Planetenstatus von Pluto. Es wurden Asteroiden entdeckt, mit zum Teil erstaunlicher Größe! Dies war nicht völlig unerwartet geschehen: bereits 1951 wurde von Gerard Kuiper ein Asteroidengürtel hinter der Neptunbahn vorhergesagt - eine Region, die heute als Kuipergürtel bekannt ist.
Das Besondere: Pluto lag inmitten des neu entdeckten Asteroidengürtels!
Bis dahin war Ceres mit 970km Durchmesser, der größte bekannte Asteroid, hier fanden sich nun zum Teil erstaunlich große Objekte, wie 2002 Quaoar (1.000km Durchmesser) und 2004 Orcus.
Richtig eng wurde es für Pluto dann 2005: Mike Brown (Caltech) und seine Kolleg:innen entdeckten gleich drei große Objekte: Haumea (unregelmäßige Form, mit einer Länge von 1.960km), Makemake (1.500km Durchmesser) und Eris – letzterer war mit einem Durchmesser von 2.400km größer als Pluto! Eris wurde aber aufgrund seines "Wohnsitzes" im Kuipergürtel als Asteroid klassifiziert - allerdings befindet sich auch Pluto dort.
Werfen wir einen BLick auf Plutos Eigenschaften, erkennen wir, dass sie auch sehr gut zu einem Asteroiden passen: er ist kleiner als die anderen Planeten und seine Bahn ist nicht kreisförmig (sondern stark oval) und stark geneigt gegenüber den anderen.
Nun waren einige Astronom:innen bereits zuvor der Meinung gewesen, dass man Pluto nicht mehr als Planet bezeichnen sollte. Hätte man 1930 mehr über Asteroiden und die Existenz des Kuipergürtels gewußt, hätte man Pluto wahrscheinlich gar nicht erst als Planet eingestuft.
Plutos Schicksalsstunde
Bei der Generalversammlung der Internationalen Astronomischen Union (IAU) im Jahr 2006 in Prag wurde schließlich über den Planetenstatus von Pluto entschieden. Ursprünglich neigte die IAU dazu, Pluto aus historischen Gründen den Planetenstatus zu belassen. Doch die Entdeckung von Eris machte eine Neudefinition des Planetenbegriffs unumgänglich. Ein erster Entwurf, der vorschlug, jeden rundlichen Himmelskörper, der sich um einen Stern bewegt und kein Mond ist, als Planeten zu klassifizieren, wurde abgelehnt. Dies hätte zu einer unübersichtlichen Anzahl von Planeten geführt und die Unterscheidung zwischen Asteroiden und Planeten verwischt.
Wann ist ein Planet ein Planet?
Stattdessen akzeptierte die IAU eine neue Definition, nach der ein Planet erstens durch sein eigenes Gewicht eine runde Form angenommen haben und zweitens seine Bahn um die Sonne freigeräumt haben muss. Während die klassischen Planeten wie Merkur, Venus und die Erde ihre Umlaufbahnen freigeräumt haben, ist dies bei Pluto und ähnlichen Objekten im Kuipergürtel nicht der Fall.
Pluto verlor also den Status eines vollwertigen Planeten und wurde stattdessen als Zwergplanet klassifiziert. Diese Entscheidung führte auch zur Schaffung der neuen Klasse der Zwergplaneten.
Pluto seinen Planetenstatus abzusprechen war also keine Willkür, sondern eine Entwicklung aufgrund neuer Erkenntnisse und Entdeckungen!
Eine gelungene Zusammenfassung der "Pluto-Diskussion" könnt ihr im Video von Jon Pumper We don't talk about Pluto sehen - und wer den Disney Film Encanto gesehen hat, wird diese Parodie noch mehr genießen!
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen.
Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Redbubble Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Apr 4, 2024 • 42min
CL030 Gammablitze, sterbende Materie und Teilchen mit Überlichtgeschwindigkeit
Die Episode über die energiereichste Strahlung im Universum und ihre Detektion: Gamma-Astronomie
CL030 - Gammablitze, sterbende Materie und Teilchen mit Überlichtgeschwindigkeit
Die Episode über die energiereichste Strahlung im Universum und ihre Detektion: Gamma-Astronomie
Ihr könnt uns hier gerne unterstützen!
Diese Episode nimmt am Fast Forward Science Wettbewerb teil.
Einleitung
Nachdem sich Eva und Jana in Folge 28 unter anderem auch über Radioastronomie (also das Beobachten der langwelligsten Strahlung im elektromagnetischen Spektrum) unterhalten haben, werfen sie dieses Mal einen Blick auf das andere Ende des Spektrums: die Gamma-Strahlung bzw. die Gamma-Astronomie. Hier werden explosive Ereignisse wie Hypernovae und Gammablitze untersucht und die Frage geklärt, ob solche Ausbrüche für die Menschheit gefährlich werden könnten.
News von Beteigeuze
Bevor es los geht hat Eva News von ihrem Lieblingsstern Beteigeuze, der wieder einmal für Schlagzeilen gesorgt hat: mit einem rasanten Rotationstempo von 5km/s (=18.000 km/h) dreht er sich nämlich viel zu schnell für einen Roten Überriesen seiner Größe!
Zumindest kamen Forscher*innen immer wieder zu dem Ergebnis. Ein neue Studie von Jing-Ze Ma u.a. vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching ist nun zu einer anderen Schlußfolgerung gekommen: Die Oberfläche des Sterns Beteigeuze ist von starken Konvektionsströmungen geprägt, die große Blasen von auf- und absteigendem Plasma verursachen. Diese Aktivität lässt die Oberfläche brodeln und kann so intensiv sein, dass die Plasmablasen einen großen Teil der sichtbaren Oberfläche einnehmen. Die schnellen Bewegungen dieser Blasen können zu einer Rot- und Blauverschiebung der Radiostrahlung führen, was auf ein bipolares Geschwindigkeitsfeld hindeutet, bei dem sich ein Teil des Plasmas von uns weg und ein anderer auf uns zu bewegt.
Diese Konvektionsströmungen könnten durch ein Teleskop fälschlicherweise als schnelle Rotation des Sterns interpretiert werden - wie Ma und seine Kolleg:innen mittels 3D-Simulationen zeigen konnten.
Die tatsächliche Rotationsgeschwindigkeit von Beteigeuze bleibt unklar. Es könnte allerdings auch sein, dass der Stern mit einem Begleitstern verschmolzen ist und daher tatsächlich schneller rotiert als üblich.
Das Paper kann man hier lesen: Jing-Ze Ma et al.: Is Betelgeuse Really Rotating? Synthetic ALMA Observations of Large-scale Convection in 3D Simulations of Red Supergiants
Gammastrahlung
Gammastrahlung ist die energiereichste Form elektromagnetischer Strahlung (mit Photonen über 100 keV; rund 100 000 Mal energiereicher als optisches Licht). Sie entsteht vor allem beim Zerfall radioaktiver Elemente und kann selbst durch dicke Bleiwände kaum abgeschirmt werden, wobei sie das Erbgut von Zellen schädigen und Strahlenkrankheit auslösen kann.
Im Gegensatz dazu besteht Alphastrahlung aus Heliumkernen, die schon durch Papier blockiert werden und nur bei Einatmen oder Verzehr gefährlich sind. Betastrahlung, aus Elektronen oder Positronen bestehend, wird durch Materialien wie Glas abgeschirmt und kann bei Kontakt Verbrennungen oder Krebs verursachen.
Gammastrahlung spielte auch eine Rolle beim Unfall in Tschernobyl. Maßgeblich für die Strahlenbelastung ist hier der Zerfall von Cäsium-137. So wird es zusammen mit Strontium-90 für die nächsten paar hundert Jahre die Zone um Tschernobyl herum verseuchen.
Gammastrahlung im Universum
Im Universum gibt es neben den berühmten Gammablitzen auch noch weitere spannende Gammaquellen, unabhängig vom radioaktiven Zerfall: aktive schwarze Löcher in Galaxienkerne (“Todesschrei der Materie”), Super- und Hypernovae (extrem energiereiche Supernovae, wird z.B. von Eta Carinae, der 100 Sonnenmassen hat, erwartet), heiße Gaswolken, Sonnenausbrüche und auch möglicherweise die Annihilation von Dunkler Materie.
Mit dem Begriff der kosmischen Strahlung hingegen sind meistens hochenergetische Teilchen gemeint und keine elektromagnetische Strahlung.
Die Beobachtung von Objekten in unterschiedlichen Wellenlängen bringt viele Vorteile und einen erheblichen Erkenntnisgewinn, wie hier am Beispiel vom Krebsnebel sehr anschaulich zu sehen ist.
Bild: CC-BY-SA 3.0, Hunster, NASA, NRAO/AUI, JPL, ESA
Wir sind auf der Erde gut gegen die schädliche hochenergetische Strahlung durch die Atmosphäre geschützt. Das macht es aber auch schwierig, Gammastrahlen aus dem Kosmos zu beobachten, denn unsere Luftschicht schluckt sie praktisch komplett. Die ersten Gammastrahlen aus dem Kosmos wurden in den 1960ern mit dem Satelliten Explorer 11 der USA (entwickelt unter der Leitung von Wernher von Braun) beobachtet.
Die meisten Weltall-Teleskope sind allerdings auf andere Wellenlängenbereiche spezialisiert, wie Infrarot oder optisches Licht. Das liegt daran, dass Gammastrahlen durch ihre extrem hohe Energie schwierig zu detektieren sind. Es braucht gesonderte Instrumente mit sehr hoher Energieauflösung.
Das Fermi Gamma Ray Space Telescope der NASA ist seit 2008 im Einsatz und ein Beispiel für einen direkten Gammastrahlen-Detektor im Weltall. Es kann Strahlung bis zu 300 GeV beobachten.
Die stärksten jemals beobachteten Gammablitze können allerdings Energien bis zu mindestens 1 TeV erreichen. Das ist etwa eine Billion mal mehr Energie als bei Photonen im optischen Bereich. Gerade am oberen Ende kommen die direkten Detektoren an ihre Grenzen. Wie konnte man also trotzdem solche Energien beobachten?
Es gibt einen Trick: die blaue Tscherenkow-Strahlung kommt uns hier zur Hilfe!
Tscherenkow-Strahlung und -Teleskope
Licht verlangsamt sich in Medien wie Luft oder Wasser gegenüber seiner Vakuumgeschwindigkeit von 300.000 km/s, im Wasser sogar um 25%.
Dies liegt an der Wechselwirkung der Photonen mit den Molekülen des Mediums, wobei Energie absorbiert und wieder emittiert wird. Die elektrischen und magnetischen Felder des Lichts interagieren mit denen der Moleküle, was den Lichtdurchgang erschwert.
Bei Überlichtgeschwindigkeit eines geladenen Teilchens im Medium entsteht Tscherenkow-Strahlung durch konstruktive Interferenz der emittierten Lichtwellen.
Diese entsteht also, wenn sich sehr energiereiche geladene Teilchen in einem Medium mit dortiger Überlichtgeschwindigkeit bewegen (natürlich kann sich nichts schneller als das Licht im Vakuum bewegen, aber schneller als Licht in bestimmten Medien eben schon). Z.B. kommt sie vor in AKWs, wo Wasser als Moderator dient und hochenergetischen Elektronen der Kernspaltung rumrasen.
Aber was hat das nun mit Gammablitzen im Kosmos zu tun?
Gammastrahlen aus dem Kosmos treffen auf die Erdatmosphäre und werden dort absorbiert. Dabei entstehen schnelle, geladene Sekundärteilchen, die sich schneller als Licht durch die Atmosphäre bewegen und Tscherenkow-Strahlung auslösen. Diese ermöglicht es, kosmische Gammastrahlenausbrüche indirekt zu beobachten und Rückschlüsse auf deren Ursprung zu ziehen. Das MAGIC Teleskop auf La Palma hat so den starken Gammablitz GRB 190114C mit einer Energie von 1 TeV beobachtet. Zukünftig soll das Cherenkov Telescope Array (CTA) in Spanien und Chile diese Forschung weiterführen.
Gammablitze und ihre Entstehung
In den letzten 50 Jahren haben Teleskope unser Wissen über die Entstehung von Gammablitzen erweitert: besonders massereiche Sterne über 20 Sonnenmassen (oder zwei kollidierende Neutronensterne) kollabieren bei ihrem Tod zu einem schwarzen Loch, das schnell rotiert. Das umgebende Gas formt eine Akkretionsscheibe um das schwarze Loch und heizt sich durch die Reibung stark auf. Sie gewinnen so viel Energie, dass Gasjets ausgestoßen werden. Dort werden die Teilchen so enorm beschleunigt, dass sie zu Gammastrahlung werden: ein Gammablitz entsteht.
Obwohl Gammablitze bislang nur in fernen Galaxien beobachtet wurden, könnte ein naher Gammablitz die Erde theoretisch sterilisieren. Es wird spekuliert, dass solche Ereignisse massives Aussterben verursachen und die Bewohnbarkeit im Universum einschränken könnten. Zum Glück sind die täglichen Gammablitze, von denen die Erde getroffen wird, zu weit entfernt, um Schaden anzurichten.
Mehr dazu kann man in "Gammablitze: Tödliches Licht explodierender Sterne" auf Spektrum.de lesen.
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen.
Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Redbubble Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Mar 21, 2024 • 1h 2min
CL029 Frauen, die nach den Sternen greifen
Die Episode über Frauen, die die Ersten waren und neue Wege gegangen sind
CL029 - Frauen, die nach den Sternen greifen
Die Episode über Frauen, die die Ersten waren und neue Wege gegangen sind
Einleitung
Diese Folge nimmt am Fast Forward Science Wettbewerb teil!
Dieses Mal ist Elka wieder dabei! Endlich zurück aus Argentinien berichtet sie von ihren Erlebnissen und auch, warum sie ab nun etwas weniger oft bei Cosmic Latte dabei sein wird. Elka besucht nämlich einen Masterlehrgang zu Künstlicher Intelligenz.
Eva und Elka rufen den März zum Frauenmonat aus und nehmen dies als Anlass in dieser Folge über Frauen zu sprechen, die die Ersten waren und mutig neue Wege gingen.
Die Entdeckung der Radioastronomie: Ruby Payne-Scott
Ruby Payne-Scott (1912-1981) war eine australische Pionierin in der Radioastronomie. Sie war eine der ersten Menschen, die Radiofrequenzinterferenzen von der Sonne entdeckten, und damit einen entscheidenden Schritt in der Entstehung der Radioastronomie machte. Ihre Arbeit trug wesentlich zum Verständnis der Sonnenkorona und deren Auswirkungen auf die Erde bei. Darüber hinaus war Payne-Scott eine der ersten Wissenschaftlerinnen, die die Technik der interferometrischen Radiobeobachtungen einsetzte, eine Methode, die heute in der Astronomie weit verbreitet ist, um die Auflösung und Empfindlichkeit von Teleskopen zu verbessern.
Zu einer Zeit, als Frauen in den Wissenschaften stark unterrepräsentiert waren, war Ruby Payne-Scott ein Beispiel für herausragende wissenschaftliche Arbeit und Durchbrüche. Ihre Arbeit und ihr Leben in den 1940er Jahren in Australien zeigt zugleich auch, wie schwer es als Frau war eine wissenschaftliche Karriere zu verfolgen. So musste sie etwa ihre Heirat verheimlichen, um nicht gekündigt zu werden, denn bis 1966 verbat ein Gesetz verheirateten Frauen im öffentlich Bereich berufstätig zu sein.
Zum Weiterlesen:
NAA National Archives of Australia: The secret life of Miss Ruby Payne-Scott
Podcast: Scientific American - The Forgotten Star of Astronomy
Die erste Frau im All: Valentina Tereshkova
Valentina Tereshkova (*1937) flog als sowjetische Kosmonautin im Jahr 1963 mit der Wostok-6-Mission ins All.
Neben der Arbeit als Schneiderin und Büglerin in einer Textilfabrik bildete Tereshkova sich in einer Abendschule zur Technikerin weiter. Schon in ihren 20ern war sie begeisterte Fallschirmspringerin. Mehrmals bewarb sie sich für die Kosmonautenschule und durfte 1962 mit der Ausbildung zur Kosmonautin beginnen. 1963 startete sie zu einer Reise ins All und war somit die 1. Frau im Weltraum, und bis 1982 auch die einzige. 48-mal umrundete sie die Erde und landete nach 71 Stunden wieder sicher in Sibirien. Bis heute ist sie die einzige Frau, die auf einer Solomission war.
Zum Weiterlesen:
SWR: Valentina Tereschkowa wird 80
Podcast: BBC Space: The First Woman in Space
Die erste amerikanische Frau im Weltraum: Sally Ride
Sally Ride (1951-2012) war eine Astronautin und Physikerin, die an zwei Space-Shuttle-Missionen teilnahm.
Schon als Kind war sie von den Naturwissenschaften fasziniert, aber sie war auch eine leidenschaftliche Sportlerin und eine talentierte Tennisspielerin.
Mit 26 Jahren, sie hatte einen Abschluss in Physik und Englisch von der Stanford University und einen Doktortitel in Astrophysik, sah sie eine Anzeige der NASA in der Studentenzeitung. Von 8000 Bewerber*innen schafften es 35 in die Ausbildung, davon waren nur 6 Frauen. Vier Jahre später, 1983, flog sie mit der Challenger vom Kennedy Space Center in den Weltraum. Sie war nicht nur die erste Frau, sondern mit 32 Jahren auch das jüngste Mitglied einer Space Shuttle Crew.
Sally Ride bekam vor dem Flug viele dumme Fragen von Journalisten gestellt: ob sie Kinder haben wolle, ob der Flug ihren Fortpflanzungsorganen nicht schaden würde, ob sie sich im All schminken würde oder ob sie weinen würde, wenn etwas schief ginge, …
Später gründete sie die Firma Sally Ride Science, die Unterrichtsmaterialien erstellt, um Kinder für die Wissenschaft zu begeistern. Nach ihrem Tod hat ihre Schwester der Öffentlichkeit offenbar, dass Sally nicht nur die erste Amerikanerin im All war, sondern auch die erste LGBT-Person. Ihre Schwester hoffte, dass die Nachricht, dass eine amerikanische Heldin lesbisch war, es jungen Menschen leichter macht, mit ihrer Homosexualität umzugehen.
Zum Weiterlesen:
Spiegel: Astronautin Sally Ride - Coming-out in der Todesanzeige
Welt der Frauen: Sally Ride: Die nach den Sternen griff
Bedtime Histories: History of Sally Ride for Kids
Tiktok von Christa Belle: Will that be enough?
Die erste afroamerikanische Frau im Weltraum: Mae Jemison
Mae Jemison (*1956) flog 1992 an Bord des Space Shuttles Endeavour.
Von klein auf hatte Mae viele Interessen: Archäologie, Astronomie, Medizin, Tanz,… Schon mit 16 maturierte sie und begann ihr Studium in Chemical Engineering und Afro-American Studies. Sie schloss 1977 ein Medizinstudium ab und arbeitete unter anderem als Ärztin in Kuba, Thailand, sowie in Sierra Leone und Liberia bei den Friedenstruppen.
1987 wurde sie, beim zweiten Antritt, als erste schwarze Frau in das Programm der NASA aufgenommen.September 1992 war sie Teil des Endeavour Space Shuttles und damit die erste schwarze Frau im All.
Sie war 190 Stunden und 127 Erdumdrehungen lang im All. Dort führte sie zahlreiche Experimente, zb mit Fröschen und Hornissen.
Ihr neuestes Projekt: Das 100 Year Starship, eine Initiative, die Menschen in 100 Jahren zu einem anderen Stern schicken will, bzw. vorbereitende Forschung dafür machen will.
Zum Weiterlesen:
National Air and Space Museum: She Had a Dream: Mae C. Jemison, First African American Woman in Space
Bedtime History: The Mae Jemison Story for Kids & Families
Startalk: A Conversation with Dr. Mae Jemison (Re-release)
Die Erste Frau am Mond?
Mit der aktuellen Artemis Mission (2024- 2026) soll auch eine Frau auf dem Mond landen, nämlich die Astronautin Christina Hammock Koch - die Frau, mit den bisher längsten Weltraumaufenthalten.
Argumente für mehr Frauen im Weltall liefert eine aktuelle Studie der ESA:
Der weibliche Stoffwechsel arbeitet effizienter, weswegen ein weibliches Viererteam bei einer Langzeitmission von 1080 Tagen an Bord, knapp 1.700 Kilo weniger Nahrung benötigt als ein männliches. Das würde nicht nur viel Platz sondern auch 150 Millionen Dollar sparen.
Zum Weiterlesen:
Wissenschaftsjahr 2023: Aufbruch zu den Sternen
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen.
Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Redbubble Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Mar 7, 2024 • 42min
CL028 Botschaften von Aliens und das Rätsel des Wow-Signals
Die Episode über Botschaften aus dem All und das Wow-Signal
CL028 - Das Rätsel des Wow-Signals und Botschaften von Aliens
Die Episode über Botschaften aus dem All, dem Wow-Signal und welche Rolle die Radioastronomie dabei spielt, Signale von Aliens zu empfangen.
Einleitung
In dieser Episode dreht sich alles um Signale aus dem All.
Denn dieses Mal ist Cosmic Latte eine Kooperation mit Netflix Deutschland zum Start der neuen Miniserie "Das Signal" eingegangen.
In "Das Signal" empfängt die Astronautin Paula auf der ISS ein Signal aus den Tiefen des Weltalls, verschwindet allerdings nach ihrer Rückkehr auf die Erde. Ihr Mann (Florian David Fitz) und ihre Tochter entdecken jedoch Hinweise von ihr, die sie zu ihrer sensationellen Entdeckung führen sollen.
Eva und Jana haben sich die Serie schon vorab angesehen und sprechen in dieser Episode daher über ein echtes Signal aus dem Weltall, das in den 1970er Jahren empfangen und dessen Ursprung bis heute nicht geklärt wurde, das Wow-Signal.
Das Wow-Signal
Es heißt tatsächlich so, weil der Entdecker des Signals, der Radioastronom Jerry R. Ehman, auf dem Papierausdruck neben den Daten "WOW!" notierte. Das tat er, weil das, was er da in den Daten gefunden hatte, wirklich wow war.
Er abeitete am „Big Ear“-Radioteleskop der Ohio State University, das am 15. August 1977 ein äußerst bemerkenswertes Signal aufzeichnete. Es suchte im Rahmen des Seti-Projekts nach Signalen von außerirdischen Zivilisationen.
Der erste Blick auf die Aufzeichnung ist allerdings wenig spektakulär: ein Haufen 1er, ein paar 2er und 3er und in der zweiten Spalte eine Zeichenfolge: 6EQUJ5
Um diese kryptische Zeichenfolge zu verstehen, muss man die Radioastronomie verstehen.
Exkurs: Radioastronomie
Radioastronomie konzentriert sich auf die Erfassung und Analyse von Radiowellen aus dem Weltraum. Dieser Zweig der Astronomie verwendet Radioteleskope, die entweder einzeln oder als Teil eines Arrays betrieben werden können, um Daten zu sammeln. Techniken wie die Very Long Baseline Interferometry (VLBI) ermöglichen es, Bilder mit hoher Auflösung zu erhalten, indem Daten von mehreren weit voneinander entfernten Teleskopen kombiniert werden.
Ein herausragendes Ergebnis dieser Methode ist das erste Bild eines Schwarzen Lochs im Zentrum der Galaxie M87, erzeugt durch ein globales, virtuelles Netzwerk an Teleskopen von der Größe der gesamten Erde (acht Radioteleskope haben 2017 auf der ganzen Welt (u.a. auf Grönland, Antarktis, Hawaii, Europa, Süd- und N-Amerika) zur gleichen Zeit die gleiche Gegend am Himmel beobachtet).
Wer genaueres über die Entstehung des ersten Bildes eines Schwarzen Loches erfahren möche, kann gerne in unsere Episode "CL 10 Das Schwarze Loch im Zentrum der Galaxis" reinhören.
Was Radioastronomie so toll macht, ist, dass sie es erlaubt, eine Vielzahl von astronomischen Objekten und Phänomenen zu studieren, die im optischen Spektrum nicht sichtbar sind, und so zu bedeutenden Entdeckungen wie der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung und Pulsaren geführt hat. Ein Vorteil gegenüber optischer Astronomie ist, dass Beobachtungen unabhängig von Tageszeit oder Wetterbedingungen möglich sind, da Radiowellen auch durch Wolken auf der Erde und Staubwolken im Weltraum dringen können.
Was ist das Wow-Signal?
Aber was ist nun das sogenannte "Wow-Signal"? Das starke Radiosignal, das das Radioteleskop 1977 plötzlich erfasste und durch eine ungewöhnliche Folge von Zahlen und Buchstaben (6EQUJ5) gekennzeichnet war, stellt die Intensität des Signals im Vergleich zum Hintergrundrauschen dar.
Wenn kein Signal gemessen wurde, dann wurde gar kein Symbol aufgezeichnet, empfing es ein Signal, wurde es, je nach Stärke mit den Ziffern von 1 bis 9 bezeichnet bzw. bei noch stärkeren Signalen mit den Buchstaben von A bis U, wobei “U” das Maximum darstellte und einem Signal entsprach, das 30-Mal stärker war als das Hintergrundrauschen.
Das Wow-Signal dauerte 72 Sekunden, stieg schnell an auf ein Maximum von U und fiel ebenso schnell ab, was darauf hindeutet, dass es von einem Punkt außerhalb unseres Sonnensystems stammte, da die Erddrehung die Beobachtungsdauer eines solchen Signals begrenzt. Die Frequenz des Signals, 1420 MHz, ist besonders interessant, da sie der natürlichen Radiostrahlung von neutralem Wasserstoff entspricht und von Astronomen zur Beobachtung des Universums genutzt wird.
Dies, sowie die Tatsache, dass das Signal nur einmal empfangen wurde und keine irdische oder natürliche Quelle eindeutig identifiziert werden konnte, wecken Spekulationen über einen möglichen außerirdischen, künstlichen Ursprung. Trotz intensiver Untersuchungen und Diskussionen bleibt die genaue Herkunft des Signals unklar. Erst 2022 wurden interessante Kandidaten für dessen Quelle lokalisiert, unter ihnen ein sonnenähnlicher Stern im Sternbild Schütze.
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen.
Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Twitter Cosmic Latte
Instagram Evi |
Redbubble Evi
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!


