
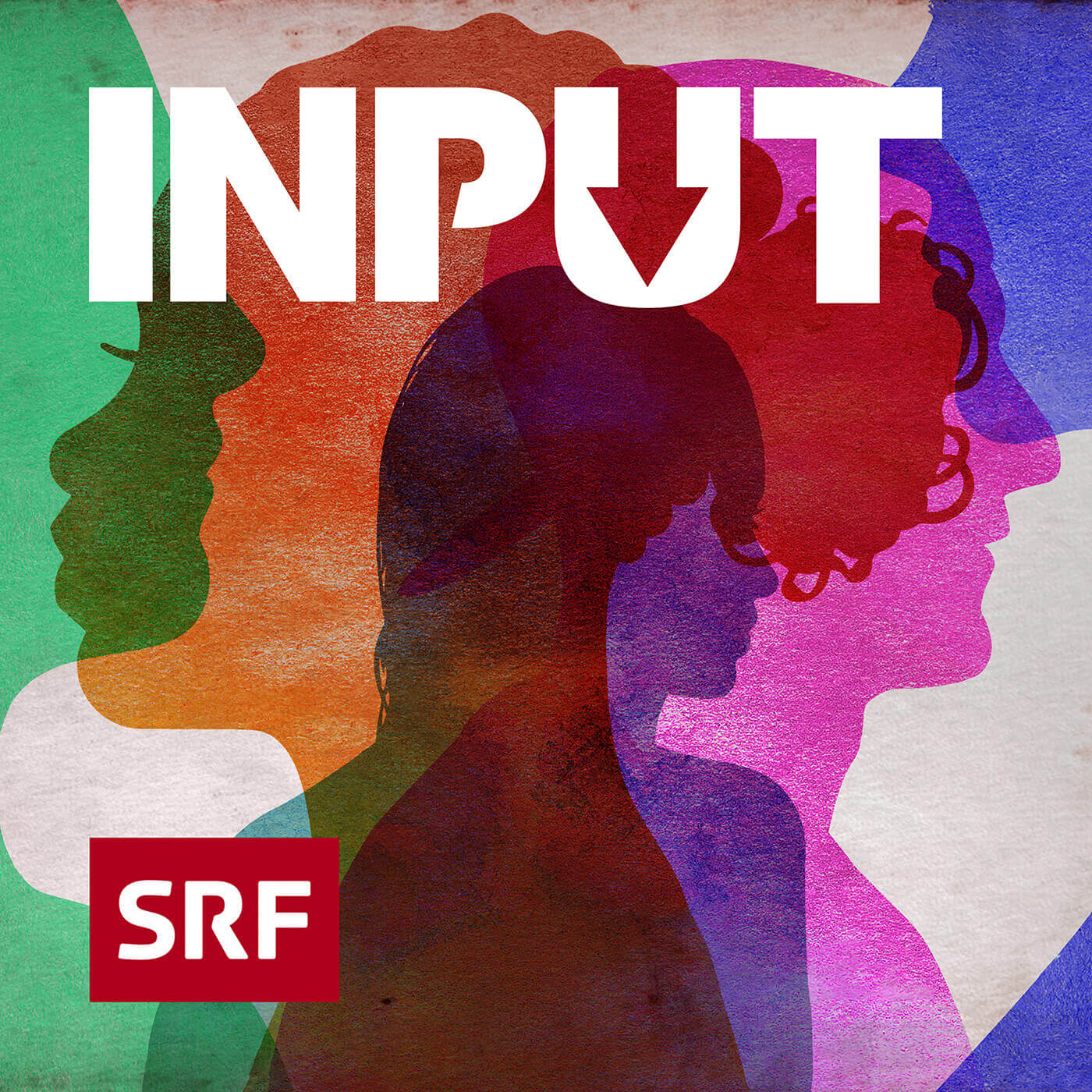
Input
Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)
Dem Leben in der Schweiz auf der Spur – mit all seinen Widersprüchen und Fragen. Der Podcast «Input» liefert jede Woche eine Reportage zu den Themen, die Euch bewegen. Am Mittwoch um 15 Uhr als Podcast, sonntags ab 20 Uhr auf Radio SRF 3.
Episodes
Mentioned books

Jun 5, 2024 • 42min
Das Dorffest ist tot – Hoch lebe das Dorffest!
Am Quartier-, Dorf- und Stadtfest sind sie die geheimen Helden: die Vereinsmitglieder. Menschen, die schon Monate zuvor für ihren Verein Zelte mieten, Würste bestellen, Helfer mobilisieren. Was treibt Menschen dazu an, in ihrer Freizeit so viel freiwillige Arbeit zu leisten?
«Ich habe zwar schlaflose Nächte vorher, aber ich liebe meinen Verein und das Dorffest», sagt Rolando Keller vom Verein «Cooking Fellows» vor dem Start des Dorffestes in Veltheim, einem Stadtteil von Winterthur.
Sind Stadt- und Dorffeste gefährdet, weil die Jungen vereinsmüde sind und den Vereinen die Mitglieder ausgehen? «Nein», sagt Vereinsexpertin Fanni Dahinden. «Aber viele Vereine tun gut daran, ihre Strukturen zu überdenken, wenn sie etwas gegen die Überalterung unternehmen wollen.»
_
(00:00) Intro
(01:54) Vor dem Dorffest: Der Verein Cooking Fellows stellt das Festzelt auf
(10:19) Beim Bierfass-Schleppen: Die Cooking Fellows sind sehr exklusiv.
(15:15) Schlaflose Nächte
(16:45) Die Cooking Fellows profitieren voneinander: geschäftlich und privat.
(19:30) Wer ist eigentlich alles auch noch Teil von meinem Quartier? Die Vereinsfachfrau über Dorffeste.
(21:54) Wie geht es den Dorffeste in der Schweiz? Können stark schwanken, sind insgesamt sehr stabil.
(23:09) Vereinssterben und die Jungen: Wie viel ist dran?
(25:00) Vom Quartierverein bis zur Fifa: Was definiert einen Verein?
(28:50) Bei Ali Karadas vom Verein Interkulturelles Forum am Dorffest.
(30:00) Ali Karadas: Die migrantischen Vereine sollen auftun!
(35:00) Wie sieht die Freiwilligenarbeit der Zukunft aus?
(37:28) Das Dorffest startet!
(03:28) Fazit: Das Dorffest ist Demokratie und Pluralismus in a nutshell
_
In dieser Sendung zu hören:
- Rolando Keller, 63, ehemaliger OK-Präsident und Aktivmitglied im Verein «Cooking Fellows» in Winterthur
- Ali Karadas, OK-Präsident des Vereins «Interkulturelles Forum» in Winterthur
- Fanni Dahinden, Geschäftführerin der Fachstelle für Vereine «Vitamin B»
_
Habt ihr Feedback, Anregungen oder Wünsche? Wir freuen uns sehr über Post an input@srf.ch
_
Autorin: Julia Lüscher

Jun 2, 2024 • 40min
Hilfe, das Bürokratie-Monster wächst weiter
Die Bürokratie ist das tägliche Abenteuer, bei dem man sich ständig denkt: «Warum geht das nicht einfacher?» So erlebt es auch Input-Host Beatrice Gmünder, die in dieser Folge herausfindet, dass Bürokratie zwar ihren Sinn hat, alles aber noch schlimmer kommen kann
Bürokratie ist ein Dickicht, das kaum durchdringbar ist. Beatrice Gmünder versucht es trotzdem. Sie trifft dabei Pflegefachfrau Florence Corminboeuf, die meint, mit ein bisschen mehr Vertrauen in ihre Arbeit wäre schon viel getan. Auf Vertrauen setzt auch Geschäftsmann Marcel Frank. Für ihn gilt ein Handschlag nach wie vor viel. Das ist Bürokratieabbau im Kleinen, erklärt Ökonom Mathias Binswanger, denn: «Solange wir am kapitalistischen System festhalten, haben wir diese Bürokratie - und sie wird nur noch komplexer».
_
(00:00) Intro: Warum dieses Thema?
(01:38) Was versteht man unter Bürokratie
(02:57) Wo sich Input-Hörer:innen ab der Bürokratie ärgern
(08:36) Bürokratie ist eng mit dem Wirtschaftssystem verbunden
(14:47) Bürokratie im Pflegebereich, im Pflegeheim Appenzell
(22:36) Unsere Bürokratie zeigt unsere Misstrauenskultur
(28:42) Im KMU Frank Türen wird auf Vertrauen gesetzt
(35:32) Mit KI wird die Bürokratie einen weiteren Schub erleben
(38:27) Fazit
_
In diesem Podcast sprechen:
* Mathias Binswanger, Ökonom und Professor für Volkswirtschaftslehre
* Florence Corminboeuf, Pflegefachfrau und Teamleiterin am Alterspflegezentrum Appenzell
* Marcel Frank, Geschäftsführer Frank Türen in Nidwalden
_
Hast du Feedback, Fragen oder Wünsche? Wir freuen uns auf deine Nachricht an input@srf.ch – und wenn du deinen Freund:innen und Kolleg:innen von uns erzählst.

May 22, 2024 • 32min
Wohnungsnot – Wenn Wohnen in der Heimat zum Luxus wird
Nirgends in der Schweiz sind die Mieten so hoch und die Wohnungen so knapp wie im Kanton Zug. Diese «Input»-Folge zeigt auf, wie die Wohnungsknappheit und überteuerte Mietzinse das tägliche Leben von Mieterinnen und Mieter beeinflusst.
Monika Beuchat-Ifanger (51) wohnt seit knapp 25 Jahren in einem Wohnblock in Steinhausen. Nun hat der Eigentümer allen das Mietverhältnis gekündigt und die Liegenschaft verkauft. Monika und ihr Partner müssen schnell eine neue Bleibe finden – fast unmöglich in einem Kanton, in dem kaum Mietwohnungen frei sind. Der Konkurrenzkampf ist gross: «Wir bewerben uns auf Wohnungen, ohne vorher die Bilder zu sehen.»
Martina (28) hat drei Jahre nach einer bezahlbaren Wohnung im Kanton Zug gesucht. Zuvor war sie in diversen Wohngemeinschaften. Trotz ihres guten Einkommens und ihrer makellosen Wohnungsbewerbungen war sie erfolgslos. Nach dem pausenlosen Suchen und den unzähligen Absagen hat sie sich dazu entschlossen, auf den Kanton Aargau auszuweichen. Ihre Freunde und Familie lässt sie in Zug zurück.
_
(00:00) Intro
(01:58) Monika liest Brief vor
(03:28) Monika und Patrick müssen wegziehen
(04:18) Eineinhalb Millionen für eine Wohnung
(06:10) Monika und Patrick fühlen sich unfair behandelt
(09:20) Der Familienzusammenhalt ist gross
(12:57) Monika und Patrick gehen an eine Besichtigung
(17:14) Es ist ein Volltreffer!
(18:33) Martina hat drei Jahre lang gesucht
(23:49) Martina musste vieles zurücklassen
(25:00) Darum ist es so schwierig im Kanton Zug
(28:15) Das ging politisch im Kanton Zug
(29:36) Martina hat gemischte Gefühle in Bezug auf Zug
(31:10) Fazit
_
Hast du Feedback, Fragen oder Wünsche? Wir freuen uns auf deine Nachricht an
input@srf.ch – und wenn du deinen Freund:innen und Kolleg:innen von uns erzählst.
_
Gesprächspartner:innen:
- Martina Barisic (28)
- Monika Beuchat-Ifanger (51)
- Patrick Beuchat (48)
- Christina Rüttimann (29)
_
Literatur und Links:
- rec. Folge: Hohe Mieten und Wohnungsnot – Wird das Wohnen in der Heimat zum Luxus? youtu.be/xxjZ1Z30k4o?si=x2-wdF84IMDy3dPp
- Bundesamt für Statistik Leerwohnungen: bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bau-wohnungswesen/wohnungen/leerwohnungen.html
- Zahlen über das Wohnen und die soziale Lage in Zug: zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/statistikfachstelle/themen/soziale-sicherheit/sozialbericht-1
- Wohnraumförderungsgesetz: bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/851.211
Team:
- Autorin: Elma Softic

May 15, 2024 • 21min
Dopamin-Detox: Was taugt der Enthaltsamkeits-Trend?
«Das verändert schlagartig dein Leben!» Auf TikTok und Instagram wird in tausenden Videos Dopaminfasten angepriesen. Dabei wird eine Zeit lang auf alles verzichtet, was Spass macht. Das soll nicht nur produktiver machen, sondern auch von der Handysucht befreien. Was steckt hinter diesem Trend?
Kein Sex, keine sozialen Medien, kein Netflix, keine Musik. Und im Extremfall wird sogar auf soziale Kontakte verzichtet. Der Enthaltsamkeits-Trend kommt aus dem Silicon Valley. Die Idee: Der Glücksbotenstoff Dopamin wird auf null gesetzt. Das soll helfen, mit digitalen Medien besser zurechtzukommen. «Input»-Macher Matthias von Wartburg hofft, mit dieser Methode seinen Handykonsum in den Griff zu bekommen. Doch die Einschätzung von Fachleuten ist ernüchternd: Dopamin-Detox könne sogar schädlich sein.
_
(00:00) Intro
(01:20) TikTok
(03:05) Dopamin
(05:50) Dopamin-Detox
(09:08) Mittel gegen Mediensucht?
(11:12) Wann ist es Sucht?
(13:05) Sven war zu oft am Handy
(14:24) Seine Lösung
(17:00) Tipp für den Alltag
(17:58) Fazit
_
In diesem Podcast sprechen:
• Katharina Bochsler – Wissenschaftsredaktorin SRF
• Franz Eidenbenz – Mediensucht-Experte, Psychologe und Psychotherapuet
• Sven (23)
_
Autor: Matthias von Wartburg
Hast du Feedback, Fragen oder Wünsche? Wir freuen uns auf deine Nachricht an input@srf.ch – und wenn du deinen Freund:innen und Kolleg:innen von uns erzählst.

May 8, 2024 • 34min
Autismus am Arbeitsplatz – Betroffene hätten viel zu bieten
Erwachsene Menschen mit der Diagnose Autismusspektrumstörung ASS sind überdurchschnittlich oft arbeitslos. Dabei hätten sie Arbeitgebern viel zu bieten.
«Matthias arbeitet so genau wie kein anderer im Betrieb, und wenn er sich in einem Problem festgebissen hat, ist er kaum mehr zu bremsen», sagt Loris Gautschi über seinen Angestellten im Autismusspektrum. Wenn Autistinnen und Autisten ihr besonderes «Betriebssystem» als Stärke ausspielen können und auf ihr Bedürfnis nach einer reizarmen Umgebung und klarer Kommunikation Rücksicht genommen wird, sind sie ein Gewinn für jedes Team.
_
(3:05) Matthias Bächler stellt sich vor
(6:21) Matthias erklärt, wie sich Augenkontakt anfühlt
(10:15) Menschen im Spektrum lernen durch Beobachten
(13:26) Katja Buchwalder: Was ist ein autismusfreundlicher Arbeitsplatz?
(17:24) Sandras Geschichte
(25:24) Matthias «Superpower»
(29:23) Menschen im Spektrum – überdurchschnittlich oft arbeitslos
¬_
In dieser Folge zu hören:
Matthias Bächler, Betroffener ASS
Katja Buchwalder, Arbeitscoach bei Autismuslink
Loris Gautschi, Geschäftsführer it5-Solutions
Sandra* (Name geändert), Betroffene ASS
_
Habt ihr Fragen, Feedbacks oder Ideen? Wir freuen uns auf eure Einsendungen unter input@srf.ch
_
Autorin: Helen Arnet
_
Links und Literatur:
Reporter: srf.ch/play/tv/reporter/video/autismus-bei-erwachsenen---woran-betroffene-in-der-arbeitswelt-leiden?urn=urn:srf:video:cb6c3256-575b-4aa0-87be-f7dea842d677
Reporter: Autismus und Schule – (k)eine Liebesbeziehung: srf.ch/play/tv/reporter/video/autismus-und-schule---keine-liebesbeziehung?urn=urn:srf:video:dd928418-9117-4730-be3f-2e28b39af04f
Input: Autismus und Schule – (k)eine Liebesbeziehung:
srf.ch/audio/input/autismus-und-schule-k-eine-liebesbeziehung?id=12384382
autismus.ch
autismuslink.ch
benefitnews.com/news/how-to-create-equitable-workplace-experiences-for-autistic-talent
thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0034-1387494?lang=de
_
Törnvall, Clara: Die Autistinnen. Berlin, 2024
Zimmermann, Maria: Anders, nicht falsch. Zürich, 2023

May 1, 2024 • 31min
Frauen und Gaming: wenn der Hauptgegner Sexismus ist
Fast die Hälfte aller Gamer sind nicht Gamer, sondern weiblich. Allerdings, viele Frauen outen sich in der virtuellen Spielwelt nicht als Gamerin. Machen sie es trotzdem, werden sie sexistisch angegriffen.
Drei von vier Frauen sind davon betroffen, wenn es klar ist, dass eine Gamerin hinter der Konsole sitzt. Vor allem beim kompetitiven eSports geht es rau zu und her. «Geh zurück in die Küche» ist dabei noch eine der harmloseren Beschimpfungen. Drei Frauen geben Input-Host Daniel Bodenmann Einblick in ihre Game-Welt: Rahel, die Hobby-Gamerin, Dilana, die mit dem Gaming Geld verdient - und Theresa, die den Sexismus bekämpfen will.
_
(00:00) Intro: Weshalb dieses Thema?
(01:49) Rahel ist Hobby-Gamerin und erklärt wie es sich in dieser virtuellen Spielwelt als Frau lebt.
(10:07) Dilana verdient Geld mit Gaming. In der Schweiz kein Problem, im Ausland steht sie an.
(05:45) Sexismus im Gaming nimmt zu
(19:55) Auch in der Gaming-Welt verdienen Frauen weniger
(21:17) Positive Entwicklungen gibt es auch
(22:51) Theresa geht aktiv gegen Sexismus in der Gamingwelt vor.
(29:22) Fazit
_
Shownotes:
- theresa.schaffer@myi.ch: Theresa Schaffer von der Game-Agentur MYI ist in der Ausarbeitung einer Sensibilisierungskampagne zum Thema Sexismus beim Gaming. Influencer (und weitere Interessierte), die sich aktiv gegen Sexismus einsetzen wollen, können sich bei ihr melden.
https://stophatespeech.ch/ : Stop Hate Speech ist ein Projekt, dass dich ermächtigt, direkt an den von Hate Speech betroffenen Diskussionen zu beteiligen und dich konstruktiv einzubringen.
_
Autor: Daniel Bodenmann
Hast du Feedback, Fragen oder Wünsche? Wir freuen uns auf deine Nachricht an input@srf.ch – und wenn du deinen Freund:innen und Kolleg:innen von uns erzählst.

Apr 24, 2024 • 27min
Was schulde ich meinen Eltern? Zwei eindrückliche Geschichten
Unsere Eltern haben sich möglicherweise für uns aufgeopfert. Aber müssen wir das auch für sie tun? Bei «Input» erzählen zwei Frauen ihre Geschichte. Annette (59) und Anouc (23) sind beide mit exakt dieser Frage konfrontiert: Was bin ich meinen Eltern schuldig?
Konkret fragt sich Annette: «Muss ich meinen Vater bis zu seinem Tod betreuen? Obwohl mich genau das bei meiner Mutter in die Erschöpfung getrieben hat?» Ihre Antwort ist klar, was im Umfeld teilweise Unverständnis auslöst. Und Anouc treibt die Frage um: «Soll ich meinen Lebenstraum aufgeben, um für meine Eltern da sein zu können?» Sie hat ihre Antwort noch nicht gefunden. Aber was sagen ihre Eltern zu den Gedankten der Tochter? In dieser «Input»-Folge wird Klartext gesprochen und es wird emotional.
_
(00:00) Intro
(00:74) Annette
(05:35) Klartext mit Vater
(09:06) Anouc
(11:32) zwischen Traum und Pflichtbewustsein
(13:21) Das sagen die Eltern
(15:55) Gemeinsam auswandern?
(18:12) Die Eltern erwarten nichts
(19:52) Zweifel und schlechtes Gewissen
(22:00) Darum schulden wir Eltern nichts
(23:54) Fazit
_
In diesem Podcast sprechen:
• Annette (59)
• Anouc (23) und ihre Eltern Karin (62) und Gerold (73)
_
Autor: Matthias von Wartburg
Hast du Feedback, Fragen oder Wünsche? Wir freuen uns auf deine Nachricht an input@srf.ch – und wenn du deinen Freund:innen und Kolleg:innen von uns erzählst.

Apr 17, 2024 • 37min
Antisemitismus & Islamophobie: Wie geht Zivilcourage?
In Zürich wird ein orthodoxer Jude mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Auch muslimische Gemeinschaften berichten von einer Zunahme von Übergriffen auf offener Strasse. Was bedeutet dieser Anstieg von Hassverbrechen für uns als Zivilgesellschaft?
Samstag Abend, anfangs März: Ein Teenager, mutmasslich islamistisch radikalisiert, greift in Zürich Wiedikon einen jüdischen Mann auf offener Strasse mit einem Messer an. Einem Jiu-Jitsu-Kampfsportler, zufällig in einem angrenzenden Restaurant, gelingt es schliesslich, den Angreifer zu überwältigen. Kurze Zeit später werden in Bad Ragaz zwei muslimische Männer vor ihrer Wohnungstür mit einer Machete angegriffen und verletzt – die Opfer gehen von einer anti-islamisch motivierten Tat aus.
Ein Schock geht sowohl durch die jüdische, als auch die muslimische Gemeinschaft in der Schweiz. Input-Autorin Julia Lüscher bleibt mit der Frage zurück: Was würde ich tun, wenn ich in so eine Szene geriete? Wie kann ich mich zivilcouragiert verhalten – ohne mich selber zu gefährden?
_
In dieser Sendung zu hören:
- Ebnomer Taha, Vorstandsmitglied VIOZ, Verein Islamischer Organisationen Zürich, muslimischer Seelsorger Unispital Zürich und Psychiatrische Uniklinik Zürich
- Jonathan Kreutner, Generalsekretär Schweizerisch-Israelitischen Gemeindebund SIG
- Andi Geu, Co-Geschäftsführer NCBI, NGO Antirassismus, Antisemitismus und Interreligiöser Dialog
- Johannes Ullrich, Professor für Sozialpsychologie, Universität Zürich
---
(02:00) Zäsur: Jonathan Kreutner über Messerangriff in Zürich im März 23
(07:50) Mehr Angriffe auf Muslime: Ebnomer Taha
(11:27) So funktioniert Zivilcourage: Johannes Ullrich, Professur für Sozialpsychologie
(18:04) Andreas Geu, Coach für Zivilcourage.
_
Links:
- Antisemitismusbericht Swissjews 2023: https://swissjews.ch/de/downloads/berichte/antisemitismusbericht2023 - Diskriminierungsbericht Stiftung gegen Antisemitismus und Rassismus GRA: https://www.gra.ch/diskriminierungsbericht-2023/ Input
- Zahlen Bundesamt für Statistik: Vorurteile gegenüber Mindeheiten: www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/zusammenleben-schweiz/einstellungen-zielgruppen.html
_
Du hast Feedback, Fragen oder Wünsche? Schreib uns an input@srf3.ch – und teile diesen Podcast mit Freund:innen und Familie.
Autorin: Julia Lüscher

Apr 10, 2024 • 45min
Leihmutterschaft: Es kann ein Gewinn für alle sein
Leihmutterschaft ist hoch umstritten. Was erlebt ein Paar, das sich trotzdem dafür entscheidet? «Wir hatten viele Ängste und Sorgen», sagen Annina und Kilian. Bei «Input» sprechen sie über Schuldgefühle, versteckte Vorfreude und dem Projekt, das trotzdem für alle Beteiligten zum Gewinn wurde.
«Leihmütter werden schamlos ausgebeutet». So lautet ein zentrales Argument von KritikerInnen. Medizinethnologin Anika König sagt: «Eine Leihmutterschaft ist nicht per se ausbeuterisch. Es gibt Leihmutterschaften, die für alle Beteiligten ein Gewinn sein können.» Von einer solchen Leihmutterschaft erzählen Kilian und Annina, die zwei Kinder von Leihmüttern haben. Und ihre US-amerikanische Leihmutter sagt: «Es war eine der besten Erfahrungen meines Lebens.»
_
(00:00) Intro
(01:02) Vorurteile
(03:40) Kritik an der Leihmutterschaft
(05:26) Leihmutterschaft kann ein Gewinn für alle sein
(08:13) Warum haben Annina und Kilian eine Leihmutterschaft gemacht?
(10.59) Die Suche nach der Leihmutter
(21:07) Die Schwangerschaft
(27:58) Die Leihmutter Laura erzählt
(32:45) Geburt und Anerkennung des Kindes
(38:25) Das Kindswohl
(40:54) Die Beziehung zur Leihmutter
_
In diesem Podcast sprechen:
• Annina* (34) und Kilian* (36): Sie haben zwei Kinder von US-amerikanischen Leihmüttern
• Anika König, als Medizinethnologin forscht sie zu transnationaler Leihmutterschaft
• Laura* (39): US-amerikanische Leihmutter von Annina und Kilian
• Ruth Baumann-Hölzle, Medizinethikerin, gegen Leihmutterschaft
*Nachname der Redaktion bekannt
_
Links
* 18.10.2020 StSt Religion Streitfrage Leihmutterschaft: srf.ch/play/tv/sternstunde-religion/video/sternstunde-religion---streitfrage-leihmutterschaft?urn=urn:srf:video:26bd93e6-feca-46d0-a438-b0dcff2f2ed8
* 09.11.2021 Echo der Zeit: Leihmutterschaft – pro und contra: srf.ch/news/schweiz/umstrittene-leihmutterschaft-milliardengeschaeft-mit-leihmuettern-ausbeutung-inbegriffen
* Ein Baby um jeden Preis - Club vom 25.2.2014: srf.ch/play/tv/club/video/ein-baby-um-jeden-preis?urn=urn:srf:video:684d9fc6-5635-41f3-8441-4dde3b5efd45
* Bis zur Adoption gilt die Leihmutter in der Schweiz als Mutter (Rendez-vous vom 19.08.2022): srf.ch/news/schweiz/bundesgericht-zu-aargauer-fall-bis-zur-adoption-gilt-die-leihmutter-in-der-schweiz-als-mutter
* Milliardengeschäft mit Leihmüttern – Ausbeutung inbegriffen: srf.ch/news/schweiz/umstrittene-leihmutterschaft-milliardengeschaeft-mit-leihmuettern-ausbeutung-inbegriffen
_
Autorin: Mariel Kreis
Hast du Feedback, Fragen oder Wünsche? Wir freuen uns auf deine Nachricht an input@srf.ch – und wenn du deinen Freund:innen und Kolleg:innen von uns erzählst.

Apr 7, 2024 • 39min
Long Covid - Grenzen unseres Gesundheitssystems
«Wir werden mit unserer Krankheit nicht ernst genommen», beklagen sich Long Covid-Betroffene immer wieder. Wie erleben Patient:innen die Situation, aber auch: Wie geht es den Hausärztinnen und -Ärzten dabei? Input-Redaktor Michael Bolliger hat mit Betroffenen und Medizinern gesprochen.
Wer immer mit Long Covid-Betroffenen spricht, bekommt häufig eine Krankheits- und Behandlungsgeschichte von Leiden, Kränkungen, Missverständnissen zu hören. So auch bei Michèle und Marcel, zwei Long Covid-Patient:innen aus der Ostschweiz. Sie erzählen von ihrem Weg in dieser Input-Folge. Input fragt aber auch bei Hausärzt:innen nach. Die sind ja in der Regel die ersten medizinischen Fachpersonen in der Begleitung einer Krankheit. Wie geht es ihnen mit einer Krankheit, die unzählige Symptome zeigt, aber bis heute noch keine eindeutigen Diagnose-Möglichkeiten kennt. Werden hier die Grenzen unseres Gesundheitssystems sichtbar?
_
(00:00) Intro
(02:30) Besuch bei drei Long Covid-Betroffenen in der Ostschweiz
(17:40) Wie erlebt der Hausarzt Thomas Langenegger die Situation?
(22:50) Das sagt Philippe Luchsinger, Hausarzt und Präsident mfe zur Kritik von Long Covid-Betroffenen, Ärzt:innen würden sie nicht ernst nehmen.
(31:26) Zusammenfassende Fakten zum Thema
(34:10) Die Perspektive der Medzinihistorikerin Martina King, Uni Fribourg
_
_
Hast du Feedback, Fragen oder Wünsche? Wir freuen uns auf deine Nachricht an input@srf.ch – und wenn du deinen Freund:innen und Kolleg:innen von uns erzählst.


