
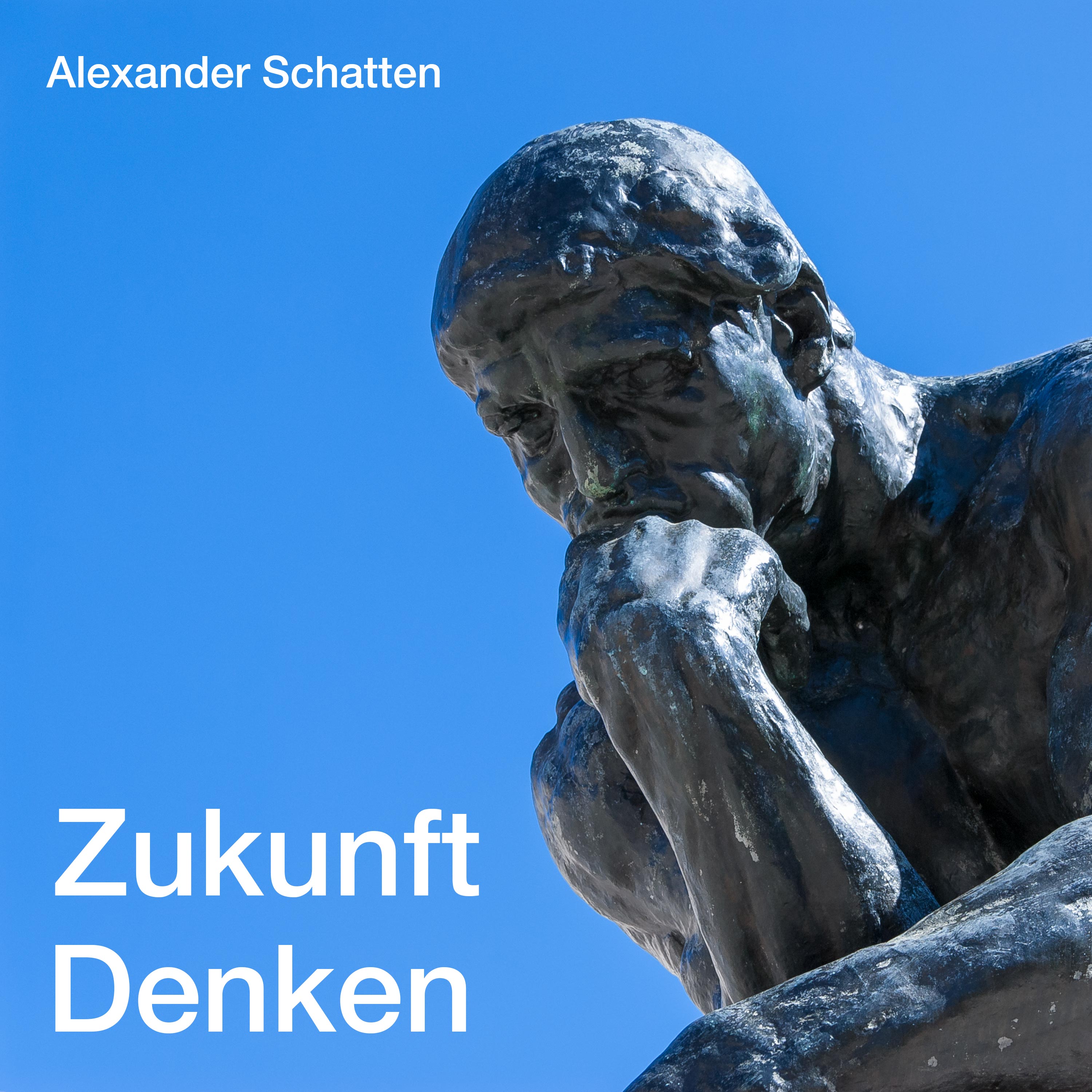
Zukunft Denken – Podcast
Alexander Schatten
Woher kommen wir, wo stehen wir und wie finden wir unsere Zukunft wieder?
Episodes
Mentioned books

48 snips
Apr 2, 2025 • 24min
121 — Künstliche Unintelligenz
In dieser Folge wird das Konzept der „Künstlichen Unintelligenz“ kritisch untersucht. Es wird beleuchtet, wie Menschen in Organisationen durch Standardisierung und Automatisierung zu unflexiblen Rädchen werden. Anhand historischer und gegenwärtiger Beispiele erfahren wir von der Entfremdung zwischen Arbeitern und ihren Produkten. Die Problematik der Verantwortungsdiffusion in großen Unternehmen wird ebenso thematisiert, während die Notwendigkeit, echte Verantwortlichkeiten zu benennen, betont wird. Ein faszinierender Blick auf die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt!

Mar 20, 2025 • 55min
120 — All In: Energie, Wohlstand und die Zukunft der Welt: Ein Gespräch mit Prof. Franz Josef Radermacher
Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts! In dieser Episode begrüße ich den renommierten Experten Franz Josef Radermacher vor einem besonderen Gast an der Wand: Albert Einstein. Was hat Einstein mit Energie zu tun? Warum ist Energie die Grundlage menschlichen Wohlstands? Und wie gestalten wir eine nachhaltige Zukunft in einer global vernetzten Welt? Dieses Gespräch nimmt uns mit auf eine Reise durch die Geschichte der Energienutzung, die Herausforderungen der Energiewende und die geopolitischen Dimensionen, die oft übersehen werden.
Prof. Radermacher ist Vorstand des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung, stellv. Vorstandsvorsitzender von Global Energy Solutions e. V. (Ulm), emerit. Professor für Informatik, Universität Ulm, 2000 – 2018 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI); er ist Ehrenpräsident des Ökosozialen Forum Europa, Wien, Mitglied des UN-Council of Engineers for the Energy Transition (CEET) sowie Mitglied des Club of Rome, Winterthur.
Was hat Einstein mit diesem Gespräch zu tun? Wir beginnen mit der Frage, welche Rolle Energie in unserer Gesellschaft spielt sowie der Tatsache, dass vielen Menschen, vermutlich den meisten, nicht klar ist, was unsere Gesellschaft antreibt? So waren 2023 mehr als 81 Prozent des gesamten weltweiten Energieverbrauchs durch fossile Quellen gedeckt, und die Menge an fossilen Energieträgern wächst ständig.
Wie hat Energie die Menschheit geprägt? Welche Energiequellen hatten wir früher und welchen Einfluss hatte die Veränderung der Energieträger auf unsere Gesellschaft und unseren Lebensstandard? Warum dominieren fossile Brennstoffe heute noch? Kann Energie Armut bekämpfen? Ist es Energie, die Wohlstand schafft?
Warum sind zwei oft übersehene Parameter von so großer Bedeutung: Energiedichte und Platzbedarf? Kernkraftwerke benötigen wenig Fläche im Vergleich zu Windrädern oder Photovoltaik:
»Da ist ja ein Faktor 100 dazwischen.« […] »Weil auch Fläche ein extrem knappes Gut ist, ist es problematisch, wenn man eine Energie mit ziemlich niedriger Dichte hat.«
Gleichzeitig sind Energie und Emissionen, besonders Treibhausgase, globale Phänomene, die lokal nicht zu lösen sind.
»Von 2004 bis 2023 haben die globalen Investitionen in Wind und Solar rund 4 Billionen Dollar ausgemacht, und trotzdem sind die fossilen Energieträger dreimal schneller gewachsen.“ Zudem: „In den großen Industrienationen […] eine Reduktion der CO2-Emissionen, aber gleichzeitig einen Zuwachs in Indien und China, der diese Reduktionen um das Faktor 5 überschattet.«, Robert Bryce
Überrascht uns China? China hat mittlerweile die EU auch in den Pro-Kopf-Emissionen überholt. Was passiert, wenn Schwellenländer folgen?
»An China kann man erkennen, was passiert, wenn ein armes Land versucht, Wohlstand aufzubauen. Und das geht bis heute nur mit fossilen Energieträgern.«
Sind schnelle Lösungen gefährlich? Großinfrastruktur, Energiesysteme sind immer eine Frage von Jahrzehnten. Wenn wir versuchen, Dinge hier über das Knie zu brechen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie große und extrem teure Fehler machen, enorm. Außerdem stellt sich die Frage, welche Relevanz Europa überhaupt noch hat?
Welche Maßnahmen gegen den Klimawandel könnten erfolgreich sein? Was wurde etwa in Baku beschlossen? Funktionieren Transferzahlungen? Warum scheitert eine Renewables Only Strategie zwangsläufig?
»Die Idee, Renewables Only, ist ja eine von Deutschland immer wieder propagierte Idee.[… Es] ist nur eine Methode, [Entwicklungsländer] arm zu halten«
Aber was ist die Alternative? Was ist Carbon Capture? Was ist die Rolle von Kernkraft? Welche Mischung verschiedener Verfahren ist sinnvoll?
Zuletzt diskutieren wir über Strom vs. Moleküle und den All-Electric-Irrtum. Damit verbunden ist der Irrglaube, Wasserstoff könnte das Renable-Desaster lösen.
Welche geopolitischen Herausforderungen sind mit diesen Themen verknüpft? Ist Prof. Radermacher optimistisch — für Europa, die Welt? Was könnte man jungen Menschen empfehlen?
Referenzen
Andere Episoden
Episode 109: Was ist Komplexität? Ein Gespräch mit Dr. Marco Wehr
Episode 107: How to Organise Complex Societies? A Conversation with Johan Norberg
Episode 95: Geopolitik und Militär, ein Gespräch mit Brigadier Prof. Walter Feichtinger
Episode 94: Systemisches Denken und gesellschaftliche Verwundbarkeit, ein Gespräch mit Herbert Saurugg
Episode 86: Climate Uncertainty and Risk, a conversation with Dr. Judith Curry
Episode 81: Energie und Ressourcen, ein Gespräch mit Dr. Lars Schernikau
Episode 73: Ökorealismus, ein Gespräch mit Björn Peters
Episode 70: Future of Farming, a conversation with Padraic Flood
Episode 62: Wirtschaft und Umwelt, ein Gespräch mit Prof. Hans-Werner Sinn
Prof. Radermacher
Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung/n
Global Energy Solutions
Prof. Radermacher im Vorstand der Global Energy Solutions
All In: Energie und Wohlstand für eine wachsende Welt, Murmann (2024)
Fachliche Referenzen
Vaclav Smil, How the World Really Works, Penguin (2022)
Vaclav Smil, Net Zero 2050, Fraser Institute (2024)
Robert Bryce, The Energy Transition Isn't (2023)
Robert Bryce, Numbers Don’t Lie (2024)

Mar 13, 2025 • 28min
119 — Spy vs Spy: Über künstlicher Intelligenz und anderen Agenten
In dieser Folge tauchen wir tief in die Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) ein und betrachten sie aus einer systemischen Perspektive. Inspiriert vom klassischen Cartoon Spy vs. Spy geht es um die Frage, wie KI-Systeme miteinander interagieren — sowohl im Sinne von Kooperation als auch Konkurrenz — und welche Herausforderungen dies für uns Menschen mit sich bringt.
Ich beleuchte die evolutionäre Natur technischen Fortschritts, die Risiken von Komplexität und Kontrollverlust sowie die möglichen Folgen einer Zukunft, in der KI von einem passiven Werkzeug zu einem aktiven Akteur wird. Begleiten Sie mich auf einer Reise durch emergente Phänomene und Fulgurationen, systemische Abhängigkeiten und die Frage, wie wir die Kontrolle über immer komplexere Systeme behalten können. Denn es stellen sich zahlreiche Fragen:
Wie könnte sich die Interaktion zwischen KI-Systemen in der Zukunft entwickeln – eher kooperativ oder kompetitiv?
Welche Rolle spielt der Mensch noch, wenn KI-Systeme immer schneller Entscheidungen treffen und autonome Akteure werden?
Welche Erfahrungen haben Sie mit technischen Systemen gemacht, die durch Komplexität oder Automatisierung an Kontrolle verloren haben?
Was bedeutet es für unsere Gesellschaft, wenn wir durch Automatisierung Know-how und Kontrolle an externe Akteure abgeben?
Wie können wir den Übergang von KI als Spielzeug zu einem systemisch notwendigen Element gestalten, ohne in eine Abhängigkeit zu geraten?
Glauben Sie, dass KI jemals eine eigene Motivation oder Intentionalität entwickeln könnte – und wenn ja, wie sollten wir darauf reagieren?
Welche Strategien könnten helfen, die Kontrolle über komplexe, nicht-deterministische Systeme wie KI-Agenten zu behalten?
Wie sehen Sie die geopolitischen Herausforderungen der KI-Entwicklung, insbesondere in Bezug auf Energie und Innovation?
Welche positiven Szenarien können Sie sich für eine Zukunft mit KI und autonomen Agenten vorstellen?
Wie bereiten Sie sich persönlich oder in Ihrem Umfeld auf die kommenden Entwicklungen in der KI vor?
Ich freue mich Ihre Gedanken und Ansichten zu hören! Schreiben Sie mir und lassen Sie uns gemeinsam über die Zukunft nachdenken. Bis zum nächsten Mal beim gemeinsamen Nachdenken über die Zukunft!
Referenzen
Andere Episoden
Episode 109: Was ist Komplexität? Ein Gespräch mit Dr. Marco Wehr
Episode 107: How to Organise Complex Societies? A Conversation with Johan Norberg
Episode 104: Aus Quantität wird Qualität
Episode 103: Schwarze Schwäne in Extremistan; die Welt des Nassim Taleb, ein Gespräch mit Ralph Zlabinger
Episode 99: Entkopplung, Kopplung, Rückkopplung
Episode 94: Systemisches Denken und gesellschaftliche Verwundbarkeit, ein Gespräch mit Herbert Saurugg
Episode 90: Unintended Consequences (Unerwartete Folgen)
Episode 69: Complexity in Software
Episode 40: Software Nachhaltigkeit, ein Gespräch mit Philipp Reisinger
Episode 31: Software in der modernen Gesellschaft – Gespräch mit Tom Konrad
Fachliche Referenzen
Spy vs. Spy, The Complete Casebook
Rupert Riedl, Strukturen der Komplexität: Eine Morphologie des Erkennens und Erklärens, Springer (2000)
Doug Meil, The U.K. Post Office Scandal: Software Malpractice At Scale – Communications of the ACM (2024)
Casey Rosenthal, Chaos Engineering, O'Reilly (2017)

Mar 3, 2025 • 58min
118 — Science and Decision Making under Uncertainty, A Conversation with Prof. John Ioannidis
In this episode, I had the privilege of speaking with John Ioannidis, a renowned scientist and meta-researcher whose groundbreaking work has shaped our understanding of scientific reliability and its societal implications. We dive into his influential 2005 paper, Why Most Published Research Findings Are False, explore the evolution of scientific challenges over the past two decades, and reflect on how science intersects with policy and public trust—especially in times of crisis like COVID-19.
John had and has major impacts in our understanding of medical research, research quality in general, public health and how to handle critical situations under limited knowledge. His work was and is highly influential and extraordinarily important for our understanding where medical science, but really, science in general is standing, how we dealt with the Covid crisis, and how we could get our act together again.
He is professor of medicine at Stanford, expert in epidemiology, population health and biomedical data science.
We begin with John taking us back to 2005, when he published his paper in PLOS Medicine. He explains how it emerged from decades of empirical evidence on biases and false positives in research, considering factors like study size, statistical power, and competition that can distort findings, and why building on shaky foundations wastes time and resources.
“It was one effort to try to put together some possibilities, of calculating what are the chances that once we think we have come up with a scientific discovery with some statistical inference suggesting that we have a statistically significant result, how likely is that not to be so?”
I propose a distinction between “honest” and “dishonest” scientific failures, and John refines this. What does failure really mean, and how can they be categorised?
The discussion turns to the rise of fraud, with John revealing a startling shift: while fraud once required artistry, today’s “paper mills” churn out fake studies at scale. We touch on cases like Jan-Hendrik Schön, who published prolifically in top journals before being exposed, and how modern hyper-productivity, such as a paper every five days, raises red flags yet often goes unchecked.
“Perhaps an estimate for what is going on now is that it accounts for about 10%, not just 1%, because we have new ways of massive… outright fraud.”
This leads to a broader question about science’s efficiency. When we observe scientific output—papers, funding—grows exponentially but does breakthroughs lag? John is cautiously optimistic, acknowledging progress, but agrees efficiency isn’t what it could be. We reference Max Perutz’s recipe for success:
“No politics, no committees, no reports, no referees, no interviews; just gifted, highly motivated people, picked by a few men of good judgement.”
Could this be replicated in today's world or are we stuck in red tape?
“It is true that the progress is not proportional to the massive increase in some of the other numbers.”
We then pivot to nutrition, a field John describes as “messy.” How is it possible that with millions of papers, results are mosty based on shaky correlations rather than solid causal evidence? What are the reasons for this situation and what consequences does it have, e.g. in people trusting scientific results?
“Most of these recommendations are built on thin air. They have no solid science behind them.”
The pandemic looms large next. In 2020 Nassim Taleb and John Ioannidis had a dispute about the measures to be taken. What happened in March 2020 and onwards? Did we as society show paranoid overreactions, fuelled by clueless editorials and media hype?
“I gave interviews where I said, that’s fine. We don’t know what we’re facing with. It is okay to start with some very aggressive measures, but what we need is reliable evidence to be obtained as quickly as possible.”
Was the medicine, metaphorically speaking, worse than the disease? How can society balance worst-case scenarios without paralysis.
“We managed to kill far more by doing what we did.”
Who is framing the public narrative of complex questions like climate change or a pandemic? Is it really science driven, based on the best knowledge we have? In recent years influential scientific magazines publish articles by staff writers that have a high impact on the public perception, but are not necessarily well grounded:
“They know everything before we know anything.”
The conversation grows personal as John shares the toll of the COVID era—death threats to him and his family—and mourns the loss of civil debate. He’d rather hear from critics than echo chambers, but the partisan “war” mindset drowned out reason. Can science recover its humility and openness?
“I think very little of that happened. There was no willingness to see opponents as anything but enemies in a war.”
Inspired by Gerd Gigerenzer, who will be a guest in this show very soon, we close on the pitfalls of hyper-complex models in science and policy. How can we handle decision making under radical uncertainty? Which type of models help, which can lead us astray?
“I’m worried that complexity sometimes could be an alibi for confusion.”
This conversation left me both inspired and unsettled. John’s clarity on science’s flaws, paired with his hope for reform, offers a roadmap, but the stakes are high. From nutrition to pandemics, shaky science shapes our lives, and rebuilding trust demands we embrace uncertainty, not dogma. His call for dialogue over destruction is a plea we should not ignore.
Other Episodes
Episode 126: Schwarz gekleidet im dunklen Kohlekeller. Ein Gespräch mit Axel Bojanowski
Episode 122: Komplexitätsillusion oder Heuristik, ein Gespräch mit Gerd Gigerenzer
Episode 116: Science and Politics, A Conversation with Prof. Jessica Weinkle
Episode 112: Nullius in Verba — oder: Der Müll der Wissenschaft
Episode 109: Was ist Komplexität? Ein Gespräch mit Dr. Marco Wehr
Episode 107: How to Organise Complex Societies? A Conversation with Johan Norberg
Episode 106: Wissenschaft als Ersatzreligion? Ein Gespräch mit Manfred Glauninger
Episode 103: Schwarze Schwäne in Extremistan; die Welt des Nassim Taleb, ein Gespräch mit Ralph Zlabinger
Episode 94: Systemisches Denken und gesellschaftliche Verwundbarkeit, ein Gespräch mit Herbert Saurugg
Episode 92: Wissen und Expertise Teil 2
Episode 90: Unintended Consequences (Unerwartete Folgen)
Episode 86: Climate Uncertainty and Risk, a conversation with Dr. Judith Curry
Episode 67: Wissenschaft, Hype und Realität — ein Gespräch mit Stephan Schleim
References
Prof. John Ioannidis at Stanford University
John P. A. Ioannidis, Why Most Published Research Findings Are False, PLOS Medicine (2005)
John Ioannidis, A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, weare making decisions without reliable data (2020)
John Ioannidis, The scientists who publish a paper every five days, Nature Comment (2018)
Hanae Armitage, 5 Questions: John Ioannidis calls for more rigorous nutrition research (2018)
John Ioannidis, How the Pandemic Is Changing Scientific Norms, Tablet Magazine (2021)
John Ioannidis et al, Uncertainty and Inconsistency of COVID-19 Non-Pharmaceutical1Intervention Effects with Multiple Competitive Statistical Models (2025)
John Ioannidis et al, Forecasting for COVID-19 has failed (2022)
Gerd Gigerenzer, Transparent modeling of influenza incidence: Big data or asingle data point from psychological theory? (2022)
Sabine Kleinert, Richard Horton, How should medical science change? Lancet Comment (2014)
Max Perutz quotation taken from Geoffrey West, Scale, Weidenfeld & Nicolson (2017)
John Ioannidis: Das Gewissen der Wissenschaft, Ö1 Dimensionen (2024)

Feb 13, 2025 • 1h 8min
117 — Der humpelnde Staat, ein Gespräch mit Prof. Christoph Kletzer
Die heutige Episode hat wieder viel Spaß gemacht. Zu Gast ist Prof. Christoph Kletzer. Ich bin auf ihn gestoßen über einen Artikel in der Presse mit dem Titel »Der humpelnde Staat« — und das soll auch der Titel dieser Episode sein.
Prof. Christoph Kletzer ist Professor am King’s College London und eine profilierte Stimme in politischen Debatten.
»Eine seltsame Krankheit hat unsere europäische Staatsordnung befallen: Sie interessiert sich immer stärker für die kleinsten Details unseres Lebens, wird immer einfallsreicher bei der Tiefenregulierung des Alltags, lässt uns aber mit unseren brennendsten Nöten allein.«
Wir beginnen mit der Frage nach den immer stärker werdenden staatlichen Eingriffen. Welche Beispiele kann man dafür nennen?
»Im Grunde haben wir alle so kleine Sandboxen, in denen wir spielen dürfen«
Und dennoch verlieren viele der westlichen Staaten zunehmend die Fähigkeiten, ihre Kernaufgaben zu erfüllen.
Erleben wir in den vergangenen Jahrzehnten einen zunehmenden Illiberalismus? Das Ganze scheint gepaart zu sein mit einer wachsenden Moralisierung aller möglichen Lebensbereiche.
»Die Unfähigkeit im Großen wird durch aggressiven Kleingeist kompensiert.«
Was ist die Rolle der einzelnen Akteure und des Systems?
»Die Funktion des Systems ist das, was es tut« — »The purpose of a system is what it does«, Stafford Beer
Woher kommt dieses Verrutschen des staatlichen Fokus?
»Machtlosigkeit im Inneren wird mit technokratischem Verwaltungsstaatshandeln kompensiert. Das ist zum Teil in die DNA der Europäischen Union eingeschrieben.«
Sie wird als Neo-Funktionalismus bezeichnet. Was bedeutet dies? Wurden wir in eine politische Einheit geschummelt? Wer hat eigentlich welche Kompetenz und wer trägt für welche Entscheidungen konkret Verantwortung?
»Das wirkt mir eher nach FIFA als nach einem demokratischen System.«
Oder wie der Komplexitätsforscher Peter Kruse es ausgedrückt hat:
»In einem Krabbenkorb herrscht immer eine Mordsdynamik, aber bei genauerem Hinsehen stellt man fest, dass eigentlich nichts richtig vorwärtsgeht.«
Wie kann man komplexe Systeme strukturieren oder Ordnung in komplexe Systeme bringen? Gibt es einen verfassungsrechtlichen Geburtsfehler in der EU? Kann man diesen noch beheben? Wird das Problem überhaupt diskutiert?
Welche Rolle spielen Preise in der Selbstorganisation komplexer Wirtschaften?
Kann Innovation als Arbitrage betrachtet werden?
Wie viel kann bei einer komplexen Einheit wie der EU zentral gesteuert werden und wie viel muss sich durch selbstorganisierende Phänomene gestalten lassen? Sollten wir bei Kernaufgaben (was sind diese?) zentralistischer handeln und mehr Staat haben, aber beim Rest viel weniger Staat zulassen?
Was können wir von der Situation in Argentinien und Javier Milei lernen? Warum sind Preiskontrollen fast immer eine verheerende Idee?
Gleiten Top-Down organisierte, etatistische Systeme immer in Totalitarismus ab?
Was sind Interventionsspiralen, wie entstehen sie und wie kann man sie vermeiden?
Erleben wir eine Auflösung der regelbasierten globalen Ordnung und wie ist das zu bewerten, vor allem auch aus europäischer Perspektive? Werden wir vom Aufschwung, der aus Nationen wie den USA oder Argentinien kommt, überrollt; haben wir mit unserer Trägheit hier überhaupt noch eine Chance, mitzukommen?
Gibt es eine »Angst vor Groß« in Europa? Dafür aber dominieren Sendungsbewusstsein und Hochmut? Wie spielt diese Angst zusammen mit einer der aktuell größten technologischen Veränderungen, der künstlichen Intelligenz?
Haben wir es im politischen und bürokratischen Systemen mit einer Destillation der Inkompetenz zu tun? Oder liegt das Problem eher bei einer Politisierung der Justiz?
»Die künftige Konfliktlage ist zwischen Justiz und Parlament.«
Wer regiert eigentlich unsere Nationen? Politik oder »Deep State«? War der »Marsch durch die Institutionen« erfolgreich und hat unsere Nationen nachhaltig beschädigt?
Wer hat eigentlich den Anreiz, in die öffentliche Verwaltung zu gehen?
Braucht es die überschießende Rhetorik von Milei, um überhaupt eine Chance zu haben, den Stillstand zu beenden?
»By liberty, was meant protection against the tyranny of the political rulers.«, John Stuart Mill
Erleben wir eine Umkehrung der hart erkämpften Werte der Aktivisten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts? Ist der Schutz von Politikern wichtiger als die freie Meinungsäußerung? Wo sind wir hingeraten?
Was bedeutet Liberalismus überhaupt und wie hat sich der Begriff verändert? Wie setzt sich der liberale Staat gegen seine Feinde zur Wehr? Aber wer entscheidet, wer der Feind ist Wie weit kann der Staat »neutral« bleiben, wie weit muss er Werte haben?
Von der Wiege bis zur Bahre, vom Staat bevormundet? Ist das dann zu viel? Oder wollen das viele wirklich?
»Die Schwierigkeit der Menschen, erwachsen zu werden, ist auch ein Wohlstandsphänomen. Der Wohlstand, den wir haben, führt auch zum ewigen Kind.«
Aber dazu kommt noch eine weitere Dimension:
»Auch die Hypermoral ist ja eine infantile Geschichte.«
Woher kommen eigentlich die großen Veränderungen im späten 20. und 21. Jahrhundert?
»Die neue Revolution ist nicht ausgegangen von der Arbeiterschaft, sondern von der administrativen Elite«, James Burnham
Schafft der administrative Staat immer neue Situationen, die immer neue Eingriffe notwendig machen und die eigene Macht verstärken? Werden also immer neue paternalistische Strukturen notwendig, um die Probleme zu »lösen«, die selbst zuvor verursacht wurden? Und diese Problemlösung erzeugt wieder neue Probleme, die … Ist das Lösen der Probleme im Sinne der Machtstruktur gar nicht wünschenswert?
Trifft dies nicht nur auf politische, sondern auch auf andere Organisationsstrukturen zu?
Was ist die »eisige Nacht der polaren Kälte« nach Max Weber? Kann man eine Bürokratie der Debürokratisierung und damit eine Multiplikation des Problems vermeiden? Lässt sich dieses Dilemma rational, vernünftig lösen oder stecken wir hier in der Pathologie der Rationalität fest?
Braucht es einen Clown, um den gordischen Knoten durchzuschlagen? Aber steckt in dieser Irrationalität nicht auch eine Gefahr? Welches unbekannte Know-how steckt — nach konservativer Logik — in den etablierten Strukturen?
Stehen wir vor der Wahl einer tödlichen Verfettung oder einer gefährlichen Operation? Was wählen wir?
Welches Hindernis stellt Statusdenken und Verhaften in Hierarchien dar? Signalisierung vor Bedeutung?
Hilft das Denken von Foucault, um diese Problemlagen besser zu verstehen?
»Academia has a tendency, when unchecked (from lack of skin in the game), to evolve into a ritualistic self-referential publishing game.«, Nassim Taleb
Spielen wir in der Wissenschaft Cargo-Kult im 21. Jahrhundert?
»Wenn man nur die richtigen Wörter sagt [passend zum jeweiligen Kult], dann ist es schon wahr.«
Und der Cargo-Kult applaudiert.
»Status können wir in Europa. Und Status ist per definitionem Abwendung von Realität.«
Wie gehen wir in die Zukunft?
»Ich bin für den Einzelnen optimistisch, fürs Kollektiv weniger.«
Referenzen
Andere Episoden
Episode 111: Macht. Ein Gespräch mit Christine Bauer-Jelinek
Episode 107: How to Organise Complex Societies? A Conversation with Johan Norberg
Episode 106: Wissenschaft als Ersatzreligion? Ein Gespräch mit Manfred Glauninger
Episode 103: Schwarze Schwäne in Extremistan; die Welt des Nassim Taleb, ein Gespräch mit Ralph Zlabinger
Episode 99: Entkopplung, Kopplung, Rückkopplung
Episode 96: Ist der heutigen Welt nur mehr mit Komödie beizukommen? Ein Gespräch mit Vince Ebert
Episode 95: Geopolitik und Militär, ein Gespräch mit Brigadier Prof. Walter Feichtinger
Episode 88: Liberalismus und Freiheitsgrade, ein Gespräch mit Prof. Christoph Möllers
Episode 77: Freie Privatstädte, ein Gespräch mit Dr. Titus Gebel
Episode 72: Scheitern an komplexen Problemen? Wissenschaft, Sprache und Gesellschaft — Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann
Christoph Kletzer
Kings College
X
Fachliche Referenzen
Christoph Kletzer, Presse Kommentar, Der humpelnde Staat: So geht sicher nichts weiter (2024)
Stafford Beer, The Heart of Enterprise, Wiley (1979)
Thomas Sowell, intellectuals and Society, Basic Books (2010)
Friedrich von Hayek, The Road to Serfdom, Routledge (1944)
John Stuart Mill, On Liberty (1859)
David Graeber, The Dawn of Everything, A New History of Humanity, Farrar, Strauss and Giroux (2021)
Max Weber, Politik als Beruf (1919)
Nassim Taleb, Skin in the Game, Penguin (2018)
Steven Brindle, Brunel: The Man Who Built the World, W&N (2006)

Jan 27, 2025 • 53min
116 — Science and Politics, A Conversation with Prof. Jessica Weinkle
Todays guest is Jessica Weinkle, Associate Professor of Public Policy at the University of North Carolina Wilmington, and Senior Fellow at The Breakthrough Institute.
In this episode we explore a range of topics and we start with the question: What is ecomodernism, and how does The Breakthrough Institute and Jessica interpret it?
“It's not a movement of can'ts”
Why are environmentalists selective about technology acceptance? Why do we assess ecological impact through bodies like the IPCC and frameworks like Planetary Boundaries? Are simplified indicators of complex systems genuinely helpful or misleading?
Is contemporary science more about appearances than substance, and do scientific journals serve more and more as advocacy platforms than fact-finding missions? How much should activism and science intersect? To what extent do our beliefs influence science, and vice versa, especially when financial interests are at play in fields like climate science? Can we trust scientific integrity when narratives are tailored for publication, like in the case of Patrick Brown?
What responsibilities do experts have when consulting in political spheres, and should they present options or advocate for specific actions? How has research publishing turned into big business, and what does this mean for the pursuit of truth?
“Experts should always say: here are your options A, B, C...; not: I think you should do A”
How does modeling shape global affairs? When we use models for decision-making, are we taking them too literally, or should we focus on their broader implications?
“To take a model literally is not to take it seriously […] the models are useful to give us some ideas, but the specificity is not where we should focus.”
What's the connection between scenario building, modeling, and risk management?
“There is an institutional and professional incentive to make big claims, to draw attention. […] That's what we get rewarded for. […] It does create an incentive to push ideas that are not necessarily the most helpful ideas for addressing public problems.”
How does the public venue affect scientists, and does the incentive to make bold claims for attention come at the cost of practical solutions? What lessons should we have learned from cases like Jan Hendrik Schön, and why haven't we?
“There is an underappreciation for the extent to which scholarly publishing is a business, a big media business. It's not just all good moral virtue around skill and enlightenment. It's money, fame and fortune.”
Finally, are narratives about future scenarios fueling climate anxiety, and how should we address this in science communication and policy-making?
“There is a freedom in uncertainty and there is also an opportunity to create decisions that are more robust to an unpredictable future. The more that we say we are certain ... the more vulnerable we become to the uncertainty that we are pretending is not there.”
Other Episodes
Episode 109: Was ist Komplexität? Ein Gespräch mit Dr. Marco Wehr
Episode 107: How to Organise Complex Societies? A Conversation with Johan Norberg
Episode 90: Unintended Consequences (Unerwartete Folgen)
Episode 86: Climate Uncertainty and Risk, a conversation with Dr. Judith Curry
Episode 79: Escape from Model Land, a Conversation with Dr. Erica Thompson
Episode 76: Existentielle Risiken
Episode 74: Apocalype Always
Episode 70: Future of Farming, a conversation with Padraic Flood
Episode 68: Modelle und Realität, ein Gespräch mit Dr. Andreas Windisch
Episode 60: Wissenschaft und Umwelt — Teil 2
Episode 59: Wissenschaft und Umwelt — Teil 1
References
Jessica Weinkle
Jessica on Substack
Jessica at The Breakthrough Institute
Jessica at the Department of Public and International Affairs (UNCW)
The Breakthrough Journal
Planetary Boundaries (Stockholm Resilience Centre)
Patrick T. Brown, I Left Out the Full Truth to Get My Climate Change Paper Published, The FP (2023)
Roger Pielke Jr., What the media won't tell you about . . . hurricanes (2022)
Roger Pielke Jr., "When scientific integrity is undermined in pursuit of financial and political gain" (2023)
Many other excellent articles Roger Pielke on his Substack The Honest Broker
Jessica Weinkle, Model me this (2024)
Jessica Weinkle, How Planetary Boundaries Captured Science, Health, and Finance (2024)
Jessica Weinkle, Bias. Undisclosed conflicts of interest are a serious problem in the climate change literature (2025)
Marcia McNutt, The beyond-two-degree inferno, Science Editorial (2015)
Scientific American editor quits after anti-Trump comments, Unherd (2024)
Erica Thompson, Escape from Model Land, Basic Books (2022)

Jan 7, 2025 • 21min
115 — Fragen über Fragen
Jahresrückblicke finde ich eher langweilig; jeder weiß, was im letzten Jahr passiert ist. Für mich ist es viel spannender zu reflektieren, was wir aus dem vergangenen Jahr lernen können. Welche Irrtümer haben wir gemacht, welche eigenen Ideen wurden in Frage gestellt? Welche neuen Fragen stellen sich und welche werden entscheidend für das kommende Jahr sein? Fragen scheinen mir konstruktiver zu sein als Antworten, da sie das Denken leiten und zu Diskussionen und Widersprüchen einladen, ohne die Antworten vorwegzunehmen.
Diese Episode widmet sich genau diesen Fragen und Themen, die besonders in den Episoden des letzten Jahres diskutiert wurden. Beginnen wir mit den »Strukturen des Versagens«. Nach Rory Sutherland kann das Gegenteil von gut ebenfalls gut sein. Das Gegenteil von schlecht hingegen ist oft noch schlechter. Die »Contrarian« Position ist keine stabile Basis zur Wahrheitsfindung. Nur durch ehrliche Auseinandersetzung und stetigen kritischen Diskurs können wir der Wahrheit näherkommen. Wir können die Realität ignorieren, aber nicht die Folgen dieses Ignorierens – ein Phänomen, das in den nächsten Jahren in Europa besonders bitter werden könnte, wenn wir weiterhin politisches oder aktivistisches Wunschdenken über die Realität stellen.
Ein weiteres Thema ist, was die Legacy-Medien ersetzen wird. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass traditionelle Medien an journalistischem Wert und Bedeutung verloren haben. Die US-Wahlen wurden durch Podcasts und soziale Medien beeinflusst, und in Europa könnten ähnliche Überraschungen folgen. Aber was sollte diese Systeme ersetzen?
Weiters haben wir diskutiert, ob mehr Wissenschaftler wirklich zu besserer Wissenschaft führen. Es gibt Anzeichen für Marktverzerrungen in der Wissenschaft, was zu kurzfristigen Zielen und Stagnation führt. Wie sollte Wissenschaftsförderung stattfinden, zumal der aktuelle Zustand nicht zufriedenstellend ist?
Komplexität und Resilienz sind ein weiteres Thema. Der Irrglaube, dass komplex gleich fragil ist, wird von der Natur widerlegt, die komplex und zugleich, oder gerade deshalb (?) resilient ist. Menschliche Systeme hingegen scheinen oft durch Komplexität fragil zu werden. Welche Faktoren machen ein komplexes System resilient oder fragil?
Ein weiterer Punkt ist das Konzept von Skin in the Game gegenüber Risikovermeidung. Gesellschaften brauchen Menschen, die kluge Risiken eingehen — Unternehmer, Innovatoren, Wissenschaftler. Doch wie kann man Risikobereitschaft fördern, wenn diese Risiken das eigene Leben zerstören können?
Schließlich diskutieren wir den Liberalismus, die Freiheit und die Organisation komplexer Gesellschaften. Zentrale Lösungen für komplexe Probleme scheitern erwartungsgemäß. Kann und sollte man dysfunktionale Systeme reformieren oder ist ein Neuanfang nötig?
Wie erwachsen sind Erwachsene wirklich und wie viel Selbstverantwortung kann man von ihnen in einer komplexen Gesellschaft erwarten?
Schreiben Sie mir Ihre Gedanken dazu – Diskussion und Widerspruch sind herzlich willkommen.
In diesen Shownotes gibt es keine Referenzen. Sie beziehen sich auf die Episoden des letzten Jahres.

Dec 26, 2024 • 41min
114 — Liberty in Our Lifetime 2: Conversations with Lauren Razavi, Grant Romundt and Peter Young
This is episode 2 with conversations from the Liberty in our Lifetime Conference. Please start with the first part; show notes and references also with episode 1.

Dec 17, 2024 • 46min
113 — Liberty in Our Lifetime 1: Conversations with Massimo Mazzone, Vera Kichanova and Tatiana Butanka
This episode is a special one as it brings you my impressions from the Liberty in Our Lifetime Conference held in Prague from November 1 to 3. Unlike my usual format of monologues or single guest interviews, this episode features brief conversations with six presenters from the conference, split into two parts.
In this first part, I speak with Massimo Mazzone about building a blue-collar Free City in Honduras, followed by discussions with urban economist Vera Kichanova, and Tatiana Butanka, who shares insights on the Free Community of Montelibero.
The conference, which generally leans towards libertarian ideas, showcases an astounding range of initiatives aimed at enhancing liberty in society.
I explore why successful societies should embrace explorers and risk-takers, questioning whether today's fear of challenging the status quo contradicts a progressive mindset. This aligns with Tatiana Butanka's appreciation for the variety of projects that are present at this conference and Lauren Razavi's call for the need of
"revolutionary thinking with evolutionary approaches."
Part two (Episode #114) will continue with conversations with Lauren Razavi, who is building an online country for digital nomads, Grant Romundt, discussing his project on floating homes, and Peter Young from the Free Cities Foundation, reflecting on free cities and the conference's outcomes.
I emphasize the importance of experimentation in dynamic societies, suggesting that progress relies on educated experiments and unique ideas, some of which will succeed, fail, or at least inspire. The discussions explore the balance between collective action and individual liberty, questioning if modern democracies have swung too far towards government control.
Two additional remarks:
No financial advice is given, despite mentions of new financial instruments in some conversations.
For full disclosure: I received a free ticket for the conference.
Other Episodes
Episode 108: Freie Privatstädte Teil 2, ein Gespräch mit Titus Gebel
Episode 107: How to Organise Complex Societies? A Conversation with Johan Norberg
Episode 88: Liberalismus und Freiheitsgrade, ein Gespräch mit Prof. Christoph Möllers
Episode 58: Verwaltung und staatliche Strukturen — ein Gespräch mit Veronika Lévesque
Episode 77: Freie Privatstädte, ein Gespräch mit Dr. Titus Gebel
Episode 44: Was ist Fortschritt? Ein Gespräch mit Philipp Blom
References
Liberty in Our Lifetime Conference
Massimo Mazzone
Massimo on X
Ciudad Morazan
Tatiana Butanka
Montelibero Wiki
Montelibero
Vera Kichanova
Vera's Homepage
Vera on LinkedIn
Vera on Facebook
Vera on X
Lauren Razavi
Lauren Razavi, Global Natives
Plumia
Lauren on X
Grant Romundt
Grant on X
Oceanbuilders
Peter Young
Peter on LinkedIn
Peter on X
Free Cities Foundation

Dec 4, 2024 • 17min
112 — Nullius in Verba — oder: Der Müll der Wissenschaft
Heute wieder eine Episode in der ich kurz über eine Thema der Wissenschaftspraxis reflektieren möchte, den meisten Zuhörern wahrscheinlich nicht klar ist, dessen Konsequenzen sich auch mir noch nicht völlig erschließen, ich freue mich also auf Emails und Kommentare. Das Thema ist wenig erbaulich, ist aber ein Puzzlestein, der gut in das Bild passt, das wir in einigen früheren Episoden schon angesprochen haben.
Die Qualität des wissenschaftlichen Publikationswesens scheint sich im Sturzflug zu befinden und dies seit vielen Jahren. Die deutsche Physikerin Sabine Hossenfeldern sagt leicht polemisch:
»Scientific Process is slowing down and most of what gets published in academia is now bullshit.«
Was erleben wir in den letzten Jahrzehnten und warum hat mich eine persönliche Beobachtung zu dieser Episode gebracht?
Warum ist das Motto der 1660 gegründeten Royal Society heute aktueller als je zuvor.
»Nullius in Verba«
Referenzen
Andere Episoden
Episode 106: Wissenschaft als Ersatzreligion? Ein Gespräch mit Manfred Glauninger
Episode 104: Aus Quantität wird Qualität
Episode 91: Die Heidi-Klum-Universität, ein Gespräch mit Prof. Ehrmann und Prof. Sommer
Episode 86: Climate Uncertainty and Risk, a conversation with Dr. Judith Curry
Episode 84: (Epistemische) Krisen? Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann
Episode 79: Escape from Model Land, a Conversation with Dr. Erica Thompson
Episode 71: Stagnation oder Fortschritt — eine Reflexion an der Geschichte eines Lebens
Episode 68: Modelle und Realität, ein Gespräch mit Dr. Andreas Windisch
Episode 47: Große Worte
Episode 41: Intellektuelle Bescheidenheit: Was wir von Bertrand Russel und der Eugenik lernen können
Episode 39: Follow the Science?
Fachliche Referenzen
Report of the Investigation Committee on the Possibility of Scientific Misconduct in the Work of Hendrik Schön And Coauthors
Publikationen von Jan Hendrik Schön (Google Scholar)
John Ioannidis, Das Gewissen der Wissenschaft, Ö1 Dimensionen (2024)
John Ioannidis, The scientists who publish a paper every five days, Nature Comment (2018)
John P. A. Ioannidis, Why Most Published Research Findings Are False (2005)
Jesse Singal, Quick Fix, Picador (2022)
Erica Thompson, Escape from Model Land, Basic Books (2022)
Sabine Hossenfelder, Lost in Math: How Beauty Leads Physics Astray (2020)
Beall's List
Jeffrey Beall
Sabine Hossenfelder, Science is in trouble and it worries me (2024)


