
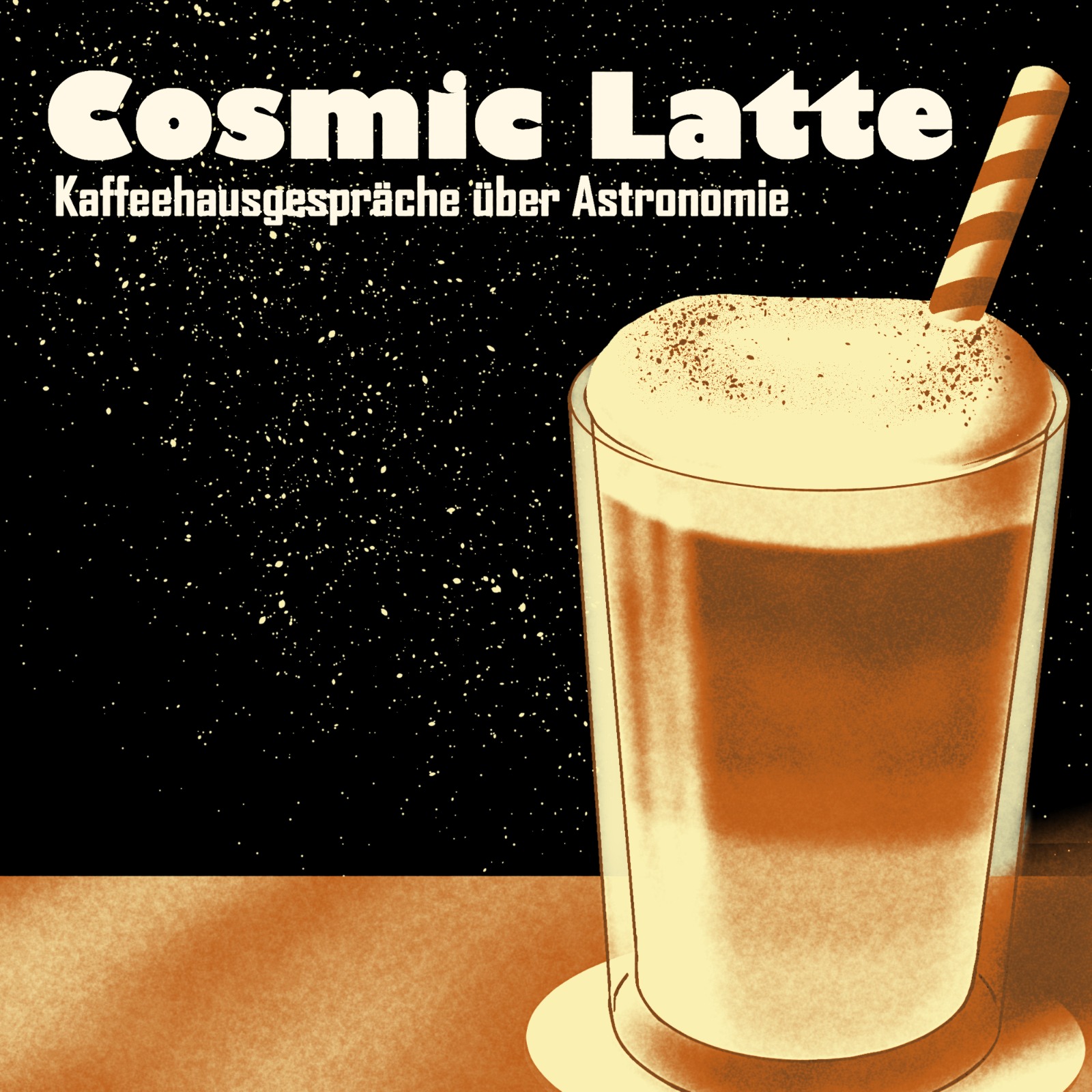
Cosmic Latte
Eva Pech, Jana Steuer, Elka Xharo
Willkommen beim Cosmic Latte Podcast!
Begleite Eva, wenn sie mit Jana und Elka bei einem Kaffeehausgespräch, über Galaxien, Sterne und die faszinierenden Wunder unseres Universums plaudert. Ihre Leidenschaft für Astronomie und Wissenschaftskommunikation verbindet die Podcasterinnen miteinander.
Eva studiert Astronomie an der Universität Wien. Sie hat einen Abschluss in Kommunikationswissenschaften und erst vor kurzem ihre Masterarbeit über Wissenschaftskommunikation geschrieben. Sie ist neben diesem Podcast auch im Podcast „Das Universum“ zu hören, wo sie über Science in Science-Fiction Filmen redet. Sie träumt davon, eines Tages ins Weltall fliegen zu können.
Elka ist zur Zeit FH-Lektorin und hat eine Ausbildung zur Medizinphysikerin abgeschlossen. Außerdem beitreibt sie als @thesciencyfeminist auf Instagram einen erfolgreichen Wissenschaftskommunikationskanal, der vor allem Frauen in der Wissenschaft sichtbar machen soll. Sie träumt davon, eines Tages Evas Weltraumflug programmieren zu dürfen.
Jana ist unser neuer Zugang bei Cosmic Latte. Sie hat nach ihrem Masterabschluss in Astrophysik nach Exoplaneten geforscht, bevor sie in die Wissenschaftskommunikation wechselte. Heute ist sie Redaktionsmitglied des YouTube-Kanals „Terra X Lesch & Co“. Neben Cosmic Latte ist sie auch in den beiden Podcasts „translunar“ und „Ein großer Schritt für die Menschheit“ zu hören.
Tauche in diesem Podcast in spannende astronomische Gespräche ein. Mach es dir gemütlich und erfahre Interessantes über die Geheimnisse des Kosmos!
Falls du Fragen hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, erreichst du uns jederzeit per E-Mail unter: kontakt@cosmiclatte.at.
Du kannst uns gerne unterstützen und zwar bei Steady (https://steadyhq.com/de/cosmiclatte/), Patreon (https://patreon.com/CosmiclattePodcast), Paypal (https://paypal.me/cosmiclattepod)!
Begleite Eva, wenn sie mit Jana und Elka bei einem Kaffeehausgespräch, über Galaxien, Sterne und die faszinierenden Wunder unseres Universums plaudert. Ihre Leidenschaft für Astronomie und Wissenschaftskommunikation verbindet die Podcasterinnen miteinander.
Eva studiert Astronomie an der Universität Wien. Sie hat einen Abschluss in Kommunikationswissenschaften und erst vor kurzem ihre Masterarbeit über Wissenschaftskommunikation geschrieben. Sie ist neben diesem Podcast auch im Podcast „Das Universum“ zu hören, wo sie über Science in Science-Fiction Filmen redet. Sie träumt davon, eines Tages ins Weltall fliegen zu können.
Elka ist zur Zeit FH-Lektorin und hat eine Ausbildung zur Medizinphysikerin abgeschlossen. Außerdem beitreibt sie als @thesciencyfeminist auf Instagram einen erfolgreichen Wissenschaftskommunikationskanal, der vor allem Frauen in der Wissenschaft sichtbar machen soll. Sie träumt davon, eines Tages Evas Weltraumflug programmieren zu dürfen.
Jana ist unser neuer Zugang bei Cosmic Latte. Sie hat nach ihrem Masterabschluss in Astrophysik nach Exoplaneten geforscht, bevor sie in die Wissenschaftskommunikation wechselte. Heute ist sie Redaktionsmitglied des YouTube-Kanals „Terra X Lesch & Co“. Neben Cosmic Latte ist sie auch in den beiden Podcasts „translunar“ und „Ein großer Schritt für die Menschheit“ zu hören.
Tauche in diesem Podcast in spannende astronomische Gespräche ein. Mach es dir gemütlich und erfahre Interessantes über die Geheimnisse des Kosmos!
Falls du Fragen hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, erreichst du uns jederzeit per E-Mail unter: kontakt@cosmiclatte.at.
Du kannst uns gerne unterstützen und zwar bei Steady (https://steadyhq.com/de/cosmiclatte/), Patreon (https://patreon.com/CosmiclattePodcast), Paypal (https://paypal.me/cosmiclattepod)!
Episodes
Mentioned books

Aug 21, 2025 • 22min
CL066 Dänemark Special: Tycho Brahe und die flüsternden Polarlichter
Die Episode über nordische Mythologie, die fehlende Nase und den betrunkenen Elch
Wir freuen uns über eine Spende über Steady, Patreon oder Paypal.
Unser letztes Sommer-Special bringt uns in den hohen Norden Europas. In Dänemark verschmelzen Mythos und Wissenschaft zu einer einzigartigen Sicht auf den Himmel. In dieser Episode gehen Eva und Jana den kosmischen Vorstellungen der nordischen Mythologie nach und treffen auf einen der exzentrischsten Astronomen der Geschichte: Tycho Brahe. Mit unglaublicher Präzision beobachtete er den Himmel, entdeckte die Supernova von 1572 und lieferte die Daten, die Johannes Kepler später zu seinen berühmten Planetengesetzen führten.
Polarlichter und nordische Mythologie
Der hohe Norden Europas ist nicht nur für seine spektakulären Landschaften bekannt, sondern auch für eine ganz eigene Tradition in Mythologie und Astronomie.
Wir beginnen unsere Reise mit den Mythen, die in der Edda überliefert sind:
Die Welt gliedert sich in drei Bereiche: Asgard (die Götterwelt), Midgard (die Menschenwelt) und Hel/Niflheim (die Unterwelt).
Verbunden werden sie durch den Weltenbaum Yggdrasil, der als kosmische Achse das Universum zusammenhält. Eine zentrale Rolle spielt auch der Bifrost, die flackernde Himmelsbrücke zwischen Göttern und Menschen, die von Heimdall bewacht wird und deren Zerstörung im Ragnarök, dem Weltuntergang, vorhergesagt ist. Manche Deutungen sehen in ihr die Polarlichter, die den Himmel durchziehen.
Besonders faszinierend ist der Blick der Samen, der indigenen Bevölkerung Skandinaviens. Sie sahen in den Nordlichtern die Seelen der Toten, tanzende Geister oder göttliche Botschaften. Ihr Wort Guovssahasat bedeutet sogar „Lichter, die gehört werden können“. Und erstaunlicherweise bestätigt die moderne Forschung inzwischen: Polarlichter können tatsächlich Töne hervorrufen: klickende, sirrende oder klirrende Geräusche, ausgelöst durch elektrostatische Entladungen in Bodennähe.
Das exzentrische Leben von Tycho Brahe
Von der Mythologie springen wir zur Wissenschaft und lernen den wohl schillerndsten Astronomen Dänemarks kennen: Tycho Brahe (1546–1601). Seine Beobachtung der Supernova von 1572 erschütterte das aristotelische Weltbild, das bis dahin den Himmel als unveränderlich betrachtete. Brahe bewies durch präzise Messungen ohne Fernrohr (allein mit gigantischen Instrumenten wie Sextanten und Armillarsphären), dass sich auch die Sternensphäre verändert. Seine Genauigkeit war revolutionär: Positionen bis auf eine Bogenminute genau, ein Durchbruch für die Astronomie.
Seine Sternwarte Uraniborg auf der Insel Hven gilt als eines der ersten modernen Observatorien. Von dort aus sammelte er Daten, die später Johannes Kepler zur Formulierung seiner Planetengesetze nutzte. Doch das Verhältnis zwischen Brahe und Kepler war kompliziert: Stolz und Status auf der einen, revolutionäre Ideen auf der anderen Seite. Erst nach Brahes Tod konnte Kepler auf die wertvollen Daten zugreifen und das Weltbild durch die Kepler Gestze dauerhaft verändern.
Brahe selbst war eine außergewöhnliche Figur: Exzentriker mit metallener Nasenprothese nach einem Degenduell, Besitzer eines zahmen Elchs (der angeblich an einem Bierunfall starb) und Arbeitgeber eines Hofzwergs, dem er übersinnliche Fähigkeiten zuschrieb. Sein Tod ist bis heute von Mythen umrankt, ob durch Krankheit, Quecksilbervergiftung oder gar eine Intrige Keplers bleibt Spekulation. Sicher ist jedoch, dass seine präzisen Beobachtungen wesentlich dazu beitrugen, die Gesetze des Himmels zu entschlüsseln.
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen.
Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Instagram Cosmic Latte |
Cosmic Latte ist eine Space Monkey Produktion.
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Aug 7, 2025 • 17min
CL065 München-Special: Fraunhofer und das Geheimnis des Sternenlichts
Die Episode über Glück im Unglück und dunkle Linien im Regenbogen
Unterstützt uns bei Steady, Patreon oder Paypal!
In diesem Sommer-Special treffen sich Eva und Jana in München, um einem allgegenwärtigen Namen auf die Spur zu gehen: Joseph von Fraunhofer.
Wer war dieser Mann, nach dem Straßen, U-Bahn-Stationen, Theater und die Fraunhofer-Gesellschaft benannt sind?
Wir werfen einen Blick auf seine unglaubliche Lebensgeschichte, die ihn, von Glück und Unglück geprägt, zum Vorbereiter der wichtigsten Methode der modernen Astronomie machte.
Begrüßung in München
Eva und Jana treffen sich zum ersten Mal in München. Es liegt also nahe, sich die wissenschaftlichen Berühmtheiten der deutschen Metropole anzusehen.
Dabei ist ein Name hier allgegegenwärtig: Joseph von Fraunhofer.
Es gibt eine U-Bahnstation, eine Straße, ein Theater und nicht zuletzt die renommierte Fraunhofer-Gesellschaft. Doch was Joseph von Fraunhofer eigentlich entdeckt hat, und warum er bis heute als einer der wichtigsten Pioniere der Optik und Astronomie gilt, wissen wahrscheinlich die wenigsten.
Grund genug, uns sein Leben und sein Werk genauer anzusehen. Dafür begeben wir uns auf eine Zeitreise, 200 Jahre zurück und lernen einen Jungen kennen, dessen Lebensweg alles andere als geradlinig verlief.
Joseph Fraunhofer und das Licht
Joseph Fraunhofer wurde am 6. März 1787 in Straubing geboren, als eines von elf Kindern einer armen Familie. Mit zehn Jahren verlor er seine Mutter und nur ein Jahr später auch seinen Vater. Als Waisenkind kam er 1799 nach München in die Lehre bei einem Spiegelmacher und Glasschleifer. Eine formale Schulbildung hatte er nie.
Doch dann geschah ein Ereignis, das sein Leben völlig verändern sollte: 1801 stürzte das Haus seines Lehrmeisters ein. Fraunhofer überlebte wie durch ein Wunder und wurde dabei von niemand Geringerem als Kurfürst Maximilian IV. aus den Trümmern gerettet. Der Herrscher schenkte ihm 18 Dukaten, mit denen sich der junge Joseph eine Glasschneidemaschine kaufen konnte. Auch der Politiker und Unternehmer Joseph Utzschneider, der bei der Rettung zugegen war, erkannte Fraunhofers Talent und verschaffte ihm Zugang zu Fachliteratur über Mathematik und Optik.
Mit dieser seltenen Mischung aus Werkzeug, Wissen und unbändigem Ehrgeiz trat Fraunhofer dem Mathematisch-Feinmechanischen Institut bei, wo er bald optische Geräte und neue Glassorten entwickelte, die alles übertrafen, was es damals zu kaufen gab. Mikroskope und Fernrohre aus der Werkstatt wurden in ganz Europa geschätzt.
Doch Fraunhofer begnügte sich nicht mit der handwerklichen Seite seines Berufs, sondern wollte auch verstehen, was man mit diesen Instrumenten alles entdecken konnte.
Besonders faszinierte ihn das Licht. Isaac Newton hatte bereits gezeigt, dass Sonnenlicht aus vielen Farben besteht, die man mit einem Prisma in einen Regenbogen aufspalten kann. 1802 hatte der schottische Forscher William Hyde Wollaston dabei dunkle Linien im Spektrum gesehen, die er aber für Trennlinien zwischen den Farben hielt.
Als Fraunhofer 1814 selbst das Sonnenlicht untersuchte, entdeckte er nicht nur dieselben Linien, sondern Hunderte davon! Da diese derart zahlreich waren, war klar: Hier steckt ein bislang ungelöstes physikalisches Rätsel. Fraunhofer perfektionierte seine Beobachtungsmethode, indem er statt eines Prismas ein feines Beugungsgitter einsetzte, und katalogisierte über 570 dieser dunklen Linien, die heute als Fraunhoferlinien bekannt sind.
Die Erklärung für diese Linien fand er leider nicht mehr heraus. Fraunhofer starb 1826 mit nur 39 Jahren an Tuberkulose. Erst 1859 erkannten Gustav Kirchhoff und Robert Bunsen, dass jede dieser Linien einem bestimmten chemischen Element entspricht. Damit legten sie den Grundstein für die Spektroskopie.
Diese Methode erlaubt es, aus der Analyse des Lichts die chemische Zusammensetzung von Sternen, Gaswolken oder fernen Galaxien zu bestimmen, selbst über Milliarden Lichtjahre hinweg.
Ohne Spektroskopie wäre die moderne Astrophysik blind für die Frage, aus was das Universum besteht.
Fraunhofers Vermächtnis lebt bis heute nicht nur in den Namen auf Straßenschildern oder Instituten fort, sondern in jeder astronomischen Analyse des Lichts. Er war ein Handwerker ohne Universitätsabschluss, der aus eigener Neugier und Beharrlichkeit einen Weg in die Wissenschaft fand. Seine Geschichte zeigt: Manchmal braucht es kein geradliniges Leben, um Großes zu erreichen, nur einen scharfen Blick, die richtige Idee und den Mut, dem Licht zu folgen.
Unterstützt den Podcast
Auch wenn die Tour vorbei ist: Wer Eva Tour de France- "Pickerl" schenken oder tauschen möchte, darf sich gerne melden!
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen.
Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Cosmic Latte ist eine Space Monkey Produktion.
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Jul 24, 2025 • 20min
CL064 Türkei-Special: Zwischen Halbmond und Sternen
Die Reise beginnt in der Türkei mit der archäologischen Sensation Göbekli Tepe, das Hinweise auf astronomisches Wissen aus der Neolithikum-Zeit liefert. Der Einfluss des Osmanischen Reiches und die islamische Astronomie werden beleuchtet, während moderne Entwicklungen in Bildung und Wissenschaft freigelegt werden. Ein Blick auf das aktuelle Bildungssystem zeigt, wie religiöse Werte die Astronomie im heutigen Kontext beeinflussen. Ein faszinierendes Zusammenspiel von Geschichte, Religion und Wissenschaft zeichnet das bildreiche Bild der Türkei.

Jul 10, 2025 • 22min
CL063 Frankreich-Special: Materiewellen und die Pioniere der Quantenmechanik
Die Episode über die Tour de France, de Broglie und l’âge d’or de la physique
Unterstützt uns bei Steady, Patreon oder Paypal!
Es ist Sommer und Cosmic Latte geht auf Reisen! In unseren Sommerfolgen geht es um Länder, in denen man Urlaub machen, aber genau so auf die Suche nach spannender Wissenschaft gehen kann. Den Anfang macht Eva mit einem Ausflug nach Frankreich und den Anfängen der Quantenmechanik.
1.Etappe: Frankreich
In unserer ersten Sommerfolge begeben wir uns nach Frankreich.
Mit dem Start der Tour de France beginnen wir unsere eigene Tour de Science und werfen einen Blick auf französische Entdeckungen und Forschende: Von Laplace, Lagrange, Messier und Ampère bis zur Beobachtungskunst am Pic du Midi.
Einer von ihnen ist Louis de Broglie, dessen Theorie, dass sich Elektronen wie Wellen verhalten können, sogar Albert Einstein erstaunte. Warum das so revolutionär war, erzählen Eva und Jana in dieser Sommerfolge!
Tour de France und das Observatorium Col de Midi
Mit dem Beginn der Tour de France beginnt für Eva auch ein Ritual: TdF-Panini-Sticker tauschen, Etappen mitfiebern und französische Landschaften genießen. Dieses Jahr führt die 14. Etappe wieder zum legendären Col de Tourmalet (entgegen Evas Anmerkung im Podcast!) – einer der höchsten Pyrenäenpässe und bereits 90-mal Teil der Tour.
Nur wenige Kilometer von dort entfernt liegt das Observatorium Pic du Midi – ein Ort, an dem nicht nur Sonnenflecken, sondern auch Mondkarten für die NASA-Apollo-Missionen erforscht wurden.
Frankreich ist geprägt von solchen Schauplätzen der Wissenschaftsgeschichte: vom im Jahr 1667 gegründeten Observatoire de Paris, das zu den ältesten Observatorien der Welt zählt und in dem einst der Urmeter definiert wurde, bis hin zum Bureau International des Poids et Mesures, in dem das berühmte Urkilogramm aufbewahrt wird.
Hinzu kommen eine goße Anzahl an Wissenschafterinnen und Wissenschafter, die in Frankreich gewirkt haben: wie etwa Urbain le Verrier, der den Neptun nur durch Berechnungen vorhersagte; Charles Messier mit seinem Messier-Katalog, Laplace, Roche, Lagrange (bekannt für die Lagrange-Punkte im Weltall, an denen wir Satelliten positionieren) oder Marie Curie.
Louis de Broglie und die Materiewelle
Doch in dieser Folge widmen wir uns einem Mann, der unsere Vorstellung von Materie radikal veränderte: Louis de Broglie (1892-1987).
1924 reichte der damals 31-jährige Physikstudent an der Sorbonne in Paris seine Dissertation ein. Ihr bescheidener und knapper Titel: „Recherches sur la théorie des quanta“ – „Untersuchungen zur Quantentheorie“. Doch diese Arbeit sollte zur Grundlage der Quantenmechanik und den berühmten Schrödingergleichungen werden.
Was de Broglie dort vorschlug, war nichts weniger als ein geistiger Quantensprung: Nicht nur Licht, sondern auch Materie – also Elektronen, Atome, ja sogar wir selbst – könne Welleneigenschaften besitzen. Aus dieser Idee entstand eine der berühmtesten Gleichungen der modernen Physik:
λ=h/p
Sie verbindet die Wellenlänge eines Teilchens mit seinem Impuls und führte zur Entstehung des Begriffs Materiewelle. Diese Vorstellung war so neuartig, dass seine Gutachter – darunter der bekannte Physiker Paul Langevin – verunsichert waren. Die Arbeit wurde zur Sicherheit an Albert Einstein geschickt. Der war begeistert und erkannte sofort, dass de Broglie „auf etwas wirklich Tiefes gestoßen“ sei.
De Broglies kühne Theorie wurde nur drei Jahre später durch das Davisson-Germer-Experiment bestätigt: Elektronen erzeugten Beugungsmuster – ganz wie Lichtwellen. Damit war der Beweis erbracht: Materie hat Wellencharakter. Inspiriert durch diese Idee formulierte Erwin Schrödinger 1926 seine berühmte Wellenmechanik.
De Broglie selbst bekam 1929 für die Entdeckung der Wellennatur der Elektronen den Nobelpreis für Physik.
Weiterführende Links:
Das im Podcast erwähnte Interview mit de Broglie könnt ihr euch hier ansehen:
Interview with Louis de Broglie, 1967 (French with English Subtitles)
Unterstützt den Podcast
Wer Eva Tour de France- "Pickerl" schenken oder tauschen möchte, darf sich gerne melden!
Ihr könnt uns via Steady, Patreon](https://patreon.com/CosmiclattePodcast)) und Paypal unterstützen.
Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Instagram Jana|
Cosmic Latte ist eine Space Monkey Produktion.
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Jun 26, 2025 • 40min
CL062 Kosmische Strahlung: Energetische Grüße aus dem Universum
Die Episode über hochenergetische Teilchen aus dem All, einen Geburtstag und eine Frau, die man kennen sollte
Unterstützt uns bei Steady, Patreon oder Paypal!
Cosmic Latte feiert Geburtstag!
Wir feiern unseren dritten Jahrestag und bedanken uns bei unseren treuen Hörerinnen und Hörern.
Diesmal haben wir ein spannendes astronomisches Thema im Gepäck: die kosmische Strahlung!
Das sind Teilchen aus dem All, die jeden Tag auf die Erde treffen und deren Energien jene aus Teilchenbeschleunigern bei Weitem übertreffen.
Obwohl sie seit über 100 Jahren bekannt sind, gibt es immer noch Fragen, die die Forschung beschäftigen. Eva und Jana schauen sich an, aus was kosmische Strahlung besteht, wie sie entdeckt wurde und warum sie für uns Menschen hier auf der Erde nicht gefährlich ist, für Mond- und Marsmissionen jedoch ein Risiko darstellt.
Drei Jahre Cosmic Latte und eine Inspiration
Wir feiern Geburtstag! Cosmic Latte wird drei Jahre alt und wir möchten unsere treuen Hörerinnen und Hörer feiern, die uns seit über sechzig Folgen unterstützen und begleiten.
Wir freuen uns immer besonders über Post aus der Hörerschaft. Dieses Mal hat uns ein Hörer zum Thema Astronomiestudium geschrieben. Da er selbst ein Spätberufener ist, finden wir seine Geschichte so inspirierend, dass wir sie natürlich mit euch im Podcast teilen möchten.
Kosmische Strahlung
In dieser Folge werfen wir einen Blick auf die kosmische Strahlung, ein Phänomen, das uns aus fernen Regionen des Universums erreicht. Sie besteht aus hochenergetischen Teilchen, darunter Protonen, Heliumkerne und schwerere Atomkerne, die ständig auf die Erde treffen.
Ihre Energien reichen von einigen Millionen bis zu unglaublichen 10²⁰ Elektronenvolt. Das ist deutlich mehr, als am Teilchenbeschleuniger LHC am CERN erzeugt werden kann.
Kosmische Strahlung besteht aus zwei Hauptkomponenten:
Primäre kosmische Strahlung: stammt direkt aus dem All, von der Sonne, von Supernovae, von Pulsaren oder von aktiven Galaxienkernen.
Sekundäre Strahlung: entsteht durch Wechselwirkungen in der Erdatmosphäre und umfasst Myonen, Pionen, Neutrinos und andere Teilchen.
Doch wie wurde diese geheimnisvolle Strahlung eigentlich entdeckt?
Der österreichische Physiker Victor Franz Hess ging dieser Frage im Jahr 1912 mit einer spektakulären Versuchsreihe auf den Grund.
Bei mehreren Ballonfahrten – unter anderem in der Nähe von Evas Heimatort Bad Vöslau in Niederösterreich – stieg er bis auf über 5.000 Meter Höhe auf und maß mit einem Elektroskop die Ionisation der Luft. Entgegen aller Erwartungen nahm die Strahlung in größeren Höhen zu. Dies war ein klarer Hinweis auf ihren Ursprung im Weltall.
Für diese Entdeckung wurde Hess im Jahr 1936 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet.
Experimenteller Nachweis
Für den experimentellen Nachweis und die Erforschung der kosmischen Strahlung spielte auch eine zweite österreichische Physikerin eine entscheidende Rolle: Marietta Blau.
Mit ihren fotografischen Emulsionen konnte sie ab den 1930er-Jahren erstmals die Spuren kosmischer Teilchen sichtbar machen, was einen Meilenstein in der Teilchendetektion darstellt.
Gemeinsam mit Hertha Wambacher wies sie im Jahr 1937 Teilchenschauer nach, auch Sekundärteilchen genannt, die entstehen, wenn kosmische Strahlung auf die Erdatmosphäre trifft. Im Gegensatz zu Hess wurde Blau für ihre bahnbrechende Arbeit lange Zeit nicht entsprechend gewürdigt. Obwohl Erwin Schrödinger sie für den Nobelpreis vorschlug, erhielt Cecil Powell 1950 diese Auszeichnung, obwohl seine Arbeit auf der Forschung der beiden Frauen basierte. In seiner Rede erwähnte Powell Blau oder Wambacher nicht.
Erst in den letzten Jahren wurde ihr Beitrag zur Teilchenphysik zunehmend anerkannt. Heute gilt sie als eine der bedeutendsten Physikerinnen des 20. Jahrhunderts und als stille Wegbereiterin der modernen Hochenergiephysik.
offene Fragen
Trotz jahrzehntelanger Forschung, gibt es immer noch einige offene Fragen zur kosmischen Strahlung:
Woher kommen die energiereichsten Teilchen? Wir haben "heiße" Kandidaten wie Supernovae, aktive Galaxienkerne, Pulsare oder Gammastrahlungsausbrüche. Doch für extrem hochenergetische Teilchen ist die Ursprungsquelle unklar.
Zudem wissen wir noch nicht genau, wie sie beschleunigt werden, und warum die Strahlung aus allen Richtungen fast gleichmäßig verteilt ist, obwohl ihre Quellen punktuell erscheinen sollten.
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen.
Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder hinterlasst ein Kommentar auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Instagram Jana|
Cosmic Latte ist eine Space Monkey Produktion.
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Jun 12, 2025 • 43min
CL061: Mit KI das Universum besser verstehen: Big Data und Deep Learning in der Astronomie
Die Episode über Künstliche Intelligenz in der Astronomie und Elkas digitalem Zwilling
Ihr könnt uns gerne bei Steady, Patreon oder Paypal unterstützen!
Wie lernt eine Maschine, das Universum zu verstehen?
In dieser Episode geht es um künstliche Intelligenz. Mit diesem Wort wird derzeit überall um sich geworfen. Aber was bedeutet "künstliche Intelligenz" eigentlich wirklich? Was ist Machine Learning und was sind neuronale Netze? Und was hat das alles mit Astronomie zu tun? Wir reisen von den Anfängen der künstlichen Intelligenz bis zu ihrem Einsatz in der modernen Astronomie. Mit dabei: Elkas digitaler Zwilling.
Was ist künstliche Intelligenz eigentlich?
Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ (KI) wurde bereits 1956 von John McCarthy geprägt. Eine einheitliche Definition gibt es aber bis heute nicht. Eine häufig verwendete ist jene von Barr und Feigenbaum (1981):
„KI ist die Fähigkeit einer Maschine, kognitive Funktionen auszuüben, die dem menschlichen Verstand zugeordnet werden – etwa Lernen, Planen, Argumentieren, Problemlösen und der Erwerb von Fähigkeiten.“
Doch selbst der Begriff „Intelligenz“ ist schwammig – sowohl bei Menschen als auch bei Maschinen. Deshalb ist es hilfreich, sich die verschiedenen Teilbereiche der KI anzusehen, vor allem Machine Learning und Deep Learning.
Historische Meilensteine der KI
KI gibt es schon länger, als man denken würde. Die wichtigsten Meilensteine der KI-Geschichte, sind:
1966: ELIZA – Der erste Chatbot simuliert eine Psychotherapeutin. Heute wirkt das simpel, doch damals war es bahnbrechend. Hier kann man ELIZA auch heute noch ausprobieren.
1995: Erste Ansätze für autonomes Fahren
1997: Schachweltmeister Garry Kasparov wird von IBMs „Deep Blue“ geschlagen – ein Meilenstein, der vielen Menschen die Überlegenheit von Maschinen in spezifischen Aufgaben demonstrierte. Dazu gibt es auch die Serie "Rematch".
2022: ChatGPT wird veröffentlicht – Der große Durchbruch in der öffentlichen Wahrnehmung. Seitdem gibt es für viele eine „Zeit vor“ und „Zeit nach“ ChatGPT.
Ein weiterer Meilenstein war AlphaFold (2018) – ein KI-System, das die Faltung von Proteinen exakt vorhersagen kann. Ein riesiger Fortschritt in der Biochemie, der mit dem Nobelpreis gewürdigt wurde.
Machine oder Deep-Learning?
Machine Learning (ML) ist ein Teilgebiet der KI, das Maschinen befähigt, aus Daten zu lernen. Es gibt drei Hauptarten:
Supervised Learning (überwachtes Lernen): Die Maschine lernt anhand von beschrifteten Daten. Beispiel: Viele Bilder von Äpfeln und Erdbeeren mit der Information „Apfel“ oder „Erdbeere“. Daraus entsteht ein Modell, das später unbekannte Bilder klassifizieren kann.
Unsupervised Learning (unüberwachtes Lernen): Hier werden Daten ohne Beschriftung analysiert. Die Maschine erkennt Muster und gruppiert sie in sogenannte „Cluster“. Das ist z. B. nützlich für Anomalie-Erkennung oder Empfehlungssysteme.
Reinforcement Learning (bestärkendes Lernen): Hier lernt ein Agent durch Belohnung oder Bestrafung, z. B. bei Spielen oder autonomen Fahrzeugen. Erfolgreiche Entscheidungen werden „belohnt“ und damit wahrscheinlicher gemacht. Wie das läuft kann man hier mit Tic Tac Toe ausprobieren.
Deep Learning (DL) ist eine Unterform des Machine Learning und nutzt sogenannte neuronale Netze, die dem menschlichen Gehirn nachempfunden sind. Diese bestehen aus vielen Schichten („Hidden Layers“) mit Millionen von Verbindungen, deren Gewichtungen während des Trainings angepasst werden. Die Modelle berechnen auf Basis der Eingabedaten Wahrscheinlichkeiten – nicht Wahrheiten. Das bedeutet: KI „weiß“ nichts, sie berechnet lediglich das statistisch wahrscheinlichste nächste Element.
Ein anschauliches Gedankenexperiment dazu ist das „Chinesische Zimmer“: Eine Person in einem Raum kann kein Chinesisch, beantwortet aber chinesische Fragen mithilfe eines Regelwerks korrekt. Von außen wirkt es, als ob sie die Sprache beherrsche – doch in Wahrheit versteht sie nichts. So ähnlich funktioniert auch KI: Sie simuliert Verständnis, ohne Bewusstsein oder eigene Intelligenz.
Bias, Verantwortung & ethische Fragen
Ein wichtiger Punkt: KI-Systeme übernehmen nicht nur das Wissen aus Daten – sondern auch deren Verzerrungen. Ein paar problematische Gesichtspunkte sind zum Beispiel:
die Gesichtserkennung, die bei weißen Männern viel besser funktioniert als bei schwarzen Frauen
Algorithmen des Arbeitsmarktservice in Österreich, die Frauen systematisch in klassische Rollen („Friseurin“) und Männer in Technikberufe lenken
KI im US-Justizsystem, die bei People of Color höhere Rückfallwahrscheinlichkeiten prognostiziert
Die Lehre daraus: Daten sind nie neutral – und KI kann gesellschaftliche Ungleichheiten verstärken, wenn sie unreflektiert eingesetzt wird. Umso wichtiger sind regulatorische Initiativen wie der EU-AI-Act, der je nach Risiko den KI-Einsatz einschränkt oder verbietet.
KI in der Astronomie: Wenn Big Data auf Deep Learning trifft
In der Astronomie spielen solche Vorurteile der KI kaum eine Rolle. Hier geht es nicht um Menschen, sondern um Daten und davon hat die Astronomie genug. Moderne Teleskope wie Kepler, TESS oder Gaia liefern pro Nacht Terabyte bis Petabyte an Daten. Ohne KI wäre deren Auswertung unmöglich.
Ein Beispiel ist das erste Bild eines Schwarzen Lochs (2019), das aus über 3,5 Petabyte Daten des Event Horizon Telescope erstellt. Diese Daten mussten mit Festplatten per Flugzeug transportiert werden, weil es nicht möglich war, diese Menge über klassische Datenleitungen zu übertragen. Und in den letzten Jahren wurden immer öfter KI-Techniken eingesetzt, um Daten auszuwerten und Entdeckungen zu machen:
Exoplaneten-Entdeckung (2023): Forscher:innen von NASA, USRA und dem SETI-Institut entdeckten mithilfe von Deep Learning 69 neue Exoplaneten – viele davon in verrauschten Signalen, die sonst übersehen worden wären ("Multiplicity Boost Of Transit Signal Classifiers: Validation of 69 New Exoplanets Using The Multiplicity Boost of ExoMiner").
TESS-Datenanalyse (2022): Eine KI kombinierte verschiedene Lernalgorithmen, um aus über 10.000 Lichtkurven drei neue Exoplaneten-Kandidaten zu filtern ("Automated identification of transiting exoplanet candidates in NASA Transiting Exoplanets Survey Satellite (TESS) data with machine learning methods").
Galaxienklassifikation mit „Morpheus“ (2020): Ein U-Net-Modell – ursprünglich für medizinische Bildanalyse entwickelt – wurde auf Hubble-Daten trainiert, um Galaxien pixelgenau zu klassifizieren ("Morpheus: A Deep Learning Framework For Pixel-Level Analysis of Astronomical Image Data". Elka, selbst aus der medizinischen Bildverarbeitung kommend, freut sich besonders über diesen Einsatz.
Universumssimulation mit CAMELS (2021): Über 4.000 kosmologische Simulationen mit mehr als 100 Milliarden Teilchen wurden per Deep Learning analysiert. Das Ziel: Prozesse wie dunkle Materie, Galaxienbildung und Materieverteilung besser zu verstehen.
„Multimodal Universe“ (2024/2025): Das aktuell größte offene KI-Datenset der Astronomie mit 100 TB an kombinierten Beobachtungen aus Teleskopen wie DESI, SDSS und JWST.
KI ist ein mächtiges Werkzeug – gerade in der Astronomie, wo sie die Arbeit von Forschenden enorm beschleunigen kann. Doch sie ist kein magisches Wesen, sondern ein System, das auf Mathematik, Wahrscheinlichkeiten und menschlichen Daten basiert. Ihre Chancen sind groß – aber ebenso ihre Risiken. Es liegt an uns, wie wir damit umgehen.
Asteroid Day in Baden
Am 30.06.2025 feiern wir den internationalen Asteroidentag im Cinema Paradiso in Baden mit einer Filmvorführung von Armageddon – inklusive einer Live-Einführung von Eva, Florian Freistetter und Ruth Grützbauch.
Jetzt schon Karten sichern – wir freuen uns auf euch!
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen.
Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Cosmic Latte ist eine Space Monkey Produktion.
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

May 29, 2025 • 48min
CL060 Sci-Fi Special: Leben die Aliens schon unter uns?
Die Episode über geheime Alien Invasionen, parasitäre Kontrolle und coole Sonnenbrillen! Science-Fiction Special mit Peter Koller
Unterstützt uns bei Steady, Patreon](https://patreon.com/CosmiclattePodcast)) oder Paypal!
Nach einer längeren Pause sind wir zurück mit einer neuen Ausgabe unserer Science-Fiction-Spezialreihe! Peter ist wieder zu Gast bei Eva, denn diesmal geht’s um ein Thema, das sich wunderbar für spannende Filmplots und philosophische Fragen eignet: Leben Außerirdische längst unter uns hier auf der Erde – und wir wissen es nur nicht?
Was ist dran an heimlichen Invasionen aus dem All?
Warum bestimmte Parasiten auf der Erde die wahren Aliens sind und was das alles mit coolen Sonnebrillen zu tun habt, besprechen Peter und Eva in dieser Folge über das geheime Leben der Aliens auf der Erde.
Aliens unter uns!
In dieser Folge nähern wir uns dem Alien-Thema von einer anderen Seite: Nicht als ferne Bedrohung aus dem All, sondern als unsichtbare Begleiter in unserer Mitte. Wir sprechen über das beliebte Motiv der versteckt lebenden Außerirdischen – eine Idee, die sich nicht nur durch Science-Fiction-Filme zieht, sondern auch tief in popkulturellen Mythen, Verschwörungstheorien und sogar in wissenschaftlichen Spekulationen verwurzelt ist.
Wir starten mit der Frage, warum wir eigentlich so fasziniert davon sind, dass Außerirdische längst mitten unter uns leben könnten. Ist das Wunschdenken? Paranoia? Oder einfach eine gute Story?
Gemeinsam werfen wir einen filmhistorischen Blick auf einige unserer Lieblingsfilme, in denen dieses Thema besonders eindrucksvoll behandelt wird. Darunter sind zum Beispiel "They Live" von John Carpenter; eine kapitalismuskritische Alien-Satire mit Sonnenbrillen, die die Wahrheit zeigen und "Body Snatchers (beide Versionen von 1956 und 1978)": Was, wenn dein Nachbar nicht mehr dein Nachbar ist?
Wir schauen uns natürlich auch wieder ein paar wissenschaftliche Hintergründe an: Wie wahrscheinlich ist es, dass Aliens tatsächlich auf der Erde leben (oder gelebt haben)? Und wie ist das mit den realen parasitären Organismen, die sich fast wie Science-Fiction anfühlen – wie etwa der Zombie-Pilz, der Ameisen steuert, oder den Toxoplasmose-Parasiten, die Mäuse mutig machen. Und was würde es eigentlich mit uns als Spezies machen, wenn wir herausfinden würden, dass wir nicht allein sind – oder sogar nur ein Experiment? Welche Vorstellungen hatten Menschen schon im 16. und 17. Jahrhundert über Leben im All? Und warum taucht das Alien-Motiv in so vielen kulturellen Erzählungen immer wieder als Spiegelbild unserer Ängste, Wünsche und Konflikte auf?
Ankündigung: Asteroidentag am 30. Juni 2025!
Am 30.06.2025 feiern wir den internationalen Asteroidentag im Cinema Paradiso in Baden mit einer Filmvorführung von Armageddon – inklusive einer Live-Einführung von Eva, Florian Freistetter und Ruth Grützbauch.
Jetzt schon Karten sichern – wir freuen uns auf euch!
In der Folge erwähnte Filme und Serien
"Avatar" (auf deutsch: "Avatar – Aufbruch nach Pandora")
"They Live" (auf deutsch: "Sie leben!")
"Invasion of the Body Snatchers" (auf deutsch: "Die Dämonischen")
"Invasion of the Body Snatchers" (auf deutsch: "Die Körperfresser kommen")
"The Hidden" (auf deutsch: "Das unsagbar Böse")
"The Arrival" (auf deutsch: "The Arrival – Die Ankunft")
"Alien" (auf deutsch: "Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt")
"Aliens" (auf deutsch: "Aliens – Die Rückkehr")
"Prometheus" (auf deutsch: "Prometheus – Dunkle Zeichen")
"Stargate" (auf deutsch: "Stargate – Das Tor zum Universum")
"The Fifth Element" (auf deutsch: "Das fünfte Element")
"Contact" (auf deutsch: "Contact")
"The Day the Earth Stood Still" (auf deutsch: "Der Tag, an dem die Erde stillstand")
"Men in Black" (auf deutsch: "Men in Black")
"Apocalypto" (auf deutsch: "Apocalypto")
"The Abyss" (auf deutsch: "Abyss – Abgrund des Todes")
"The Primevals" (auf deutsch: "The Primevals")
"La morte viene dal pianeta Aytin" (auf deutsch: "Dämonen aus dem All")
"Resident Alien" (auf deutsch: "Resident Alien")
"3rd Rock from the Sun" (auf deutsch: "Hinterm Mond gleich links")
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon](https://patreon.com/CosmiclattePodcast)) und Paypal unterstützen.
Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Cosmic Latte ist eine Space Monkey Produktion.
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

May 15, 2025 • 44min
CL059 Sind wir die erste Zivilisation auf der Erde? Die Silurianer Hypothese
Die Episode über diejenigen, die vielleicht vor uns da waren, und darüber, was wir der Zukunft hinterlassen.
Ihr könnt uns gerne bei Steady, Patreon oder Paypal unterstützen!
Gab es vor uns eine Zivilisation auf der Erde?
Was nach Science Fiction klingt, ist ein ernsthaftes wissenschaftliches Gedankenexperiment: die Silurianer-Hypothese.
In dieser Episode gehen wir der Frage nach, ob es theoretisch möglich wäre, Spuren einer technischen Zivilisation zu entdecken, die vor uns auf der Erde existiert haben könnte. Wir schauen uns an, welche geologischen Hinweise wir heute finden könnten, was uns Fossilien (nicht) verraten und warum der Klimawandel dabei eine Rolle spielt.
Und warum Doctor Who in dieser Diskussion nicht fehlen darf, erfahrt ihr in dieser Folge von Cosmic Latte.
Einleitung
Neben Astronomie und Podcasting teilen Eva und Jana noch eine weitere Leidenschaft: Pen-&-Paper-Rollenspiele!
Passend zum Thema dieser Folge ist Eva seit kurzem auch Spielleiterin in einer Welt voller kosmischer Schrecken: dem Cthulhu-Mythos.
Das gleichnamige Pen-&-Paper-Rollenspiel „Call of Cthulhu“, das auf den Erzählungen von H. P. Lovecraft basiert, entführt die Spielenden meist in die 1920er oder 1930er Jahre - in eine düstere, geheimnisvolle Welt voller verborgener Wahrheiten und seelischer Abgründe. Die Spielenden schlüpfen in die Rolle von „Ermittlern“, die sich mit Okkultismus, Wissenschaft und Wahnsinn auseinandersetzen - nicht selten auf Kosten ihrer geistigen Gesundheit.
Besonders faszinierend ist die Erweiterung Cthulhu: Extraterrana Cthulhiana, in der der Mythos den Weltraum erreicht: Raumfahrtgeschichte trifft auf Lovecraftsche Fiktion, kosmische Strahlung und Exoplaneten auf uralte außerirdische Wesen. Es geht um versunkene Tempel auf dem Mond, um Artefakte, die Portale öffnen, und um die Großen Alten, die lange vor uns da waren - und vielleicht nie ganz verschwunden sind.
Und genau hier schließt sich der Kreis zur Silurianer-Hypothese: Denn was wäre, wenn es vor uns Menschen tatsächlich eine Zivilisation auf der Erde gegeben hat? Eine, deren Spuren so tief verborgen oder längst ausgelöscht sind, dass sie uns wie ein Mythos erscheint - oder wie eine düstere Legende aus einem Rollenspiel? Die Großen Alten des Cthulhu-Mythos und die hypothetischen Silurianer teilen einen interessanten Gedanken: Wir könnten nicht die Ersten gewesen sein.
Die Silurianer Hypothese: Gab es vor uns schon einmal eine Zivilisation auf der Erde?
Glaubst du an extraterrestrisches Leben?
Glaubst du an die Existenz außerirdischer Zivilisationen?
Und wenn ja, warum haben wir noch nichts von ihnen gehört?
Diese Fragen sind nicht nur Stoff für Science-Fiction-Filme. Sie stehen auch am Anfang einer wissenschaftlichen Überlegung, die als Silurianer-Hypothese bekannt geworden ist. Und sie führt zu einer vielleicht noch erstaunlicheren Frage: Was, wenn wir Menschen gar nicht die erste technische Zivilisation auf diesem Planeten waren?
Ein Gedankenexperiment aus der Wissenschaft
Die sogenannte Silurianer-Hypothese stammt nicht etwa aus einem obskuren Blog oder von Verschwörungstheoretikern, sondern wurde 2018 von zwei renommierten Wissenschaftlern formuliert: dem Astrophysiker Adam Frank von der Universität Rochester und dem Klimaforscher Gavin Schmidt, Direktor des NASA Goddard Institute for Space Studies.
In ihrer Publikation stellen sie die Frage: Wenn es vor Millionen von Jahren eine industrielle Zivilisation auf der Erde gegeben hätte - könnten wir heute noch Spuren davon finden?
Wichtig dabei: Frank und Schmidt betonen ausdrücklich, dass sie nicht wirklich an die Existenz einer solchen früheren Zivilisation glauben. Ihre Hypothese ist vielmehr ein Gedankenexperiment, das uns helfen soll, besser zu verstehen, welche Spuren eine technische Zivilisation im geologischen Gedächtnis eines Planeten hinterlässt - und damit auch, wie wir ähnliche Spuren auf anderen Planeten erkennen könnten.
Der Begriff Silurianer ist eine Anspielung auf die Science-Fiction-Serie Doctor Who, in der reptilienartige Wesen - die Silurianer - lange vor den Menschen auf der Erde lebten. In der Serie zogen sie sich angesichts einer drohenden Katastrophe unter die Erdoberfläche zurück und gerieten später in Konflikt mit der modernen Menschheit. Der Name wiederum leitet sich vom Silur ab, einer realen geologischen Periode vor rund 430 Millionen Jahren.
Könnten wir eine uralte Zivilisation überhaupt noch nachweisen?
Die zentrale Frage der Silur-Hypothese lautet: Was bleibt von einer Zivilisation übrig - nach Millionen von Jahren? Die Antwort ist ernüchternd: höchstwahrscheinlich fast nichts.
Geologische Prozesse wie Plattentektonik und Erosion erneuern die Erdkruste alle paar hundert Millionen Jahre. Nur extrem alte Gesteinsformationen wie in Grönland oder Westaustralien sind überhaupt noch erhalten.
Fossilienbildung ist selten, und nur ein kleiner Teil der heute zugänglichen Erdoberfläche stammt aus der Zeit vor dem Quartär (älter als 2,5 Millionen Jahre).
Städte, Straßen und Bauwerke - selbst so imposante wie die Pyramiden - wären innerhalb von Jahrtausenden verschwunden, verwittert oder vom Erdboden verschluckt worden.
Das bedeutet: Selbst wenn es vor der Menschheit eine technische Zivilisation gegeben haben sollte - unsere Chancen, heute noch direkte Artefakte zu finden, sind verschwindend gering.
Indirekte Spuren im Klima und in den Sedimenten
Statt nach Artefakten zu suchen, lohnt sich ein Blick in die geologischen und klimatischen Archive der Erde. Frank und Schmidt stellen die Hypothese auf, dass sich Spuren eines Industriezeitalters auch anhand von chemischen und klimatischen Veränderungen in der Atmosphäre und Biosphäre nachweisen lassen.
Ein Beispiel dafür ist das so genannte Paläozän/Eozän-Temperaturmaximum vor rund 55 Millionen Jahren: Innerhalb von 4000 Jahren stiegen damals die globalen Temperaturen um etwa 6 Grad Celsius - ein Vorgang, der stark an unseren heutigen anthropogenen Klimawandel erinnert. Damals waren vermutlich vulkanische Aktivitäten oder Methanausgasungen für den Anstieg verantwortlich. Ein ähnlich schneller Temperaturanstieg könnte aber auch durch den Einfluss einer industriellen Zivilisation verursacht worden sein.
Weitere mögliche Hinweise sind:
Isotopenanomalien in Sedimenten (z.B. erhöhte Mengen künstlich erzeugter Elemente wie Plutonium-244)
Rußpartikel, die auf industrielle Emissionen hinweisen können
Plastik- oder Atommüllreste, die tief im Ozean vergraben sind
Spuren von künstlichem Dünger oder anderen chemischen Markern
Spuren auf dem Mond oder anderen Himmelskörpern im Sonnensystem, auf denen keine Erosion oder Plattentektonik stattfindet
Haben wir Hinweise auf die Silurianer gefunden?
Nein. Bis heute gibt es keine konkreten Beweise für eine Zivilisation vor der Menschheit. Aber: Unsere Suche ist stark eingeschränkt durch geologische Prozesse, durch die geringe Menge an erhaltener Erdoberfläche und durch die Fragilität technologischer Spuren im Laufe der Zeit.
Die Silurian-Hypothese will nicht die Vergangenheit erklären - sie will unseren Blick in die Zukunft schärfen. Sie zeigt, wie schwierig es ist, Zivilisation nachzuweisen - selbst auf unserem eigenen Planeten. Und sie liefert wertvolle Überlegungen für die Suche nach außerirdischem Leben: Was würden wir auf fernen Planeten finden - Millionen Jahre, nachdem dort eine Zivilisation verschwunden ist?
Die Silurianer-Hypothese ist kein Beweis für vergangene Hochkulturen, sondern ein Anstoß, über unser eigenes Erbe, den Zustand unseres Planeten und mögliche fremde Welten nachzudenken. Was bleibt von uns?
Weiterführende Links
Das Original Paper von Schmidt und Frank findet ihr unter diesem Link.
Welche Spuren hinterlässt die Menschheit auf geologischer Zeitebene?
Lesenswerte Artikel dazu im The Guardian und in der NY Times.
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen.
Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Instagram Evi |
Instagram Jana|
Cosmic Latte ist eine Space Monkey Produktion.
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

May 1, 2025 • 32min
CL058 - Kepler und das Weltgeheimnis
Die Episode über Johannes Kepler und die Entdeckung der kosmischen Ordnung
Unterstützt uns gerne bei Steady, Patreon oder Paypal!
Warum bewegen sich die Planeten um die Sonne?
Dieser Frage gehen Eva und Elka in dieser Folge nach und werfen einen Blick zurück in die Anfänge der modernen Astronomie. Vor 400 Jahren fragte sich Johannes Kepler, warum das Sonnensystem so aufgebaut ist, wie es ist, und suchte nach einer kosmischen Ordnung und Harmonie. Mit seinem Werk legte er den Grundstein für Isaac Newton, der mit der Entdeckung des Gravitationsgesetzes zeigen konnte, dass es Naturgesetze gibt, die sowohl auf der Erde als auch im Universum gelten.
Die Bedeutung dieser Entdeckungen zeigt sich auch heute noch, wenn wir die Bahnen von Exoplaneten berechnen und Weltraumteleskope an den Lagrange-Punkten im All positionieren.
Einleitung
Wir beginnen mit einem Veranstaltungshinweis: Wer Elka live erleben möchte, kann dies am 11. Mai im Planetarium Wien tun. Dort spricht sie ab 19 Uhr über die Heldinnen am Sternenhimmel.
Johannes Kepler und das Weltgeheimnis
Der Astronom, Physiker und Mathematiker Johannes Kepler (1571-1630) ist bestimmt einer der wichtigsten Wegbereiter der modernen Naturwissenschaften.
In einer Zeit, in der Magie, Aberglaube und religiöse Dogmen noch das Weltbild bestimmten, suchte Kepler nach einer mathematisch fundierten Erklärung für den Aufbau des Universums. Seine erste große Veröffentlichung (1596), „Mysterium Cosmographicum“ (Das Weltgeheimnis), war der Versuch, die Struktur des Sonnensystems mit Hilfe platonischer Körper zu erklären – ein kreatives, wenn auch letztlich falsches Modell. Doch Kepler war überzeugt, dass dem Kosmos eine göttliche Ordnung und mathematische Harmonie zugrunde liegt. Diese Überzeugung trieb ihn an, das Rätsel der Planetenbewegung zu lösen.
Die entscheidende Wende kam, als Kepler 1600 als Assistent des dänischen Astronomen Tycho Brahe nach Prag ging. Nach Brahes Tod erhielt Kepler Zugang zu dessen hochpräzisen Beobachtungsdaten, insbesondere über die Umlaufbahn des Mars. In jahrelanger mühsamer Analyse erkannte Kepler, dass die Marsbahn nicht durch Kreise oder Epizykel erklärt werden konnte. Die scheinbar geringen Abweichungen in den Daten zwangen ihn, das bis dahin vorherrschende Bild von perfekten Himmelskreisen zu verwerfen. Stattdessen entdeckte er, dass sich die Planeten auf elliptischen Bahnen bewegen - mit der Sonne in einem der Brennpunkte. Diese Erkenntnis führte zu den ersten beiden Keplerschen Gesetzen, die er 1609 in seinem Werk "Astronomia Nova" veröffentlichte.
Die ersten beiden Keplerschen Gesetze beschreiben die elliptische Form der Planetenbahnen und die unterschiedliche Bahngeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Entfernung zur Sonne. Später folgte sein drittes Gesetz, das den Zusammenhang zwischen der Umlaufzeit eines Planeten und der Größe seiner Bahn beschreibt. Kepler schuf damit ein vollständiges Modell der Planetenbewegung - allein auf der Grundlage von Beobachtungen und geometrischen Überlegungen, ohne moderne Mathematik oder physikalische Kraftgesetze.
Von Kepler zu Newton
Die Erklärung für das „Warum“ seiner Gesetze kam erst Jahrzehnte später mit Isaac Newton, der 1687 das Gravitationsgesetz formulierte. Newton zeigte, dass dieselbe Kraft, die Äpfel zu Boden fallen lässt, auch für die Bewegung der Planeten verantwortlich ist. Aus seinem Gravitationsgesetz leitete er mathematisch die Keplerschen Gesetze ab und schuf damit die Grundlage der klassischen Mechanik. Die Himmelsmechanik wurde dadurch präziser und leistungsfähiger, so dass beispielsweise die Existenz neuer Planeten - wie Neptun - aus Bahnstörungen berechnet werden konnte.
Bis heute spielt Keplers Erbe in der Astronomie eine zentrale Rolle. Moderne Anwendungen wie die Berechnung von Exoplanetenbahnen oder die Positionierung von Raumsonden an Lagrangepunkten im eingeschränkten Dreikörperproblem zeigen, wie relevant Keplers Suche nach der kosmischen Ordnung auch nach über 400 Jahren noch ist.
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen.
Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schickt uns gerne eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schreibt ein Kommentar auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Cosmic Latte ist eine Space Monkey Produktion.
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!

Apr 17, 2025 • 51min
CL057 Wie studiert man Astronomie?
Die Episode über das Astronomie-Studium zusammen mit dem Keplergymnasium Graz
Ihr könnt uns gerne bei Steady, Patreon oder Paypal unterstützen!
Diesmal war Eva zu Gast bei den Schülern des Astronomie-Leistungskurses am Keplergymnasium in Graz, um mit ihnen über das Astronomiestudium zu sprechen. In einer gemeinsamen Podcast-Episode mit dem Schulpodcast "Astronomie am Kepler" erzählt Eva, was es wirklich bedeutet, Astronomie zu studieren. Warum man nachts weniger durch ein Teleskop schaut als in Mathe- und Physikbücher und warum genau das spannend und faszinierend ist, könnt ihr in dieser Episode hören!
Kepler Latte
Jana ist zurück aus Costa Rica und berichtet vom Südsternhimmel.
Währenddessen war Eva zu Gast im Mehrschulenkurs Astronomie am Keplergymnasium Graz. Die Schülerinnen und Schüler betreiben gemeinsam mit ihrem Lehrer Norbert Steinkellner, einen eigenen Podcast, Astronomie am Kepler, in dem sie über aktuelle Themen der Astronomie sprechen.
Grund genug, mit Eva in einer gemeinsamen Folge über das Studium der Astronomie zu plaudern.
Zuvor spricht Eva aber noch mit Jana darüber, welche Vorstellungen und Erwartungen sie selbst hatten, bevor sie ihr Studium an der Universität begannen.
Gemeinsam mit den Gymnasiasten erzählt Eva dann, was sie zu ihrem Studium gebracht hat, welche Herausforderungen es zu meistern galt und gilt, welche Prüfung die schwierigste war… und dass ein Astronomiestudium nicht bedeutet, in lauen Sommernächten den Sternenhimmel zu beobachten. Vielmehr ist Astronomie ein mathematisch-physikalisches Studium, denn die Sprache der Astronomie ist die Mathematik. Ein gewisses Interesse an Physik und Mathematik ist daher von Vorteil, der Umgang mit höherer Mathematik wird aber ohnehin während des Studiums erlernt und sollte daher nicht abschrecken, sondern vielmehr motivieren - man kann alles lernen!
Weiterführende Links
Die ganze Folge bei Astronomie am Kepler könnt ihr hier anhören: AK033: Kepler Latte
Informationen über das Astrophysik und Astronomie Studium an der Universität Wien findet ihr auf der Website der Uni Wien: Allgemeine Informationen zum Bachelor Astronomie.
Für jene, sie sich ein Studium überlegen, bietet das Institut für Astrophysik ein Online-Self-Assessment an, das bei der Entscheidung helfen kann.
Unterstützt den Podcast
Ihr könnt uns via Steady, Patreon und Paypal unterstützen.
Der Podcast ist aber natürlich weiterhin gratis auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Kontakt
Falls ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder hinterlasst ein Kommentar auf cosmiclatte.at.
Und sonst findet ihr uns hier:
Instagram Cosmic Latte |
Instagram Elka |
Instagram Evi |
Instagram Jana|
Cosmic Latte ist eine Space Monkey Produktion.
Du möchtest deine Werbung in diesem und vielen anderen Podcasts schalten? Kein Problem!Für deinen Zugang zu zielgerichteter Podcast-Werbung, klicke hier.Audiomarktplatz.de - Geschichten, die bleiben - überall und jederzeit!


