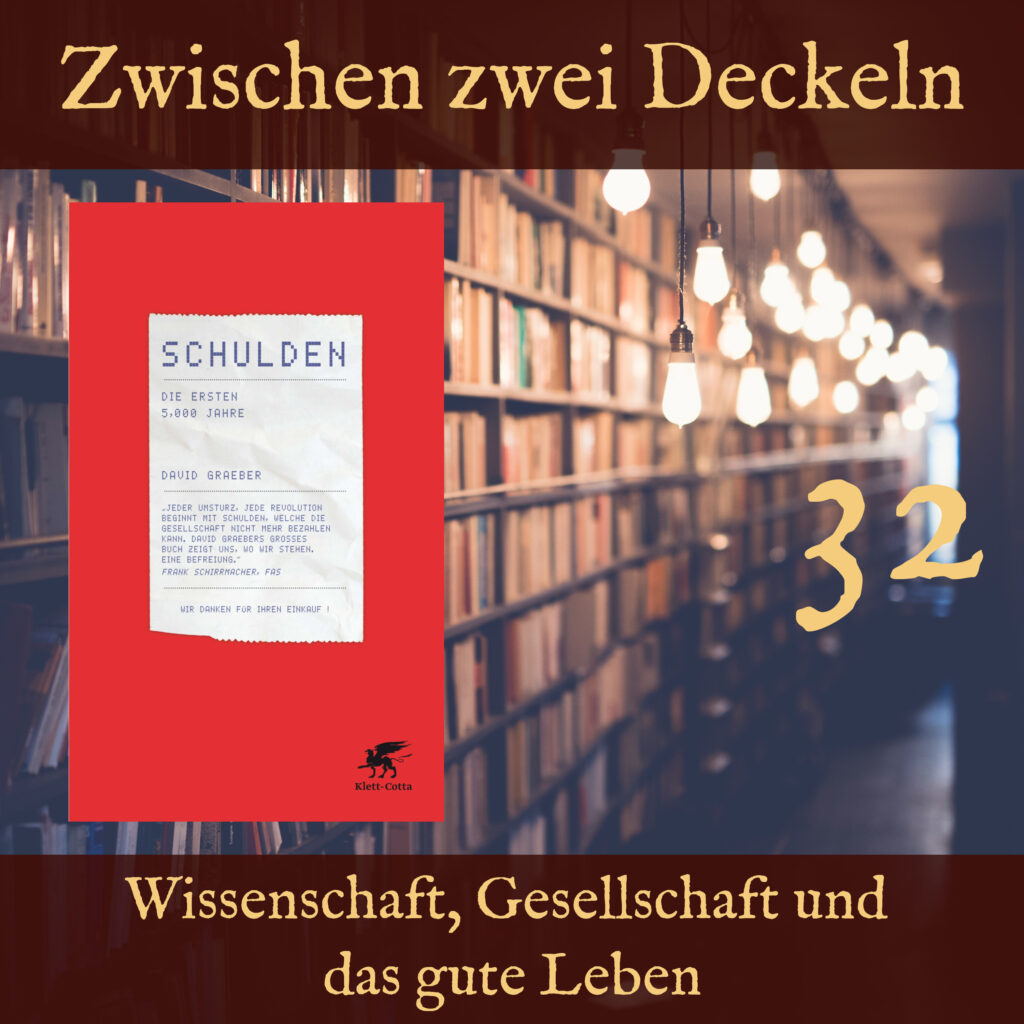Zwischen Zwei Deckeln
Zwischen Zwei Deckeln 032 - Schulden von David Graeber
Nov 11, 2021
In dieser Folge wird die Frage erörtert, wie Geld und Schulden als staatlich geschaffene Werkzeuge soziale Beziehungen kontrollieren. Historische Beispiele zeigen, dass Geld nicht selbstverständlich ist, sondern von tiefen gesellschaftlichen Dynamiken beeinflusst wird. Die komplexen Verhältnisse zwischen Schulden, Eigentum und Ungleichheit werden kritisch beleuchtet. Zudem wird die Evolution des Geldes von alten Währungen bis zu modernen Finanzsystemen behandelt, während die Verbindung zwischen Geld, Macht und Kultur hervorgehoben wird.
AI Snips
Chapters
Books
Transcript
Episode notes
Geld entstand aus Schulden
- Das klassische Bild vom Geld als Tauschmittel wird historisch nicht belegt.
- Schulden waren im Ursprung sozialer und impliziter Natur, nicht mengenmäßig erfasst.
Staatliche Rolle beim Geld
- Geld wurde vom Staat geschaffen, um Steuern zu erheben und Soldaten zu bezahlen.
- Geld ist ein Mittel, um soziale Kontrolle durch staatliche Macht zu ermöglichen.
Ursprüngliche Funktion des Geldes
- Geld war ursprünglich primär ein Mittel zur Wertmessung, nicht Tausch- oder Wertaufbewahrungsmittel.
- Die Wertaufbewahrung und Tauschfunktion entwickelten sich erst später historisch.