
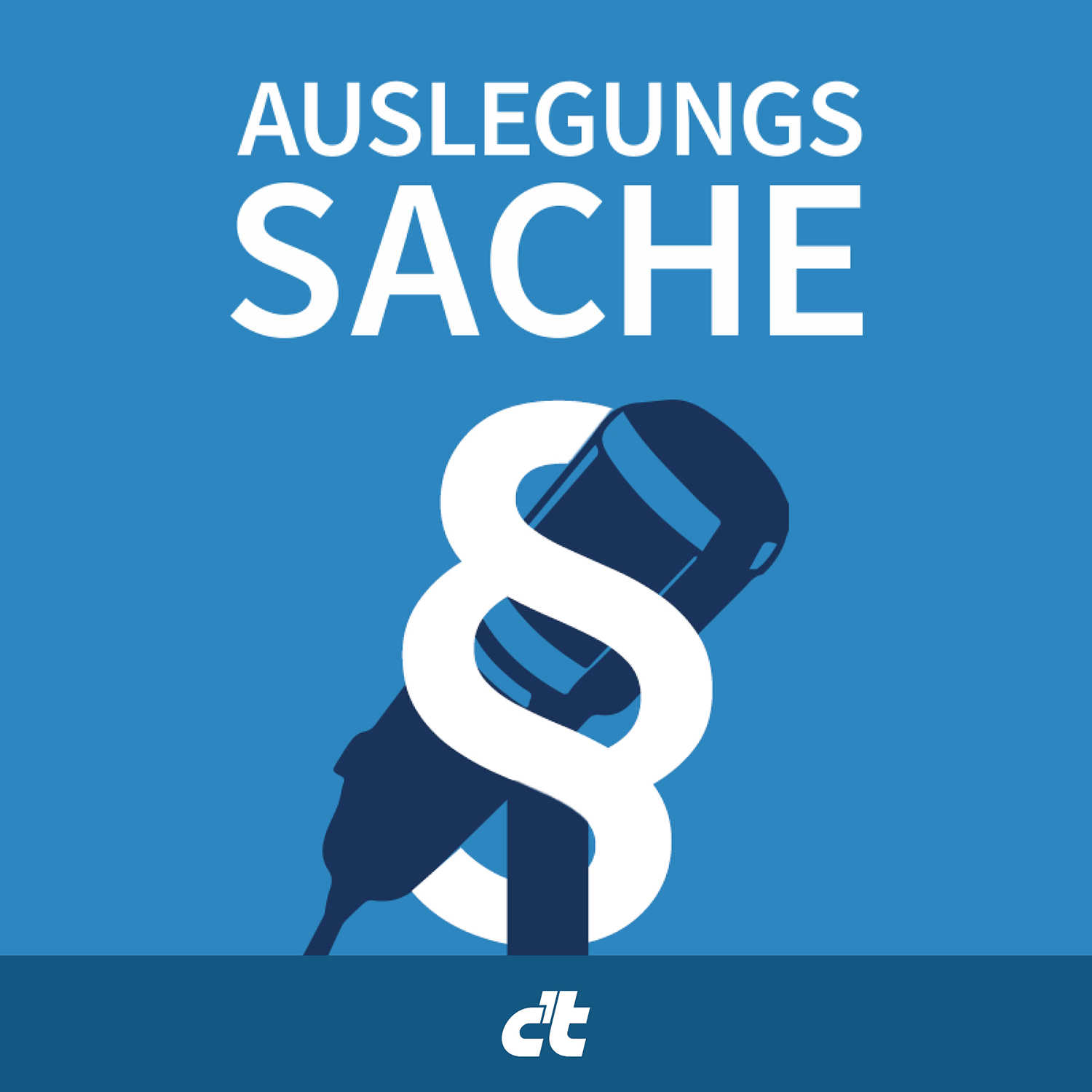
Auslegungssache – der c't-Datenschutz-Podcast
c't Magazin
Sie möchten beim Thema Datenschutz auf dem Laufenden bleiben, aber keine seitenlange Literatur wälzen? Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an unser Juristen-Redakteurs-Duo.
Alle 14 Tage bespricht c't-Redakteur Holger Bleich mit Joerg Heidrich aktuelle Entwicklungen rund um den Datenschutz. Joerg ist beim c't-Mutterschiff Heise Medien als Justiziar für das Thema zuständig und hat täglich mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu tun. Wechselnde Gäste ergänzen das Duo.
Mehr Infos gibts unter https://heise.de/-4571821
Alle 14 Tage bespricht c't-Redakteur Holger Bleich mit Joerg Heidrich aktuelle Entwicklungen rund um den Datenschutz. Joerg ist beim c't-Mutterschiff Heise Medien als Justiziar für das Thema zuständig und hat täglich mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu tun. Wechselnde Gäste ergänzen das Duo.
Mehr Infos gibts unter https://heise.de/-4571821
Episodes
Mentioned books

Jun 28, 2024 • 1h 8min
Ländle unter Aufsicht
Mit Prof. Tobias Keber, Holger Bleich und Joerg Heidrich
Dass eine Landesdatenschutzbehörde weitgehend geräuschlos von einer kompetenten Hand in die nächste übergeben wird, ist mitterweile keine Normalität mehr. In Baden-Württemberg hat das funktioniert: Vor rund einem Jahr, am 1. Juli 2023, trat Prof. Tobias Keber die Nachfolge von Stefan Brink als Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI) Baden-Württembergs an.
In Episode 112 des c't-Datenschutz-Podcasts plaudert Keber über sein erstes Amtsjahr und erläutert, wie er seine Behörde sieht. Der studierte Jurist war zuvor von 2012 bis 2023 Professor für Medienrecht und Medienpolitik an der Hochschule der Medien Stuttgart. Keber ist außerdem seit seit 2015 Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit (GDD).
Eine Schwerpunkt der Tätigkeit seiner Behörde legte er im ersten Jahr auf die Betrachtung von Künstlicher Intelligenz (KI) aus datenschutzrechtlicher Perspektive. In der Episode spricht sich Keber wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen dafür aus, dass hierzulande die deutschen Datenschutzbehörden als Aufsicht für die bald in Kraft tretende KI-Verordnung fungieren. Der Behördenleiter fordert einen pragmatischen Blick auf generative KI und erzählt, dass er schon heute dutzende KI-Projekte öffentlicher Stellen im Ländle datenschutzrechtlich beurteilen muss.

Jun 14, 2024 • 1h 3min
Datenleaks verhindern!
Mit Dr. Christopher Kunz, Sylvester Tremmel und Holger Bleich
Auslegungssache meets Passwort! In der aktuellen Episode trifft der c't-Datenschutz-Podcast auf sein neues Pendant aus der Security-Sparte von heise. Zu Gast sind nämlich Christopher Kunz und Sylvester Tremmel, die beiden Hosts des Podcasts "Passwort". Naturgemäß geht es deshalb diesmal weniger um Auslegungen der DSGVO als um handfeste IT-Sicherheitsprobleme, deretwegen bei Nutzern oder Unternehmen Datenabfluss droht.
Christopher und Sylvester schätzen zunächst ein Bußgeld der Datenschutzbehörde Singapurs ein: Wegen eines schwachen Admin-Passworts kam es bei einer Lernplattform zu einem Einbruch und zum Abzug der Daten von über 500.000 Nutzern. Die beiden schätzen die beschriebene Schwachstelle ein und geben Tipps für gutes Passwort-Management sowie Policies in Unternehmen. Ihr Credo: Eine Policy allein genügt nicht, es braucht technische Maßnahmen, um die Mitarbeiter zu starken Passwörtern zu bringen.
Im Hauptteil des der Episode erläutern Christopher und Sylvester, wie Nutzernamen-Passwort-Kombinationen gestohlen werden und was jeder einzelne dagegen tun kann. Sie schildern, auf welchen Kanälen derlei Daten gehandelt werden. Außerdem schätzen sie die Qualität und Wirkung von Leakcheckern wie "Have I Been Pwned" ein. Kann man ihnen trauen? Und wie sollte man sie nutzen, auch als Unternehmen?

May 31, 2024 • 1h 15min
Ein EU-Wahl-Special
Mit Falk Steiner, Holger Bleich und Joerg Heidrich
Die aktuelle Episode des c't-Datenschutz-Podcasts steht fast komplett im Zeichen der Europawahl, die in Deutschland am 9. Juni stattfindet. Holger und Joerg haben sich vorgenommen, einen digitalpolitischen und datenschutzrechtlichen Rückblick auf die vergangene Legislaturperiode zu wagen und begründet dazu aufzurufen, wählen zu gehen.
Als versierter Gast bereichert diesmal Falk Steiner das Gespräch. Falk beobachtet als freier Journalist für c't und heise online das politische Geschehen in Berlin und in Brüssel. In der Episode erläutert er die Zusammenhänge zwischen den vielen digitalpolitischen Gesetzgebungsverfahren im Bund und der EU. Außerdem besprechen die drei, welche Verfahren mit in die nächste Legislatur genommen werden dürften und was anstehen könnte. Nicht zuletzt spekulieren sie darüber, ob die Datenschutz-Grundverordnung in den nächsten fünf Jahren aufgeschnürt und reformiert werden könnte.
Abschließend folgt noch ein kurzer Ritt durch die Parteiprogramme der größeren deutschen Parteien zur EU-Wahl. Es bleibt die Erkenntnis, dass zur Digitalpolitik durch die Bank viele Allgemeinplätze und wenig konkrete Forderungen zu finden sind. Allenfalls große politisch Linien lassen sich finden. Falk merkt lakonisch an, dass Digitalpolitik und insbesondere Datenschutz eben nach wie vor bei vielen Entscheidungsträgern keinen hohen Stellenwert genießt.

May 17, 2024 • 1h 6min
Das KI-DSGVO-Dilemma
Jo Bager, Holger Bleich und Joerg Heidrich diskutieren die orientierungslosen Aspekte der DSK-Leitlinie zur AI, besonders die unlösbaren DSGVO-KI-Widersprüche. Kontrovers: DSK fordert Berichtigungs- und Löschungsrechte, die technisch nicht umsetzbar sind.

May 3, 2024 • 1h 12min
Datenschutz in der Games-Branche
Mit Prof. Christian-Henner Hentsch, Holger Bleich und Joerg Heidrich
Der Umsatz mit Computerspielen steigt in Deutschland kontinuierlich. 2023 wurden mit PC-Games und Konsolenspielen mehr als 3,7 Milliarden Euro umgesetzt. Besonders boomt der Markt auf Smartphones und Tablets: Für fast drei Milliarden Euro kauften Daddlerinnen und Daddler Items, Skins oder Coins per In-App-Stores in den Spielen.
Für die Branche gelten hierzulande dieselben datenschutzrechtlichen Einschränkungen wie für etwa soziale Medien. Hinzu kommen allerdings noch strenge Jugendschutzbestimmungen. Und längst werden die Games nicht mehr (nur) im Laden gekauft, sondern hauptsächlich über Plattformen wie Steam, Playstation oder eben den Appstores von Google und Apple. Sowohl beim Kauf als auch bei der Nutzung fallen eine Menge Daten an.
Im Datenschutz-Podcast von c't erläutert ein juristischer Experte und Interessenvertreter die Perspektive der deutschen Games-Branche: Prof. Christian-Henner Hentsch ist Professor für Urheber- und Medienrecht an der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht der TH Köln, daneben verantwortet als Leiter Recht und Regulierung für den Verband der Deutschen Games-Branche "game" alle verbandsinternen rechtlichen Fragen sowie die rechtspolitischen Themen.
Henner gibt einen Einblick in die Branche und erklärt, welche Parteien dort derzeit agieren, von Plattformen über Publisher bis zu Indie-Studios. Weil der Verkauf von Werbeplätzen in Spielen kaum stattfinde, benötigten Spiele-Anbieter in aller Regel keine Einwilligung zur Datenerhebung. In diesem Bereich werde alles über die Kauf- und Nutzungsverträge geregelt. Dies umfasse auch die Verarbeitung von anfallenden personenbezogenen Daten während des Spielens.
Bei den Plattformen selbst würden eine Menge Daten auflaufen, doch diese würden nur sehr eingeschränkt an Publisher und Entwickler weitergegeben, sagt Hentsch. Aber natürlich finde eine Beobachtung der Spieler statt, um das Spielerlebnis zu optimieren und manchmal auch, um geeignete Stellen zu finden, an denen jemand besipielsweise besonders interessiert sein könnte, mit zusätzlichen Items den Fortgang des Games zu beschleunigen.

Apr 19, 2024 • 1h 5min
Datenschutz im Krankenhaus
Mit Christian Säfken, Holger Bleich und Joerg Heidrich
Ja, Datenschutz fordert Aufmerksamkeit. Beim Datenschutz im Gesundheitswesen begeben sich alle Beteidigten aber in ein juristisches Minenfeld, denn hier geht es fast immer um sensible Daten. Im Juristensprech handelt es sich laut Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) um die "besondereren Kategorien personenbezogener Daten", für die schärfere Anforderungen bei Verarbeitung und Schutz gelten. Im alltäglichen Klinikbetrieb fallen fast ausschließlich derlei Daten an, und das meist in einem gewachsenen, heterogenen IT-Umfeld.
Dort die Verantwortung die Einhaltung aller datenschutzrechtlicher Pflichten zu verantworten, klingt nach einem anspruchsvollen Job. Im c't-Podcast erläutert der Datenschutzbeauftragte eines Krankenhauskonzerns, was er alles im Auge behalten muss: Christian Säfken ist Justiziar und Datenschutzbeauftragter der KRH Klinikum Region Hannover GmbH. Die Klinikgruppe mit 3400 Betten und rund 8500 Mitarbeitern versorgt jährlich rund 135.000 Patienten stationär und zudem 160.000 ambulant. Mit rund 40 Prozent Marktanteil ist die Gesellschaft der größte Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in der Region Hannover.
Im Gespräch mit Joerg und Holger schildert Christian die Herausforderungen, die der Klinikalltag mit sich bringt. Wie umgehen mit Notfällen, bei denen keine Einwilligung zu holen ist? Wie reagieren auf datenschutzrechtliche Auskunftsbegehren, die den Rahmen zu sprengen drohen? Was ist mit Gerätschaften, die via Fernwartung Patientendaten preisgeben könnten? Christian gibt spannende Einsichten in die praktischen Probleme und zeigt auf, dass mit Pragmatismus auch die DSGVO-Hürden zu bewältigen sind.

Apr 5, 2024 • 1h 2min
Folgen des Stay-Informed-Datenlecks
Mit Holger Bleich und Joerg Heidrich
Wegen der Fehlkonfiguration eines Webservers standen beim Kita- und Schul-App-Betreiber Stay Informed eine Menge sensibler Dateien (teilweise von Minderjährigen) offen im Netz, eventuell sogar über mehrere Jahre. Ein anonymer Hinweisgeber hatte c't auf das gravierende Datenleck aufmerksam gemacht. Wir verifizierten das Problem und wiesen die Stay Informed GmbH aus Freiburg darauf hin. Sie reagierte umgehend und schloss die Lücke.
Wegen der datenschutzrechtlichen Konstellation sind die Folgen der Panne in diesem Fall besonders heftig: Stay Informed bietet seine App-Infrastruktur Kitas, Schulen und anderen Einrichtungen zur papierlosen Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Eltern an, und zwar als Software-as-a-Service-Produkt. Das Unternehmen schließt dazu mit jeder Einrichtung beziehungsweise mit deren Träger einen Auftragsverarbeitungsvertrag ab. Weil es deshalb als Auftragsnehmer der Datenverarbeitung fungiert, ist es nicht direkt verantwortlich für das Leck im Sinne der DSGVO. Dies sind vielmehr die mehr als 11.000 angeschlossenen Auftragsgeber, also alle Einrichtungen.
In Episode 106 der Auslegungssache spricht Joerg mit Holger über die rechtlichen Grundlagen und die Folgen. Holger war an der Recherche zum Stay-Informed-Datenleck beteiligt und kann viel berichten. Joerg erklärt, welche Rolle Stay Informed, die Einrichtungen, und die vom Leak jeder Menge sensibler, personenbezogener Daten Betroffenen rechtlich einnehmen.
Es ist vertrackt: Die Einrichtungen und Träger müssen sich auf die Information von Stay Informed verlassen und entsprechend ihre zuständige Landesdatenschutzbehörde zum Vorfall informieren. Eventuell haften sie sogar mit. Überdies können über 800.000 Betroffene ihre Rechte aus der DSGVO beanspruchen, also etwa Auskunft oder Löschung verlangen - und zwar von sicherlich teilweise völlig überforderten Einrichtungen, die selbst gar keinen Einfluss auf das datenverarbeitende System hatten und haben.

Mar 22, 2024 • 1h 10min
Vorsicht, Datenschutz!
Mit Niklas Mühleis, Holger Bleich und Joerg Heidrich
Heise-Podcast "Vorsicht, Kunde!"
DSGVO-Portal: Rückblick DSGVO-Bußgeldverfahren und Datenpannen 2023

Mar 8, 2024 • 1h 11min
Leidige Informationspflichten?
Mit Barbara Schmitz, Holger Bleich und Joerg Heidrich
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gibt "Betroffenen" von Datenverarbeitung einige Rechte in die Hand, beispielsweise das Auskunftsersuchen und die Möglichkeit, personenbezogene Daten vom Verantwortlichen löschen zu lassen. Damit sie wissen, welche Rechte ihnen zustehen und wo sie diese einfordern können, schreibt die DSGVO außerdem in Art. 13 und 14 Informationspflichten vor. Es geht zuallererst um die allseits bekannte Datenschutzerklärung, aber nicht nur um sie.
Bei den Informationspflichten steckt der Teufel oft im Detail. Grund genug für den c't-Datenschutz-Podcast, einmal genauer auf den Gesetzestext und mögliche Konstallationen in der Praxis zu schauen. Holger und Joerg bekommen dabei Unterstützung von Barbara Schmitz, Rechtsanwältin für IT- und Datenschutzrecht. Barbara berät Unternehmen zur Erfüllung der Informationspflichten und kann aus ihrem beruflichen Alltag berichten.
Kaum beachtet wird in der öffentlichen Diskussion der genannte Art. 14 DSGVO, in dem es um Informationen zu Daten geht, die nicht vom Verantwortlichens selbst erhoben, aber von diesem weiterverarbeitet werden. Hierzu muss er konkret und in einer zeitlichen Frist nach Erhalt die Quelle offenlegen. Spannend: Ändert sich der Verarbeitungszeck, muss auch das mitgeteilt werden. Die Drei in der Runde grübeln darüber, wo diese Pflicht in der Praxis verfängt und ob ihnen eine solche Information schon einmal untergekommen ist.

Feb 23, 2024 • 1h 18min
Kommunikation absichern schwer gemacht!
Mit Sylvester Tremmel, Holger Bleich und Joerg Heidrich
Jüngst titelte c't in einer großen Bestandsaufnahme etwas provokant: "So kaputt ist E-Mail!" Wir zählten all die Schwächen auf, die das Kommunikationsmedium auch nach 40 Jahren nicht los geworden ist. Dazu gehört, dass sich immer noch keine Methode durchgesetzt hat, um vertrauliche Inhalte via Mail Ende-zu-Ende-verschlüsselt von A nach B zu schicken. Klar, es gibt OpenPGP und S/MIME. Doch welcher Adressat nutzt das schon?
Dabei ist das Bedürfnis groß: Berufgeheimnisträger wie Ärzte, Anwälte oder Journalisten sind darauf angewiesen, dass ihre Kommunikation von niemandem abgehört werden kann. Außerdem verlangt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Art. 32 geeignete technische und organisatorische Maßnahmen nach Stand der Technik, die die Verarbeitung von personenbezogenen Daten absichern. Dazu gehört eben explizit auch die Verschlüsselung.
In Episode 103 des c't-Datenschutz-Podcasts beschäftigen sich Holger und Joerg mit dieser Problematik auf technischer und rechtlicher Ebene. Zur Vertiefung haben sie mit c't-Redakteur Sylvester Tremmel einen Experten eingeladen, der sich seit Jahren mit Verschlüsselungsmethoden in Mailclients und Messengern auseinandersetzt.
Neben den technischen Grundlagen geht es um die rechtliche Einordnung. Joerg weist auf eine Forderung der Bremer Landesdatenschutzbehörde hin, die von Rechtsnwälten verlangt, Mails an Mandanten, Prozessgegner und Kollegen Ende-zu-Ende zu verschlüsseln. Die Runde fragt sich leicht verzweifelt, wie eine solche Forderung zustandekommt und wie sie realisiert werden könnte, obwohl die Adressaten oftmals vor verschlüsselten Mails wie der berühmte Ochs vorm Berg stehen.
Die Ratlosigkeit steigt, als ein aktueller Gesetzentwurf aus dem Bundesdigitalministerium zur Sprache kommt: Die geplante Novelle des Gesetzes zum Datenschutz in der Telekommunikation und bei Telemedien (TTDSG) sieht vor, dass jeder E-Mail- und Messenger-Nutzer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beherrschen, aber nicht verpflichtend anwenden muss. Die Runde ist sich einig, dass noch viel Fortschritt bei der E-Mail nötig ist, um dieses Ziel zu realisieren. Sylvester und Holger sind sich einig: Wer bequem und dennoch abhörsicher kommunizieren will, greift derzeit am besten zu verschlüsselnden Messengern wie Signal.


